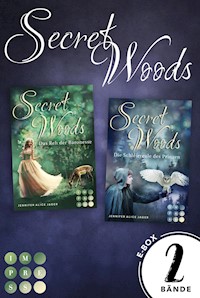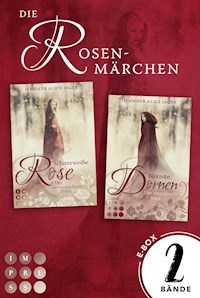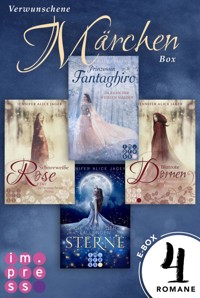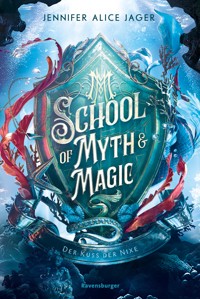
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: School of Myth & Magic
- Sprache: Deutsch
Nixen gibt es wirklich – und sie sind gefährlich. So wurde es Devin ihr Leben lang eingetrichtert. Als sie ihren Schwarm Tyler aus Versehen zu tief in den Badesee lockt und so ins Krankenhaus befördert, begreift Devin, dass in ihr selbst Nixen-Kräfte schlummern. Um sie zu kontrollieren, soll sie die geheime "School of Myth & Magic" besuchen, zusammen mit Hexen, Drachen, Vampiren und einem sehr charmanten Faun. Doch etwas – oder jemand – mit dunklen Absichten ist ihr an die Schule gefolgt. Band 1 der romantischen Fantasy-Reihe *** Leseprobe *** "Sag mir, warum du ihn angegriffen hast", verlangte ich. "Angegriffen?" Herablassung lag in seiner Stimme. "Wen? Du musst schon genauer werden. Ich schaue sie mir nicht an." Ich legte die Stirn in Falten. "Du schaust dir wen nicht an?" Er rückte näher an mich heran - so nah, dass ich nicht anders konnte, als ihm direkt ins Gesicht zu blicken und die Narbe zu sehen, die ihn zeichnete. Was auch immer mit ihm geschehen war, musste unglaublich schmerzhaft gewesen sein. Das war es vielleicht immer noch, so frisch, wie die Verletzung aussah – beinahe, als wäre sie ihm gerade erst zugefügt worden. Ganz unbewusst hob ich die Hand, verspürte den Drang die Narbe zu berühren und zu ertasten, ob ich die Magie unter meinen Fingerkuppen spüren konnte. "Meine Opfer", sagte er leise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2024 Die Print-Ausgabe erscheint im Ravensburger Verlag
© 2024 Ravensburger Verlag Copyright © 2024 by Jennifer Alice Jager Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München. Lektorat: Franziska Jaekel Umschlaggestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz, Hamburg Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.
ISBN 978-3-473-51225-6
ravensburger.com/service
Ich habe gelacht, geweint,
mich unsterblich verliebt
und meine Geschichte
mehr als einmal verflucht.
Jetzt bist du an der Reihe.
1
Ein nicht ganz so perfekter Tag
Es war einer der heißesten Tage des Sommers, mein neuer Bikini in schillernden Grüntönen stand mir ausgesprochen gut und mein Geburtstag war dieses Jahr auf einen Samstag gefallen. Es war also alles perfekt und so, wie es sein sollte.
Ich tippte ein schnelles Bis gleich in den Gruppenchat, warf mein Handy aufs Bett und mich gleich daneben. So konnte ich mehr oder weniger bequem in meine Shorts schlüpfen. Noch im Liegen streckte ich mich, fischte mein Tanktop von der Nachttischlampe und stülpte es mir über.
In nicht einmal einer halben Stunde würden mich Isla und die anderen zu unserem Ausflug an den See abholen. Auch Tyler hatte zugesagt. Wirklich glauben konnte ich das noch nicht. Mit elf oder zwölf, als ich noch Zahnspange, Flechtzöpfe und Hornbrille getragen hatte, war ich total in ihn verschossen gewesen. Wir hatten denselben Heimweg und für mich war er wie ein Beschützer gewesen, hinter dem ich mich vor dem bissigen Nachbarshund verstecken konnte. Mittlerweile beschränkten sich unsere Begegnungen auf den Schulflur und meine Verliebtheit war verflogen. Dennoch zauberte der Gedanke daran, dass er meinen Geburtstag mit mir feiern wollte, ein Lächeln auf meine Lippen.
Mir fiel der Lipgloss ein, den mir Isla geschenkt hatte. Ich kugelte wie eine Sushirolle auf Abwegen vom Bett und landete vor dem Schreibtisch, wo die wenigen Schminkutensilien, die ich besaß, vor einem mit Fotos, Schmuck und Konzertkarten zugekleisterten Spiegel lagen. Darunter befand sich auch der gesuchte Lipgloss und ich betupfte meine Lippen damit.
Normalerweise war ich nicht der Typ für Make-up. Dieses übertrieben farbenfrohe Hochglanzpink schien zudem so gar nicht zu meinen mischbraun-blond-brünetten Haaren zu passen. Doch Isla zuliebe machte ich gern eine Ausnahme. Spätestens im Wasser wäre ich alles wieder los.
Ich band mir einen Pferdeschwanz, was beinahe ein Ding der Unmöglichkeit war, weil kein Haargummi der Welt genug Grip besaß, um meine widerspenstige Mähne im Zaum zu halten. Natürlich lösten sich sofort ein paar besonders eigenwillige Strähnen, baumelten vor meinem Gesicht und blieben an meinen Lippen kleben. Ich versuchte sie wegzupusten, was es nur noch schlimmer machte.
Genervt verdrehte ich die Augen. Als Geburtstagsfrühstück hatte ich mir die Pancakes meiner Granny gewünscht und keine Haare mit Erdbeer-Lipgloss-Geschmack, aber meine gute Laune wollte ich mir davon nicht vermiesen lassen. Wenn das alles war, was an meinem Siebzehnten schiefging, konnte ich den Tag immer noch problemlos unter der Kategorie Perfekt abheften.
Ich befreite meine Haare vom Lipgloss und fischte unterdessen nach meiner Kette, die ich am Abend vor dem Spiegel abgelegt hatte. Allerdings fasste ich ins Leere. Die Kette war nicht da.
»Wo zum …!?« Ich suchte den Tisch ab, durchwühlte alles, ging in die Hocke und schaute nach, ob sie runtergefallen war. Unter dem Tisch war allerdings nichts weiter zu sehen als ein paar Staubmäuse, eine zerknüllte Socke und Popcorn – was auch immer das unter meinem Schreibtisch zu suchen hatte.
Mir kam in den Sinn, dass ich die Kette auch im Bad abgelegt haben könnte. Wenn ich nicht immer mit den Gedanken woanders wäre, würde mein Leben um so vieles leichter sein.
Ich stopfte Badetuch, Sonnencreme und Handy in eine Tasche, hängte sie mir über die Schulter und warf noch einen Blick in das angrenzende Bad. Von meiner Kette fehlte jede Spur.
»War ja klar«, murrte ich, aber auch das konnte mir den Tag nicht verderben. Irgendwann würde die Kette schon wieder auftauchen.
Ich verließ mein Zimmer, ging die schmale Treppe nach unten und überwand die letzten Stufen mit einem Satz. Gekonnt wie eine Reckturnerin landete ich auf beiden Füßen und vollzog eine tiefe Verbeugung.
Dad entging der Lärm natürlich nicht und er streckte den Kopf aus dem Nebenzimmer. Staub lag ihm auf der Nase und ein Bleistift steckte hinter seinem Ohr. Der Werkzeuggürtel um seine Hüfte deutete ebenfalls darauf hin, dass er mal wieder im Renovierungswahn war.
Er musterte meine knappe Sommerbekleidung, die kaum den Bikini verdeckte. »Wenn du dich so anziehst, solltest du dich auch wie eine Erwachsene verhalten und eine Stufe nach der anderen nehmen.«
»Passt schon, erwachsen werden wird völlig überbewertet«, sagte ich und winkte ab. »Nette Begrüßung übrigens, dafür, dass ich heute Geburtstag habe.«
Ich schob mich an ihm vorbei und betrat das kleine, dunkle Zimmer in seinem Rücken. So vollgestopft mit Dads Werkzeug, den Kisten, Regalen und Möbeln wirkte es mehr wie eine Rumpelkammer und weniger wie der urige Wohnraum, den ich kannte.
»Du willst das wirklich durchziehen?«, fragte ich ein wenig wehmütig. Ich strich mit dem Finger über den staubigen Kaminsims, bis hin zu dem Foto von Granny mit mir als Kind im Arm. Um meinen Hals war die Kette zu sehen, nach der ich gerade gesucht hatte. Ein dreieckiger Metallanhänger mit einem darin eingelassenen schwarzen Edelstein, höchstens ein paar Dollar wert und trotzdem mein wertvollster Besitz, weil ich die Kette von Granny hatte. Und nun hatte ich sie verlegt.
»Es ist jetzt zwei Jahre her«, sagte Dad leise und einfühlsam. Offenbar entging ihm nicht, wie mich die Gedanken an Granny runterzogen.
Mein Blick wanderte zu dem blau-grünen Unterwassergemälde an der Wand über dem Kamin. Ich machte einen Schritt zurück, um es in seiner vollen Größe betrachten zu können. Dad trat an meine Seite.
Genau wie das Wesen auf diesem düsteren Bild hatte Granny immer die Seemonster beschrieben, die in all ihren Geschichten vorkamen. Teils Fisch, teils Mensch, mit Schuppenhaut, Reißzähnen und Klauen. Gefährlich, aber auch anmutig, Ehrfurcht einflößend und vor allem wunderschön. Sie war nicht müde geworden, von ihnen zu erzählen und mich vor ihnen zu warnen. In ihren letzten Lebensjahren waren sie für Granny zur Realität geworden. Sie hatte wirklich daran geglaubt, dass diese Wesen existierten, in den Untiefen lauerten und nur darauf warteten, unschuldige Menschen in ihre Fänge zu kriegen. Wäre sie noch am Leben, hätte sie alles darangesetzt, mich von einem Ausflug zum Badesee abzuhalten.
»Du hast ja recht«, sagte ich einsichtig. »Es wird Zeit, dass etwas mit diesem Zimmer passiert, und du kannst ein Büro gut gebrauchen.«
»Ich kann auch an einem anderen Tag loslegen«, schlug er vor.
»Nein, ist schon gut«, wiegelte ich ab. »Ich bin gleich weg, also hast du niemanden an der Backe, der sich über den Lärm beschwert.«
Er nickte zufrieden. »In der Küche wartet übrigens eine Überraschung auf dich.«
Meine Augen weiteten sich. »Hast du etwa …?«
»Ich habe es zumindest versucht.« Er schmunzelte leicht verlegen.
Ich eilte an ihm vorbei zur Küche und dort standen sie – wie gemalt, belegt mit Früchten und mit einem Klecks Orangenmarmelade obendrauf. Genau wie Granny sie mir immer gemacht hatte: die leckersten Pancakes der Welt.
Erst jetzt begriff ich, dass der Staub auf Dads Nase in Wirklichkeit Mehl war. Der Berg an dreckigem Geschirr in der Spüle wies darauf hin, dass er sich völlig damit übernommen hatte, die Pancakes nach Grannys Rezept zuzubereiten. Wahrscheinlich würde ich eine erschreckend hohe Anzahl an Fehlschlägen im Mülleimer finden.
Dad trat hinter mir in die Küche und legte eine Hand auf meine Schulter. »Freust du dich?«
»Und wie!« Ich wandte mich ihm zu und drückte ihm einen Kuss auf die Wange.
»Herrgott, was hast du da auf den Lippen?«, beschwerte er sich. »Honig?«
Ich lachte, während er sich die Rückstände des Lipgloss abwischte. Als ich erneut die Lippen spitzte, schob er mich zum Tisch.
»Du bist so ein Spielverderber«, maulte ich.
»Und du benimmst dich wie ein kleines Kind.«
Ich grinste breit. »Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich mir meinen jugendlichen Leichtsinn bewahren muss.«
»Ja klar«, höhnte er.
»Was denn? Man wird nicht jünger!«
»Du bist so ein Scherzkeks.« Er steckte eine Kerze in die Pancakes und zündete sie an. »Wünsch dir was.«
Nachdem es gerade um Küsse ging, war mein Wunsch schnell gefunden. Einmal Tyler so nahe kommen … das wäre es. Sozusagen als Abschluss unserer gemeinsamen Schulzeit, bevor wir nächstes Jahr auf verschiedene Colleges gehen würden. Ich schloss die Augen und pustete die Kerze aus.
Keine zwanzig Minuten später hupte es vor dem Haus. Ich nahm den letzten Bissen Pancake und sprang auf. »Bis später!«, rief ich Dad mit vollem Mund zu.
Er war wieder im Nebenzimmer verschwunden und maß dort die Wände aus. »Genieß den Tag!«
»Das habe ich fest vor.«
Als ich die Tür öffnete, schlug mir augenblicklich die Hitze entgegen. Ich musste meine Augen mit der Hand schützen, weil die Sonne so stark blendete.
Ein Vorteil unseres Reihenhauses in einer ruhigen Seitenstraße in Soho, Birmingham, war, dass es selbst im Hochsommer immer schön kühl blieb. Der Nachteil war die Größe. Die Räume waren beengt, der Flur und die Treppe so schmal, dass keine zwei Personen nebeneinanderlaufen konnten. Ein Grund mehr, Grannys altes Zimmer neu herzurichten. Wir brauchten den Platz.
»Happy Birthday, Süße!«, hallten mir die Stimmen von Isla und den anderen entgegen.
Ich senkte die Hand vor meinen Augen und sah, dass es Konfetti regnete.
Gleich vor der Treppe zum Haus, halb auf dem Bürgersteig, stand ein ziemlich heruntergekommener grüner Jaguar mit offenem Verdeck, rostiger Stoßstange und verbeulten Türen. Der Wagen gehörte Islas Schwester Bonnie, die am Lenkrad saß. Isla hatte sich von der Rückbank erhoben und hielt die Arme weit ausgebreitet. Was der Wind von ihrem Konfetti nicht davongetragen hatte, hing ihr in den blonden Locken. Tyler saß neben ihr, Dustin hatte sich den Beifahrersitz gesichert.
Lächelnd lief ich die Stufen nach unten, wo ich von Isla am Arm gepackt und herangezogen wurde. Sie drückte mich so fest, dass mir die Luft wegblieb. Stocksteif ließ ich es über mich ergehen.
»Du weißt, dass ich das hasse.« Umarmungen waren nicht mein Ding.
»Einmal im Jahr musst du da durch.« Sie drückte mich noch fester. »Und jetzt komm!«
Ehe ich begriff, was sie vorhatte, zerrte sie mich in den Wagen.
»Woah!«, stieß ich aus, als ich mit dem Rücken voran und baumelnden Beinen zwischen ihr und Tyler landete.
Wobei … nicht wirklich zwischen den beiden, denn ich schaute direkt in Tylers Gesicht. Mein Kopf lag in seinem Schoß.
»Happy Birthday«, sagte er mit seiner rauen, dunklen Stimme.
Die Sonne blitzte über ihn hinweg und hüllte sein schiefes Grinsen in Schatten, ein starker Kontrast zum leuchtenden Blau seiner Meeresküstenaugen.
»Liegst du bequem?«, fragte er.
»Sehr sogar«, erwiderte ich.
»Wo ist die Kette, die du sonst immer trägst?«
Ich griff an die Stelle, wo an jedem anderen Tag der Anhänger war. Tyler hatte die fehlende Kette bemerkt? Ein verlegenes Lächeln machte sich auf meinen Lippen breit, wurde jedoch schnell von einem Stirnrunzeln vertrieben.
»Wo schaust du denn hin?« Halb im Scherz verdeckte ich meinen Ausschnitt.
Isla nahm meine Hand und zog mich mit einem Ruck hoch, während Dustin sich zu uns umdrehte.
»Wir treffen uns mit den anderen am See«, sagte er.
»Schnallt euch an«, forderte uns Bonnie auf und löste die Handbremse.
Da ich wusste, wie ruppig ihr Fahrstil war, kam ich ihrer Aufforderung gern nach. Sie drehte die Musik laut auf, im Radio lief gerade Bad Habits und Isla stimmte umgehend mit ein. Lauthals sang sie das Lied, das sie in- und auswendig kannte – genau wie jeden anderen Song von Ed Sheeran. Beim Refrain machte ich mit.
Die Jungs waren weniger begeistert, aber wir ließen uns den Spaß nicht nehmen. Immerhin sollte dieser Tag am See etwas Besonderes werden und Mitsingen auf dem Rücksitz gehörte definitiv dazu.
Nach einer halben Stunde bogen wir auf den Parkplatz des Kingsbury Water Parks ein, der an einem sonnigen Tag wie diesem gut besucht war. Zum Glück hatten wir vorgesorgt und eine Stelle ausgekundschaftet, die abgelegen an einem der kleineren Seen lag, wo wir ungestört waren. Dort warteten bereits die anderen auf uns. Sie besuchten ebenfalls unsere Schule, und auch wenn nicht alle eng mit mir befreundet waren, hatte sie die Vorstellung begeistert, einen der letzten Sommertage am See zu verbringen. Einige planschten ausgiebig, sprangen von Felsen und spritzten sich gegenseitig nass, andere hatten es sich auf Badetüchern am Ufer gemütlich gemacht. Im flachen Wasser standen gekühlte Getränke, aus Boxen dröhnten die angesagten Sommerhits und jemand hatte einen Grill aufgestellt.
»Wer zuerst im Wasser ist!«, rief Isla, schon auf halbem Weg zum Ufer. Sie warf ihre Tasche von sich, zog sich das Oberteil aus und stoppte nicht einmal, um sich aus ihrer Hose zu schälen.
Auch ich warf alles von mir, schlüpfte aus meinen Schuhen und hatte noch keinen Fuß ins Wasser gesetzt, als mich Isla auch schon nass spritzte.
»Na warte, das kriegst du zurück!«, rief ich lachend und stürmte ihr nach. Wir lieferten uns eine wilde Wasserschlacht, bis sich ein paar Jungs einmischten und uns unter Wasser tunken wollten, angeführt von Dustin. Isla sprang ihm auf den Rücken und ließ sich nicht abschütteln, egal wie sehr er es auch versuchte.
»Devin, hilf mir!«, forderte sie mich auf.
Ich hatte nicht vor, meine beste Freundin im Stich zu lassen, also hob ich die Arme aus dem Wasser, um einen Angriff auf Dustin zu starten, als wie aus dem Nichts eine gigantische Welle über uns hinwegschwappte. Sie riss uns von den Füßen und begrub uns unter sich. Für einen Moment sah ich nur aufgeschäumtes Seewasser und wusste nicht, wo oben und unten war, bis ich den Boden ertastete und mich abstoßen konnte. Ich durchbrach die Wasseroberfläche und holte Luft. Auch die anderen tauchten nach und nach wieder auf.
Mein Haargummi hatte sich verabschiedet, ich strich mir den sumpfbraunen Haarvorhang von der Stirn und schaute mich um.
»Wo kam die denn her?«, fragte Dustin.
Das hätte ich auch gern gewusst. Wir waren nicht am Meer und schon gar nicht an einem Surferstrand mit Monsterwellen.
»Es sah fast aus, als hättest du die Welle heraufbeschworen«, meinte Isla lachend und ahmte meine Armbewegung nach.
»Ja klar«, gab ich zurück.
»Wow!«, stieß jemand aus und deutete nach links.
Ich rechnete mit der nächsten Welle, entdeckte aber nur Tyler, der sich auf einem besonders hohen Felsen zum Sprung bereitmachte. Das sah nach mindestens fünf Metern aus.
»Das traust du dich nie!«, rief ihm Dustin zu.
»Spring!«, forderte Isla ihn auf.
»Spring! Spring!«, stimmten die anderen mit ein.
Tyler nahm Anlauf, stieß sich ab und landete mit angezogenen Beinen laut platschend im Wasser. Er löste damit eine Welle aus, die allerdings nicht ansatzweise so hoch war wie die zuvor.
»Jetzt bin ich dran«, sagte Dustin und watete zum Ufer. Ein paar Leute folgten ihm.
Tyler schwamm aus der Sprungzone bis zu uns herüber. »Traut ihr euch nicht?«
»Als ob wir es nötig hätten, hier was zu beweisen.« Isla wandte sich an mich. »Wollen wir unsere Badetücher ausbreiten?«
»Machen wir«, stimmte ich zu.
Sie hakte sich bei mir unter und zog mich zum Ufer. »Ich verstehe total, dass du auf Tyler abfährst. Er ist echt heiß!«
»Ich fahre doch nicht auf ihn ab. Früher vielleicht, aber jetzt nicht mehr.«
Isla lachte. »Ja klar, du machst bei jedem Typen, der dich auch nur zu lange anguckt, einen auf unnahbaren Eisblock, weil du nur Augen für einen hast, aber kaum ist er in greifbarer Nähe, fährst du nicht mehr auf ihn ab.«
Ich warf einen flüchtigen Blick zurück zu Tyler. Er beachtete uns nicht weiter, sondern feuerte die Springer an. Ihn als heiß zu bezeichnen, war noch untertrieben. Mal ganz abgesehen davon, dass sein Lächeln zum Dahinschmelzen war, hatte er als Mitglied des Fußballteams einen durchtrainierten Körper mit keinem Gramm zu viel auf den Rippen.
Am Ufer breiteten wir unsere Badetücher aus, cremten uns ein und genossen die Sonne. Ich lag gerade auf dem Bauch, hatte den Kopf auf die verschränkten Armen gelegt und die Augen geschlossen, als etwas Kaltes meine Schulter berührte. Erschrocken fuhr ich hoch. Tyler kniete neben mir und reichte mir eine eiskalte Pepsi.
Ich nahm die Flasche entgegen und er stieß mit mir an.
»Auf deinen Geburtstag«, sagte er.
»Auf einen perfekten Ferientag«, fügte ich hinzu.
»Isla hat zu viel Schiss, das ist nichts Neues, aber du traust dich doch, oder?« Er nickte in Richtung des hohen Felsens.
Ich schaute zu Isla, die jedoch beim Sonnenbaden eingedöst war.
»Wenn wir zusammen springen?«, fügte Tyler hinzu.
Ich hätte mich auch ohne männlichen Beistand darauf eingelassen, wollte mir die Gelegenheit, den Sprung mit ihm gemeinsam zu machen, aber nicht entgehen lassen.
»Okay«, stimmte ich zu. Sachte stupste ich Isla an und hielt ihr die Pepsi hin. »Hältst du die mal?«
Sie blinzelte verschlafen. »Klar«, sagte sie, richtete sich ein Stück auf und nahm mir die Flasche ab.
Ich folgte Tyler in Richtung des Felsens, wobei wir uns durch ein paar Hecken schlagen mussten.
Nachdem wir die anderen nicht mehr sehen konnten, ergriff ein seltsames Gefühl von mir Besitz. Ich blieb stehen und schaute mich um. Es war wie ein Blick, den man im Nacken spürte – als wäre da jemand, der mich aus dem Schatten heraus beobachtete. Sehen konnte ich allerdings niemanden. Nur einen Vogel. Eine Krähe oder eine Elster, die sich flatternd von ihrem Versteck in der Krone eines Baumes erhob und in der Ferne verschwand.
»Bist du jetzt unter die Vogelbeobachter gegangen?«, fragte Tyler im Scherz. »Pass lieber mit den Ästen am Boden auf.« Er reichte mir seine Hand. Ich griff danach und schob das ungute Gefühl beiseite.
Schließlich kamen wir am Felsen an und kletterten bis zum höchsten Punkt, von wo aus wir den gesamten See überblicken konnten. Von oben sah es noch viel höher aus. Zum Glück hatte ich weder Höhenangst noch war ich wasserscheu.
»Du musst keine Angst haben«, versicherte mir Tyler.
»Das wollte ich dir auch gerade sagen«, konterte ich, löste mich von ihm und warf mich rücklings in die Tiefe.
Der Aufprall war nur halb so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Ich tauchte komplett unter und schwebte einen Moment lang zwischen aufsteigenden Luftblasen und in der Sonne glitzernden Partikeln.
Schwer zu sagen, woran es lag, aber mich ergriff nicht das übliche Bedürfnis, sofort wieder aufzutauchen und nach Luft zu schnappen. Hier unten, abgeschirmt von Wind und Lärm, fühlte sich alles so friedlich an, so befreiend. Ich bewegte meine Hände durch das Wasser und spürte, wie es meine Finger umspielte. Es kam mir vor, als könnte ich die Strömung beeinflussen, sie lenken, mit meinem bloßen Willen dazu beitragen, dass die Luftblasen nicht aufstiegen, sondern um meinen Körper tanzten.
Als die Jungs uns vorhin untergetaucht hatten, war mir der See noch dunkel, fast schwarz vorgekommen. Vielleicht lag es an der Position der Sonne, vielleicht auch daran, dass ich jetzt an einer anderen Stelle war, aber die Schwärze schien wie verflogen – als hätte jemand einen Vorhang aufgezogen. Das Wasser umhüllte mich wie waberndes, grün schimmerndes Glas. Ich konnte die Pflanzen am Grund erkennen, die sich sanft mit der Strömung bewegten; die Fische, die in Schwärmen zwischen ihnen umherschwirrten; sogar die strampelnden Beine der anderen in der Nähe des Ufers, das gut zwanzig Meter oder mehr von mir entfernt war.
Bevor sich Tyler Sorgen machte, weil ich nicht wieder auftauchte, katapultierte ich mich aus dem Wasser und warf mit einem tiefen Atemzug mein Haar nach hinten.
Tyler stand noch auf dem Felsen. Er nahm Anlauf und folgte mir mit einem beherzten Sprung. Kaum eine Armlänge von mir entfernt, tauchte er in den See ein und blieb verschwunden.
Ich wartete, aber nichts geschah. Zugegeben, ich hatte mir auch Zeit gelassen, aber Tyler war inzwischen viel länger unter Wasser und ewig konnte er auch nicht die Luft anhalten. Ich wurde unruhig und wollte untertauchen, um nach ihm zu suchen, als ich eine Berührung im Nacken spürte.
Mit einer schnellen Bewegung fuhr ich herum. Tyler war gleich hinter mir aufgetaucht. Auf seinen Lippen lag das schiefe Lächeln, das ich so an ihm mochte.
»Hattest du Angst um mich?«, fragte er neckend.
»Sehr witzig, natürlich hatte ich das!« Gespielt beleidigt stieß ich ihn von mir, konnte mir ein Lachen aber nicht verkneifen.
Tyler ergriff mein Handgelenk, zog mich zu sich heran und mit einem Mal wurde alles um uns herum still. Unser Lachen verstummte, die Musik und die Stimmen der anderen rückten in die Ferne. Übrig blieben nur wir und unser wilder Atem.
»Devin, ich …«, sagte Tyler wie benommen. Er schaute mich an, als würde er mich zum ersten Mal im Leben wirklich sehen, und kam mir so nah, dass sich unsere Lippen beinahe berührten.
Mein Herz überschlug sich geradezu und mein Körper fühlte sich an, als würde er mit dem Wasser verschmelzen. Wie schwerelos schwebte ich, wie losgelöst von Raum und Zeit. Ich hob die Hand, berührte Tylers Wange und es war, als würde diese Berührung ausreichen, um genauso mit ihm zu verschmelzen wie mit dem Wasser. Als spürte ich ihn weit über diese Berührung hinaus.
Seine Lippen berührten meine, warm und weich. Seine Hand wanderte über meinen Körper, bis plötzlich sein Atem stockte.
Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, beendete den Kuss, bevor er die Bezeichnung verdiente, schob Tyler von mir und schaute ihn an. Seine weit aufgerissenen Augen waren blutunterlaufen und von Panik gezeichnet. Seine Lippen hatten sich blau gefärbt und er drohte zu versinken, weil sein ganzer Körper wie erstarrt war.
»Tyler?!«, stieß ich aus.
Aus dem Augenwinkel sah ich eine Bewegung im Wasser. Etwas Schmales, beinahe Durchsichtiges zuckte an uns vorbei und war ebenso schnell verschwunden, wie es aufgetaucht war. Tyler atmete hektisch, bewegte sich wieder, aber nur mit größter Mühe.
»Bleib ganz ruhig!«
Ihn musste etwas gebissen haben. Anders konnte ich mir das Ganze nicht erklären. Was auch immer ich im Wasser gesehen hatte, war vermutlich giftig.
»Hilfe!«, rief ich den anderen zu und wandte mich wieder an Tyler. »Wir müssen aus dem Wasser raus.«
Ich wollte ihm helfen, aber er schlug plötzlich um sich und brachte Abstand zwischen uns, als wäre ich diejenige gewesen, die ihn angegriffen hatte. Sein Kopf tauchte immer wieder unter, doch jedes Mal, wenn es mir gelang, ihn am Arm festzuhalten, riss er sich los.
Ein paar Jungs hatten sich nach meinem Hilferuf auf den Weg zu uns gemacht und bekamen ihn zu fassen.
»Wir haben ihn«, sagte einer von ihnen.
Er beruhigte sich einigermaßen, sodass sie ihn zum Ufer ziehen konnten. Bestürzt schwamm ich ihnen nach, bis ich festen Boden unter den Füßen hatte.
Tyler konnte aus eigener Kraft nicht stehen. Schlaff hing er in den Armen seiner Retter und musste von ihnen an Land geschleppt werden, bevor sie ihn ablegen konnten.
Bonnie kam angelaufen. »Was zur Hölle ist passiert?«
»Da ist ein Tier im See, schnell alle raus!«, rief ich den Leuten zu, die noch im Wasser waren.
Teils kreischend wateten sie ans Ufer. Mein Blick hing noch ein paar Sekunden an der Wasseroberfläche, aber ich konnte mir nicht vorstellen, womit wir es zu tun hatten. Wieso gab es in einem Badesee giftige Tiere? War das eine Süßwasserqualle gewesen? Oder eine Schlange? Es hätte Warnschilder oder ein Badeverbot geben müssen!
Ich schaute zu Tyler, um den sich die anderen versammelt hatten. Er war ohnmächtig und sah leichenblass aus. Seine Wangen waren eingefallen, als hätte er tagelang nichts gegessen. In mir schnürte sich etwas zusammen. Ich konnte den Puls in meinen Ohren pochen hören. Was für ein Tier konnte so etwas anrichten?
»Atmet er?«, fragte jemand überfordert.
Die meisten standen bloß perplex herum, also riss ich mich zusammen. Ich schob mich zu Tyler vor, sank neben ihm auf die Knie und fühlte seinen Puls. Zu meiner Erleichterung konnte ich ihn ertasten.
»Wir müssen den Notarzt rufen«, sagte ich.
Bonnie hatte ihr Handy am schnellsten griffbereit.
»Vielleicht ein Hitzschlag«, meinte jemand.
»Haben wir einen Sonnenschirm für Schatten?«, fragte ein anderer.
Zwei Leute brachten ein großes Badetuch und hielten es über Tylers Kopf.
Bonnie kniete sich mit dem Handy am Ohr neben ihn und berührte seine Wange »Tyler? Hörst du mich? Nein, er ist nicht ansprechbar.«
Ich ließ meinen Blick über seinen Körper wandern, suchte nach Anzeichen für das, was ihn angegriffen hatte, und fand tatsächlich etwas: Rötungen an seinen Armen und Beinen, die sich von seiner sonnengebräunten Haut abhoben. Feine Linien, wie Verbrennungen.
»Bonnie, hier!« Wenn er mit einem giftigen Tier in Berührung gekommen war, musste der Notarzt das wissen.
»Warten Sie einen Moment«, sagte sie ins Telefon und fuhr mit dem Finger über eine der Linien, die unter ihrer Berührung verblasste. »Nein, da ist nichts. Gut, verstehe …« Sie stand auf und entfernte sich.
Ich schaute mir die Linien genauer an und erkannte darin Muster, die an Schriftzeichen einer fremden Sprache erinnerten. Wie konnte das sein? Bevor ich Antworten fand, verblassten auch die übrigen Rötungen. Hatte ich mich getäuscht? Waren es doch Verbrennungen einer Qualle, die nur zufällig ein Muster ergaben? Aber dann hätten sie nicht nach wenigen Minuten spurlos verschwinden dürfen.
Ich fuhr mit den Händen über mein Gesicht und merkte, dass ich nicht nur Wasser wegwischte. Tränen liefen mir über die Wangen. Ich fühlte mich noch immer innerlich zusammengeschnürt und völlig aufgelöst, sodass es mir schwerfiel, einen klaren Gedanken zu fassen.
Ein Badetuch legte sich über meine Schultern und Isla sank neben mir auf den Boden. »Geht es dir gut?«, fragte sie.
Ich schüttelte den Kopf. Wie sollte es auch? Irgendein Tier hatte Tyler angegriffen, irgendetwas Gefährliches war dort draußen und ich hatte es zu spät gesehen.
Meine Granny hätte schnell eine Antwort auf die Frage gehabt, was in diesem See lauerte. Aber das konnte nicht sein. Es gab keine Seemonster. Nicht im wahren Leben.
2
Mit Fish and Chips wird alles besser
Mit feuchtem Haar und durchnässter Kleidung lief ich im Wartezimmer des Good Hope Hospitals auf und ab. Dustin, Bonnie, Isla und ich waren dem Krankenwagen, der Tyler abgeholt hatte, in Bonnies Wagen gefolgt.
Obwohl der Vorfall am See über eine Stunde zurücklag, konnte uns noch immer niemand etwas über Tylers Zustand sagen. Kein Arzt hatte sich bei uns blicken lassen und seine Eltern waren auch noch nicht eingetroffen.
Das Auf- und Ablaufen half nicht viel, um genau zu sein, gar nicht. Ich würde nicht eher zur Ruhe kommen, bis ich mir einen Reim darauf machen konnte, was dort draußen im Wasser vorgefallen war.
Ich hatte erst den Sanitätern, danach den Parkwächtern und später der Polizei von meiner Beobachtung erzählt, doch alle hatten mich nur verständnislos angestarrt. Um ehrlich zu sein, hätte ich mir selbst nicht geglaubt, wenn ich nicht dabei gewesen wäre, und auch Google konnte mir nicht beantworten, welches Tier Rötungen hinterließ, die nach Schriftzeichen aussahen.
Isla verstellte mir den Weg. »Wenn du so weitermachst, läufst du noch eine Furche in den Boden.«
»Das soll ein SOS werden.« Ich deutete auf die Route, die ich in der letzten halben Stunde abgelaufen war.
»Wie wäre es, wenn du dich hinsetzt«, riet sie mir und zeigte auf einen dieser unbequemen Plastikstühle, die es nur in Wartezimmern gab. Wahrscheinlich speziell dafür entwickelt, den Angehörigen die Wartezeit noch unerträglicher zu machen.
Seufzend fügte ich mich und stützte meine Stirn mit den Händen ab. Ich hatte mir zwar einen unvergesslichen Tag gewünscht, dabei aber ganz andere Vorstellungen im Kopf gehabt. Beim nächsten Mal sollte ich meinen Geburtstagswunsch genauer formulieren.
Ein flackerndes Licht unmittelbar vor mir zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Als ich aufschaute, hielt Isla mir einen Muffin mit brennender Kerze hin. Der Anblick zauberte mir ein Lächeln auf die Lippen.
»Wo hast du denn den her?«, fragte ich.
Dustin hob die Schultern. »Im Geschenkeshop kannst du echt alles kaufen.«
»Es ist immer noch dein Geburtstag«, erinnerte mich Isla. »Also wünsch dir was.«
Obwohl das mit dem Wünschen bis jetzt nicht gut ausgegangen war, tat ich ihr den Gefallen. Kaum hatte ich die Kerze ausgepustet, öffnete sich die Tür zum Wartezimmer. Sofort saß ich aufrecht.
Wenn jetzt Tyler eintrat und erklären würde, dass es ihm gut ging, wäre mein nächster Wunsch ein knallrotes Cabrio. Allerdings war es nicht Tyler, sondern andere Besucher, die wie wir ins Wartezimmer verbannt worden waren.
Ich hielt diese Ungewissheit einfach nicht mehr aus. Entschlossen, etwas dagegen zu tun, stand ich auf. »Ich schaue mal nach, was los ist.«
»Die lassen dich sowieso nicht zu ihm«, sagte Bonnie.
»Was wollen sie denn tun, wenn ich nach ihm suche? Mich verhaften?« Ich ging zur Tür.
»Das wäre eine Option«, meinte Dustin.
Lieber legte ich mich mit der Security des Krankenhauses an, als noch länger Däumchen zu drehen. Ich brauchte Antworten, weil mich die vielen Fragen in meinem Kopf sonst noch um den Verstand brachten.
»Ich komme mit.« Isla drückte Dustin den Muffin in die Hand.
»Als deine große Schwester sollte ich …«, begann Bonnie, seufzte dann aber resigniert. »Ach, was soll’s, geht ruhig, wenn ihr unbedingt Ärger haben wollt.« Sie ließ sich auf einen der Stühle plumpsen.
Auf dem Gang vor dem Wartezimmer schauten wir uns um. Ein paar Pfleger waren zu sehen, kümmerten sich aber nicht um uns. Genauso wenig wie das übrige Krankenhauspersonal. Ich hatte auch nicht erwartet, dass sich sofort ein halbes Dutzend Sicherheitsleute auf uns stürzen und uns zu Boden ringen würde.
»Und jetzt?«, fragte Isla unsicher.
Ich beugte mich verschwörerisch zu ihr vor. »Jetzt suchen wir die Umkleide, besorgen uns Arztkittel und schlagen uns bis zu Tylers Zimmer durch. Vielleicht musst du ein paar Bettpfannen leeren oder eine Blinddarm-OP durchziehen, um den Schein zu wahren. Das geht doch klar, oder?«
Islas Unsicherheit war sofort verflogen. »Kein Problem, so was erledige ich im Schlaf.«
Ich schmunzelte.
»Und jetzt noch mal im Ernst«, bat sie.
Ich schaute mich noch einmal um. »Da entlang?«, schlug ich vor und deutete zum linken Flur, an dessen Ende eine Hinweistafel hing. Zwar bezweifelte ich, dass darauf Tylers Name mit Richtungspfeil zu finden war, aber uns wäre schon viel geholfen, wenn wir wüssten, wo sich die Patientenzimmer befanden. In eine Blinddarm-OP wollte ich nämlich nicht wirklich hineinplatzen.
»Okay«, stimmte Isla zu.
Wir hatten die Hinweistafel noch nicht ganz erreicht, als Isla abrupt stehen blieb. »Sind das nicht Tylers Eltern?«, fragte sie und nickte zu einem abzweigenden Gang. Tatsächlich standen die beiden dort und unterhielten sich mit einer Ärztin.
»Stimmt, das sind sie!« Erleichtert ging ich auf sie zu. »Wie geht es ihm?«, übersprang ich die üblichen Höflichkeitsfloskeln.
»Devin, nicht wahr?« Tylers Mum schaute mich mit rot umrandeten Augen an. Sie sah sehr mitgenommen aus und tat mir unheimlich leid. Der Anruf aus dem Krankenhaus musste ein Schock für sie gewesen sein und jetzt unterbrachen wir auch noch ungefragt dieses Gespräch.
»Tut mir leid, ich wollte nicht …«, entschuldigte ich mich.
»Schon gut«, wiegelte sie ab. »Du warst bei ihm, oder? Er ist noch nicht zu sich gekommen.«
»Der Zustand Ihres Sohnes ist stabil, das ist jetzt das Wichtigste«, sagte die Ärztin.
»War es eine Vergiftung?«, hakte ich nach.
»Gift?« Tylers Vater wirkte aufgebracht.
»Da war ein Tier im Wasser«, erklärte ich.
»Die toxikologische Untersuchung hat nichts ergeben«, sagte die Ärztin.
»Also war es kein Tier? Was denn nun?«, wollte Tylers Vater wissen.
»Vielleicht war das im Wasser nur ein Stück Plastikmüll?«, mutmaßte Isla, die dazugetreten war. »Du meintest doch, dass es durchsichtig war wie eine Qualle.«
»Ja schon, aber …« Konnte ich mich wirklich so getäuscht haben? Was auch immer es gewesen war, es hatte lebendig gewirkt. Ich schaute in das Zimmer, vor dem wir standen. Tyler lag dort in einem Krankenbett, mit Beatmungsmaske und Schläuchen, die von ihm wegführten. Er war noch immer leichenblass, dunkle Augenringe zeichneten sein Gesicht. Mir wurde ganz anders, als ich ihn so schwach und verletzlich dort liegen sah. Ausgerechnet Tyler, den nie etwas erschüttern konnte, dem nichts und niemand Angst machte. Es schnürte mir die Kehle zu.
Die Ärztin unterrichtete Tylers Eltern über die geplanten Untersuchungen, was wie ein fernes Rauschen im Hintergrund an mir vorbeiging. Es nahm mich zu sehr mit, Tyler so zu sehen. Ich betrat das Zimmer und näherte mich zögernd dem Bett.
Bisher war Tyler unerreichbar für mich gewesen. Er hatte nie durchblicken lassen, dass er mehr in mir sah als das kleine Mädchen mit der Hornbrille von früher. Aber am See, kurz bevor das Chaos ausgebrochen war, hatte er mich mit einem Blick angeschaut, den ich nicht von ihm kannte. Er hatte mich küssen wollen, war dabei jedoch wie ausgetauscht gewesen – wie fremdgesteuert.
Ich blieb unmittelbar neben seinem Bett stehen und wusste nichts mit mir anzufangen. Wenn er nur aufwachen würde. Er hatte etwas im Wasser gesehen, genau wie ich, und was auch immer es gewesen war, es hatte ihm Angst gemacht. Wenn er den Ärzten davon erzählte, würden sie ihn hoffentlich richtig behandeln können, damit es ihm bald wieder gut ging.
»Tyler, ich …« Noch immer unschlüssig und mit dem brennenden Gefühl der Hilflosigkeit in meiner Brust, griff ich nach seiner Hand.
In diesem Moment schlug er die Augen auf.
Eine Welle der Erleichterung überrollte mich. »Du bist wach!«
Tylers Augen weiteten sich. Ihn ergriff dieselbe Panik wie im Wasser. Neben ihm begann ein Gerät wild zu piepsen, sein Atem ging stoßweise, er riss sich von mir los und drückte sich auf dem Bett so weit wie möglich zurück.
»Geh weg von mir!«, schrie er, als stünde ich mit erhobenem Messer vor ihm.
»Tyler, ich … ich bin es!«, stammelte ich völlig perplex.
Die Ärztin und Tylers Eltern stürmten an mir vorbei und drängten mich zur Seite. Wie benommen stolperte ich nach hinten.
Er hatte mich angeschaut, als wäre ich ein Monster, als hätte ich ihn im See angegriffen und nicht irgendein Tier.
Weiteres Krankenhauspersonal eilte zu Tyler und ich war gezwungen, bis zur Tür auszuweichen. Sie warfen mit Begriffen um sich, mit denen ich nichts anfangen konnte, richteten seine Sauerstoffmaske und verabreichten ihm eine Spritze. Das Piepsen wurde rhythmischer, Tyler schien sich zu entspannen, nachdem nun seine Mum ihm die Hand hielt.
»Was ist passiert?«, fragte Isla.
Ich stand völlig neben mir. »Keine Ahnung. Lass uns verschwinden, ja? Ich will jetzt nur noch nach Hause.«
»Okay, aber dein Dad wollte dich doch abholen.«
»Egal, ich will einfach hier weg.« Mit großen Schritten lief ich los.
Ich musste unbedingt meine Gedanken sortieren und aus alldem schlau werden. Mir war so übel, dass es hinter meinen Schläfen pochte. Ich rieb in kreisenden Bewegungen darüber, was wenig nutzte.
Isla holte mich ein und legte ihre Hand auf meinen Arm. »Selbst wenn wir mit dem Bus fahren, wären wir ewig unterwegs. Außerdem wäre dein Dad bestimmt nicht begeistert, wenn er hier ankommt und du bist schon weg.«
»Hast du gesehen, wie Tyler auf mich reagiert hat?«, fragte ich.
Sie verengte den Blick. »Er ist gerade erst aufgewacht, was erwartest du denn?«
»Jedenfalls nicht, dass er so tut, als würde ich ihn fressen wollen. Er hat mich … Kurz bevor das mit ihm passiert ist, wollte er mich … küssen.«
»Vorhin im See? Echt jetzt? Er hat nie durchblicken lassen, dass er was von dir will. Aber ist doch mega! Du stehst seit Ewigkeiten auf ihn und er jetzt auch auf dich. Damit hat deine Durststrecke endlich ein Ende und ich muss keine Angst mehr haben, dass du irgendwann ins Kloster gehst oder so.« Sie stieß mich mit dem Ellbogen an. »Ihr wärt ein tolles Paar!«
Um ehrlich zu sein, bezweifelte ich das. Wir hatten nicht wirklich viel gemeinsam, aber darum ging es gerade nicht.
»Schreib das Kloster lieber nicht so schnell ab«, riet ich ihr. »Offensichtlich hält er mich für ein männerfressendes Monster.« Ich deutete an Isla vorbei zu den Patientenzimmern.
»Anfall, Schock, was weiß ich. Er kommt schon wieder in Ordnung und dann könnt ihr dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt.« Sie grinste zufrieden.
Ich sah das nicht so locker. Es gab zu viele Faktoren, die ich nicht verstand, die keinen Sinn ergaben und sich ganz und gar falsch anfühlten. Ich wollte wirklich nur nach Hause und diesen schrecklichen Tag abhaken.
»Ich brauche frische Luft«, sagte ich. »Sagst du den anderen Bescheid, dass Tyler wach ist? Ich warte auf dem Parkplatz auf Dad.«
»Okay, dann hol ich dein Zeug und wir treffen uns draußen.«
Ich nickte dankend und nahm den Weg zur Eingangshalle. Vielleicht würden Tyler und ich in ein paar Tagen über seine Reaktion auf mich lachen, aber im Moment war mir ganz und gar nicht danach zumute. Ich ging auf die Drehtür zu und die Aussicht, endlich hier rauszukommen, beschleunigte meine Schritte.
Am liebsten wäre ich nach draußen gestürmt, doch die Drehtür zwang mich zur Geduld. Ich betrat eine der Kabinen, während zwei Männer in dunklen Uniformen auf der anderen Seite dasselbe taten. Erst schenkte ich ihnen wenig Beachtung, doch dann fiel mir auf, wie seltsam ihre Uniformen aussahen. Als wären sie Polizisten aus einem alten Schwarz-Weiß-Krimi. Die Jacken hochgeschlossen, mit goldenen Knopfreihen und einem breiten Gürtel, an dem etwas hing, das verdächtig nach einem runenverzierten Schlagstock aussah. Runen? Auf einem Schlagstock? Das war mehr als seltsam.
Ein mulmiges Gefühl ergriff mich, auch wenn es bestimmt eine simple Erklärung für ihre Kleidung gab und es nur Zufall sein konnte, dass mich die Runen auf den Schlagstöcken an die Rötungen auf Tylers Haut erinnerten.
Vielleicht fand irgendwo in der Gegend ein Historienfest oder eine Fantasy Convention statt? Allerdings wirkten die beiden Männer mit den ersten Mienen nicht wie Cosplayer.
Der eine war jung und groß, mit kurzen braunen Locken, kupferfarbener Haut und stechenden Augen. Der andere war um die fünfzig, mit gestutztem Bart, grau melierten Haaren und einem silbergrauen Teint.
Dass ich von ihnen genauso gemustert wurde wie sie von mir, ließ mein ungutes Gefühl wachsen. Der Ältere flüsterte dem Jüngeren etwas zu, ohne mich aus den Augen zu lassen, und nickte auch noch in meine Richtung. Zwar musste ich nach dem Schwimmen immer noch wie begossen aussehen, aber das rechtfertigte nicht, mich so ausgiebig zu begutachten.
Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, durch diese blöde Drehtür zu gehen. Sowie der Spalt zur Freiheit breit genug war, quetschte ich mich hindurch und stolperte hinaus in die Einfahrt.
Als ich über die Schulter zurückblickte, betraten die Männer gerade die Eingangshalle und beachteten mich nicht weiter. Hatte ich mir ihre aufdringlichen Blicke nur eingebildet? Vielleicht entwickelte ich gerade eine ausgeprägte Paranoia, was nach den heutigen Geschehnissen kein Wunder war.
Auf dem Parkplatz angekommen, lehnte ich mich an einen Poller und atmete tief durch.
Kurz darauf gesellten sich die anderen zu mir, und während wir auf Dad und Dustins Eltern warteten, hob sich die Stimmung wieder etwas. Wir teilten uns meinen Geburtstagsmuffin, schlossen Wetten ab, ob Dustin es schaffen würde, den Poller zu überspringen, und lachten, weil ihn das Teil genau zwischen den Beinen erwischte. Als Dad vorfuhr, hatten sich meine Nerven beruhigt. Ich verabschiedete mich von den anderen und setzte mich auf den Beifahrersitz.
»Gibt es Neuigkeiten?«, fragte Dad ohne Umschweife.
»Tyler ist bei Bewusstsein. Er … er wird wieder.«
»Fish and Chips bei Sharks?«, schlug er vor.
Ich lächelte breit. Dad genügte das als Antwort, er legte den Gang ein und wir fuhren los. Er wusste, wie ich tickte. Egal wie mies es mir ging, ob wegen schlechter Noten oder eines heftigen Streits, eine Portion Fish and Chips bei Sharks munterte mich immer auf.
3
Ein Riesenkrake wäre mir lieber gewesen
An diesem Abend überfiel mich der Schlaf regelrecht. Ich war kaum unter die Bettdecke gekrochen, als ich den Kampf gegen ihn schon verlor. Erst umfing mich Dunkelheit, dann klarte sie allmählich auf und ich fand mich im Badesee wieder – schwebend unter Wasser, umspielt von Luftblasen.
Ich konnte weit blicken, das Ufer aber nicht sehen, was jedoch keine Angst in mir auslöste. Im Gegenteil. Es war, als gäbe es keine Begrenzung, nichts, was mich aufhalten oder festhalten könnte. Es gab nur das Wasser und mich und das Gefühl von Unendlichkeit. Es war unglaublich, fast schon berauschend.
Ich bewegte die Hände, ließ die Strömung durch meine Finger fließen und merkte bald, dass ich sie mit meinem Willen lenken konnte.
Während ich das Schauspiel beobachtete, bemerkte ich aus dem Augenwinkel etwas an meinen Beinen. Ich schaute nach unten, meine Augen weiteten sich, Panik schwappte über mich hinweg. Etwas Durchscheinendes, Tentakelartiges klebte an mir. Es hielt mich fest und ließ sich nicht abschütteln, so sehr ich es auch versuchte. In meiner Verzweiflung riss ich den Mund weit auf und gab einen stummen Schrei von mir. Wasser füllte meine Lunge, brannte wie Feuer und sorgte dafür, dass ich tiefer sank. Tiefer hinab in die Dunkelheit, wehrlos diesem Ding ausgeliefert, das mich fest im Griff hatte.
Im nächsten Moment wachte ich auf. Sofort saß ich aufrecht im Bett und atmete schwer. Mein Haar klebte mir schweißnass an der Stirn. Ich brauchte nicht lange, bis ich begriff, dass es bloß ein Traum gewesen war. Um mich vollends davon zu überzeugen, schlug ich die Decke beiseite. Tatsächlich kamen nur mein Schlafshirt und gelb gestreifte Kuschelsocken zum Vorschein, keine giftigen Monstertentakel, die an meinen Beinen klebten. Dennoch fühlte ich mich, als wäre ich gerade dem Tod durch Ertrinken entkommen.
Ich schälte mich aus dem Bett und ging ins Bad, das direkt von meinem Zimmer abging, sodass ich nicht auf den Flur treten musste und Gefahr lief, Dad zu wecken. Wobei die Gefahr nicht sehr groß war. Üblicherweise schlief er fest wie ein Stein und hätte sich wahrscheinlich auch nicht von einem echten Tentakelmonster wie einem riesigen Kraken wecken lassen, der unser Haus verschlingen wollte.
Ich drehte den Wasserhahn auf und lauschte einen Moment lang dem Plätschern. Als wäre mein Geburtstag nicht schon schlimm genug ausgegangen, mussten mich die Ereignisse auch noch bis in meine Träume verfolgen. Wenn Tylers Träume während seiner Ohnmacht ähnlich abgelaufen waren, wunderte es mich nicht mehr, dass er beim Aufwachen so panisch auf mich reagiert hatte.
Ich legte die Hände zusammen, hielt sie unter den Wasserhahn und ließ sie bis über den Rand volllaufen. Mein Plan war eine nasse Abkühlung im Gesicht, die daran scheiterte, dass es nicht mein Spiegelbild war, das mir entgegenblickte, sondern das des Seemonsters auf Grannys Bild. Die Augen leuchteten beinahe gänzlich weiß, es hatte Kiemen am Hals, Flossen statt Ohren und schimmernde Fischschuppen, die ein Gesicht umrahmten, das meinem zum Verwechseln ähnlich sah.
Ich schrie, riss die Hände vom Waschbecken weg und stolperte rückwärts gegen die Badewanne, in der ich mit dem Hintern landete.
Eilig betrachtete ich meine Hände und tastete mein Gesicht ab. Alles normal. Ich war nicht zu einem abgedrehten Ungetüm mutiert. Aber was zum Teufel war das dann eben gewesen? Eine Halluzination? Ein Tagtraum? Ich hievte meine Beine in die Wanne, griff nach dem Rand und lugte vorsichtig darüber hinweg, um einen Blick in den Spiegel zu werfen. Ich wollte sichergehen, dass ich mir den Anblick nur eingebildet hatte.
Das Gute war, dass ich ganz ich selbst war. Ein bisschen lädiert, mit Schweißtropfen auf der Stirn und wirrem Haar, aber immer noch ich, ohne Flossen und Schuppen. Das Schlechte war, dass über dem Waschbecken – wie von Zauberhand gehalten – das von mir geschöpfte Wasser schwebte. Es hing wabernd in der Luft, fing das Badezimmerlicht auf und warf es in blau schimmernden Tupfern auf die Fliesen.
Mir schoss der Gedanke durch den Kopf, dass ich wahrscheinlich noch immer im Bett lag und einen erschreckend realistischen Traum hatte. Das war die einzig logische Erklärung. Entweder das oder ich hatte den Verstand verloren.
In beiden Fällen war es bestimmt nicht die beste Idee, in der Badewanne hocken zu bleiben. Ich stieg über den Rand und näherte mich dem seltsamen Phänomen. Was auch immer es war, es machte keine Anstalten, auf meine Annäherung zu reagieren. Vorsichtig streckte ich die Hand nach dem Wasser aus. Ich berührte es nur ganz leicht mit der Fingerspitze und schon klatschte es ins Waschbecken, spritzte mich nass und brachte mich erneut dazu, einen Satz nach hinten zu machen. Diesmal landete ich jedoch nicht in der Wanne – auch wenn ich dafür mit den Armen rudern musste.
Ich schaute an mir herunter. Mein Schlafshirt war komplett durchnässt. Das Wasser fühlte sich kalt an, rann über meine Haut, tropfte von meinen Armen. Das war kein Traum, keine Einbildung. Als zusätzlichen Beweis hätte ich mich noch kneifen können, aber das war nicht nötig. Kein Traum fühlte sich so an.
Mein Atem ging schneller, meine Gedanken überschlugen sich, und noch bevor es mir gelang, sie in einigermaßen gerade Bahnen zu lenken, hörte ich Stimmen, die aus dem Flur zu mir vordrangen. Erschrocken riss ich den Kopf zu meinem Zimmer herum.
»Wir erledigen das, während sie schläft, also sei leise«, sagte ein mir unbekannter Mann mit gesenkter Stimme.
»Du bist doch derjenige, der –« Eine lose Diele quietschte. »Mist!«
Einbrecher? Wirklich? Seemonster, Tylers Zusammenbruch, schwebendes Wasser und am Ende auch noch das? Am liebsten wäre ich zur Tür gestürmt und hätte die Typen angeschnauzt, dass sie sich einen anderen Tag aussuchen sollten, weil dieser hier schon verhunzt genug war.
Da ich aber an meinem Leben hing, verzichtete ich darauf. Stattdessen schlich ich zurück in mein Zimmer und versteckte mich hinter der Tür. Erst jetzt fiel mir ein, dass es schlauer gewesen wäre, zu meinem Handy zu schleichen, um die Polizei zu alarmieren. Dieses Zuerstdenken,dannhandeln lag mir einfach nicht. Mein Handy befand sich neben dem Bett, also am anderen Ende des Zimmers, und war damit unerreichbar, denn die Schatten der Eindringlinge krochen bereits unter dem Türspalt hindurch.
Ich hielt die Luft an, damit mich mein hektischer Atem nicht verriet. Mein Herz schlug gegen meine Rippen und in meinen Ohren rauschte es so laut, dass ich mich kaum auf andere Geräusche konzentrieren konnte.
Die Klinke wurde nach unten gedrückt, die Tür schwang knarrend auf, und kaum hatten die Fremden mein Zimmer betreten, warf ich mich mit vollem Körpereinsatz gegen die Tür.
Ein heftiger Schmerz schoss mir durch die Schulter, die Tür knallte gegen die Einbrecher und sie stolperten zur Seite. Das verschaffte mir genug Platz, um an ihnen vorbei auf den Flur zu stürzen. Schlitternd stieß ich gegen die Wand und wirbelte zu den Männern herum, die sich bereits wieder aufgerichtet hatten, sodass ich genauer sehen konnte, mit wem ich es zu tun hatte. Nur glauben konnte ich es nicht. Es waren die seltsamen Typen aus dem Krankenhaus!
»Was zum Teufel wollt ihr von mir!?«, schrie ich.
Wie hatten sie mich überhaupt finden können? Es war ja nicht so, dass ich irgendwo eine Visitenkarte mit meiner Adresse verloren hatte. Ich besaß ja nicht einmal eine.
Mein Blick huschte flüchtig zu Dads Schlafzimmer, was der Ältere der beiden Männer bemerkte. Rasch verstellte er mir den Weg.
»Ganz ruhig, Kleine«, forderte er mich auf und wirkte dabei, als wäre ich die Bedrohung.
»Ruhig bleiben?«, gab ich aufgebracht zurück. Als wäre das eine Option bei einem Überfall. Ich stand in klatschnassem Schlafshirt und gelb gestreiften Kuschelsocken zwei mit Schlagstöcken bewaffneten Männern gegenüber. Schlagstöcken aus Metall, wohlgemerkt. Ich hatte alles andere vor, nur nicht ruhig zu bleiben.
»Wenn du uns erklären lässt«, bat der Jüngere mit amerikanischem Akzent.
Aus dem Augenwinkel sah ich, dass der andere nach dem Schlagstock an seinem Gürtel griff. »Ja klar, erklären mit dem Schlagstock«, knurrte ich.
Möglichst unauffällig schaute ich zur Treppe. Wenn ich loslief, würden mir die Typen bestimmt folgen, ich konnte sie von Dad weglocken und was dann? Ich hatte keine Ahnung, aber irgendetwas würde mir schon einfallen. Bei den Nachbarn klingeln oder laut um Hilfe rufen, Hauptsache, die Männer waren erst mal aus dem Haus.
Ich machte einen Schritt rückwärts zur Treppe und riss die Augen auf. Das Wasser, mit dem mein Shirt getränkt war, blieb einfach in der Luft hängen. Es hatte sich aus den Fasern gelöst und schwebte nun in Form wabernder Tropfen zwischen mir und den Männern.
»Sie lässt es drauf ankommen«, sagte der Ältere und wandte sich an mich. »Du legst dich mit den Falschen an!«
»Ich glaube nicht, dass sie versteht, was vor sich geht«, meinte sein Begleiter und kam auf mich zu.
Abwehrend riss ich die Hände hoch. »Bleibt weg!«, schrie ich und mit meinen Worten schossen ihnen die Wassertropfen wie Pistolenkugeln entgegen.
Das Wasser traf sie mit solcher Wucht, dass sie von mir weggeschleudert wurden und auf dem Boden aufschlugen.
Ich war wie gelähmt. Es wäre sinnvoller gewesen wegzurennen, statt Löcher in die Luft zu starren, aber meine Beine gehorchten mir nicht. Meine Gedanken rasten, ich hielt die ausgestreckten Arme noch immer erhoben und traute meinen Augen kaum. Hatte ich das getan? Folgte das Wasser meinem Willen, so wie in meinem Traum? Aber wie konnte das sein?
Während der ältere Mann noch stöhnend am Boden lag, zog der jüngere eine Art Kurzschwert aus seinem Schlagstock und richtete es auf mich. War ja klar. Es reichte nicht aus, dass diese Männer seltsame Kostüme trugen und mich mit Schlagstöcken bedrohten, sie konnten daraus auch noch Klingen hervorzaubern.
Ich wirbelte auf dem Absatz herum und rannte los.
»Arané e lumina!«, rief der junge Mann in bedrohlich gesenkter Stimmlage.
Ich hatte gerade die Treppe erreicht, da packte mich etwas am Fußgelenk und brachte mich zu Fall. Verzweifelt versuchte ich, mich zu befreien, warf mich auf den Rücken und sah, was mich festhielt – eine Art Netz, das sich über den Boden ausgebreitet hatte und aus Linien, Wirbeln und Symbolen bestand, die wie von unsichtbarer Hand mit Kreide gezeichnet wirkten. Ausgangspunkt dieses abstrusen Gebildes war das Kurzschwert des Mannes, das er in den Boden gerammt hatte und noch immer festhielt.
Die Linien lösten sich von den Dielen und begannen mein Bein zu umwickeln. Sie krochen immer weiter hinauf, bis sie meinen Oberkörper erreicht hatten und meine Arme fixierten.
Ich wollte mich herauswinden, doch je mehr ich mich wehrte, desto enger zogen sich die Linien zusammen. Ich hatte keine Chance.
»Verdammt, du mieser …!«, zischte ich.
»Hast du sie unter Kontrolle, Cardeles?«, fragte der Ältere und hievte sich humpelnd auf die Füße.
»Ja, habe ich«, antwortete Cardeles. Er ließ das Schwert stecken, kam näher und ging direkt neben mir auf ein Knie.
Ich zappelte noch immer und spuckte ihm ins Gesicht. Es brauchte schon etwas mehr als so einen Zaubertrick, um mich unter Kontrolle zu bringen. Auch wenn ich nicht wirklich wissen wollte, was diese Typen noch zu bieten hatten.
»Bleib ja weg von mir!«
Cardeles blieb erschreckend gelassen. Er wischte sich die Spucke von der Wange und hielt seinen Begleiter mit einer knappen Handbewegung auf Abstand, als sich dieser nähern wollte.
»Wenn du dich beruhigst und mit uns redest, können wir dir helfen«, erklärte er. In seinem Blick lag etwas Vertrauenswürdiges, dem ich nur schwer widerstehen konnte. Seine Augen wirkten warm und offen und ein einnehmendes, wenn auch kaum merkliches Lächeln umspielte seine Mundwinkel. Aber das alles änderte nichts daran, dass ich gefesselt am Boden lag, während er über mich gebeugt neben mir kniete.
»Du hast ein verdammtes Schwert auf mich gerichtet, also erzähl mir nichts von Hilfe«, zischte ich durch zusammengebissene Zähne.
»Ganz schön biestig, die Kleine, für das, was sie angestellt hat«, meinte der Ältere. »Soll ich die Strafe direkt vollstrecken?«
»Eins nach dem anderen«, sagte Cardeles.
Strafe? Wofür? Für das unerlaubte Verlassen des Wartebereichs im Krankenhaus?
In dem Moment trat Dad aus seinem Schlafzimmer. »Was zur Hölle?!«
»Dad, ruf die Polizei!«, brüllte ich und wehrte mich erneut gegen das Netz. Ich befürchtete jedoch, dass ich nur dagegen ankommen würde, wenn jemand das Schwert aus dem Boden zog.
Cardeles stand auf, während der andere Mann Dad den Weg versperrte, indem er die flache Hand vor sein Gesicht hielt.
»Hier passiert nichts«, sagte er.
Dad wich einen Schritt zurück, als die Handfläche des Mannes zu leuchten begann. Das Licht legte sich auf Dads Haut und sein Blick wurde trüb. Die Unruhe darin erlosch, er wirkte teilnahmslos und regte sich nicht mehr. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. In meinen Ohren begann es erneut zu rauschen, Panik ergriff Besitz von mir.
»Was macht ihr mit ihm?«, rief ich aufgebracht.
»Als Normalsterblicher wird er das alles nicht verstehen«, erklärte Cardeles. »Genauso wenig wie dein Freund Tyler.«
»Tyler? Wart ihr seinetwegen im Krankenhaus? Habt ihr ihm dasselbe angetan wie Dad?« Deswegen hatten sie mich nach unserer ersten Begegnung nicht weiter beachtet. Sie waren erst auf Tyler losgegangen. Hatte er ihnen verraten, wo ich wohnte?
»Hättest du gewollt, dass er allen erzählt, was er am See gesehen hat?«, fragte Cardeles. »Man hätte ihn für verrückt erklärt.«
Dad räusperte sich. »Darf ich den Herren einen Kaffee anbieten?«
»Was?!«, stieß ich fassungslos aus.
»Wieso nicht?«, sagte der Ältere. Cardeles schaute ihn vorwurfsvoll an, woraufhin er mit den Schultern zuckte.
»Das verspricht eine lange Nacht zu werden«, verteidigte er sich. »Ein Kaffee kann nicht schaden.«
»Na dann, folgen Sie mir«, sagte Dad und machte sich auf den Weg.
Ich glaubte nicht, was gerade geschah. Seine Tochter lag gefesselt am Boden und er stieg seelenruhig über mich hinweg.
»Verdammt noch mal, Dad!«, schrie ich und wand mich erneut.
»Er hört dich nicht«, sagte Cardeles. »Nicht wirklich. Aber keine Sorge, sobald wir alles geklärt haben, heben wir den Zauber auf. Dafür musst du mir nur versprechen, uns nicht wieder anzugreifen, wenn ich dich befreie. Einverstanden?«
Was hatte ich denn für eine Wahl? In dem Zustand durfte Dad nicht bleiben. Ich wusste nicht, ob sie ihn unter Drogen gesetzt hatten oder tatsächlich etwas Übernatürliches vor sich ging. Aber er lief wie ein Zombie die Treppe nach unten zur Küche. Und ich wollte auch nicht den Rest meines Lebens wie eine Roulade zusammengezurrt auf dem Boden verbringen.
»Einverstanden«, grummelte ich missmutig – und genervt und angefressen. Ich war so wütend auf diese Männer, auf das alles hier, auf die ganze beschissene Welt, wie schon lange nicht mehr.
»Sehr schön.« Cardeles ging zu seinem Schwert, zog es aus dem Boden und die Kreidelinien verblassten.
Während er die Klinge zurück in die Metallhülle steckte, sodass sie wieder zu einem Schlagstock wurde, richtete ich mich auf.
»Du hast sicher einige Fragen. Vielleicht möchtest du dich umziehen, bevor wir sie dir beantworten?«, schlug Cardeles vor und wandte sich an seinen Begleiter. »Sullivan, achtest du auf ihren Vater?«
»Mach ich. Du kommst hier klar?« Er beäugte mich misstrauisch. »Ich kenne solche wie sie. Die spielen gern die Unschuldigen, bevor sie ihre Krallen zeigen.«
»Sie wird keinen Ärger mehr machen«, meinte Cardeles.
»Klar, weil ich auch diejenige bin, die hier Ärger macht.« Meine Worte trieften förmlich vor Sarkasmus, sodass es mich nicht gewundert hätte, wenn dieser Sullivan beim Vorbeigehen darauf ausgerutscht wäre.
Cardeles entlockten sie ein Schmunzeln. Er deutete auf mein Zimmer, als wüsste ich nicht selbst, wo mein Kleiderschrank stand. »Nach dir.«
Widerwillig folgte ich seiner Anweisung. Ich ging zu meinem Schrank und durchwühlte die Schubladen. Was trug man am besten bei einer Geiselnahme? Ein Shirt mit dem Aufdruck Hilfe, ich werde gegen meinen Willen festgehalten! wäre ideal gewesen. Leider besaß ich so etwas nicht.
Ich musste mir etwas einfallen lassen. Irgendetwas. Es gab sicher einen Ausweg, den ich bloß noch nicht sehen konnte.
Cardeles lehnte am Türrahmen. Er ließ mich keine Sekunde aus den Augen, schien jede meiner Bewegungen zu analysieren und zu bewerten und tat das mit einer Routine, die mich vermuten ließ, dass so etwas zu seinem Alltag gehörte.
Professioneller Geiselnehmer also? Das klang absurd. Andererseits reihte sich diese Annahme in eine ganze Menge anderer Absurditäten ein, von denen ich bis vor Kurzem noch geglaubt hatte, dass sie unmöglich wären. Angefangen mit Magie. Waren Tyler und ich im See mit einem magischen Wesen in Kontakt gekommen? Hatte es mich … infiziert? Ich hatte unheimlich viele Fragen und Cardeles behauptete, sie beantworten zu können. Aber durfte ich riskieren, blindlings seinen Anweisungen zu folgen, in der vagen Hoffnung, dass er die Wahrheit sagte?
»Könntest du …?« Ich gestikulierte, dass er sich umdrehen sollte.
Sein Blick ging zum Fenster.
»Denkst du, ich leide an akuter Selbstüberschätzung und springe aus dem obersten Stock?«
»Mach schnell«, sagte er nur und drehte sich um.
Ich schlüpfte in eine Jeans. Vielleicht war es keine schlechte Idee, aus dem Fenster zu fliehen. Wie hoch war das? Vielleicht vier Meter? Wenn ich mich abrollen würde … war es immer noch zu riskant. Und was wäre dann mit Dad? Ich verwarf den Gedanken und friemelte umständlich mein Top unter mein Schlafshirt. Nur für den Fall, dass Cardeles linste. Anschließend huschte ich auf Zehenspitzen zu meinem Nachttisch.
»Mit Höflichkeit habt ihr Amerikaner es nicht so, was?«, fragte ich, um eventuelle Geräusche zu übertönen, während ich mein Handy in meiner Gesäßtasche verschwinden ließ und zurück zum Kleiderschrank schlich.
»Das hast du erkannt?«
»Was? Dass du Amerikaner bist oder dass du keine Aufforderung gebraucht hättest, dich umzudrehen, wenn du höflich wärst? Fertig.«
Er wandte sich zu mir um. Wieder lag dieses amüsierte Schmunzeln auf seinen Lippen. Schön, dass er sich von mir unterhalten fühlte, aber ich fand die ganze Sache nicht zum Lachen.
»Beides«, sagte er. »Wie alt bist du? Siebzehn? Achtzehn?«
»Im Ernst? Du fragst nach meinem Alter? Soll das ein Flirt werden? Fragst du mich gleich, ob ich mir wehgetan habe, als ich vom Himmel gefallen bin? Hätte ich gewusst, dass sich das in diese Richtung entwickelt, hätte ich Make-up aufgelegt.«
Sein Schmunzeln wurde breiter. »Du bist wirklich schlagfertig. Dabei verstehst du nicht einmal, was hier vor sich geht, oder irre ich mich?«
»Ich habe nicht die geringste Ahnung«, erwiderte ich stockernst. »Und ich habe nichts Falsches getan.«
»Ich glaube dir, dass du das glaubst.«
Noch umständlicher hätte er sich nicht ausdrücken können. Ich wollte endlich meine Antworten und verlor allmählich die Geduld.
»Können wir dann?« Ohne seine Reaktion abzuwarten, marschierte ich an ihm vorbei zurück auf den Flur, wo mir der Duft nach frisch aufgebrühtem Kaffee entgegenschlug.
Eine Berührung an meiner Gesäßtasche ließ mich aufschrecken. Ich wirbelte zu Cardeles herum, der mein Handy in die Höhe hielt.
»Das bekommst du später wieder. Versprochen.«
»Hast du mir gerade an den Hintern gefasst?«, warf ich ihm vor.
»Ich …«, stammelte er.
Endlich hatte ich es geschafft, ihn aus dem Konzept zu bringen. Seine hypersouveräne Art machte mich nervöser als alles andere. Ich nutzte seine kurze Verwirrung, schnappte mir mein Handy und ging auf Abstand zu ihm. »Ich schalte es ab«, sagte ich und ließ ihn dabei zusehen, wie der Bildschirm schwarz wurde. »Aber ich behalte es bei mir. Einverstanden?«
»Einverstanden«, stimmte er mit einem Nicken zu.
»Also, ich heiße Devin Blackwood, bin siebzehn Jahre alt und habe mir nichts zuschulden kommen lassen. Zumindest nichts, was diesen nächtlichen Überfall rechtfertigen würde. Und du bist Cardeles …?«
»Seth. Seth Cardeles, Wächter des Tribunals und fünfundzwanzig Jahre alt, wenn wir schon dabei sind unsere persönlichen Daten auszutauschen. Und ich bin hier, weil du gegen diverse Gesetze der Zwischenwelt verstoßen hast.«
Wächter? Tribunal? Zwischenwelt?
»Ich verstehe kein Wort«, gestand ich.
»Das wirst du noch«, versprach er und deutete zur Treppe.
Ich schob das Handy zurück in meine Tasche und ging die Stufen nach unten. Seth folgte mir in kurzem Abstand. Schon vom Flur aus konnte ich Dad und Sullivan am Küchentisch sitzen sehen. Dad starrte wie hypnotisiert auf seine Kaffeetasse. Mein Inneres zog sich zusammen und lenkte mich einen Moment von Sullivan ab, der etwas hinter seinem Rücken versteckte, als er mich sah.
»Lass uns das schnell hinter uns bringen«, schlug er vor und stand auf. Etwas Bedrohliches schwang in seinen Worten mit und weckte in mir das Gefühl, geradewegs in eine Falle zu tappen. Seth schien kein schlechter Kerl zu sein, aber dieser Sullivan? Er plante etwas und das gefiel mir gar nicht. Wenn er mich mit demselben Zauber belegte wie Dad, wären wir ihnen hilflos ausgeliefert.
Ich schaute zum Spülbecken, in dem sich noch das Geschirr von heute Morgen stapelte. Wie üblich hatte Dad es zum Einweichen mit Wasser volllaufen lassen. Wenn es mir gelingen würde, die Kontrolle über das Wasser zu erlangen, könnte ich uns verteidigen. Aber wie? Bisher war es nur Zufall gewesen.
»Sie greift an!«, rief Sullivan und versetzte mir damit einen solchen Schreck, dass sein Ausruf zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wurde. Das Wasser in den Schüsseln und Pfannen explodierte regelrecht, spritzte zu allen Seiten und zwang Sullivan, sich zu ducken, während ich unter Seths Arm hinwegtauchte.
Ich wusste nicht, wie ich das mit dem Wasser angestellt hatte, aber ich musste die Chance nutzen und Hilfe holen, egal wie. Also rannte ich zur Haustür und riss sie auf.
Ein Hauch warmer Nachtluft wehte mir entgegen, dann knallte die Tür wieder zu. Seth hatte mich eingeholt.
»Du kannst nicht davor fliehen«, sagte er.