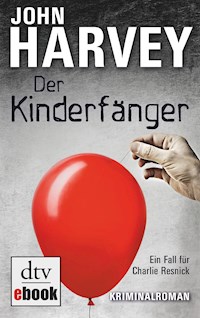8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Krimi
- Serie: Will Grayson & Helen Walker
- Sprache: Deutsch
Ein Fall für Will Grayson und Helen Walker Ihre Flötenstunde war kurz vor 18 Uhr zu Ende gewesen. Sie hatte ihren Mantel angezogen, ihre blaue Schultasche genommen und die Wohnung des Musiklehrers verlassen, um draußen auf ihren Vater zu warten. Seither hat niemand mehr die 10-jährige Beatrice gesehen. Es ist der blanke Horror für die Eltern. Vor allem für Ruth, die Mutter, ist es ein schreckliches Déjà-vu: Während eines Campingurlaubs 15 Jahre zuvor verschwand ihre Tochter aus erster Ehe ebenfalls spurlos. Tage später fand man sie tot in einem alten Minenschacht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
John Harvey
Schrei aus der Ferne
Kriminalroman
Deutsch von Sophie Kreutzfeldt
Deutscher Taschenbuch Verlag
Deutsche Erstausgabe 2012
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH und Co. KG, München
© 2012 für die deutschsprachige Ausgabe:
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH und Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH, KN digital– die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
eBook ISBN 978-3-423-41375-6 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-21392-9
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de/ebooks
Für
PETER COLES
Ein kleiner Dank für viele Jahre voller guter Ratschläge und uneingeschränkter Hilfe
All die süßen Kleinen?
Alle, sagst du?– O Höllengeier!– Alle!
William Shakespeare, ›Macbeth‹
TEIL EINS
1
Ruth stellte ihre Tasse ab, ging durch den Raum und öffnete die Schublade. Selbst mit Hausschuhen an den Füßen fühlte sich der Küchenfußboden kalt an. Februar. Heute Morgen um sieben, als sie zum ersten Mal hinausgegangen war, war es immer noch dunkel gewesen.
Der Umschlag war da, wo sie ihn hingelegt hatte, unter Quittungen für alte Stromrechnungen, Zetteln mit Mitteilungen von der Frau, die dienstags und donnerstags zum Putzen kam– Ruth hatte sich nie die Mühe gemacht, sie wegzuwerfen–, und Rezepten, die sie aus irgendwelchen Zeitschriften gerissen hatte: ein mattweißer selbstklebender Umschlag, dessen Ecken etwas wellig waren. In ihm steckte eine ganz normale Ansichtskarte, die eine größtenteils grün kolorierte Landkarte von Cornwall zeigte; auf der Rückseite stand über der Adresse in angestrengt sauberer Handschrift Ruths Name zusammen mit dem ihres Exmannes, Simon. Mr und Mrs Pierce. Die alte Adresse in London NW5.Der Text daneben war ein wenig schief, neigte sich von links nach rechts.
Liebe Mum, lieber Dad!
War heute wieder am Strand. Riesige Wellen!
Morgen gehen Kelly und ich zum Surfunterricht.
Hoffentlich geht es Euch gut. Bis bald.
Liebe Grüße,
Heather
Obwohl sie den Text auswendig wusste, las Ruth langsam jedes Wort, sorgfältig, nahm sich Zeit. Bis bald. Einen Moment lang schloss sie die Augen. Die Landkarte war mit kleinen Zeichnungen illustriert: die Kathedrale von Truro, eine Kuh über einem Eimer mit Milch, St Michael’s Mount, die Felsen von Land’s End.
Neben der gezackten Küstenlinie war auf halbem Weg zwischen Cape Cornwall und Sennen Cove mit dem Kugelschreiber ein kleiner Punkt gemacht worden, und wenn Ruth die Karte vor dem Küchenfenster in die Höhe hielt, wie sie es jetzt beim bereits schwindenden Nachmittagslicht tat, konnte sie einen schwachen Lichtschein durch das winzige Loch sehen, das absichtlich mit dem Stift gemacht worden war. Hier bin ich stand da in kleinen Buchstaben, die sich über das Meer erstreckten. Hier bin ich: Ein Pfeil zeigte auf den Punkt.
Wie lange sie dastand und hinausstarrte, dann hinunterstarrte auf die Karte in ihrer Hand, wusste sie nicht. Irgendwann hielt sie kurz die Luft an und schob die Postkarte wieder in den Umschlag, legte den Umschlag zurück in die Schublade, sah auf die Uhr und wendete sich schnell ab. Zeit, sich Schuhe und Mantel anzuziehen und ihre Tochter von der Schule abzuholen; ihre andere Tochter, Beatrice, die Tochter, die noch lebte.
2
Will Grayson hasste Morgen wie diesen, hasste diese Jahreszeit. Wenn der Wecker klingelte, war es nicht mehr so dunkel, dass er den Ruf ohne schlechtes Gewissen ignorieren und zehn oder fünfzehn Minuten länger rausschlagen konnte, sofern die Kinder nebenan nicht aufwachten. Vielmehr begann der Himmel am fernen Horizont aufzubrechen, und es war schon so hell, dass er davon aus dem Bett gescheucht wurde.
Neben ihm bewegte sich Lorraine, und für einen Augenblick kehrte er zu ihrer Wärme zurück. Als er die glatte Haut auf ihrer Schulter küsste, griff sie schläfrig mit der Hand nach seiner, aber dann riss er sich los.
Unten zog er seine Laufsachen an und schnürte die Schuhe zu. Susies erstes Schreien erklang, als er den Riegel an der Tür zurückzog und nach draußen trat. Ein paar Stretchübungen, und schon lief er los. Die schmale Straße führte zum Ende des Dorfes und zu dem Pfad zwischen den Feldern, der ihn zum Fenn bringen würde.
Obwohl er es manchmal leugnete und jede Verantwortung abstritt, war es Will gewesen, der sie letztendlich hierher gebracht hatte, in dieses kleine lang gestreckte Dorf im dünn besiedelten Norden der Grafschaft, wo unter dem weiten Himmel alles Wasser zu sein schien, manchmal sogar das Land.
Richtig war, dass Lorraine, noch bevor Jake, ihr erstes Kind, geboren wurde, gedrängt hatte, aus der Stadt fortzuziehen, aus dem kleinen Reihenhaus mit dem winzigen Garten und den feuchten Wänden. Irgendwo aufs Land, wo sie mehr Platz und frische Luft hatten, wo die Kinder– sie hatte immer von mindestens zwei gesprochen– in gesunder Umgebung aufwachsen konnten. Will hatte halb zugestimmt, aber trotzdem gezögert, weil er das betriebsame und lebhafte Cambridge mochte, wo natürlich auch ihre Freunde lebten. Außerdem fürchtete er die lange Fahrt zur Arbeit, den langsam im Stau dahinkriechenden Verkehr. Vielleicht sollten sie lieber an Ort und Stelle bleiben und sich nach oben orientieren, schlug er Lorraine vor. Ein ausgebautes Dachgeschoss, davon gab es genug. Aber nachdem sie etwas in der Stadt angesehen hatten– nicht größer als ihr eigenes Haus, aber fast doppelt so teuer– und von Ely aus nach Osten gefahren waren, war ihnen ein Schild mit der Aufschrift Zu verkaufen aufgefallen. Es führte sie von der Hauptstraße weg und stammte nicht von einem Makler, sondern von dem Eigentümer persönlich, einem Bauherrn mit einem Blick für Gestaltung, der das Land vor zwei Jahren gekauft und das Haus– einfach, klare Linien, helles Holz und Glas– als Traumhaus für seine Frau gebaut hatte. Es war wohl eher sein Traum gewesen als ihrer, wie sich herausgestellt hatte.
Will gefiel die hölzerne Veranda, die an der Rückseite des Hauses verlief, die angenehme Atmosphäre der Räume, die hohen breiten Fenster, aus denen man die Kathedrale von Ely und die langsam untergehende Sonne sehen konnte.
»Also, was denkst du?«, hatte er Lorraine gefragt und voller Freude die Antwort in ihren Augen gelesen.
Sobald der Reiz des Neuen vergangen war, waren sie überzeugt davon, einen Fehler gemacht zu haben. Will war fast im Zentrum von Cambridge stationiert, in der Polizeidienststelle an der Parkside, und an manchen Tagen– an den meisten– dauerte die Fahrt noch länger, als er erwartet hatte. Lorraine, die nur ein Krabbelkind zur Gesellschaft hatte, fühlte sich in den langen Stunden seiner Abwesenheit vom Leben abgeschnitten. Sie glaubte, sie würde langsam den Verstand verlieren. Manchmal dachte sie, es ginge sogar ganz schnell.
»Okay«, hatte Will dann gesagt. »Wir verkaufen. Begrenzen den Schaden. Suchen uns was anderes.«
Sie waren geblieben. Nach und nach, fast widerstrebend, fand Lorraine andere Frauen im Dorf, andere Mütter, mit denen sie gemeinsame Interessen hatte. Will wurde fest als Detective Inspector ins Morddezernat übernommen, und er brachte Detective Sergeant Helen Walker als seine Nummer Zwei mit– eine gute Arbeitsbeziehung, die sich inzwischen fast fünf Jahre lang bewährt hatte. Wie lange Will an ihr festhalten konnte, bis sie selbst einem Kommando vorstehen würde, wusste er nicht.
In letzter Zeit hatte er gemerkt, dass Helen irgendetwas quer lag, dass ihre Zunge spitzer und ihr Temperament aufbrausender denn je waren. Und vielleicht war es das. Ein Mangel an Anerkennung. Vielleicht hatte sie sich zu lange in seinem Kielwasser bewegt.
Vierzig Minuten nachdem er aufgebrochen war, kehrte Will mit schmerzenden Muskeln, klarem Kopf und an der Haut klebendem Unterhemd ins Haus zurück; er duschte schnell, rubbelte sich ab und ging dann zum Frühstück in die Küche, wo Jake sich Rice Krispies in den Mund löffelte, als gäbe es kein Morgen, und Susie es schaffte, mehr von dem Brei aus ihrer Schale in ihr Haar zu befördern als sonstwohin.
Will schenkte sich eine zweite Tasse Kaffee ein und strich Marmelade auf seine letzte Scheibe Toast; Lorraine war oben und gab ihrem Gesicht den letzten Schliff. Drei Tage die Woche arbeitete sie im Sekretariat des King’s College, und an den betreffenden Tagen lieferte sie Susie bei einer Tagesmutter ab, bevor sie Jake in die Grundschule brachte, von der ihn die Tagesmutter nach dem Unterricht abholte.
Will trank die restlichen Schlucke Kaffee, spülte den Becher aus und bückte sich dann, um Jake kurz zu umarmen und ihm einen Kuss auf den Kopf zu drücken. »Hab einen schönen Tag in der Schule. Streng dich an!«
»Okay.«
Susie streckte die Arme nach ihm aus, und es gelang ihm, sie auf die Wange zu küssen, ohne dass sein Hemd von ihren klebrigen Fingern Breiflecken bekam.
»Dad?« Jakes Stimme ließ Will an der Tür innehalten. »Können wir Fußball spielen, wenn du heute Abend nach Hause kommst?«
»Klar.«
Wenn sie die Vorhänge in der Küche und im Wohnzimmer offen ließen, hätten sie so viel Flutlicht, wie sie brauchten. Jake würde Manchester United sein, wahlweise Rooney oder Ronaldo, während Will zu Cambridge United verdammt war. Gelinde gesagt, ein ungleiches Match.
Als Will in die Diele trat, war Lorraine fast unten an der Treppe angekommen.
»Gehst du schon?«, fragte sie.
»Ich muss.«
»Kommst du spät nach Hause?«
»Nicht später als sonst.«
Sie kam in seine Arme, und als er den Kopf zu ihr beugte, küsste sie ihn leicht auf die Lippen und trat zurück. »Später, okay?«
Will lachte. »Kann ich dich beim Wort nehmen?«
»Träum weiter!«
Immer noch lachend zog er seinen Mantel vom Haken und trat durch die Tür.
Wie so oft war Helen vor ihm da, lehnte sich auf dem Parkplatz des Reviers an das Dach ihres blauen VW und rauchte eine letzte Zigarette, bevor sie das Gebäude betrat.
In den vergangenen paar Jahren hatte sie es mit Pflaster, Hypnose, Nikotinkaugummis, sogar Akupunktur versucht, aber sie hatte es nie geschafft, länger als drei Monate aufzuhören: ein besonders scheußlicher Fall, wieder eine Reihe von Tagen, an denen sie in aller Frühe aufstehen musste, obwohl sie spät, sehr spät ins Bett gekommen war, und sie war abgesprungen und rückfällig geworden.
Sie richtete sich auf, als Will näher kam, und blinzelte ein wenig in dem Licht, das überraschend hell für diese Tageszeit, diese Jahreszeit war. Helen trug schwarze Hosen und rote Stiefeletten sowie einen grauen Pullover unter einem blauen Wollmantel. Ihr frisch aufgehelltes Haar hatte sie zurückgebunden. Will dachte nicht zum ersten Mal, was für eine attraktive Frau sie doch war, und fragte sich, warum die Männer– wenn sie Männer bevorzugte, was so zu sein schien– nicht vor ihrer Tür Schlange standen.
Aber vielleicht taten sie das.
Von einer bitteren und etwas bizarren Beziehung abgesehen, hatte Helen ihm nie irgendetwas über die Wechselfälle ihres Privatlebens anvertraut– und damals auch nur, weil sie im Krankenhaus gelegen hatte und sehr deprimiert gewesen war.
»Hallo«, sagte sie jetzt fröhlich.
»Hallo.«
»Alles in Ordnung mit den Kindern?«
»Prima.«
»Und mit Lorraine?«
»Auch.«
Helen grinste. »Du bist wirklich ein Glückspilz, was?«
»Ach ja?«
»Schöne Frau, wunderbare Kinder, höhere Aufklärungsrate als alle anderen.«
Will runzelte die Stirn. »Läuft das auf irgendwas hinaus? Oder ist es nur dein stinknormales Sticheln am Montagmorgen?«
Helen neigte den Kopf zur Seite. »Es läuft auf was hinaus.«
»Wenn es nämlich um deine Beförderung geht, ich habe dir doch gesagt, dass ich alles unterstütze…«
»Es geht nicht um die Beförderung, so überfällig sie auch ist.«
»Worum dann?«
»Mitchell Roberts.«
»Was ist mit ihm?«
»Er ist entlassen worden.«
»Wann?«
»Ende letzter Woche.«
»Mein Gott!«
»Gerichtliche Verfügung, ihn unter Aufsicht zu stellen, aber…« Helen zuckte die Achseln.
»Mein Gott!«, sagte Will noch einmal. »So eine Scheiße!«
Helen drückte ihre Zigarette unter der Hacke aus und folgte ihm zwischen den Autos hindurch zum Eingang des Gebäudes.
3
Es war vor drei Jahren und einigen Monaten im Hochsommer gewesen. Ein norwegischer Lastwagenfahrer, der eine Ladung Holzspäne beförderte, war über einen geraden Abschnitt der A10 nach Süden gefahren und musste einer kleinen Gestalt ausweichen, die ziellos am Straßenrand herumstolperte. Der Fahrer hatte angehalten, gewartet und unsicher in den Rückspiegel geblickt– ein Ausländer in einem fremden Land, der sich auf der Fahrt vom Hafen in Immingham schon verspätet hatte und auf keinen Fall in irgendetwas hineingezogen werden wollte.
Während er noch zögerte, fiel die Gestalt– ein Mädchen, er war sich fast sicher– einfach um und blieb bewegungslos auf dem Grünstreifen liegen. Er fluchte leise vor sich hin, stellte den Motor ab und kletterte aus dem Führerhaus.
Ein Bein lag ausgestreckt zum Straßenbelag hin da, das andere war angewinkelt; ihre Fußsohlen waren rissig und blutig, die Schnitte mit Kies und Erde verkrustet. Sie trug eine übergroße Öljacke, sonst nichts. Die dunkelgrüne Jacke stand offen und hatte Ölflecken. Das Mädchen war kaum in der Pubertät, die Hüftknochen stachen scharf unter der dünnen Haut hervor, ein paar Härchen wuchsen dunkel zwischen den Beinen. Die Brüste, fast noch wie die eines Jungen, hoben und senkten sich leicht über dem Umriss der Rippen. Die Augen waren geschlossen.
Ohne sie zu bewegen, bedeckte der Fahrer ihren Körper so gut er konnte, dann rannte er zum Lastwagen und holte sein Handy.
Der erste Polizeiwagen aus Ely war in sieben Minuten da, der Krankenwagen in zehn; Will, der an einer Sitzung im Polizeihauptquartier in Huntingdon teilgenommen hatte, traf ein, als die Sanitäter das Mädchen auf eine Trage legten. Sie war viel zu verschreckt, um mit jemandem zu sprechen oder auch nur ihren Namen zu nennen. Als sich Will vorsichtig zu ihr hinunterbeugte und ermutigend lächelte, zuckte sie zusammen.
Es dauerte mehrere Stunden, bis sie ihren vollen Namen herausbekamen: Martina Ellis Jones. Sie lebte mit ihrer Mutter und drei Geschwistern etwa eine Meile von Littleport entfernt auf einem inoffiziellen Stellplatz für Zigeuner und Landfahrer, einem wenig ansprechenden Stückchen Erde zwischen dem Old Croft River und Mow Fen.
Als Will später an jenem Tag über die schmale Straße fuhr– kaum mehr als ein Weg–, hing die Sonne tief am Himmel, dunkelrot und von Wolken zerschnitten.
Vier Wohnwagen waren wie zum Schutz gegen feindliche Elemente und den durchdringenden Wind mehr oder weniger kreisförmig angeordnet. Fast erloschen schwelte ein Feuer an einer Stelle etwa in der Mitte, Spielzeug und diverse Fahrräder lagen verstreut herum. Direkt außerhalb des Kreises standen zwei Autos; ein drittes ohne Räder war etwas weiter hinten auf dem Weg auf Ziegelsteinen aufgebockt.
Als Will an die Tür des ersten Wohnwagens klopfte, hörte er das tiefkehlige Knurren eines Hundes, der zu bellen begann, als er noch einmal klopfte. Eine Stimme im Inneren schrie den Hund an aufzuhören, dann wurde offenbar etwas durch die Luft geschleudert, und ein Jaulen ertönte, bevor wieder Stille einkehrte. Niemand kam an die Tür.
Will wurde klar, dass er sich zu den feindlichen Elementen zählen musste.
Als er schließlich beim dritten Wohnwagen ankam, war seine Ungeduld nicht mehr zu verkennen: Er trat mit dem Fuß an die Tür und stieß eine scharfe Warnung aus, die Polizei nicht bei ihren Ermittlungen zu behindern. Dazu den Namen des Mädchens. Noch ein Hund fing zu bellen an, anders als der erste. Eine andere Stimme befahl ihm, ruhig zu sein, drohte dem Tier Gott weiß welche Strafe an, und das Bellen hörte auf.
Langsam öffnete sich die Tür.
Der Mann, der dort stand, musste sich seiner Größe wegen ein wenig in der Türöffnung ducken; er hatte eine silbergraue Haarmähne, die auf seinen Schultern auflag, und seine Nase war nicht nur einmal gebrochen. Er trug einen zerlumpten Pullover über einem kragenlosen Hemd und eine schwarze Hose mit einem ausgefransten Seil als Gürtel; in der linken Hand hielt er einen lackierten Spazierstock, auf den er sich beim Stehen stützte. Einen Moment lang erblickte Will den Hund zwischen seinen Beinen, dann war er verschwunden.
»Martina Jones«, sagte Will.
»Was ist mit ihr?« Die Stimme war rau und krächzend. Will hätte den Mann auf sechzig oder älter geschätzt, wäre da nicht das Leuchten in seinen Augen gewesen.
»Sie lebt hier?«
»Was geht Sie das an?«
»Lebt sie hier?«
»Jawohl«, sagte der Mann. »Wenn sie Lust hat.«
»Könnte ich vielleicht reinkommen?«, fragte Will.
Der Mann rührte sich nicht vom Fleck.
Um sie herum rührte sich jetzt allerlei: Die Stimmen von Erwachsenen und auch von Kindern waren zu hören; die Bewohner kamen heraus, wollten wissen, was los war.
»Was«, sagte der Mann, »hat Martina jetzt schon wieder angestellt?«
»Schon wieder?«
Der Mann sah ihn unbeeindruckt an.
»Was soll das heißen, schon wieder?«, fragte Will.
»Tut nichts zur Sache.«
»Sie sagen damit…«
»Ich weiß, was ich damit sage.« Er klopfte mit dem Stock auf den Boden. »Wo ist das Mädchen?«
»Im Krankenhaus. In Huntingdon.«
»Also ist es was Ernstes?«
»Ziemlich ernst.«
Der Mann fluchte und stieß den Stock heftig gegen die Seite des Wohnwagens, was ein kleines Kind im Inneren zum Weinen brachte. »Was ist passiert?«, fragte er.
»Sie ist an der A10 entlanggelaufen.«
»In Gottes Namen«, sagte der Mann und schlug seinen Stock noch einmal gegen den Wohnwagen, »habe ich sie nicht immer wieder davor gewarnt?«
»Wovor gewarnt?«
»Vor dem Weglaufen.«
»Ist Martinas Mutter hier?«, sagte Will.
»Das ist doch egal.«
»Wenn sie hier ist…«
»Sie sprechen mit mir, das muss genügen.«
»Sind Sie Martinas Vater?«
Er lachte. »Seh ich etwa so aus?«
Will hob beide Schultern. »Ist er denn hier? Der Vater?«
»Wenn er hier wäre, würde ich ihm mit diesem Stock den Kopf abschlagen und ihn an die verfluchten Krähen verfüttern.«
Eine jüngere Frau erschien hinter ihm in der Türöffnung, ein Baby mit verschmiertem Mund an der nackten Brust.
»Was ist los?«, fragte sie. »Geht es um Martina? Hat er Martina gesagt?«
»Geh wieder rein und zieh dir was an, verdammt.«
»Jemand muss ins Krankenhaus mitkommen«, sagte Will. »Sie und Martinas Mutter. Es gilt einige Fragen zu beantworten. Wie es dazu gekommen ist, dass man sie dort gefunden hat. Ein paar andere Sachen.«
Er sagte nichts über Wunden auf der Schulter des Mädchens, die vermutlich von Bissen herrührten, den Striemen auf ihrem Gesäß, dem dünnen Rinnsal aus getrocknetem Blut auf der Innenseite ihres Oberschenkels. Das konnte warten.
Der Name des silberhaarigen Mannes war Samuel Llewelyn Mason Jones. Er war Martinas Großvater und der Patriarch eines lockeren Verbundes von Schwestern, Brüdern, Vettern, Kusinen und Lebensgefährten, die an der Ostküste des Landes mehr oder weniger nach Belieben herumreisten. Cleethorpes, Hunstanton, Wisbech, Market Rasen, Lowestoft, Colchester, bis hinunter nach Canvey Island.
Martinas Mutter, Gloria, hatte Martina bekommen, als sie gerade sechzehn war; seither hatte sie noch drei weitere Kinder geboren, zwei Jungen und ein Mädchen.
»Eine wilde Bande, alle zusammen«, sagte Jones. »Ich bin’s, der sie unter Kontrolle halten muss.«
Will dachte an den rohen Striemen auf dem Gesäß des Mädchens und an das Seil um die Taille des Großvaters, an andere Dinge, die passiert waren oder auch nicht, Dinge, die der alte Mann getan hatte oder auch nicht.
Martina, so schien es, rannte immerzu weg, eine Gewohnheit, ein Zwang: manchmal nicht weiter als bis zu einem nahen Feldrand, wo sie sich versteckte; manchmal legte sie sich in ein altes Bauernhaus, in einen Traktoranhänger, in ein leeres Ölfass, das auf die Seite gerollt war. Meistens, aber nicht immer, kam sie von allein zurück. Normalerweise am selben Tag. Diesmal war sie seit dem späten Nachmittag des Vortags verschwunden gewesen.
»Sie haben sie nicht als vermisst gemeldet?«, fragte Will.
Jones sah ihn an, als wäre Will ein Narr.
»Haben Sie sie gesucht?«
»Natürlich. Wir alle. Keine Spur von ihr.«
»Und sie ist über Nacht weggeblieben?«
Jones sah ihn ungerührt an. »Sie war irgendwo.«
»Wissen Sie, wo das gewesen sein könnte?«
»Fragen Sie sie doch.«
Aber Martina redete nicht, nicht mit ihrer Mutter oder ihrem Großvater, nicht mit dem Arzt oder den Krankenschwestern, schon gar nicht mit Will. Auch nicht mit Helen, als diese eintraf. Klaglos lag sie da und presste die Augen fest zusammen, als man sie gründlich untersuchte und Abstriche von verschiedenen Teilen ihres Körpers genommen wurden.
Sie war keine Jungfrau mehr. Vor kurzer Zeit hatte sie Geschlechtsverkehr gehabt, und abgesehen von einigen leichten Abschürfungen, die vermutlich auf die Tatsache zurückzuführen waren, dass sie klein war, gab es keinerlei Hinweise, dass es gegen ihren Willen geschehen war. Auf der Rückseite ihrer Beine und auf ihrer Brust gab es schwache Spuren von Sperma und auch Speichel.
Als der Großvater davon unterrichtet wurde, zeigte er sich kaum überrascht, sondern grunzte und sah zur Mutter hinüber. »Der Apfel«, sagte er, »fällt nicht weit vom Stamm.«
Will vernahm ihn weiter, und Helen sprach mit Gloria und dann noch einmal– ergebnislos– mit Martina. Weitere Mitglieder der Familie wurden befragt, während Beamte den Wohnwagen gründlich durchsuchten. Wie ein Fliegenschwarm im Hochsommer machten sich Sozialarbeiter über die anderen Kinder her.
Erst am dritten Nachmittag, als Helen schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte, dass Martina etwas sagen würde, erwähnte das Mädchen Mitchell Roberts’ Namen. Zuerst sprach sie nur von Mitchell.
»Sagen Sie Mitchell, dass es mir gut geht«, sagte sie. »Sonst macht er sich nämlich Sorgen.«
4
Mitchell Roberts lebte und arbeitete bei Rack Fen: Er hatte dort eine hauptsächlich aus Betonstein und Wellblech errichtete kleine Tankstelle mit Werkstatt und einer ebenerdigen Wohnung im hinteren Teil. Sie war weniger als eine Meile vom Lager der Familie Jones entfernt, genauso weit weg war die Stelle, wo Martina gefunden worden war.
In einer Ecke der Werkstatt unterhielt Roberts ein kleines Lager mit Vorräten für Landwirte, die kamen, um Diesel zu tanken oder einen kaputten Reifen zu ersetzen: Tierfutter und Dünger und verzinkte Futterschaufeln. Hinter der Kasse standen auch Tüten mit H-Milch und Zigaretten zum Verkauf, Schachteln mit Frühstücksflocken und Schokoladenriegel, die ihr Verfallsdatum lange überschritten hatten, außerdem Getränkedosen, Pepsi und 7-Up, lauwarm, weil der Kühlschrank ständig den Geist aufgab.
Will hatte Roberts per Computer überprüfen lassen, bevor er und Helen aufbrachen. Dieser erste Versuch hatte nicht viel erbracht: keine polizeiliche Akte, keine Vorstrafen. Anscheinend hatte er das Geschäft drei Jahre zuvor übernommen, nachdem es fast genauso lange leer gestanden hatte. Es hieß, er kenne sich mit Traktoren bestens aus und man könne sich in einem Notfall auf ihn verlassen.
In einem Teil des Landes, wo das Reden um des Redens willen nicht sonderlich hoch im Kurs stand, hielt man Roberts für recht gesellig; bereitwillig unterbrach er seine Arbeit, um seine Meinung zum Besten zu geben: zum Wetter, wurde immer schlechter, zum Wasserpegel, steigend, und zu der Tatsache, dass der Benzinpreis in ungeahnte Höhen schoss. Hatte der Einmarsch in den Irak das nicht eigentlich regeln sollen?
Was für ein Leben er führte, sobald das Licht ausgeschaltet und die Treibstoffpumpen abgeschlossen waren, wusste man weder noch kümmerte man sich darum. Bis jetzt.
Wills Jackett lag auf dem Rücksitz, und sein Hemd klebte am Rücken; neben ihm hatte Helen das Fenster heruntergelassen und hielt die Finger in die Luft. Das Thermometer im Auto zeigte sechsundzwanzig Grad an.
Die Öljacke, die Martina Jones getragen hatte, lag doppelt in Plastik eingeschlagen im Kofferraum.
Will lenkte den Wagen an den Straßenrand und brachte ihn zum Stehen. Eine einsame Krähe hüpfte ein Stück weit weg und fuhr dann damit fort, auf dem Boden herumzuhacken.
»Oh Gott!«, sagte Helen, als sie die Wagentür schloss und sich umsah. »Kannst du dir vorstellen, wie das sein muss? So weit draußen zu leben?«
Will folgte ihrem Blick über die flache, fast kahle Landschaft zu der kleinen Erhöhung im Westen, die ein optimistischer Kartograph Croft Hills genannt hatte.
»Das muss ich mir nicht vorstellen«, sagte er.
Helen schüttelte den Kopf. »Im Vergleich zu hier lebst du in einer Metropole.«
Der Mann, der aus dem Gebäude trat und ihnen entgegenkam, war mittelgroß, hatte hellblondes Haar und trug ein kariertes Hemd unter einer Latzhose, die mehr als eine Wäsche ausgelassen hatte. Will hätte ihn auf Mitte bis Ende vierzig geschätzt, wenn ihm nicht bereits bekannt gewesen wäre, dass Roberts zweiundfünfzig war.
Roberts sah von Will zu Helen und zur Sicherheit noch einmal zurück. »Sie müssen sich verfahren haben«, sagte er.
»Glauben Sie?«
»Ich kenn einfach jeden hier in der Gegend und ich hab Sie noch nie gesehen. Also wenn Sie nicht jemand hier draußen besuchen wolln oder ’n dringendes Bedürfnis haben, das Schwemmland zu sehn, würde ich sagen, ja, Sie haben sich verfahren.«
»Denken Sie noch mal darüber nach«, sagte Will.
Roberts warf einen Blick über die Schulter auf nichts im Besonderen. »Dann sind Sie von der Polizei«, sagte er.
Will hielt ihm seinen Polizeiausweis hin. »Mitchell Roberts?«, sagte er.
Roberts nickte. »Dem Finanzamt und ’n paar anderen einschlägigen Institutionen zufolge, ja. Die meisten Leute nennen mich Mitch.«
»Sie hat sie Mitchell genannt«, sagte Helen.
Roberts blinzelte. »Sie?«
»Sagen Sie Mitchell, dass er sich keine Sorgen machen soll. Das hat sie gesagt.«
Roberts trat einen halben Schritt zurück und legte die Hand auf die Hüfte.
»Haben Sie sich am Bein verletzt?«, fragte Will.
»Vor ’ner Weile ist ’n Traktorchassis draufgefallen. An manchen Tagen tut es mehr weh als an anderen.«
»Wenn Sie nervös sind, vielleicht?«, schlug Will vor.
»Bin ich denn nervös?«
»Das müssen Sie mir sagen.«
»Ich…« Er lächelte. »Ich weiß gar nicht, worum’s geht. Irgendeine Frau sagt, ich soll mir keine Sorgen machen.«
»Keine Frau«, sagte Helen. »Nicht direkt.«
»Sie sagten doch…«
»Eher ein Mädchen.«
»Ich kenne kein…«
»Martina.«
»Wer?«
»Martina Jones.«
»Nee, tut mir leid, ich…« Roberts hob eine Hand und schüttelte den Kopf.
Will ließ das Schloss am Kofferraum aufschnappen, nahm die Jacke in ihrer Plastikverpackung heraus und legte sie über den Arm. Er trat auf Roberts zu und hielt die Jacke hoch.
»Oh«, sagte Roberts, und Erleichterung breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Gott sei Dank. Ich hab schon gedacht, die werd ich nie wiedersehen.«
»Gehört sie Ihnen?«
»Ja, das is’ meine. Die würd ich überall erkennen, eingewickelt oder nicht.«
»Sind Sie sicher?«
»So sicher, wie ich hier stehe.« Er lächelte. »Ich erkenn jeden verdammten Fleck da drauf.«
»Würden Sie uns erzählen, wie sie Ihnen abhandengekommen ist?«, fragte Will.
»Abhandengekommen? Na, die Kleine hat sie mir geklaut, so war das.«
In Wills Schläfe begann ein Nerv zu zucken. »Welche Kleine denn?«
Roberts sah ihn an. »Die, von der Sie mir erzählt haben, schätze ich. Wie hieß sie noch mal?«
»Sie wissen es nicht mehr?«
»Nein, ich weiß es nicht mehr.«
»Martina«, sagte Will ruhig. »Martina Ellis Jones.«
Roberts scharrte mit der Zehenspitze in der Erde. »Ich hab ihren Namen nicht gekannt.«
»Aber Sie haben ihr Ihre Jacke gegeben.«
»Ganz bestimmt nicht. Sie hat sie geklaut, das hab ich doch schon gesagt.«
»Wann war das?«
Roberts dachte darüber nach. »Muss inzwischen drei, nein, vier Tage her sein.«
Will und Helen tauschten einen kurzen Blick aus.
»Wie wär’s denn, wenn Sie uns erzählen, wie Martina zu Ihrer Jacke gekommen ist?«, sagte Helen.
»Wollen Sie reinkommen?«, fragte Roberts und schlurfte ein wenig zur Seite. »Raus aus dieser Hitze. Ich hab Brause da oder ich kann Tee machen.«
Weder Will noch Helen rührten sich von der Stelle.
Roberts räusperte sich. »Sie sind immer mal vorbeigekommen, sie und ihre Brüder«, sagte er. »Manchmal noch ’n anderes Mädchen. Die sind über die Felder gelaufen.« Er zeigte auf eine schmale Lücke in der niedrigen Hecke, wo der Anfang eines Pfads sein mochte. »Zigeuner, fahrendes Volk, wie immer Sie die nennen wollen.« Er spuckte zu Boden. »Manchmal hatten sie Geld. Haben sie ihrer Mutter wahrscheinlich aus der Geldbörse geklaut. Dann haben sie sich ’ne Pepsi oder so gekauft. Hab einen von den Jungs mal erwischt, wie er sich einfach so zwei Marsriegel nehmen wollte, und hab ihm ’nen Tritt in den Hintern gegeben. Hab sie alle weggejagt. Hab ihnen gesagt, wenn einer von denen das noch mal macht, brauchen sie nicht mehr wiederzukommen.«
»Und?«, fragte Will.
»Was?«
»Sind sie wiedergekommen?«
»Nach ’ner Weile.«
»Ist Martina jemals allein hierhergekommen?«, fragte Helen.
Roberts schluckte und wischte sich mit der Hand über den Mund. »Hin und wieder.« Angesichts der Hitze war es keine Überraschung, dass ihm der Schweiß in Strömen übers Gesicht lief.
»Zum Beispiel an dem Tag, an dem sie Ihre Jacke mitgenommen hat?«
»Ja. Zum Beispiel.«
»Erzählen Sie uns, was an diesem Tag passiert ist«, sagte Will.
Roberts blinzelte, weil ihm Schweiß in die Augen gelaufen war. »Gibt nix zu erzählen. Ich hab so ziemlich den ganzen Nachmittag an ’nem Anhänger gearbeitet und bin dann ins Haus, um abzuwaschen, und da war sie.«
»Im Haus?«
»Nein. Sie saß da drinnen auf der Theke, frech wie Oskar, und aß ’n Twix. Ich weiß noch, was ich zu ihr gesagt hab, nämlich: Ich hoffe nur, dass du das bezahlst.«
»Und hat sie?«
»Oh ja.«
»Sie hatte Geld?«
»Wie hätte sie sonst bezahlen sollen?«
Will sah ihn an. »Sie haben sie dann ins Haus mitgenommen?«
»Warum hätte ich das tun sollen?«
»Vielleicht, um die Jacke zu holen?«
Roberts schüttelte den Kopf. »Die Jacke hängt immer an ’nem Haken direkt da drin.« Er zeigte in die Werkstatt, deren Tür offen stand. »Ich kann’s Ihnen zeigen, wenn Sie wollen.«
»Später«, sagte Will.
»Warum haben Sie ihr die Jacke gegeben?«, fragte Helen.
»Ich hab ihr das verdammte Ding nicht gegeben. Hab ich doch schon gesagt. Sie hat sie genommen, als ich gerade nicht hingesehn hab, und is’ damit weggerannt. So war das.«
»Und warum hat sie das getan?«
»Woher soll ich das wissen? Die sehen was, das sie nehmen können, und weg is’ es. Sie kennen doch deren Sorte.«
»Deren Sorte?«
»Sie wissen, was ich meine.«
»Vor vier Tagen war es doch ziemlich heiß?«, sagte Will eher beiläufig.
»Würd ich sagen.«
»So heiß wie heute?«
»Ungefähr.«
»Trotzdem hat sie Ihre Jacke genommen, eine schwere Jacke für Erwachsene. War das nicht sinnlos?«
»Wie gesagt, wenn was nicht festgenagelt is’…«
»Hören Sie«, sagte Helen und fixierte ihn mit ihrem Blick, »lassen Sie sich was Besseres einfallen.«
»Ich versteh nicht, was Sie meinen.«
»Sie verstehen nicht, was ich meine? Als das Mädchen gefunden wurde, lief sie kopflos und völlig verängstigt durch die Gegend, und außer Ihrer Jacke trug sie nichts. Sie war nackt. Splitterfasernackt.«
»Davon weiß ich nix.«
»Sie glauben nicht, dass sie Ihre Jacke deshalb genommen hat? Um sich zu bedecken? Nach dem, was passiert war?«
Roberts umklammerte sein Bein noch fester.
»Was haben Sie mit ihren Kleidern gemacht?«, fragte Will. »Haben Sie sie verbrannt? Irgendwo ein Feuer gemacht? Oder sind sie immer noch im Haus?«
»Hören Sie«, sagte Roberts, »ich weiß gar nicht, wieso…«
»Souvenirs«, sagte Helen. »Nennen Sie das nicht so? Das mögen Sie doch? Ihre Sorte?«
In Roberts’ Augen erwachte plötzlich etwas zum Leben. »Fick dich!«, sagte er. »Alte Schlampe! Fick dich, fick dich, fick dich!«
»Mitchell Roberts«, sagte Will. »Ich verhafte Sie…«
Helen hatte recht gehabt. Ganz hinten in der Truhe, in der Roberts seine eigenen Kleider aufbewahrte, fanden sie Martinas Baumwollschlüpfer– an einer Seite eingerissen und voller Flecken. Wie nicht anders zu erwarten, machte Martina selbst völlig widersprüchliche Angaben, die von einer Minute zur anderen variierten. Mitchell hatte sie überhaupt nicht angerührt, er hatte sie gezwungen, Sachen zu tun, er hatte gedroht, sie wegen Diebstahls anzuzeigen, wenn sie nicht mitmachte. Mitchell liebte sie, sie liebte ihn, wirklich. Sie hasste ihn, weil er ihr wehgetan hatte. Es war überhaupt nicht Mitchell gewesen, der diese Sachen mit ihr gemacht hatte, sondern jemand in einem roten Auto, der sie mitgenommen hatte. Es war ihr Großvater gewesen. Wirklich, der war es.
Sie hatten ihn natürlich unter die Lupe genommen, den Großvater. Fragen, Beweismaterial, Proben von Gewebe und Körperflüssigkeiten, DNA.Für den blutigen Striemen auf dem Gesäß seiner Enkelin nahm Samuel Jones bereitwillig die Schuld auf sich. Strafe, das brauchte sie. Davon hatte sie zu wenig bekommen, und das zu spät. Das war die Wahrheit. Jones starrte Will mit allzu klaren Augen an, als forderte er ihn heraus, ihm zu widersprechen, ihn zu fragen, warum sie lieber in einem Traktoranhänger auf den Strohschnipseln geschlafen hatte als in ihrem eigenen Bett, warum sie an Entwässerungsgräben entlang über offene Felder zu Mitchell Roberts’ Haus gewandert war, und das nicht einmal, sondern mehrmals.
Am Ende gab es nichts, das darauf hindeutete, dass Jones seine Enkelin sexuell missbraucht hatte; wie Will meinte, hatte er sie lediglich in die Arme von jemandem getrieben, der das für ihn erledigt hatte.
»Du kannst Jones nicht die Schuld geben«, sagte Helen. »Nicht für etwas, das jemand anders getan hat.«
»Kann ich nicht?«, sagte Will.
Die Analyse der Bisswunden und der Spuren von Sperma und Speichel auf Martinas Körper versperrte Mitchell Roberts’ Verteidigung jeden aussichtsreichen Weg. Allerdings gab es Bedenken, Martina in den Zeugenstand zu rufen, weil unklar war, wie sie sich verhalten würde. Deshalb akzeptierte die Staatsanwaltschaft zwei Schuldbekenntnisse wegen sexueller Übergriffe und eines wegen rechtswidrigen Geschlechtsverkehrs mit einem Mädchen unter dreizehn, und Roberts wurde zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt.
Seither hatte er nach Wills Schätzung etwas mehr als die Hälfte verbüßt. Auf keinen Fall genug. Will wäre glücklich gewesen, hätte man ihn einsperrt und dann den Schlüssel weggeworfen.
5
Ruth hatte nicht geglaubt, dass sie je wieder heiraten würde, nicht nach der Scheidung. Einer Scheidung, die Simon ihr zuerst ausreden wollte, weil er unbedingt beweisen musste, dass er verstand, was sie durchmachte, was sie dachte. Schließlich war es eine Zeit, in der sie zusammenhalten, sich gegenseitig helfen und unterstützen mussten. Weil er keine nahen Angehörigen hatte– seine Eltern waren beide relativ jung gestorben und sein einziger Bruder lebte seit langer Zeit in Südafrika– und zu seinen Kollegen lediglich oberflächliche Beziehungen pflegte, lief Simon ohne Ruth Gefahr, ins Schwimmen zu geraten. Seine unkomplizierte Fassade drohte in sich zusammenzufallen.
Aber Ruth hatte sich selbst überrascht– und Simon ganz sicher auch–, indem sie sich nicht beirren ließ, und sobald ihm klar wurde, dass sie ihren Entschluss nicht rückgängig machen würde, war er rücksichtsvoller gewesen, als sie erwarten konnte, sogar versöhnlich, das musste sie ihm lassen. Und als es dann so weit war, als sie ihr vorläufiges Scheidungsurteil in der Hand hielt, fühlte es sich an, als hätte man ihr unter Narkose einen Zahn gezogen. Schlimmer war es nicht gewesen. Man ging hinein und nur Minuten später, so schien es zumindest, kam man wieder heraus. Zugegeben, die Zunge konnte zunächst nicht anders, als immer wieder zu der Stelle zu wandern, wo jahrelang dieser eine Zahn gewesen war, und nach einem Schmerz zu suchen, der nicht wirklich da war.
Sie hatte als Erstes ihren Eltern von Andrew erzählt, war nach Cumbria gefahren, um ein Wochenende mit ihnen zu verbringen. Ihr Vater war im Wintergarten damit beschäftigt gewesen, etwas umzutopfen, und hatte kaum aufgesehen, lediglich seine Zustimmung durch ein Nicken ausgedrückt, als hätte er diese Entwicklung schon seit Langem erwartet; ihre Mutter hatte sich in ihrem Sessel vorgebeugt und Ruths Hände umschlossen: »Wenn du dir sicher bist, wirklich sicher…«
Die Freunde bei der Arbeit, die ihr so nahestanden, dass sie es ihnen erzählte, waren auch nicht überraschter gewesen als ihr Vater; sie meinten, es sei genau das, was sie brauche, jemand, der ihr helfen würde, ihr Leben neu in den Blick zu nehmen. Selbst die wenigen Freunde, die sie und Simon gemeinsam hatten, sagten überwiegend, sie treffe die richtige Entscheidung, als sie die Neuigkeit hörten.
Als sie am Ende den Mut aufbrachte, auch Simon zu erzählen, dass sie jemand anderen kennengelernt hatte, war sogar er vernünftiger gewesen, als sie eigentlich erwarten durfte. Nicht unmittelbar natürlich, nicht sofort, aber sobald er die anfängliche Überraschung überwunden hatte.
Sie hatten sich in einem Café getroffen, nicht weit vom Büro der Stadtverwaltung entfernt, wo Simon arbeitete. Ruth hatte ihn erst zwei Tage zuvor angerufen: Sie würde nach London kommen, um ein paar Einkäufe zu machen, vielleicht könnten sie sich auf einen Kaffee oder so treffen? Sie hatte es so beiläufig klingen lassen wie möglich.
»Natürlich«, hatte er gesagt. »Passt es dir am Nachmittag? Sagen wir um drei? Viertel nach drei? Ich habe eigentlich einen Termin, aber den kann ich verschieben.«
Und als sie gefragt hatte, ob er sicher sei, weil sie seinen Tag nicht durcheinanderbringen wolle– in Wirklichkeit, weil sie kalte Füße bekommen hatte–, lachte er sie aus.
»Hör zu, Ruthie, ich hab immer Zeit für dich, das weißt du doch. Außerdem ist es lange her. Wenn ich dich nicht bald sehe, vergesse ich, wie du aussiehst.«
Ruthie: Wie sie es hasste, wenn er sie so nannte.
Auf den ersten Blick hatte Simon sich kaum verändert. Immer noch gepflegt in seinem leichten grauen Anzug. Aber er war dünn, bemerkte sie, dünner als früher, seine Wangenknochen traten stärker hervor, und er hatte Sorgenfalten um die Augen.
Wie alt war er jetzt? Zweiundvierzig? Dreiundvierzig? Als sie an diesem Morgen in den Spiegel geblickt hatte, hatte sie eine Frau gesehen, die bei günstigem Licht gerade noch für fünfundvierzig durchgehen konnte. Sie war achtunddreißig.
»Ich hab dich warten lassen. Tut mir leid«, sagte Simon.
Ruth lächelte kurz, um zu zeigen, dass alles in Ordnung war.
Sie hatte sich ein wenig unwohl gefühlt, als sie in dem lebhaften Café saß, umgeben von Leuten, die größtenteils jünger waren als sie selbst, dazu lässiger und modischer gekleidet. Männer und Frauen, die geschäftig ihre Laptops benutzten oder angeregte Unterhaltungen in mehreren Sprachen führten, deren Stimmen sich über das periodische Schrillen der Kaffeemaschine und den rhythmischen Ethnopop erhoben, der aus den Lautsprechern kam.
»Noch einen Kaffee?«
»Nein, danke. Ich möchte nichts.«
Er lächelte und ging zur Theke, von der er ein paar Minuten später mit einem kleinen Cappuccino zurückkehrte.
»Inzwischen am Nachmittag immer koffeinfrei, fürchte ich. Sonst bin ich zu aufgedreht und schmeiße Sachen durchs Büro.«
»Das bezweifle ich.«
»Du würdest dich wundern.«
»Meinst du?«, sagte Ruth.
Als sie erfahren hatten, was ihrer Tochter passiert war, war Simon natürlich wütend auf die Leute gewesen, denen er die Schuld gab, aber fast nie auf Ruth. Und später, als sie immer noch versuchten, sich mit dem Ereignis abzufinden, hatte er sich verkrochen und still in einer Ecke geweint, als wäre sein Schmerz etwas, das nicht geteilt werden konnte. Echt und unmittelbar und ganz allein seiner.
»Also«, sagte er und trank einen Schluck Kaffee, »worum geht es?«
»Um nichts Besonderes, wie schon gesagt. Ich bin nur hergekommen und…«
»Ruth, du lebst am Stadtrand von Ely, nicht am Ende der Welt. In den letzten achtzehn Monaten musst du ein halbes Dutzend Mal in London gewesen sein, wenn nicht öfter. Wenn du mich hättest sehen wollen, um ein bisschen zu reden und herauszufinden, wie es mir geht, wäre das überhaupt keine Schwierigkeit gewesen.«
»Simon…«
»Nein, das macht nichts. Ist in Ordnung. Du wolltest nicht, dass wir Freunde bleiben. Und ich habe das respektiert. Ich habe das verstanden. Eine klare Trennung. So viel leichter. Zumindest für dich.« Er schnaubte leise durch die Nase. »Wir gehen eben auf verschiedene Weise mit solchen Sachen um.«
Oh Gott, dachte Ruth. Sie rührte mit dem Löffel in ihrer leeren Tasse herum. »Ich habe jemanden kennengelernt«, sagte sie mit so leiser Stimme, dass Simon sich vorbeugen musste. Sein Gesichtsausdruck verriet, dass er sie nicht gehört oder verstanden hatte.
»Ich habe jemanden kennengelernt«, sagte sie noch einmal, dieses Mal zu laut, sodass die junge Frau, die neben ihnen saß, von ihrem Buch aufsah und lächelte.
Simon brauchte ein paar Sekunden, bevor er antworten konnte.
»Du meinst im Sinne von… Ja, natürlich meinst du das. Und ist es was Ernstes?«
»Ja.«
»Also… also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin überrascht, das ist alles. Ich habe gedacht, du wolltest mir vielleicht etwas über deine Familie mitteilen. Ich weiß ja, dass es deinem Vater nicht so gut geht. Ich habe gedacht, du würdest vielleicht nach Cumbria ziehen, um näher bei deinen Eltern zu sein.« Er schüttelte den Kopf. »Aber das habe ich nicht erwartet.«
»Nein.« Sie lachte verlegen. »Der Gedanke an junge Liebe ist im Zusammenhang mit mir ziemlich abwegig.«
»Das habe ich nicht gemeint.«
»Simon…«
»Ich dachte, du wolltest allein sein. Ich dachte, darum wäre es gegangen.« Sie bemerkte, dass seine Fingernägel fast bis auf das Nagelbett abgekaut waren.
»So war es auch«, sagte sie. »Das musst du mir glauben. Dass so etwas passiert, ist das Letzte, was ich erwartet hätte.«
»Fast.«
»Wie bitte?«
»Fast das Letzte. Nicht so unerwartet wie…« Ein Schatten huschte über seine Augen.
»Simon, es tut mir leid, ich…«
»Nein, nein. Herzlichen Glückwunsch. Wirklich. Ich meine es ehrlich.«
»Danke.«
»Wo hast du ihn eigentlich gefunden, deinen Märchenprinzen? Deinen Ritter in glänzender Rüstung?«
»Mach dich nicht lustig.«
»Mach ich nicht.«
»Vielleicht hätte ich es dir gar nicht erzählen sollen. Ich weiß auch nicht genau, warum ich es getan habe. Es schien einfach wichtig zu sein, das ist alles.«
»Ja, natürlich. Ich verstehe. Glaube ich wenigstens. Und es freut mich, dass du mich informieren wolltest. Ich freue mich auch für dich. Ganz ehrlich.« Er presste sich ein Lächeln ab, beugte sich über den Tisch und zielte einen unbeholfenen Kuss auf ihre Wange.
»Ich muss jetzt gehen«, sagte Ruth. Sie war nervös und fühlte sich unbehaglich, merkte, dass die junge Frau neben ihnen sie mit unverhohlener Neugier anstarrte, und wünschte, sie wäre nie gekommen.
Draußen standen sie für einen Augenblick Seite an Seite auf dem Bürgersteig. Seine Haut war merkwürdig blass, fand sie, als wäre er in letzter Zeit nicht viel an die frische Luft gekommen.
»Simon«, sagte sie, »geht es dir gut?«
»Mir? Ja, natürlich. Mit mir ist alles in Ordnung, was hast du denn gedacht?«
Und schon war er auf dem Weg, schlängelte sich durch den Verkehr, der sich in beiden Richtungen in einer langsamen unendlichen Reihe durch die Upper Street quälte.
Sie hatte Andrew durch eine Freundin kennengelernt. Catriona war eine fröhliche Fünfundfünfzigjährige, mit der sie samstag- und donnerstagnachmittags in der Buchhandlung von Oxfam arbeitete. Ruth war noch einmal an die Uni zurückgekehrt, um Informations- und Bibliotheksmanagement zu studieren, und arbeitete außerdem drei Tage die Woche in einem kleinen Kunstgewerbeladen in der Nähe der Kathedrale. Die ehrenamtliche Tätigkeit bei Oxfam half ihr, ihre Zeit vollends auszufüllen.
Catriona gelang es immer wieder, Ruth dazu zu überreden, mit ihr den neuesten ausländischen Film anzusehen oder sie in eine neue Ausstellung zu begleiten. Ruth hatte einmal verraten, dass sie früher selbst gemalt hatte, deshalb schrieb Catriona ihr ein größeres Wissen zu und bat Ruth ständig, ihr das Unerklärliche zu erklären. Sie beschwatzte Ruth sogar, mit ihr und ihrem Mann Lyle zu den Treffen des Ely Folk Clubs zu kommen, die gelegentlich im »Lamb« stattfanden, wo Lyle nach zu viel Bier den Refrain immer viel zu laut mitsang. Und dann waren da natürlich die Fahrten auf dem Great Ouse: Lyle war genauso stolz auf die Zugkraft des 80-PS-Dieselmotors seines erlesenen alten Boots wie auf die Spanten aus Eiche, die Planken aus Teak und die traditionellen Fender aus Kokosseil.
Sie hatten sich Ruths Geschichte angehört, alle beide, und gutherzig, wie sie waren, beschlossen sie, dass Ruth nicht still vor sich hin welken dürfe. Du musst ausgehen und Leute kennenlernen, neue Freunde finden, ein neues Leben beginnen.
Bei Einladungen zum Abendessen stellten Catriona und Lyle ihr Männer vor, die sie offensichtlich als geeignet ansahen und die aus dem einen oder anderen Grund ledig waren: ein Witwer, der seine Frau vor Kurzem an den Krebs verloren hatte, ein Wissenschaftler aus Cambridge, der nie geheiratet hatte und sich für die Geschichte der christlichen Liturgie interessierte, ein Musiker, der Volksmusik machte und sich besonders der Blechflöte angenommen hatte.
Und plötzlich war da Andrew. Andrew Lawson.
Er war Rektor einer örtlichen Grundschule, wirkte robust und verlässlich. An diesem ersten Abend zeichnete er sich durch außerordentliche Zurückhaltung aus, wurde nur ein einziges Mal richtig lebhaft, nämlich als er eine neue Förderstrategie beschrieb, bei der Fünft- und Sechstklässler den jüngeren Schülern aus der ersten und zweiten Klasse vorlasen.
»Ruth war früher Lehrerin«, hatte Catriona gesagt, um die Sache in Schwung zu bringen.
»Das ist lange her«, sagte Ruth.
Aber Andrews Interesse war geweckt. »Hier in Ely?«, fragte er.
»Nein. In London.«
»Oberschule?«
»Grundschule.«
»Trotzdem ein hartes Pflaster. Die meisten Kinder von hier fressen Ihnen aus der Hand, besonders wenn sie aus den Dörfern kommen.«
»Der Grund ist«, tönte Lyle, »dass sie nie gelernt haben, mit Messer und Gabel zu essen.«
Alle lachten und die Unterhaltung wandte sich anderen Themen zu.
Ruth war überrascht, als Andrew sie vier Tage später zu Hause anrief. »Catriona hat mir Ihre Nummer gegeben. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus.«
Zu ihrer großen Überraschung stellte sie fest, dass ihr das überhaupt nichts ausmachte.
Natürlich war er verheiratet gewesen. Die Ehe hatte zehn Jahre gehalten, fast so lange wie ihre eigene, war aber kinderlos geblieben.
Nicht lange, nachdem sie Simon geheiratet hatte, war Ruth mit Heather schwanger gewesen. Sie hatten eigentlich gar nicht darüber nachgedacht, es war einfach passiert. Damals war sie sechsundzwanzig.
Es war keine leichte Geburt gewesen und im Anschluss litt Ruth heftig unter einer postnatalen Depression. Eine Zeitlang hatte sie Heather regelrecht abgelehnt– ihre Schuldgefühle deswegen hatten nie aufgehört–, und wenn Simon nicht gewesen wäre, hätte alles in sich zusammenbrechen können.
Erst als Heather ein Kleinkind war, hatten sie und Ruth eine wirkliche Bindung entwickelt, obwohl Simon immer sehr wichtig für das Kind geblieben war und ihm möglicherweise näherstand, als das bei anderen Vätern üblich war.
Sie sprachen von einem zweiten Kind, aber Ruth hatte zu viel Angst und Simon war vorsichtig. »Wir sind jetzt glücklich, stimmt doch?«, sagte er. »Warum etwas ändern? Was, Ruthie? Warum ein Risiko eingehen?«
»Ich beneide dich«, sagte Andrew. Das war eine ganze Weile, nachdem sie sich kennengelernt hatten, als sie begannen, an eine Heirat zu denken. »Ich sollte es nicht sagen, sollte es nicht einmal denken, ich habe kein Recht dazu. Aber es ist so. Du und Simon. Was ihr mit Heather hattet.«
»Trotz allem, was dann passiert ist?«, fragte Ruth.
Andrew sah sie an und entdeckte den Kummer in ihren Augen. Er konnte nicht darauf hoffen, ihn jemals auszulöschen. »Ja. Trotz allem, was dann passiert ist.«
Nicht sehr lange nach der Hochzeit– Catriona trat triumphierend in einem pinkfarbenen Kostüm mit Orchideen im Haar auf, Lyle nahm mit rötlichem Gesicht recht unverhohlene Schlucke aus einem silbernen Flachmann– meinte Andrew, dass sie auch ein Kind haben sollten.
»Andrew, nein! Nein, das ist absurd. Es ist einfach nicht… Außerdem bin ich zu alt.«
»Nicht unbedingt.«
»Doch. Das weißt du.«
»Das werden wir feststellen.«
Beatrice wurde fast genau ein Jahr nach ihrer Hochzeit geboren, und obwohl Ruth inzwischen neununddreißig war, gab es keine Komplikationen und die Geburt war relativ leicht.
Als Simon es hörte– sie musste es ihm sagen, sie hatte darüber nachgedacht, es mit Andrew durchgesprochen und war zu dem Schluss gekommen, dass es nicht anders ging–, reagierte er großmütig: Er schickte eine Glückwunschkarte, eine Flasche Moët und diverse Babysachen wie gestrickte Schuhe und dergleichen aus dem Baby Gap in der Nähe seines Büros.
Ruth, die sich unbehaglich und merkwürdig verpflichtet fühlte, schickte ihm einen überschwänglichen Dankesbrief und Bilder von dem Baby, aber darauf antwortete Simon nicht.
Fünf Monate später erhielt sie einen Brief. Kurz und bündig:
Habe deinen Ratschlag befolgt– den Rat, den du mir vor langer Zeit gegeben hast. Habe hier verkauft und mich selbständig gemacht. Wünsch mir Glück. Wenn du je jemanden brauchst, der deine Steuererklärung überprüft…
Es gab keine Telefonnummer, keine Adresse.
Seither hatte Ruth nichts von ihm gehört.
Mit Beatrice gab es keine der Schwierigkeiten, die sie mit Heather erlebt hatte. Von dem Augenblick an, in dem ihr Mund die Brust fand und mit überraschender Kraft saugte, war das Stillen kein Problem, genauso wenig wie später das Abstillen und die Umstellung auf die Flasche. Beatrice nahm zu, sie wuchs, glücklich folgten ihre Augen Ruth durch den Raum.
Sie war ein wunderbares Baby, ein liebevolles Kind, und wenn Ruth daran dachte, wie es mit ihrer Erstgeborenen gewesen war, wurden ihre Schuldgefühle noch größer.
Natürlich verbarg sie ihre Gefühle vor Beatrice und überkompensierte sie durch Liebe und Zuwendung. So gut wie möglich verbarg sie sie auch vor Andrew, obwohl ihr das nicht immer gelang.
»Was ist das?«, fragte er eines Abends, als Beatrice fünf Jahre alt war, und hielt den Umschlag vorsichtig von sich weg, als könnte er sich daran verbrennen.
»Das weißt du.«
»Hm?«
»Du weißt, was das ist. Ganz genau.«
Wie ein griesgrämiger Zauberer drehte er den Umschlag zwischen Daumen und Finger um und schüttelte den Inhalt heraus. Die Ansichtskarte mit der grünen Landkarte von Cornwall flatterte auf den Tisch, an dem Ruth saß, und landete mit dem Bild nach unten.
Bald. Bis bald.
»Ich dachte…«, sagte er.
»Was hast du gedacht?«
»Ich habe nur gedacht, nach so langer Zeit…«
Ruth lachte, ein sarkastisches, humorloses Lachen. »Wie lange ist es denn her, Andrew? Weißt du das überhaupt?«
»Komm schon, Ruth, darum geht es doch gar nicht. Die Zeit, sie ist…«
»Natürlich geht es darum. Willst du wissen, wie viele Jahre? Wie viele Monate? Wie viele Tage?«
»Ruth, sieh mal…«
»Nein, sieh du mal. Sieh dir das an.« Sie schrie jetzt, war außer sich. »Diese verdammt blöde Karte mit den Kühen und Kathedralen und Fischerbooten und ihrer Schrift… sieh mal, das ist ihre Schrift hier, lies es, lies es einfach selbst.« Sie wedelte mit der Karte vor seinem Gesicht herum, stieß damit in seine Richtung, bis er ausweichen musste. »Bis bald, das steht da. Bis bald. Und du hast geglaubt, ich würde es vergessen. Vergessen. Wegen Beatrice, deinetwegen, wegen meines verdammt guten Lebens hast du geglaubt, es würde einfach zu einem– was?– einem schlechten Traum? Zu etwas, das jemand anderem passiert ist? Und du glaubst, wenn ich aufhöre, sie anzusehen, diese Karte, wenn ich sie nie aus dem Umschlag, nie aus der Schublade nehme, würde alles anders werden und ich würde schneller vergessen?«
Andrew stand da, getroffen von der Macht ihrer Wut, die Augen auf den Boden geheftet. Ruth wurde nie dermaßen wütend, fluchte fast nie.
»Hier.« Sie stieß die Karte wieder in seine Richtung. »Nimm sie. Nur zu, nimm sie schon. Zerreiß sie. Wenn du denkst, das macht einen Unterschied. Wenn du denkst, dass mich der Anblick dieser Karte an sie denken lässt. Mach schon. Reiß sie in kleine Stücke. Worauf wartest du?«
Sie streckte ihm die Karte ganz nah vors Gesicht, sodass er kaum eine andere Wahl hatte, als sie ihr aus der Hand zu nehmen.
»Nur zu«, sagte sie. »Zerreiß sie.«
Ohne sie anzusehen, ließ er die Karte durch die Finger gleiten und zu Boden fallen, dann drehte er sich um und ging weg. Ruth legte die Postkarte in die Schublade zurück, nahm sie von Zeit zu Zeit heraus und weder sie noch Andrew erwähnten den Vorfall je wieder.
Aber nach einem besonders anstrengenden Tag oder wenn sie ein Glas Wein mehr als üblich getrunken hatte, gab es trotzdem Gelegenheiten, bei denen sie ihren Kopf an seine Brust legte, weil sie über Heather reden und ihm erklären wollte, was sie fühlte. Andrew gereichte es zur Ehre, dass er dann einen Arm um sie legte und zuhörte und sie auf den Kopf küsste, als würde er verstehen.
Nur wenn er einen außergewöhnlich schwierigen Tag in der Schule hinter sich hatte– eine überlange Sitzung mit der Stadtverwaltung, eine Debatte über zusätzliche Mittel–, fühlte sie, wie er sich verspannte. Sie blieben stumm auf dem Sofa sitzen, fühlten sich unbehaglich und ihre Muskeln verkrampften sich, bis einer von ihnen etwas über die Uhrzeit murmelte und meinte, dass sie früh aufstehen müssten. Dann erhoben sie sich und erledigten die verschiedenen Aufgaben, machten das Licht aus, verschlossen die Türen, gingen ins Bad und dann ins Bett.
Aber Beatrice war ein Schatz, Beatrice war ein Engel, sie war gut in der Schule, sie war beliebt. Ruth liebte sie, bewunderte sie, war stolz auf sie und, ja, sie liebte Andrew auch. Natürlich liebte sie ihn.
Wie viel Glück sie trotz allem gehabt hatte, hielt sie sich vor, weil sie zwei schöne Töchter bekommen hatte und so zweimal gesegnet war. Und außerdem hatte sie gleich zwei freundliche und liebevolle Männer getroffen, die, jeder auf seine Weise, eine Stütze waren, und überall gab es Menschen, die keine Kinder oder keinen Mann oder keines von beidem hatten, für die das Glück aus irgendeinem Grund immer unerreichbar war.
Da sie all das wusste, hätte sie doch eigentlich glücklicher sein müssen?
6
Im Dezernat war Liam Noble seit neun Monaten für Erkenntnisse über gefährliche Täter und Sexualverbrecher zuständig. Er operierte innerhalb der MAPPA, einem Zusammenschluss verschiedener Behörden zum Schutz der Öffentlichkeit. Sein Schwerpunkt waren stark rückfallgefährdete Täter, die nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis verschiedene Grade der Überwachung benötigten.
Noble hatte früher in der Bewährungshilfe gearbeitet und davor beim Sozialamt, eine Karriere, die ihn zum idealen Mann für die vorliegende Aufgabe machte, wie seine Vorgesetzten betont hatten, als er ernannt wurde.
»Wenigstens wissen Sie, wie die Typen ticken«, hatte einer gesagt.
Worauf Noble beinahe geantwortet hätte: Die Typen ticken genauso wie Sie und ich. Natürlich wusste er, dass es Situationen gab, in denen das nicht wirklich zutraf. Und die Fähigkeit, sich teilweise in die Köpfe der Bewährungshelfer und Sozialarbeiter hineinzuversetzen, die ihm bei den Treffen der MAPPA gegenübersaßen, trug ebenso zur Verwirrung wie zur Aufhellung bei, wie er festgestellt hatte.
Als »kooperierend« war sein Umgang mit Kollegen in seiner letzten Beurteilung beschrieben worden, eher umgänglich als fordernd. Dahinter stand natürlich die unausgesprochene Empfehlung, dass von Fall zu Fall etwas klarere Direktiven angebracht wären.
Das wollte Noble gerade ausprobieren, als Will Grayson an seine Tür klopfte. Er hatte einen leitenden Sozialarbeiter am Apparat und das Gespräch darüber, ob es geboten sei, die Stiefkinder eines kürzlich entlassenen Straftäters in Pflege zu geben, war auf irritierende Weise im Kreis verlaufen.
»Will«, sagte er. »Kommen Sie herein. Setzen Sie sich. Ich bin hier fast fertig.«
Er schien erleichtert zu sein über die Unterbrechung. »Nein«, sagte er dann ins Telefon hinein, »ich denke, Sie sollten das Verfahren auf jeden Fall einleiten. Unbedingt. Tun Sie es noch heute. Es ist nicht gut, die Kinder einem Risiko auszusetzen.« Er hörte einen Augenblick zu, dann: »Ja. Ja, richtig. Sie informieren mich.«
Als er den Hörer ablegte, stieß Noble einen langen befriedigten Atemzug aus, bevor er sich an Will wandte. »Unnötig zu fragen, warum Sie hier sind.«
»Um mir die Zeit zu vertreiben?«
Noble lachte. »Mitchell Roberts, richtig?«
»Wann wollten Sie es mir erzählen?«
»Ich dachte, Sie würden es früh genug herausfinden.«
»Und wie lange wissen Sie es schon? Ein paar Monate?«
Noble schüttelte den Kopf. »Sechs Wochen.«
»Ich war der Meinung, die Strafvollzugsbehörde müsste die Entlassung drei Monate vorher ankündigen.«
»Nur bei Gefangenen der Stufe drei.«
»Und Roberts ist nicht Stufe drei? Er gehört nicht der höchsten Risikogruppe an?«
»Das Risiko ist nicht hoch genug.«
»Erzählen Sie das mal Martina Jones«, sagte Will. »Erzählen Sie das der nächsten Zwölfjährigen, die er in die Finger kriegt.«
Noble seufzte und rutschte ein Stück auf seinem Stuhl vor. »Es gibt keinen Hinweis, dass Roberts ein Serientäter ist, es gibt keine einschlägige Vorgeschichte. Das Geschehen war ein isolierter Vorfall.«
»Schwachsinn.«
»Wie bitte?«
»Bei Leuten wie Roberts gibt es ein Muster. Sie wissen das genauso gut wie ich.«
»Es gibt auch ein erstes Mal.«
»Und dafür halten Sie es? Haben Sie die Protokolle vom Prozess gelesen? Die Bilder gesehen? So etwas geschieht doch nicht aus heiterem Himmel. Es gibt nur einen einzigen Grund, aus dem wir nichts darüber wissen: Entweder war er clever oder er hatte verdammtes Glück oder beides.«
»Will, Will, wütend zu werden bringt doch nichts.«
»Mir bringt es was.«
Noble musterte ihn gründlich. »Wenn wir für den Augenblick mal annehmen, dass Sie recht haben, gibt es natürlich noch eine Alternative.«
»Und die wäre?«
»Die Kriminalpolizei war nicht so gewieft, wie sie hätte sein können.«
»Was soll das, Liam? Wollen Sie die Verantwortung abwälzen? Die Schuld umverteilen?«
»Keineswegs. Aber wenn es etwas in Mitchells Vergangenheit gibt, was ich bezweifle, wieso ist es dann nie herausgekommen?«
Will hielt den Mund. Als sie Roberts damals in Haft genommen hatten, war er natürlich zu einer ganzen Reihe ungelöster Missbrauchsfälle an Mädchen vernommen worden. Allerdings war dabei nichts Relevantes ans Licht gekommen, und sobald die Staatsanwaltschaft der Anklage im Fall Martina Jones zugestimmt hatte, war die Frage in den Hintergrund getreten, weil andere, dringendere Dinge Vorrang hatten.
»Die Sache ist nun einmal die«, sagte Noble, »wenn Sie die Untersuchungshaft einbeziehen, hat Roberts mehr als die Hälfte seiner Strafe verbüßt. Er hat das Programm für Sexualstraftäter erfolgreich absolviert. Das Gremium, das über eine bedingte Haftentlassung entscheidet, hat echte Reue bei ihm festgestellt. Ihm ist klar, dass er etwas Unrechtes getan hat.«
»Etwas Unrechtes?«
»Ja.«
»Und Sie glauben das?«
»Ja. Bis er mir einen Grund gibt, etwas anderes zu denken.«
Will stand schnell auf. »Wenn er Ihnen einen Grund dazu gibt, ist es zu spät.«
Auch dieses Gespräch hatte sich erschöpft, befand Noble. »Er steht im Strafregister für Sexualtäter. In den ersten sechs Monaten wohnt er in einer anerkannten Unterkunft und meldet sich regelmäßig bei seiner Bewährungshelferin. Wir werden ihn genau überwachen, machen Sie sich da keine Gedanken.«
Will stand in der offenen Tür und sah auf ihn zurück. »Nicht so genau wie ich.«
»Um Gottes willen, Will…«, begann Noble.
Aber Will war weg.
Es war Mittwochmorgen, zwei Tage, nachdem Helen die Nachricht von Roberts’ bevorstehender Entlassung weitergegeben hatte. Sie saß auf der einzigen freien Ecke von Wills Schreibtisch, nutzte seine Abwesenheit, um einen privaten Anruf zu machen, und hielt sich das Handy ans Ohr. »Ja«, sagte sie munter. Und: »Ach wirklich? Das würdest du? Hier?« Sie lachte. »Ich glaube nicht, dass Will das gefallen würde.« Noch ein Lachen; es war laut und kam tief aus dem Hals.
»Das ist ein dreckiges Lachen, wenn ich je eins gehört habe«, sagte Will, als er eintrat.
»Ich muss Schluss machen«, murmelte Helen schnell, schob ihr Handy zusammen und schwang herum, wobei sie mehr Bein zeigte als möglicherweise beabsichtigt.
»Entschuldigung. Ich musste telefonieren.«
»Ist in Ordnung.«
»Du weißt doch, wie es da draußen ist, dieser ganze Lärm und alle spitzen die Ohren.«
»Dann war es privat?«
»Gewissermaßen.«
»Wer ist der Glückliche?«
Grinsend zog Helen eine Augenbraue in die Höhe. »Das würdest du wohl gern wissen?«
»Wahrscheinlich nicht.«
Helen glitt von seinem Schreibtisch herunter und strich ihren Rock an den Oberschenkeln glatt. Sie trug ein seriöses Kostüm in feierlichem Schwarz und schwarze Schuhe mit einem kleinen Absatz. Wie inzwischen fast immer hatte sie ihr Haar zurückgesteckt.
»Bist du später bei Gericht?«, fragte Will.
»Als Strafe für meine Sünden.«
»Curtis Chambers?«
»Genau der.«
Chambers war mit dem Türsteher eines Nachtclubs in Streit geraten, war zum Haus eines Freundes gefahren und hatte sich eine Waffe geliehen, eine umgebaute Startpistole, die aber die Hälfte der Zeit Ladehemmung hatte. Dann war er zum Club zurückgekehrt und hatte nach weiteren hitzigen Worten und einigem Geschiebe und Geschubse die Pistole aus der Tasche genommen und dem Türsteher in den Kopf geschossen. Wie durch ein Wunder hatte der Mann überlebt. Chambers war drei Tage später verhaftet worden. Die Anklage lautete auf Mordversuch, gefährliche Körperverletzung und das Tragen einer Waffe an einem öffentlichen Ort. Jetzt plädierte er auf Notwehr.
»Die Sache ist ganz eindeutig«, sagte Will.
»Würde man denken.«
Will ließ sich auf seinem Stuhl nieder. »Ich war bei Noble«, sagte er.
»Wegen Roberts?«
»Ja.«
»War vielleicht nicht so gut.«
»Glaubst du?«
Helen schüttelte den Kopf. »Hör zu, Will. Du weißt, was ich denke. Du musst dich damit abfinden. Außerdem werden sie sich alle auf ihn stürzen.«
»Sie?«
»MAPPA.Er kann nicht in der falschen Richtung in eine Einbahnstraße reinfahren, ohne dass es jemand merkt.«
»Schöner Gedanke«, sagte Will. »Leider haben sie ihn als Stufe zwei klassifiziert. Das Risiko ist nicht hoch genug. Ein paar Monate in einem Wohnheim, ein paar nette Plaudereien mit seiner Bewährungshelferin. Er bleibt sauber, erzählt ihnen, was sie hören wollen, und wenn sie sich dann die Hände reiben, kann er vom Radar verschwinden.«
»Eins ist mir nicht klar«, sagte Helen.
»Was?«
»Warum es so an dir nagt. Seit diesem Fall hat es andere gegeben, ähnliche. Zu viele, ganz gewiss. Aber warum geht dir dieser so unter die Haut?«
»Ich weiß es nicht. Die Angst in den Augen des Mädchens, als ich sie das erste Mal sah? Roberts, als wir ihn befragt haben? Wie er dastand, wie der Schweiß an ihm runterlief und wie er uns die Hucke vollgelogen hat. Das anzügliche kleine Lächeln. Als ob er in Erinnerungen geschwelgt hat.«
»Wir haben ihn nicht mehr in der Hand, Will. Wir können nichts tun.«
Will sah zu ihr auf und sagte nichts.