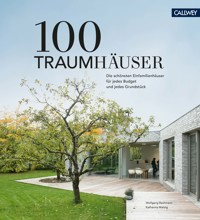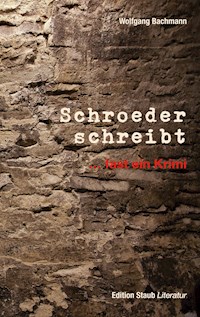
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Tochter eines berüchtigten Politikers wird ermordet. Hingerichtet bei einer obszönen Party. Jedenfalls glaubt das der ehemalige Feuilleton-Redakteur Schroeder, der seine Berufserfahrungen mit einem Gesellschaftsroman krönen möchte. Doch der unheimliche Mord gewinnt zunehmend Macht über ihn. Schließlich gerät Schroeder selbst in Tatverdacht. Er erleidet Panikattacken und sieht sein Ende nahen. Da kommt es zur überraschenden Wendung ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Bachmann verweilte sich nach dem Architekturstudium mit einer Dissertation und fand danach einige Jahre Unterschlupf in Architekturbüros. Dort konnte er sich nie entscheiden, was er aus den ganzen Fachzeitschriften abkupfern sollte, entlief deshalb zur Bauwelt nach Berlin und ging 1991 zum Baumeister nach München. Zunächst als Chefredakteur, von 2011 bis 2013 als Herausgeber. Inzwischen hält er Vorträge, juriert, moderiert, diskutiert, schreibt Kritiken, Glossen und Kurzgeschichten für Zeitungen, Magazine und Bücher.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Prolog
In den Gelben Sack gehören Leichtverpackungen. Das sind zum Beispiel Spülmittelflaschen, Yoghurtbecher, Zahncremetuben, Vakuumfolien, Konservendosen, Kronkorken, Milchtüten, Styroporpolster, Aludeckel. Da kommt eine Menge zusammen. 46kg Wertstoffe stopft jeder Bundesbürger pro Jahr in einen Gelben Sack. Aber nicht einmal die Hälfte davon wird recycelt. Das meiste wandert als Ersatzbrennstoff in die Zementwerke. Die zum Abholen bereitgestellten vollen Tüten sind leicht und werden häufig vom Wind auf die Straße geweht. Ihr Inhalt interessiert die Passanten nicht. Anders die weißen Säcke. Sie enthalten Marmeladen- und Gemüsegläser, vor allem Flaschen. In der Pfalz: Weinflaschen. Wenn man sieht, was die einzelnen Haushalte alle zwei Wochen abliefern, kann man das als Vitalitätsbeweis betrachten. Armselig, wer nur zwei, drei grüne Literflaschen entsorgen kann. Von so einem Umsatz können auch die Winzer nicht leben. Aber an diesem Freitag waren in Königsbach ohnehin die Gelben Säcke an der Reihe.
An der Kirche St. Johannes, 1753 erbaut, mit einem spätgotischen Turm aus älterer Zeit, standen sonst nie welche. Was sollte die Pfarrgemeinde schon abliefern? Ein paar Plastikblumen, Grablichter, Kerzenhüllen, eine Folie, mit der ein Messgewand aus der Reinigung kam? Aber heute lagerten zwei prall gefüllte Gelbe Säcke an der Treppe, die vom Hirschhornring zum Kirchenvorplatz führt. Durch die trübgelbe, nur 15μm starke Folie konnte man den Inhalt nicht genau erkennen. Es schien sich jedoch nicht um Kleinmüll zu handeln, nicht um ein Sammelsurium aus besagten Leichtverpackungen, sondern um massive Gegenstände mit weichen Konturen, worüber sich die reißfeste Plastikhaut wie um eine Weihnachtsgans spannte. Man hatte den sperrigen Abfall auch nicht gereinigt, denn die Folie klebte auf einer braunroten Schliere, die sich in den unteren Zipfeln des Sacks zu einem zähen schwärzlichen Brei gesammelt hatte. Wo das Material den Inhalt nicht berührte, waren unter der morgendlichen Sonneneinstrahlung bereits Blasen entstanden, hier kondensierte das Flüssige und legte sich als matter Film unter die transparente Pelle. Einer der 90 Liter fassenden Polyethylen-Säcke war auf der Treppe abgerutscht, war umgefallen und hatte von seinem unappetitlichen Inhalt ein schmales Rinnsal auf die Stufen abgegeben. Dort sammelten sich um die angetrocknete Lache Ameisen und Käfer. Vor allem ein paar Schmeißfliegen kümmerten sich um die unerwartete Morgengabe. Mit aufgeregtem Surren drangen die Zweiflügler der Gattung Calliphora vicina durch die nachlässig verzurrte Sacköffnung und bohrten ihre Leckrüssel in das tote Fleisch, das ihnen reichlich Nahrung bieten würde. Es war ein Festmahl, was ihnen da unerwartet auf der Kirchenstiege beschert wurde. Eine frische Leiche! Mundgerecht angeschnitten. Ein wenig roch es nach einem Parfüm, vermutlich Magie noire. Die Körperteile stammten wohl von einer jüngeren Frau. Darüber tanzte das Geschmeiß und ließ sich von dem aromatischen Dunst völlig irre machen. Was es hier zu beißen gab, würde für mehrere Fliegenvölker reichen. Und jeden Tag würde es besser schmecken, wenn die Verwesung eingesetzt hätte. Hier konnten sie ihre Larven ablegen, tausendfach. Den Maden sollte es gut gehen. So eine Gelegenheit kam nicht so schnell wieder.
Doch jetzt rumorte ein schwerer Diesel neben den Säcken, es stank nach Auspuffgasen. Ein Müllfahrzeug hielt mit stöhnenden Bremsen neben der Treppe an. Zwei Männer sprangen ab.
1
Mit jungen Mädchen wusste Schroeder wenig anzufangen. Es waren Zwitterwesen, weder Kind noch richtige Frau. Das war ihm schon aufgefallen, als er zur Schule ging. Gerade hatte man mit ihnen Fangen gespielt, auf einmal wurden sie komisch, schwärmten für Schlagersänger, tuschelten herum und probierten, ob ihnen schon die Stöckelschuhe ihrer Mutter passten. Bei Jungs war das alles einfacher, die wurden naturgemäß größer, stärker, bekamen eine tiefere Stimme und warteten auf den Bartwuchs. Wenn sie im Wirtshaus fraglos ein Bier bestellen konnten, war der Anschluss zu den Männern geschafft.
Das lag jetzt einige Jahrzehnte zurück. Aber Schroeder war damit nicht weitergekommen. Er hatte keine Kinder, und als Redakteur im Feuilleton des Rhein-Echos hatte ihn die Soziologie der Pubertierenden nicht interessiert. Seine Umgebung betrachtete er nach der erzählbaren Qualität des Ereignisses, egal ob es sich um verspätete Züge, zugeschotterte Gärten, zersiedelte Ortsranderweiterungen oder den inzwischen selbst auf den Vorstandsetagen anzutreffenden legeren Aufzug der leitenden Angestellten handelte. Für einen Journalisten gehörte das alles zu den Zeitzeichen, die etwas bedeuteten, die eine Veränderung markierten. Daran konnte man sich abarbeiten, Kolumnen schreiben oder in längerer Form in Reportagen und Essays darüber nachdenken.
Jetzt brauchte er aber erst mal ein Mittagessen. In Neustadt hatte gerade einer dieser neuen Burger-Läden eröffnet, die das Fastfood für die bürgerliche Speisekarte domestizierten. Man konnte auf Bierbänken im Freien sitzen, das kam Schroeder heute gerade recht.
Am liebsten hatte er immer einen Tisch für sich allein, an langen Bänken war dieser unsoziale Luxus aber weniger wert, da musste man irgendwie zwischen die anderen Gäste rutschen. Also suchte er von weitem, wo es ihm am erträglichsten wäre, wo er möglichst am Rand sitzen könnte. Er wollte seine künftigen Tischnachbarn nicht erst aus der Nähe mustern und dann offenkundig ihre Gesellschaft verschmähen. Ein entschlossener Auftritt war ihm wichtig. Das gehörte sich für einen Siebzigjährigen, er war kein seniler Opa. Also ließ er alle denkbaren Sitzplätze eilig durch sein Bewertungsraster filtern: wo er vermutlich Zeuge lauter Gespräche würde, Raucher ertragen müsste, korpulente Beisitzer in Kauf nehmen oder zusehen, wie jemand ungeschickt sein vollgestopftes Brötchen in sich hinein mampfte. Schließlich hatte er sich entschieden, hinten links vor der Hauswand, da saßen zwei Mädchen nebeneinander, sie waren mit ihrer Mahlzeit fast fertig und verweilten noch mit einer Cola. Er könnte etwas seitlich von ihnen Platz nehmen. Wie fragt man da, ohne dass es steif klingt oder herablassend?
Kann ich mich da ausbreiten?, nickte Schroeder ihnen zu – es klang mehr wie eine Behauptung als eine Frage – und schwang ungeniert ein Bein über die Bank. Dazu grinste er mit schiefem Gesicht. So einen Auftritt mussten die beiden doch cool finden.
Jaja, antwortete eines der Mädchen, lächelte ebenfalls und wedelte mit der Hand, was weniger nach Einladung aussah, eher als Zeichen, sich mit seiner Turnübung zu beeilen und sie nicht unnötig von ihrem Gespräch abzulenken.
Schroeder stellte seinen Rucksack neben sich und griff sich die auf einem Brett angeklemmte Speisekarte. Nachdem er sich eine Schorle und einen klassischen Burger bestellt hatte, kramte er sich sein Moleskine-Büchl und einen Stift aus dem Gepäck. Nicht um sofort etwas zu notieren, sondern um einen Bezugspunkt zu haben. Er nahm damit eine Rolle ein, konnte nachdenklich schauen, blättern, lesen, vielleicht doch eine Beobachtung festhalten. Und unauffällig mit träumendem Fernblick zu den beiden Mädchen sehen, bevor er sie scheinbar gedankenverloren unauffällig musterte.
Die näher zu ihm saß, hieß Miri, die andere Alma. So sprachen sie sich an. Schroeder mochte Abkürzungen grundsätzlich nicht. Miri klang wie eine Produktbezeichnung, die sich eine Werbeagentur für eine fettarme Frischkäsezubereitung ausgedacht hatte. Alma wirkte dagegen fast wie ein Klassiker, irgendwie vornehm. Gut zu sprechen, zwei dunkle Vokale. Alma Mater stand bekanntlich für Universität, weil dort Bildung und Wissen vermehrt wurden, Alma war die Tapfere, die Fruchtbringende, die Seele, wusste er noch aus dem Lateinunterricht. Wie alt mochten diese Mädchen sein? Es war sein altes Problem. Er hatte keine Ahnung. Zwischen zwölf und siebzehn, schätze er. Sie waren zierlich gebaut, deutlich kleiner als er. Miri trug eine Zahnspange, in der sich ein Rucolablatt ihrer Mahlzeit verfangen hatte. Alma war eindeutig die hübschere, wirkte ein wenig älter, hatte gewaschene Haare und einen Hauch Make-up aufgetragen. Wenn sie sich beim Sprechen konzentrierte, legte sie die Stirn in Falten und kräuselte dazu ihre Nase, ihre Augenbrauen folgten für einen Moment mit einer S-förmigen Kontur, als ließen sich dabei die Gedanken leichter bewegen. Schroeder war fasziniert von diesem Mienenspiel, es hatte etwas Ernsthaftes, Alma plapperte nicht, sie erzählte, teilte mit. Gute Frau! So war es früher schon gewesen, erinnerte er sich. Ein attraktives Mädchen hatte meistens eine etwas weniger ansehnliche Freundin. Das Aschenputtel musste für sie kleine Gefälligkeiten erledigen und bekam dafür die Chance, auch einen von den Jungs, die die Prinzessin umschwärmten, abzubekommen. Das Leben lief wie im Märchen.
Inzwischen war Schroeders Bestellung angekommen, bei den Mädchen wurde abserviert. Nun hatten sie Platz, ihre Handys nebeneinander zu legen und ihre Downloads zu vergleichen, anschließend machten sie ein Selfie: Alma und Miri beim Mittagstisch. Schroeder amüsierte sich über die Vorhersehbarkeit ihrer Handlungen. Als er seinen Burger anschnitt, sah Alma zu ihm auf und wünschte einen guten Appetit. Schroeder nickte mit vollem Mund. Einen Moment hatte er mit ihr Blickkontakt. Sie war keine zwölf, präzisierte er seine erste Einschätzung, mindestens vierzehn, fünfzehn. Alma trug ein bis zu den Schultern ausgeschnittenes T-Shirt. Dort machte sich ein glänzender himbeerfarbener Träger mit diesen typischen flachen Ösen bemerkbar. Eindeutig: Sie hatte schon einen richtigen BH an. Das nahm Schroeder wie eine Zertifizierung, sie gehörte damit doch zu den erwachsenen Frauen. Er vergewisserte sich unauffällig, was die Träger halten sollten, vermutlich Größe A, etwas steif gepolstert, mit Bügel. Gut, dass dieses interessante Requisit von den Feministinnen noch nicht abgeschafft war. Er mochte alles, was Frauen anders hatten. Er war eindeutig hetero. Als er in der Pubertät steckte, gehörte es zum sogenannten guten Ton, dass Damen ihre Unterwäsche verbargen und keine sichtbaren Hinweise gewährten. Die einschlägigen Frauenzeitschriften waren voll mit Tipps, wie man störrische Träger bändigen konnte. Das Mindeste war, dass man keine Trikolore blitzen ließ, sondern alles, was zum Vorschein kommen könnte, dieselbe unauffällige Farbe besaß. Das war jetzt Geschichte, die Mädchen trugen bunte Wäsche unter weißen Blusen, die Jungs warben gut sichtbar über dem Gürtel ihrer Jeans für den Hersteller ihrer Unterhosen. Und als wollte Alma Schroeders Entdeckung bestätigen, fasste sie an ihr Hemdchen und tastete mittig nach dem Rand ihres Büstenhalters und zog ihn unauffällig ein wenig nach unten, während sie mit den Schultern eine korrigierende Bewegung ausführte. So konnten sich Form und Inhalt bequem miteinander arrangieren. Hatte Schroeder schon tausendmal gesehen. Er fand das charmant, damenhaft, das konnten Männer nicht nachmachen. Die kratzten sich höchstens mehr oder weniger diskret im Schritt, das war ihre geschlechtsspezifische Handbewegung. Da wollte man gar nicht wissen, warum es sie juckte. Wie elegant dagegen diese zarte Geste, wie sie Alma beherrschte. Doch, sie war schon eine passable Frau, wie konnte er nur so ahnungslos sein.
Miri kümmerte sich inzwischen energisch um ihr Handy, gluckste etwas über die Apps, die sie ihrer Freundin zeigte und erläuterte. Schroeder schnitt energisch in seinen Burger, es machte ihm Spaß, das weiche Trumm mit Messer und Gabel kunstfertig zu zerlegen. Sollten die jungen Dinger ruhig staunen, wie man das ordentlich machte, ohne mit Maulsperre zu schlingen und herum zu kleckern. Von ihm konnte man etwas lernen. Miri wich seinem Blick aus. Noch ein Kind, dachte Schroeder. Mit Alma war das etwas anderes. Wenn er sich kauend umsah, gelang es ihm, ihr in die Augen zu schauen. Ganz zufällig natürlich. Sie hatte schlanke Hände mit gepflegten langen Fingernägeln. Bei Miri waren sie kurz und angeknabbert, vor allem schrecklich angepinselt und mit einer Art Silbersand beklebt. Das machte den Unterschied. Schroeder nahm einen Schluck von seiner Schorle und dachte, wäre ich jetzt gut fünfzig Jahre jünger, würde ich mich für Alma entscheiden. Wahrscheinlich würde er sich aber gar nicht trauen, sie anzusprechen. Damit hätte er heute kein Problem. Aber es war zu spät. Sie könnte seine Enkelin sein. Wenn er mit ihr Kontakt aufnehmen würde, fiele das unter Pädophilie. Zu Recht!
Schroeder korrigierte seinen Blick, betrachtete die beiden Mädchen mit Großvateraugen, als wollte er ihnen als nächstes ein Eis spendieren. Mit seiner Mahlzeit war er inzwischen zu Ende, er schob den Teller ein wenig zur Seite.
War’s gut?, fragte Alma und sah zu ihm auf.
Oh, äh …, ja, stotterte Schroeder, kann man sich ab und zu mal antun. So einen Dings … hmm, Burger.
Warum stammelte er?
Miri sah strafend zu Alma. Sie erklärte ihr doch gerade ihre neue App.
Schroeder bestellte sich einen Espresso. Die Mädchen beugten sich wieder über ihre Handys, bis Alma sich unvermittelt aufrichtete.
Bin gleich zurück, kündigte sie an.
So eine tiefe, warme Stimme!, registrierte Schroeder, tolle Frau.
Sie drehte sich zur Seite, schwang ein Bein über die Bank, und als sie sich erhob und das andere nachzog, fasste sie mit beiden Händen an den knappen Beinausschnitt ihrer weißen Shorts und ordnete den Sitz. Dazu beugte sie sich ein wenig nach vorne, sah mit halboffenem Mund und einem unschuldigen Augenaufschlag zu Schroeder, nur für eine Sekunde, aber die Botschaft war angekommen. Sie konnte es, registrierte er. So machten es die Frauen im Film, nur trugen sie dabei Nahtnylons mit schwarzen Strumpfhaltern. Ein Klischee, aber gut. Schroeder grinste. Alma verschwand, vermutlich zur Toilette, Miri krümmte sich noch emsiger über ihr Mobilgerät, um seinem Blick auszuweichen. Damit kann man sich beschäftigen, gell, sagte Schroeder, damit das Mädchen nicht so unbeteiligt blieb. Er vermied es gerade noch hinzuzufügen, so was habe es früher alles nicht gegeben. Miri nickte und zeigte ihm verlegen lächelnd ihre Zahnspange.
Da is bei dir noch Rucola, lachte Schroeder und wies bei sich auf einen Eckzahn.
Miri sah in ihr Handy, fand das Blättchen mit der Selfie-Kamera und entfernte es mit zwei Fingern.
Doch praktisch so ein Gerät, nickte Schroeder.
Jetzt kam Alma zurück, sie hatte Lippenstift aufgetragen und sich die Haare hochgesteckt. Sie schenkte ihm ein kurzes Lächeln, nur um zu sehen, ob er sie bemerkt hatte. Er antwortete mit einem leichten Verschieben der Augenbrauen, die einzige Mimik, zu der Roger Moore als James Bond fähig gewesen war. Mindestens siebzehn, dachte er, wenn nicht fünfundzwanzig, und – sie ist bildhübsch. Höchstens einssechzig, Größe 34. Egal. Er stand auf, nahm seinen Rucksack und suchte ebenfalls nach der Toilette.
Dort hielt er sich noch eine Weile mit den Werbeflyern auf, steckte einige Konzertankündigungen ein und lief anschließend gemächlich zu seinem Platz zurück. Die beiden Mädchen hatten bereits bezahlt und waren gegangen. Neben seinem leeren Glas lagen noch sein schwarzes Notizbuch und sein Stift. Außerdem eine unbenutzte Serviette. Er setzte sich, schlug das Büchl auf und blätterte sich zu der Seite, auf der er zuletzt geschrieben hatte. Unter seinen Aufzeichnungen stand etwas in einer fremden Schrift.
Schroeder las: Ich finde Sie süß. Alma.
Vor den Namen war ein Herz gemalt. Ohne Pfeil, nur so. Schroeder sah sich um, als ob jemand das Verfassen der Mitteilung beobachtet haben könnte. Er klappte das Notizbuch zu, spannte das Gummi darüber und griff nach der Serviette, die zufällig liegengeblieben war. Als er sie umdrehte, sah er einen akkurat abgedrückten Kussmund.
Nein, entfuhr es ihm, nicht so was. Sie war wohl doch erst zwölf. Er rief nach der Rechnung, schob aber Buch und Serviette sorgfältig in seinen Rucksack.
Er war mit dem Rad gekommen. Bis zu seiner Wohnung ging es ein Stück den Berg hinauf. Die kleine Anstrengung würde ihm guttun.
Es hörte wohl nie auf, das mit den Frauen. Alma, ein Kind. Wer sie wohl einmal erobern würde? Blöd, dass er nicht mehr in Frage kam.
2
Schroeder wohnte in Gimmeldingen. Nach der Trennung von Andrea hatte er sich eine herrschaftliche Eigentumswohnung direkt gegenüber der Kirche gekauft, ein klassizistisches Haus, das einmal für einen Weinkommissär gebaut worden war und deshalb über umfangreiche Kellergewölbe verfügte. Schroeder wohnte im Obergeschoss, das er bei der Renovierung mit einem Balkon zum Gartenhof ergänzt hatte. Hier saß er gerne und sah auf den über den Dächern erkennbaren dunklen Haardtrand. Wenn es das Wetter irgendwie zuließ, holte er sich seinen Laptop und arbeitete auf diesem Freisitz. So ließen sich die Gedanken besser durchlüften, erklärte er den Nachbarn, wenn sie sich wunderten, dass er auch bei frischen Temperaturen und im Halbdunkel etwas in seinen Rechner hämmerte.
Er hatte das Schreiben noch nicht aufgegeben. In erster Linie belieferte er seine alte Zeitung mit Kolumnen, es war eine Balance aus direkten Aufträgen und von ihm frei angebotenen Beiträgen. Die komfortable Situation als Freiberufler mit passablem Rentenbezug bescherte ihm jedoch bisweilen einige Verwirrung. Hatte er nichts zu tun, suchte er sich energisch einen Auftrag, weil er sich sonst wie ausrangiert vorkam. Er gehe sich wahnsinnig auf die Nerven, wenn er nicht schreibe, hatte Franz Xaver Kroetz einmal bekannt. Das konnte Schroeder bestätigen, genau so war es. Aber kaum hatte er ein, zwei Termine vor sich, war mit einer Aufgabe intensiver beschäftigt, litt er sofort unter der Belastung, wollte alles nur schnell hinter sich bringen, früher fertig werden, erledigt haben, um das verdiente Nichtstun zu genießen. Doch jeder der beiden widersprüchlichen Vorsätze hatte ein kurzes Verfallsdatum. Manchmal fuhr er in die Redaktion nach Ludwigshafen, um mit den ehemaligen Mitarbeitern in der Kantine zu essen. Sonst hielt er sich vom Verlag lieber fern, er mochte das nicht, wie ein Alterspräsident durch die Büros zu streifen und zu beobachten, was sich alles verändert hatte, was die jungen Leute, die er zum Teil gar nicht mehr kannte, inzwischen anstellten. Er war als Leitender Redakteur ausgeschieden, nachdem er jahrelang das überregionale Feuilleton im Echo geprägt hatte. Kunst, Architektur, Umwelt, Literatur, Gesellschaft waren seine Themen, die er geflissentlich zueinander in Beziehung setzte, über die er nicht berichtete, sondern wortreich erzählte. Konservative Kollegen betrachteten seine Verlautbarungen als Gonzo-Journalismus. Hieß: So könne man vielleicht in Los Angeles arbeiten, aber nicht im Land der Dichter und Denker.
Für Schroeder war das Schreiben eine andere, eine zweite Wirklichkeit. Bei Uwe Timm hatte er gelesen, Literatur sei ein utopischer Raum, eine Verweigerung der Nur-Realität, ein grundsätzliches Anders-Sein gegenüber dem Jetzt-und-Hier-Sein. Eben, das war es. Es gab Ereignisse und das Verarbeiten der Ereignisse. Dazu musste man darüber schreiben, die Realität subjektiv herauspräparieren, mit einem Text synchronisieren, so wie es Martin Walser immer wieder schaffte, die Welt in Sprache zu verwandeln. Oder Ror Wolf. Der hatte sich als Wirklichkeitsfabrikant bezeichnet, das gefiel Schroeder, das klang produktiv nach Schaffen und Schöpfen. Ihm ging es nicht um eine Moral, er wollte lediglich einen Assoziationsraum herstellen, in dem er sich auskannte und der durch kluge Abschweifungen auch den Lesern ein Deutungsmuster lieferte und eine eigene Einschätzung erlaubte. Schroeders Texte waren in erster Linie Selbstgespräche, an denen er teilhaben ließ. Bisweilen fürchtete er, dabei unfreiwillig zu viel von sich preiszugeben. Schwer vorstellbar, wie andere Menschen in anderen Berufen das Leben bewältigten und es aushielten, dass sie täglich mit etwas konfrontiert wurden, was ohne ihre Beteiligung an ihnen vorbeiströmte. Natürlich konnte jeder nachdenken, mit Freunden oder Kollegen sprechen. Aber damit war nichts erledigt. Erst indem man eigene Sätze formulierte, eine Beziehung zum Geschehenen herstellte und sich notierte, also aufschrieb, ließ sich die Welt begreifen. Wenn auch überwiegend nur in ihrer unerklärlichen Verfassung. Walser hatte einmal gesagt, durch das Schreiben erfahre er etwas, was er vor dem Schreiben nicht gewusst habe.
Wie die Wirklichkeit und ihre literarische Interpretation miteinander korrespondierten, hatte sich Schroeder nie gewissenhaft überlegt. Es passierte eben, ein Glück, dass er schreiben durfte. Es stellte damit einen Sachverhalt her, den er nach Belieben formulieren konnte. Wie der liebe Gott, nur eben mit Worten. Es lag in seinem Ermessensspielraum, ob er das Leben günstiger oder bedrohlicher darstellte, ob sich Lösungen andeuteten oder wenigstens im beschränkten Umfang eines Artikels eine Episode zu einem manierlichen Ende kam. Corriger la fortune war das zugrundeliegende Prinzip seiner journalistischen Arbeit, vergleichbar dem Expressionismus’ eines Franz Marc, der die immer täuschende Natur zerlegte und nach seinem Willen neu zusammenfügte. Nur malte Schroeder eben mit Sprache. Er folgte der Regel show, don’t tell. Das hieß, als Autor formulierte er nicht: Der Freiherr war ein wenig echauffiert, als er die Nachricht vernommen hatte, sondern schrieb: Der Freiherr umklammerte seinen Krückstock und schlug mit dem Silberknauf mehrmals so heftig auf das Teetischchen, dass die zierlichen Sèvres-Tassen, die sich seit Generationen im Familienbesitz befanden, mit wilden Pirouetten über die Mahagoniplatte hüpften und mit einem spitzen Klirren auf dem Marmorboden zersprangen. Das war Metro-Goldwyn-Mayer, nur so konnte man die Leser einbeziehen.
Manchmal ertappte sich Schroeder, dass er bereits während seiner Beobachtungen Sätze vor sich hinsagte, als sei er der zugeschaltete Live-Reporter, der dem Publikum erläutern sollte, was gerade passierte. Das verlangte eine sorgfältige, vorsichtige Auseinandersetzung mit aktuellen Ereignissen, auch eine Selektion, denn nicht alles war mitteilenswert, worauf man gegenwärtig stieß. Was nicht zu einer spannenden Geschichte passte, konnte sofort vernachlässigt oder entsprechend beiläufig erledigt werden. Manchmal glaubte er, er käme im Leben mit allem besser zurecht, weil er sich selbst beobachten musste, sein Denken und Handeln daran zu messen, ob es später zu einer vernünftigen Mitteilung taugte. Er war als Emissär unterwegs, vielleicht sogar als Schlichter, ein Pendler zwischen kategorischem Imperativ und Feuilleton.
Das führte dazu, dass Schroeder in der Wirklichkeit wie in einem Spielfilm agierte. Das Leben bereitete etwas vor, worauf er mit unbewusster Spontaneität antwortete, eine Art Method Acting. Unvermeidlich, dass er sogar die sich ankündigenden Ereignisse erzählerisch vorwegnahm. Schuld war seine ständige Angst, mit einem Text nicht rechtzeitig fertig zu werden. Sie verfolgte ihn seit seiner Schulzeit. Erst recht als Journalist musste er gewappnet sein, nichts schlimmer als ein eilig hingeworfener Kommentar, der sich kurz darauf schon als Unsinn herausstellte. Also fing Schroeder bereits im Kopf zu formulieren an, bevor der Starkregen die Pegel steigen ließ, bevor der Virus eine Pandemie auslöste, bevor die NATO ihr Manöver an der russischen Grenze begonnen hatte. Absehbar, dass er immer vom Schlimmsten ausging. Und gottlob jedes Mal das Ausbleiben des GAUs erleben durfte. Die Katastrophe hätte ihn wenigstens nicht überrascht. Ihn nicht!
Mit zunehmendem Alter reizte es Schroeder, das, was er im Laufe der Zeit schon einmal bedacht hatte, all das Provisorische, zu einem Roman zusammenzutragen. Er hatte bereits einige fragmentarische Versuche unternommen, sie aber aus unterschiedlichen Gründen nie als stimmige Geschichte beendet. Am liebsten wäre es ihm, dass sich die disparaten Einzelteile irgendwann wie von selbst zwischen zwei Buchdeckeln zusammenfinden würden. Zu einer großen Erzählung, einem Gesellschaftsroman, einem unterhaltsamen Bulletin des Zeitgeistes, worauf Reich-Ranicki immer gewartet hatte. Narrativ sagte man heute dazu, daraus entsteht Kultur, aus erzählten Informationen, ohne die eine Gesellschaft nicht existieren kann. Mit einem Buch dazu beizutragen, war zwar eine Marotte unter Journalisten, das wusste er. Aber deshalb nicht verkehrt. Nur war Schroeder bisher keine sinnstiftende Geschichte eingefallen, mit der er seine Gedanken hätte ausbreiten können. Es wäre ihm albern und unehrlich vorgekommen, dafür fiktive Figuren zu erfinden, die er mit Inhalten füttern musste, damit sie von ihm ausgedachte bühnenreife Sätze aufsagten. Worum sollte es gehen? Um Liebe, Mord und Totschlag ... Das interessierte ihn nicht, das war Kasperltheater, wenn nicht selbst Erlebtes, Erkanntes, Erfahrenes eine Rolle spielte, das er den von ihm stellvertretend eingesetzten Personen als Handlung auftrug. Er wartete sozusagen auf einen Abschlussbericht seines Berufslebens in Romanform, damit wollte er von dem Zeugnis ablegen, was ihm wichtig schien. Danach würde er vielleicht gar nicht mehr schreiben.
Diese Herausforderung lag vor ihm wie ein lockender, dunkler Wald, eine unendliche Wüste oder ein unbekanntes Meer. Und wie einen Pionier reizte ihn diese Aufgabe, die ihm niemand stellte. Aber er fürchtete sie. Er hatte Respekt davor. Wenn er als Redakteur an einem längeren Essay arbeitete, versank er in diesen Phasen vollkommen in seiner Auseinandersetzung. Bis ein Text fertig war, lebte er mit ihm, knetete ihn, schnitt ihn zurecht, änderte die Zutaten. In jedem freien Moment schweifte er in sein unfertiges Werk zurück, beim Bahnfahren, beim Wandern, bei diesen unerträglichen Verlagskonferenzen, auch früher schon, wenn er mit Andrea einsilbig beim Essen saß. Sie musterte ihn dann amüsiert, als könnte sie aus ihm herauslesen, mit welchem Thema er sich gerade abmühte. Nicht auszuschließen, dass seine Exkursionen in diese Parallelwelt die Ursache waren, dass sie irgendwann die Lust an ihrem angeheirateten Dichter verloren hatte. Manchmal machte er sich Notizen auf einer Serviette, mit Vorliebe ohne Text als krakelige Skizzen, um sich von einer Fiktion kurz abzumelden und ins wirkliche Leben zurückzukehren. Die Vorstellung, wie es ihm ergehen würde, wenn er sich für Monate und Jahre einer stringenten Handlung verpflichtete, um einen umfangreichen Roman zu schreiben, war ihm unheimlich. Er würde nicht loslassen können, er würde mit seinen Figuren leben, sich fragen, was sie dachten, warum sie so handelten. In der Zeit könnte er niemanden um sich haben, er wäre privat nicht mehr zu gebrauchen. Furchtbar! Und nicht auszudenken, wenn er auf halber Strecke die Lust verlöre... Machte das noch Spaß, wenn man schon wusste, was man beabsichtigte und es im Kopf erledigt hatte, war dann nicht nur noch präzises, fleißiges Handwerk nötig? Er hatte sich immer gewundert, wie Daniel Buren, Yves Klein oder Mario Merz ihre Marken-Kunst kultivierten. Langwierige Konzepte passten nicht zu Schroeder.
Andererseits war das Schreiben so etwas wie eine Lebensversicherung für ihn. Nicht wegen der paar Kröten, mit denen das Echo seine Artikel honorierte. Es war eine Aufgabe, die erledigt werden musste und während