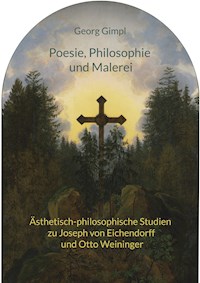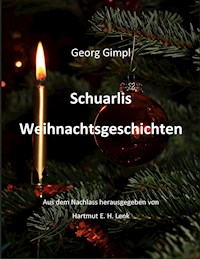
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von 1993 bis zu seinem viel zu frühen Tod im Jahre 2014 verfasste Dr. Georg Gimpl für seine Verwandten und Freunde jeweils zum Weihnachtsfest Geschichten, die mit seinen Reisen in verschiedene Länder und mit seinen geisteshistorischen Forschungen, aber vor allem mit seinem Heimatort Rußbach am Pass Gschütt verbunden sind. Die Liebe zu seiner Heimat im Salzkammergut, zu den Menschen dort und zu der zauberhaften Natur der Alpen prägen viele dieser Texte. Sie bieten zugleich Einblicke in die Lebensweise, die Bräuche, Sprache und Alltagswelt in diesem Teil Österreichs und sind ein wertvoller Beitrag zur Regionalgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung des Herausgebers
Das Christkindl, tausendprozentig. (1993)
Wurim (1994)
Der Nikolaus (1995)
Donnerkogel (1996)
Brief an das Christkindl (1999)
Ob Christ oder Haider (2000)
Papparazza im Mikrokosmos (2001)
Die Tunk (2002)
Marlies (2003)
Tourismus – Industriestandort Russbach (2004)
Der Rotkappler (2005)
Auf Kafkas Spuren (2006)
Schiss (2007)
Ruspach an der Grenze (2012)
Buchteln (2013)
Schustersterben (2014)
Die Heimat im Herzen
(Vorbemerkungen des Herausgebers, 2022)
Georg Gimpl (1949–2014) wurde am 26. Mai 1949 als zweiter Sohn des in Rußbach am Pass Gschütt lebenden Schumachers Georg Gimpl und seiner Ehefrau Frieda in Abtenau geboren. Die in der malerischen Umgebung der Alpen liegende Gemeinde blieb für ihn der emotionale Lebensmittelpunkt, auch wenn er die Hauptschule im Nachbarort Abtenau besuchte, ihn die Gymnasialausbildung und das Studium zunächst nach Salzburg führten und er – nach einigen kürzeren Tätigkeiten als junger Mann in der Schweiz und in Island – fast sein gesamtes Arbeitsleben im fernen Finnland, an der Universität Helsinki verbrachte. Seit 1975 war er dort, zunächst stellvertretend, als Lektor für deutsche Sprache und österreichische Literatur tätig, 1981 – gleich nach der Promotion in Salzburg mit einer Dissertation über den Tractatus logico-philosophicus von Ludwig Wittgenstein – erfolgte die Festanstellung. Aufgrund seiner Forschungen v. a. im Bereich der Geistesgeschichte, darunter zu den österreichisch-finnischen Kulturbeziehungen, wurde Georg Gimpl 1991 zum Privat-Dozenten für Ideen- und Wissenschaftsgeschichte an der Universität Oulu im Norden Finnlands ernannt.
Die Universität Helsinki und besonders auch ihre Humanistische Fakultät hatte schon damals ein sehr internationales Personal: Kolleginnen und Kollegen aus vielen Nationen waren dort tätig, viele von ihnen als Vermittler der Sprachen und Kulturen ihrer Herkunftsländer. Man traf sich zum gemeinsamen Mittagessen, und im Laufe der Zeit bildeten sich über den kollegialen Austausch hinaus Freundschaften heraus. Man schätzte die regelmäßigen Gespräche am Mittagstisch, die Diskussion über existenzielle und alltägliche Probleme aus den verschiedensten Perspektiven, man genoss die Internationalität und das Weltbürgertum der daran Beteiligten. Bald unternahm man, wenigstens einmal im Frühjahr, gemeinsame Ausflüge oder traf sich bei Veranstaltungen inner- und außerhalb der Universität. Die Tschechin Helena Lehečková, der Engländer Andrew Chesterman, der Libanese Faruk Abu-Chacra, der US-Amerikaner Phil Brooks und der Österreicher Georg Gimpl gehörten Anfang der 90er Jahre zum festen Kern dieser Gemeinschaft. Zum größeren Kreis gehörten Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, aus Großbritannien, den USA, Australien, Island und natürlich aus Finnland. Später wurde auch ich in diesen Kreis aufgenommen, und desgleichen stießen Kollegen, die nicht an der Universität Helsinki tätig waren, hinzu, v. a. der Volkswirtschaftler und Historiker, zuletzt Leiter des Verkehrssicherheitsamts Finnlands) und der Designer Kaarle Holmberg.
In der Mitte der 90er Jahre entstand bei einem der Gespräche die Idee, einen kleinen Sammelband zusammenzustellen, in dem die Traditionen und Bräuche des Weihnachtsfestes in den verschiedenen Ländern und Kulturen vorgestellt werden sollten. Helena, Andrew und Georg übernahmen die Herausgeberschaft für diesen Band, der 1995 unter dem Titel „Christmases / Jouluja“ im Universitätsverlag Helsinki erschien und zehn Beiträge in finnischer, englischer und deutscher Sprache vereint. Georg Gimpl steuerte die 1993 verfasste Geschichte „Das Christkindl, tausendprozentig“ bei, deren Wiederabdruck in diesem Band mit freundlicher Genehmigung des Verlages Gaudeamus (als Rechtsnachfolger des Universitätsverlages) Helsinki erfolgt.
In den folgenden Jahren machte es sich Georg Gimpl zur Gewohnheit, seinen Verwandten und Freunden eine Geschichte zu (fast) jedem Weihnachtsfest zuzuschicken. In einigen Jahren (1997 und 1998, 2008 bis 2011) waren die von Georg versandten Briefe vor allem an die Familie und enge Freunde gerichtet und eher persönlicher Natur. Aber die Geschichten, die er in all den anderen Jahren, bis zu seinem plötzlichen Tod am 10. Oktober 2014, verfasst hat, berichten uns nicht nur über persönliche Erlebnisse auf seinen Reisen, mit seinen Freunden und in der dörflichen Gemeinschaft, in der er fest verwurzelt war. Sie verschaffen uns darüber hinaus interessante Einblicke in die Alltags- und Regionalgeschichte dieses Teils Österreichs. Sie vermitteln uns einen Eindruck von dem schweren Leben in der Nachkriegszeit, von den Sitten und Bräuchen dieser Gegend. Und sie bezeugen die tiefe Bindung, die Georg Gimpl zu seinem Heimatort Rußbach am Pass Gschütt verspürte. Die Natur und die Menschen des Ortes, für den er in seinen letzten Lebensjahren ein virtuelles Dorfmuseum1 erstellte, die Lokalgeschichte der Region mit ihren teils erstaunlichen Geschichten, hatten es ihm angetan. Er liebte seine Heimat und den Menschenschlag, der dort zu Hause war, sehr. Es verwundert in diesem Zusammenhang keinesfalls, wie tief verletzt Georg Gimpl von dem Boykott der EU gegen sein Land war, als dort die als rechtspopulistisch geltende Freiheitliche Partei (FPÖ) an der Regierung beteiligt wurde (vgl. „Christ oder Haider“).
Die Geschichten wurden von dem auserwählten Leserkreis mit großem Interesse gelesen und als sehr bereichernd empfunden. Daher unterstützten die Kollegen und Freunde von Georg den Wunsch von Georgs Witwe Pirkko Sallinen-Gimpl (1940–2022) und seines Sohnes Martin, die Weihnachtsgeschichten einem größeren Kreis von Leserinnen und Lesern zugänglich zu machen. Der ursprüngliche Plan, sie gemeinsam mit zwei längeren wissenschaftlichen Texten aus dem Nachlass zu veröffentlichen,2 erwies sich als nicht sinnvoll. Der singuläre Charakter und der Umfang der Geschichten rechtfertigen vielmehr einen eigenen Band.
Für die Veröffentlichung wurde die über die Jahre leicht variierende Schreibweise nach den heute geltenden Orthographieregeln vereinheitlicht. Das betrifft insbesondere die Schreibung mit ß (auf das Georg Gimpl in den frühen Texten ganz verzichtete), die Groß- und Kleinschreibung z. B. von Personalpronomen und bestimmten Wendungen wie im Übrigen, außerdem die Anführungszeichen. Eigenarten des Stils von Georg Gimpl, etwa bei der Kontamination des Pronomens es und Verbformen wie in gibts (für gibt’s oder gibt es) oder hats (für hat’s oder hat es), wurden ebenso unverändert gelassen wie Dialektismen und Wortneuschöpfungen. Auch Varianten in der Umschrift von Dialektismen (z. B. Schurl, Schurli, Schuarli, Schuali als mundartlicher Kosename für Georg) blieben unverändert. Einen Teil der für Ortsfremde unbekannten Wörter hat Georg Gimpl, oft auf witzig-humorvolle Weise, am Ende einiger Geschichten in Vokabellisten erklärt.
Mein Dank gebührt Susanne Frejborg, Ove Knekt und Martin Gimpl, die mir gescannte Versionen einiger Geschichten zur Verfügung gestellt haben. Für ihre Hilfe beim Korrekturlesen danke ich Susanne Frejborg, Dr. Petra Schirrmann und Dr. Michael Möbius sehr herzlich. Die Verantwortung für möglicherweise übersehene Fehler verbleibt natürlich allein bei mir als Herausgeber.
Berlin, im November 2022
1 Vgl. dazu Georg Gimpl: Mein Rußbach. Postum herausgegeben von Peter Hafner, Norbert Höll und Paul Hager. Rußbach: Salzburger Bildungswerk. 2017.
2 Georg Gimpl: Poesie, Philosophie und Malerei. Ästhetisch-philosophische Studien zu Joseph von Eichendorff und Otto Weininger. Aus dem Nachlass herausgegeben von Hartmut E. H. Lenk. Norderstedt: Books on Demand. 2022.
Das Christkindl, tausendprozentig.
(1993)
Das Christkindl kennt natürlich jeder. Es hat seidene, weiße oder güldene Locken, ein Gesicht, fein wie aus Wachs, und schaut überhaupt aus wie ein Engel, nur ohne Flügel. Aber nicht, weil ihm diese schon abgebrochen wären, wie einem der Engel in unserer Krippe, sondern weil das Christkind ja gar keine Flügel hat. Es ist ganz einfach ein wunderschönes kleines Kind.
Mein Christkindl riecht zudem immer noch ein bisschen nach Leder. Aber um das zu erklären, muss ich erst eine andere Geschichte erzählen.
***
Also bevor das Christkind kommt, muss natürlich erst einmal ein Christbaum ins Haus. Diesen Christbaum durften wir, erst mein Bruder und später ich, stets mit Vater gemeinsam aus dem Wald holen. Es war das immer ein Abenteuer: Allein mit Vater durch den oft schon tiefen Schnee zu stapfen, der Vater die Säge in der Hand und lautlos wie zwei richtige Jäger, denn „wenn wir Glück haben“, meinte er, „sehen wir auch etwas – einen Hasen, ein Reh oder einen Fuchs; oder vielleicht sogar das Christkind“, flüsterte er, und den Blick immer wieder nach oben, auf die Baumkronen gerichtet.
Beim Christbaumsuchen wurde Vater, offen gesagt, immer ganz anders. Sonst in seinem ganzen Wesen die Kulanz in Person, kannte er bei Christbäumen keinen Pardon. Hier kamen wir auch kaum auf irgendeinen gemeinsamen Nenner: Für mich war der Wald voller Christbäume, für ihn schien es darin nicht einen einzigen zu geben. Wie Old Shatterhand kniff er die Augen zusammen und musterte erst einmal das Revier, ehe er an die Feinarbeit ging. „Hier könnte einer stehen!“ Oder: „Da brauchen wir gar nicht weiter schauen!“
So viele Vorschläge und Entdeckungen ich auch machen mochte, immer gab es daran etwas zu bekritteln. Man konnte es ihm an den Augen ablesen: Als hätte er sich plötzlich Lineal und Winkelmesser auf die Nase gesetzt und mich nur mitgenommen, um mir zu demonstrieren, wie heutzutage der ganze Wald nichts mehr taugte. „Ja, früher, da gab es noch Christbäume“, erklärte er nur. „Aber heute, schau sie dir an!“: Der war ihm „zu hoch“, der „zu kurz“. Da war angeblich der Stamm „zu schwach“ oder gar „krumm“; dort „fehlte zu allem auch noch ein Ast in der Reihe“. Da passte ihm wieder „die Farbe des Grases“ nicht. Dort wiederum war es „zu wenig buschig“. „Schaut nichts gleich“, brummte er dann. Oder die Reihen der Äste tanzten aus der Geometrie, waren „unregelmäßig“ oder lagen womöglich auch nur ein paar Millimeter „zu weit auseinander“. „Ja, siehst du denn nicht, wie der aussieht, oben: nichts dran; den können wir doch nicht nehmen!“ Wörtlich mit nichts konnte man ihm kommen und ich hatte es ja auch bald gelernt, meine Vorschläge vorsichtiger zu formulieren: „Vielleicht der!“ „Oder was meinst du zu dem?“ „Der wäre vielleicht nicht schlecht.“ „Würde der vielleicht gehen, oder meinst du nicht?“ – Sie gingen natürlich alle nicht.
Jahre später zeigte ich meinem Vater einmal den Christkindlmarkt in Salzburg auf dem Residenzplatz, wo die Bauern zu Weihnachten dann immer einen ganzen Wald von Christbäumen anbieten. Ich dachte, damit würde ich ihm bestimmt eine Freude machen. Für Vater war das aber geradezu ein Schock. Er schüttelte die ganze Zeit nur den Kopf. „Da ist ja kein einziger richtiger Christbaum darunter!“, sagte er. „Nein, wie die Leute so blöd sein können und sich so einen Kreppen ins Haus stellen! Und dafür zahlen sie auch noch ein Heidengeld …“
Etwas davon, bemerke ich hin und wieder, ist auch mir davon zurückgeblieben. Tannenbäume messe auch ich heute noch an Christbäumen, wenn ich durch den Wald gehe. Immer bleibt dann mein Blick bald irgendwo in den Baumkronen hängen. Erst in allerletzter Zeit bin ich da durch das Waldsterben etwas toleranter geworden. Heute bin ich schon zufrieden, wenn die Kronen einigermaßen gerade gewachsen sind und ich entdecke plötzlich nur kranke Bäume. „Lauter kranke Bäume“, sage ich, während mein Bruder sagt: „Jetzt hör mal, übertreib doch nicht!“
Vater hatte auch absolut kein Verständnis für Leute, die zwei Christbäume umsägten, weil ihnen der erste plötzlich nicht mehr gefiel und sie ihn dann wegschmissen, wenn sie einen noch besseren fanden. Das sind „Baumräuber!“, belehrte er mich, die keine Augen haben und keine Selbstbeherrschung. Entdeckten wir dann irgendwo so einen weggeschmissenen Christbaum im Wald, so war er empört und förmlich beleidigt. Da würd ihm auch „der Gizi“ kommen, wenn er der Förster wär.
Dem Förster Gapp musste man nämlich seine Absicht, sich einen Baum zu holen, erst melden und ihn am Schluss natürlich dann auch bezahlen, dreißig oder vierzig Schilling waren das damals. Ganz schön teuer, sagte mein Vater; aber der Förster bestätigte Vater auch regelmäßig, dass er einen besonders schönen Baum gefunden habe. „Da Gimpi kennt sich da aus“, lachte er – und ich war da meistens sehr stolz auf meinen Vater. Befolgte man diese Regel nicht und wurde vom Förster Gapp ohne Anmeldung mit einem Christbaum im Wald erwischt, so galt man als Christbaumdieb. Es war also besser, sich erst gar nicht erwischen zu lassen.
Nur einmal haben auch wir uns einen zweiten Christbaum geholt, und das kam so: Wir waren damals mit dem Roller auf die Schattauhöhe hinaufgefahren – Vater hatte da schon im Sommer einen entdeckt und fand auch, was er wollte. Nun brachten wir also unsere Beute heim. Ich saß hinten auf dem Sozius und hielt den Christbaum fest in der Hand. „Halt dich aber ruhig“, sagte Vater, „die Straße ist eisglatt heute, damit es mich nicht verreißt.“ Vater fuhr langsam, als hätt ich hinter ihm den Nachttopf in der Hand gehabt.
Beim Lenzlbichl passierte es dann. Nun, so genau weiß ich das allerdings nicht mehr, wie es herging. Vater und ich lagen jedenfalls im Schnee, die Säge irgendwo mitten auf der Straße und beim Roller drehten sich noch die Räder.
Ich weinte, vor Schreck und weil unserm Christbaum einige Zweige abgebrochen waren. Dass ich ein bisschen blutete und aufgeschürft war, weil ich den Christbaum beim Sturz nicht aus der Hand gelassen hatte, machte mir weniger aus. Vater war blass vor Schreck, aber als er sah, dass mir nichts passiert war, lachte er nur. „Hats uns akkurat gschleudert“, meinte er und – mit Blick auf den ramponierten Christbaum: „Das macht nichts. Holen wir uns halt einen neuen!“
Den hatten wir dann auch überraschend bald gefunden, denn dieses eine Mal, erinnere ich mich, war Vater dann nicht ganz so wählerisch. Von dem Unfall, sagte er, erzählen wir besser niemandem, auch Mutter nicht, und dabei blieb es auch. Aber die Sache hat sich nun verjährt und ich denke, es ist Zeit, dieses Geheiminis heute zu lüften.
Auch dem Förster haben wir dann natürlich nur den einen Baum bezahlt und nichts von unserm Unfall erzählt. In diesem Fall wäre dies berechtigt, erklärte mir mein Vater, denn da war „höhere Gewalt“ im Spiel.
„Nicht schlecht, Gimpi, dein Baum“, sagte der Förster beim Zahlen dann, „nur ein bissl krumm! Gibst mir halt einen Zwanziger dafür!“ Billig diesmal, dachte ich für mich und triumphierte innerlich. – Wenn der Gapp wüsste, dass das bereits der zweite ist!
***
Ich komme jetzt auf meine eigentliche Geschichte zurück und den Ledergeschmack meines Christkindls, von dem ich gesprochen hatte.
Als Schuhmacher hatte mein Vater natürlich auch einen eigenen Lederraum. Dieser hatte für uns Buben seine eigene Mystik. Einmal von den verschiedensten Arten der Lederhäute abgesehen, die es da gab und die ja in sich schon faszinierende Möglichkeiten für alle möglichen Spiele boten, befanden sich dort aus mir heute noch unerklärlichen Gründen auch Vaters Jagdbücher, die er einst dem Bleistift-Fabrikanten Faber für ein Paar Goisererschuhe abgeluchselt hatte. Zwei dicke Bände: Die Hohe Jagd und Die Niedere Jagd wie ein ganzer Stapel von der Österreichischen Jagdzeitung oder wie sie hieß; so genau kann ich mich an die Titel nicht mehr erinnern. Vor allem aber war dieser Lederraum hinter der Werkstatt des Vaters auch der einzige Raum unserer Wohnung, den wir ganz für uns haben konnten – und natürlich bekamen wir auch die vielen Lederflecke und –streifen, die da abfielen, wenn er sich mit seinem scharfen Kneip hin und wieder die passenden Stücke aus den jeweiligen Häuten herausschnitt. Ja, sogar Nägel gab es in allen Größen und Formen, wie Hammer, den Locher, Beißzangen, Stichel und Werkzeug aller Art – Vater war da großzügig und hatte, aus der Zeit, wo er noch einen Gesellen hatte, zwei komplette Schuhmacher-Ausrüstungen: Wenn wir ihm nur versprachen, dann alles auch wieder an seinen Platz zurückzugeben, so war das schon in Ordnung. Auch Mutter durfte da nicht dreinreden, vonwegen „alles angeräumt“ und „furchtbarem Durcheinander da drin“, so dass man „nicht einmal mehr wüsste, wohin man den Fuß setzen sollte“. Vater befand, dass „ihnen das nicht zu gut“ ist „und basta damit!“
So gab es in unserer Wohnung also genaugenommen oft regelrecht zwei Werkstätten; die eigentliche, Vaters, draußen – wie unsere, hinten. Aber wir waren beide ganz bei der Sache und in unsere Arbeiten verbissen. Und wenn hin und wieder jemand in Vaters Werkstatt kam und sich bei ihm sein Herz ausschüttete oder auch nur den Zorn über irgend so ein „neues Glumpert“ von der Leber redete, so konnte man sich hinter der Tür da zuweilen Dinge anhören, das hätte man nicht für möglich gehalten! Sachen gab es mitunter, einfach unerhört und unbeschreiblich!
Nur einmal im Jahr war Vater in puncto Lederraum ganz auf Mutters Seite – zu Weihnachten eben. Da durfte nur Mutter hinein, und wir absolut gar nicht. Ja, der Lederraum wurde dann regelrecht abgeschlossen.
Das war genau dann, wenn der Christbaum und die Weihnachtskekse hineinkamen. Nun, an sich war das so schlimm auch wiederum nicht. Lange konnte man sich im Winter dort ja ohnedies nicht aufhalten, denn dieser Raum blieb immer ungeheizt – und gerade das machte ihn ja ideal für den Christbaum und die Kekse.
Und die Spitze von allem: Nun werkte „das Christkind“ da drinnen herum, „schmückte den Christbaum“ und bereitete die Pakete vor. – Ja, wenn man ganz großes Glück hatte, konnte man es zuweilen auch hören, wiewohl Vater uns dann mitunter belehrte, es wäre besser für uns, in dieser Zeit auch aus seiner Werkstatt hinauszugehen, „damit das Christkind im Lederraum hinten ruhig arbeiten könne“. Denn stören dürfe man es dabei auf keinen Fall und es wäre seiner Ansicht nach auch ratsam, wenn seine eigene, enge Werkstatt speziell zu Weihnachten möglichst in Ordnung bliebe. Das Christkind sehe so was gerne und das schlüge sich dann wohl auch bei den Geschenken nieder.
Das alles leuchtete einem ja auch vollkommen ein. Aber spannend war es schon zu wissen, dass da drinnen möglicherweise gerade das Christkind war.
Einmal aber musste Vater schnell auf die Post und ich brauchte ja auch nur ein paar Nägel. Er hatte seine Werkstatt wohl abgesperrt, aber den Schlüssel dabei stecken lassen. Und so stahl ich mich so schnell und leise wie möglich hinein. Die Nägel hatte ich bald, aber – was war das für ein Geräusch hinten im Lederraum gewesen? Da war doch wer?! Sollte da vielleicht jetzt, wo es so leise und weil der Vater grad weg war, das Christkind drinnen sein? Leise schlich ich zur Tür und spähte beim Schlüsselloch hinein. Es war nur eine Sekunde lang, dass ich drinnen etwas vorbeihuschen sah. Wirklich, da war jemand. Aber war das nicht Mutters Kittel gewesen? Und ihre Pantoffel? Vom Christkind konnten diese jedenfalls nicht sein! Ich war vollständig benommen, von dem wenigen, was ich da sah. Mäuschenstill schlich ich wieder bei der Werkstatt hinaus, schloss schnell die Tür ab und dachte erst noch einmal gründlich über alles nach. Als Vater bald darauf nach Hause kam, beichtete ich ihm die Nägel. „Ist schon gut“, sagte er, „aber hoffentlich hast du dabei nicht das Christkind gestört!“ „Nein, ich war ganz leise“, sagte ich, und fügte dem noch so nebenbei hinzu, ob er vielleicht wisse, wo Mutter sei?
„Mutter?“, fragte er, „Moment mal! Ach ja, einkaufen oder so was ist sie wohl gegangen; warum?“ „Ich hätte sie nur kurz gebraucht, aber das hat Zeit“, sagte ich und war auch schon wieder weg, damit er nicht merkte, wie ich rot im Gesicht wurde. Als ich Mutter später dann traf, erzählte sie von sich aus, dass sie einkaufen war. Aber sie hatte dieselbe Schürze an, die ich durch das Schlüsselloch gesehen hatte und auch ihre Außenschuhe, stellte sich dann heraus, waren staubtrocken. „Ach so“, sagte ich. Ich behielt die Sache für mich und erzählte nicht einmal Günther davon.
***
Am Heiligen Abend kam dann das Christkind. Aber so schnell wurde es nicht Abend. Alle möglichen Hindernisse waren da erst noch in Kauf zu nehmen.
Zunächst musste man an diesen Tagen ja besonders aufpassen, sich nur ja nicht daneben zu benehmen, weil sonst womöglich „das Christkind nicht kommt“ – und man ja so leichtsinnig kein solches Risiko eingehen wollte. Aber das war nicht einfach, weil man doch schon die ganze Zeit voller Aufregung war. Überdies war der Vormittag des 24. Dezember auch noch strenger Fasttag, es gab also kein Kletzenbrot, keine Kekse, nichts. Am Nachmittag, um zwei oder drei Uhr, wenn ich mich recht erinnere, ging man dann erst mal zur Weihnachtsandacht, auf die ich mich immer besonders freute. Erstens, weil diese bedeutete, dass es nun wirklich ernst wurde, und zweitens, weil diese Andacht immer mit dem „Wer klopfet an?“, dem Herbergslied, eröffnet wurde und damit wenigstens einmal im Jahr in der Kirche ordentlich geklopft und diese ganze Geschichte zudem auch im Wechselgesang anschaulichst vorgetragen wurde. Einfach wunderschön klang das von der Empore herunter und wenn man dazu noch auf den Nebenaltar hinübersah, auf die große Weihnachts-Krippe, das war damals schon was für Kinderohren und Kinderaugen!
Auch traf ich dann nach der Andacht immer auch meine Goden, die Tante Lisi und den Onkel, Tante Hilda und Onkel Sepp, denen ich „Gesegnete Weihnachten!“ wünschte und mit deren Paketen unter dem Christbaum ich bestimmt rechnen konnte. Und zwar waren das immer Pakl, die sich sehen lassen konnten!
Nach dieser Andacht fing dann die Liturgie, zu Hause, an. Erst hieß es, im Ofen ein ordentliches Feuer machen, mit großen Scheiten, damit wir davon dann eine richtige Glut, das heißt Kohlen für das „Rauchen“ bekommen würden. Letzteres war besonders spannend. Vater voran mit dem Glutkessel, aus dem ganz dick der Weihrauch quoll, wir in einer Art Prozession hintennachzottelnd, so zogen wir dann betend durch alle Zimmer des Hauses. Keine Ecke, kein WC und kein Keller wurde da vergessen, und auch die Holzhütte nicht. Zudem durfte ich meist „sprengen“, also das ganze Haus dabei mit Weihwasser bespritzen. Wenn das einmal gemacht war, dann lag Weihnachten wörtlich in der Luft, und es war das eine Erwartung, zum Zerreißen spannend.
Danach ging es ans Rosenkranzbeten, wie es sich eben für eine rechte Rauhnacht gehört. Das heißt also 50 Mal „Gegrüßet seist Du, Maria …“! – Ich erwähne das hier nur, damit man nicht vergisst, wie sich 50 „Gegrüßet seist Du, Maria …!“ zu Weihnachten auf zwei katholische Kinderknie auswirken … Auch Vater war da übrigens nicht immer ganz bei der Sache, wetzte mit den Knien hin und her und hatte Schwierigkeiten mit dem genauen Text obendrein. Aber mein Bruder passte schon auf und wenn Vater ins Schleudern geriet oder gar steckenzubleiben drohte, so sprang er prompt ein und half ihm nach. Ja, mein Bruder wartete schon förmlich darauf, dass der Vater ins Schleudern kam! Mutter schüttelte dann regelmäßig den Kopf.
Freilich war es damit noch lange nicht getan. Nach dem Rosenkranz kamen erst noch alle möglichen Extrafürbitten für alle möglichen und unmöglichen Verwandten und Bekannten; und da, muss ich sagen, war Vater immer ausgesprochen erfindungsreich – wie viele Verwandte und Bekannte wir nur hatten! Das nahm kein Ende – sogar „Freunde und Feinde“ wurden dabei stets bedacht. War man aber einmal so weit, so war man über den Berg. Ganz kurz wurde noch privat nachgebetet und dann war man – wie die Knie – erlöst.
Oft aßen wir anschließend darauf: Ganz früher „die Tunk“, d. h. eine Schüssel Schlagsahne, in die man, wie bei einem Fondue, sein Milchbrot tunkte und die uns alljährlich zu Weihnachten die Bichlhäusleut schenkten. Später die „frischen“ oder „schäpsernen“ Würstel, also letztere aus Schaffleisch gemacht. Und noch später, als die Zeiten schon besser wurden, oft ein Schnitzel oder einen Kalbsbraten, mit allem Drum und Dran – Mutter war ja eine hervorragende Köchin und legte sich da immer ins Zeug.
Dann aber war nichts mehr aufzuhalten. Dann kam das Christkind. Das war natürlich wiederum ein Drama für sich, einfach klassisch! Mit unzähligen Steigerungen – und verzögerten Momenten, aber natürlich zuletzt doch stets mit einem sagenhaft glücklichen Ende.
Damit das Christkind kommen und ungestört seine Arbeit verrichten konnte, musste natürlich erst einmal alles außer Haus; das war der obligate weihnachtliche Spaziergang bei uns, der Spaziergang der Spaziergänge schlechthin, jedes Jahr! Nur Mutter blieb zu Hause; sie musste ja auf das Essen aufpassen oder dieses wegräumen, damit Ordnung im Hause sei; das Christkind, erklärte sie, würde nur in ein aufgeräumtes Haus kommen. Später übrigens, im Nachhinein, fiel mir auf, dass auch Vater regelmäßig etwas vergessen hatte und, während Bruder und ich schon unterwegs waren, „nur noch für einen kurzen Moment“ wieder ins Haus zurückmusste. – Irgendjemand musste ja den aufgekränzten Christbaum vom Lederraum in die Wohnstube tragen; aber wie gesagt, das wurde mir erst lange später klar.
Sehr oft, erinnere ich mich, wurde bei diesen Spaziergängen mein Bruder aktiv und lenkte mich von meiner Ungeduld ebenso ab wie er sie steigerte. Er erzählte mir irgendwelche Weihnachtsgeschichten und war da ein Meister. Zwischendurch sah er das Christkind vorbeiflitzen. „Da, schau hin, schnell!“ sagte er. Aber es war dann natürlich in der Regel schon zu spät, denn ich hielt den Kopf immer in der falschen Richtung, ich sah nichts mehr davon. Oder er hatte, während ich mich auf seine Geschichten konzentrierte, plötzlich irgendetwas gehört: eine Pferdekutsche etwa und das entsprechende Geläut dazu. „Du nicht?“, fragte er dann etwas indigniert, „ja, sag einmal, hörst du denn nichts?“ „Nein“, sagte ich, was sollte ich denn sonst sagen, ich hatte wirklich nichts gehört. Ob wenigstens Vater etwas gehört hätte, fragte er dann. „Ja irgendwas“, sagte Vater, meistens hatte dann auch Vater etwas gehört. Manchmal freilich hatten wir beide Pech. Aber wenn Bruder was gesehen hatte, so war das im Grunde gar nicht zu verwundern. Sah man doch nun überall im Ort deutlich, dass da und dort in den Häusern schon das Christkind gekommen war. Überall in Rußbach kam jetzt das Christkind. Also musste es jetzt da sein; die Frage war nur, wann es endlich auch zu uns kommen würde.
Nie hatte ich etwas gesehen oder gehört. Nur einmal, glaube ich mich zu erinnern, habe dann auch ich gesagt, dass ich etwas gehört oder gesehen hätte, obwohl ich, ehrlich gesagt, nichts gesehen und gehört hatte. „Wirklich?“, fragte mein Bruder. „Hast du? Wo? Ich nicht. Bist du sicher, dass du dich da nicht getäuscht hast?“ Ich war mir natürlich nicht sicher, aber ich ließ seine Frage unbeantwortet im Raum stehen.
Wieder und wieder sah ich dann nach den erleuchteten Fenstern unserer Wohnstube. Und irgendwann ging dann tatsächlich auch bei uns das elektrische Licht aus und es brannten nur noch die Lichter vom Christbaum darin. Aber da war ich auch schon weg wie ein Pfeil – es war das ein einziger Reflex. Und keine fünf Pferde hätten mich zurückhalten können, so lief, nein, rannte ich dann heim.
Mutter stand oft schon vor der Tür, um mir – völlig unnötig – entgegenzurufen, dass das Christkind schon da sei. „Das habe ich ja selbst schon gesehn!“ – und ich stand auch schon drin. Ja, es war gekommen! Und wie!
Ob die andern dann nachkamen, oder ob sie schon früher drinnen waren und was sich sonst um mich herum abspielte, daran erinnere ich mich so genau nicht mehr. Aber anwesend waren sie wohl auch – denn später beim Singen und Paketeöffnen waren wir jedenfalls alle wieder beisammen.
Den Rest des langen Abends konnte man dann in vollen Zügen genießen. Mutter stellte die Weihnachtskekse auf den Tisch und wir durften uns darüber hermachen und herausfischen und essen, was und so viel wir nur wollten. Ach, Mutter konnte wunderbare Kekse backen! Vater holte ein Flasche Wein vom Keller und die beiden tranken ein Gläschen. Auch für Mutter ein Glas, darauf bestand er, aber bei ihr musste dann immer, zu seinem Entsetzen, auch Zucker hinein.
Dann hatte man endlich auch die Zeit, sich die Geschenke genauer anzusehen, sie anzuziehen oder sie auszuprobieren. Es war dies alles wunderbar, denn das Christkind wusste immer, was man dringendst brauchte oder sich auch gewünscht hatte. Und dass man „nicht alles haben konnte“, war auch klar – weil das Christkind ja „auch noch an andere Kinder denken musste …“
Oft blieben wir dann sogar bis Mitternacht auf, um uns erst das Turmblasen – das Weihnachtsblaskonzert vom Kirchturm aus – anzuhören und um schließlich in die Mitternachtsmesse zu gehen. Dort konnte man dann auch schon seine neuen Kleider tragen und sehen und erfahren, was die andern bekommen hatten. Die Weihnachtsmette selbst war stets ein sehr festliches Ereignis, bei dem ich aber entweder einen großen Kampf gegen den Schlaf führen musste oder sonst nicht ganz bei der Sache war. Zu sehr war ich in meinen Gedanken bei den Geschenken und kochte schon alle möglichen Pläne aus. Pfarrer Cölestin hatte gerne davon gepredigt, wir sollten über den vielen Geschenken das wirkliche Christkindl nicht vergessen.
Offen gesagt, so ganz geheuer war mir das nie. Denn vor Pater Cölestin hatte ich, schon damals, immer großen Respekt. Und das mit den „vielen Geschenken“ und dem „Vergessen des Wesentlichen“ – hatte er da vielleicht etwa mich gemeint?
***
Irgendwann später einmal fragte ich dann Günther, nur so nebenbei, ohne mir etwas anmerken zu lassen und nur um ihn auszuhorchen, ob er an das Christkind glaube. Günther sagte zunächst gar nichts, sah mich nur etwas verdutzt an, kratzte sich dann ein paar Mal dort, wo man sich nicht kratzen sollte, und meinte: Also soviel könne er mir verraten, dass mit dem Glöckchenläuten etwas nicht stimme und er hundertprozentig wisse, dass das seine Mutti wäre. Er hätte sie nämlich gesehen. „Hundertprozentig, fragte ich ihn?“
„Hundertprozentig“, sagte er, „ich schwör dirs. Es darf ein Höllenloch unter uns reißen, wenn es nicht so war“, versicherte er.
Nichts passierte; wir saßen beide immer noch fest auf den Wurzeln der Kirchenlärche. „Und was hat sie dann gesagt, als du ihr gesagt hast, dass sie das war?“
Günther fingerte sich erst einmal den Nasenstüber herunter und sagte dann: „Nichts. Denn ich hab ihr ja nicht erzählt, dass ich grad in der Kellerspeis unten unter der Stiege gewesen bin, als sie oben bei der Haustür hinausbimmelte. Konnte ich ja gar nicht. Sonst wär sie mir draufgekommen, dass ich ihre Vanillekipferln ausprobiert hab.“ – „Eh nur ein paar, sagte er“. „Und außerdem, habe ich mir gedacht, pass ich erst in Zukunft noch ein bisschen besser auf; dann weiß ich es tausendprozentig, alter Knabe“, fügte er dem etwas spöttisch hinzu und ein bisschen von oben herab.
Ich war beeindruckt – obwohl Glöckchen bei uns, ehrlich gesagt, nie geläutet hatten. Aber auch ein bisschen verärgert. Denn so aufpuddeln hätte er sich deswegen vor mich dennoch nicht müssen. Wenn ich es nämlich genau betrachtete, war ich nicht selbst erheblich näher dran?!
„Hör zu“, sagte ich. „das ist gar nichts!“ Und ich erzählte ihm meine Geschichte. Günther vergaß auf Kratzen und Nasenbohren und machte nur noch Augen. Hundertprozentig, schloss ich, könne ich es natürlich nicht sagen, aber zu 95% bin ich mir dessen sicher.
Aber diese letzten Bedenken ließ Günther nicht gelten. Für ihn war der Fall klar. „Das Christkindl ist bei mir meine Mutti und bei dir deine Mami“, sagte er. „Aber wie gehen wir das an, dass wir da auch ganz sicher sind, ich meine tausendprozentig sicher“, murmelte er und kratzte sich, diesmal in der Stoppelfrisur.
Da blitzte es, ausnahmsweise, auch einmal bei mir auf: „Wir sagen nichts. Wir lassen sie glauben, dass wir immer noch ans Christkindl glauben und passen weiterhin auf“, sagte ich.
„Abgemacht, alter Knabe“, sagte er, „wir lassen sie weiterhin Christkindl spielen!“ „Eingeschlagen“' sagte ich und es klatschte, dass die Hand brannte.
Und so glauben wir beide heute noch an das Christkindl. Er an seine Mutti, ich an meine Mami. Tausendprozentig!
Wurim
(1994)
Was ein Wurim ist, wird vermutlich nicht jeder wissen. Ein Wurim ist nämlich a Wuarm – auf gut Gosingerisch. – Also nach der Schreibe gesprochen und damit‘s auch jeder Schicky-Micky vom Burgtheater versteht: ist nicht mehr und nicht weniger als ein hundsgewöhnlicher Gosauer Wurm.
Wie nun ausgerechnet ich auf so einen Gosauer Wurm gekommen bin, das möcht ich euch erzählen. Dummerweise hat meine Geschichte freilich den Haken, dass ich erst grad auf keinen Wurm gekommen bin.
Doch muss ich da zunächst etwas weiter ausholen. Wie jede Rußbacher Schnapsidee höherer Potenz nimmt auch diese ihren Ausgang vom Dorfstüberl. Günther glaubte nämlich wieder einmal bemerken zu müssen, dass ich außer Urlaubmachen eh nichts zu tun hätt, woraus er nach eurem Stamperl auf seine Rechnung dann auch gleich folgerte, dass ich tags darauf Sepp und Rudi beim Fischen Gesellschaft leisten würde. „Morgen um vier“, beschloss er kurz, ehe ich überhaupt zum Luftschnappen für den Gegenangriff ansetzen konnte. „Einen trinken wir aber noch darauf.“
Zugegeben, nicht nur der Obstler, auch die Idee hatte es in sich. Denn wenn ich eigentlich auch absolut keine Zeit hatte, so hatte er mich damit ja doch schon an die Angel bekommen. Gibt es ein schöneres Fischwasser als den Vorderen Gosausee? Mein Bedenken, dass ich dort dann ja eigentlich nichts zu tun hätte, wischte Günther wie ein verschüttetes Bier vom Tresen. „Was willst du, allein die Unterhaltung und die Natur sind doch schon Programm genug!“ Und außerdem hätte er heute nicht mehr Zeit, sich mit mir da noch lang herumzustreiten. Er mache Sperrstunde. Und ich müsse ohnedies schlafen gehen, damit ich morgen früh genug aus den Federn käme.
Pünktlich um fünf fand ich mich also tags darauf wie verabredet bei Rudi ein. Das Wetter sah nicht gerade ermunternd aus. Es nieselte und Nebelschwaden hingen ins Gamsfeld herein. Nach einer halben Stunde kam auch Sepp dahergezottelt. Zu meinem Glück war auch bei ihm die Sonnenuhr ein bisschen nachgegangen und zu guter Letzt musste auch Rudi erst noch einen halben Ofen aufsetzen. Mit andern Worten, ich fand mich in bester Gesellschaft.
Es begann bald vollends zu regnen. Wäre es nicht doch gescheiter, mich unter einem dieser herrlichen und warmen Kachelöfen zu verkriechen, von denen in Rudis Betrieb fast in jeder Ecke einer so einladend herumstand? Ich schürte Zweifel und Kati tröstete mich und stand mir bei. Aber die Fischer ließen nicht locker. Erstens würden sich die Wolken ohnedies bald verziehen und zweitens, behaupteten sie, „beißen sie heute“. Kati und ich sahen bald ein: Es hatte keinen Sinn, dagegen mit einem noch so vernünftigen Argument zu kommen.
Die Fischer, das weiß ich nun, haben eines mit den Jägern gemein: Sie lügen, dass sich die Stoßstangen biegen. Wenn ich in meiner Erinnerung die kurze Fahrt bis zum Gosausee an mir vorbeistreifen lasse, so wundere ich mich eigentlich, dass man bei den EU-Verhandlungen nicht eigens auch die Fangquoten der Fischer vom Gosausee festgelegt hat. Wenigstens den Walfang dort hätte man ihnen verbieten müssen und Forellen, die länger als drei Meter sind, sollten sie tunlichst wieder zurück in den See zu werfen haben – für Gossy, die Schwester von Nessy, die die beiden natürlich auch sehen, wenn sie sich, bei leichtem Nebel, versteht sich, zwischendurch einen dreiviertelzentnerschweren Setzling zwischen die Zähne klemmt, um dann samt ihrem Blinker, Senkblei und Kescher in die Untiefen des Gosausees abzuzischen.
Zugegeben, nicht ganz so, aber doch so ungefähr klingt das. wenn einem die beiden erzählen, was sie schon alles gefangen oder fast schon gefangen haben.
Wir stehen schon am Gosausee, da bemerken die beiden Herren, dass sie ja auch einen Köder brauchen! Und da ihnen anderes zum Frühstück für die Fische nicht eingefallen sei, müsste erst ein Fischerl her – ohne Fischerl keine Fische, logo. Ich hätte natürlich jetzt etwas zynisch werden können, aber weil ich unter Freunden eben ein ausgesprochen mitleidiges Wesen bin und um ihnen meinen hohen Erwartungsdruck zu ersparen, beschließe ich, ihnen also wenigstens die Schmach meines etwas mitbetroffenen Zusehens dabei nicht anzutun. „No Problem“, sag ich, „ich hol euch Regenwürmer“ und halte mich plötzlich für den wichtigsten Mann der ganzen Partie.
Womit ich denn auch schon bei den Wurim wär. Regenwürmer nehmen bekanntlich nicht gerne Sonnenbäder, sondern haben es gerne feucht. Aus eben demselben Grunde lieben sie aber auch keine steinigen Böden und am allerwenigsten Kalkgestein. Dass wir uns zudem am Ende eines Jahrhundertsommers befanden, machte die Sache noch einmal verwickelter. Man muss die Schuttkegel im Gebiet des Gosausess kennen, um zu verstehen, wie aussichtslos es von vorneherein war, da oben auch nur irgendein Wurmerl zu finden. So pirschte ich mich denn auch von vornherein möglichst nahe an den Bach heran und es war mir auch klar, dass ich womöglich ein gutes Stück talwärts musste. Es blieb dort also bald kein Stein mehr auf dem andern und jedes Bloch und jeder Knüppel wurde aufgedreht. Aber ich fand buchstäblich nichts. Absolut nichts. Und so war ich es nun bald, der unter Zeit- und Leistungsdruck geraten war. Wenn mich nicht bald ein paar Würmer anspringen, dachte ich, die lachen sich die Bäuche kaputt dort oben …
Und siehe da! Förmlich in letzter Minute schien sich tatsächlich der Zufall meiner zu erbarmen. Vor mir öffnete sich nämlich urplötzlich eine gewaltige Baustelle, das Ende einer noch riesigeren Narbe, die einige Barbaren der Freizeitindustrie in Gestalt einer Skipiste brutal in die dort einst so unberührte alpine Natur geschlagen hatten. Und am unteren Ende dieser Ökokatastrophe, an der Talstation also, lachte mir das zweifelhafte Glück. Die Liftanlagen waren noch kaum fertiggebaut und Schubraupen hatten da und dort immer noch den Boden aufgebrochen und an einer Stelle die wenige Erde sogar zu einem Haufen aufgeschüttet. Wenn es in dieser ganzen Gegend überhaupt Würmer geben sollte, dann da. Ja, sogar ein Spaten lachte mich bald an. Er lehnte an einem Kiosk, an dem drei Männer herumhantierten, damit beschäftigt, noch vor Ausbruch der Wintersaison für die großen und kleinen Nöte ihrer Gäste ein schmuckes Häusl zu bauen. Da sie die Schaufel im Moment ohnedies nicht brauchten, liehen sie mir diese denn auch gerne und fragten mich auch gar nicht weiter danach, wofür. Wie ein Berserker und mit der Besessenheit eines Verzweifelten grub ich nun die Erde in diesem Haufen um. Aber vergebens abermals – als wären die Würmer allesamt ausgestorben. Nicht ums Verrecken hatte sich hier auch nur einer meiner erbarmt.
Resigniert gab ich also schließlich den Spaten zurück und bedankte mich. „Nichts zu danken“, meinten sie, wollten aber nun doch gerne wissen, was ich denn eigentlich „in dem Dreckhaufen dort“ gesucht hätte. Sie hatten mich offensichtlich beobachtet und mein Verhalten kam ihnen etwas spanisch vor. Ich gebe zu: Ein plötzlich auftauchender Mensch, der wie ein Wilder mit einem Spaten über einen Erdhaufen herfällt und zwischen den Flüchen nur „Ja, spinnst du? Das gibts nicht! Mensch, das gibts nicht!“ von sich gibt, musste ja auch etwas stutzig machen. „Regenwürmer“, antwortete ich. Ach so, meinten sie. Regenwürmer gebe es da natürlich in der ganzen Gegend keine, das hätten sie mir gleich sagen können. Sie bemühten sich dabei gar nicht, ihr Schmunzeln zu unterdrücken. „Ja, sind Sie denn ein Forscher?“, fragte mich dann der Älteste unter ihnen, weil ihm meine Erklärung so gar nicht in den Kopf gehen wollte. „Nein, warum?“, sagte ich, zumal ich nun meinerseits mit seiner Frage wenig anfangen konnte – „Regenwürmer, zum Fischen.“ „Zum Fischen?“, schnappte er ein. Er konnte es kaum fassen. Mit einem Schlag war ich ihm interessant geworden. „Wo, wie“, drängte er nun plötzlich nach, als hätte er etwas spitz bekommen und auch die zwei andern schienen sich plötzlich auszukennen. „Ja, haben Sie denn eine Karte?“ Nein, ich nicht, gab ich zu, aber meine beiden Freunde da oben, am Gosausee.