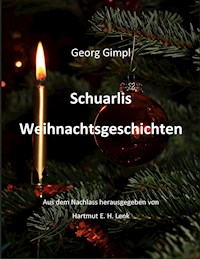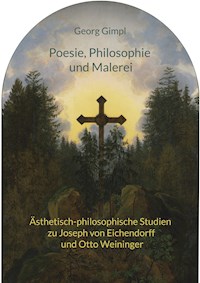
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Band enthält zwei umfangreichere Studien aus dem Nachlass des 2014 verstorbenen Autors. Die eine, verfasst 1993, befasst sich mit Joseph von Eichendorffs Roman "Ahnung und Gegenwart" (1815), die andere, etwa 2003 geschrieben, mit Otto Weiningers Buch "Geschlecht und Charakter" (1903). In beiden Studien geht Georg Gimpl dem Einfluss der jeweils zeitgenössischen Malerei auf die Texte und ihrer Einbettung in die Philosophie ihrer Zeit nach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Foto von Georg Gimpl
Curriculum vitae
Bemerkenswerte Texte bemerkenswerter Autoren
Vorbemerkungen des Herausgebers
Verzeichnis der Veröffentlichungen
Nachruf auf Dozent Dr. Georg Gimpl
Bild vor Bild
die Wunderdonau hinab.
Joseph von Eichendorffs
Roman an die Nation (1993)
1.
Wallfahrten
in Natur und Kunst. Die Lukasbrüder
2.
Die Maler und Bilder von
Ahnung und Gegenwart
2.1 Die Maler und Malerinnen des Romans
2.2 Bildschöne Seelen
2.3 Bilder, konkret
2.4 Kulissen
3.
Hieroglyphen
4.
Und alles drängt
zu Gott
5.
Philosophie gegen Philosophie
6.
Die Deutschrömische Schule der österreichischen Philosophie
7.
Taugenichtigkeiten
Geschlecht und Ästhetik
(
ca. 2003)
I.
Das Elend des Dissertanten: von Freud zu Jodl – von der Biologie der Geschlechter zur Biologie der Ideale
Introspektion und Typos – zur methodologischen Wende Weiningers: vom Labor ins Kaffee Griensteidl
II.
Theorie der Heniden. Zur differentiellen Psychologie des männlichen und weiblichen Bewusstseins
III.
Erotik und Ästhetik
„Was ist schön?“
Platonisch
und
engelrein
. Die Ästhetik von M
„Was ist hässlich?“
Sinnlich
und
versaut
– die Ästhetik von W
Der Streit um Klimt und die „Philosophie“ – Friedrich Jodl und Otto Weininger
Friedrich Jodl: „Nicht das Nackte auf dem Bilde, sondern das Hässliche wird von uns angefochten“
Otto Weininger – nackt und hässlich!
IV.
Also sprach Weininger – oder der antisezessionistische Stil von
Geschlecht und Charakter
Anhang
Georg Gimpl, 17. September 2014 (Foto: Hartmut Lenk)
Curriculum vitae
1949
Geboren in Abtenau, Land Salzburg, Österreich, als zweites Kind von Georg und Frieda Gimpl.
1955–1961
Kindheit und Volksschule in Rußbach, Land Salzburg.
1961–1968
Gymnasialausbildung am Borromäum und Akademischen Gymnasium in Salzburg. Abschluss mit Auszeichnung.
1968–1975
Studium der Philosophie, Psychologie sowie Deutsche Sprache und Literatur an der Paris-Lodron-Universität Salzburg.
1975
Mag. phil. in Deutsche Philologie und Philosophische Propädeutik, Paris-Lodron-Universität Salzburg.
1980
Promotion zum Dr. phil. in Deutsche Philologie und Psychologie. Dissertation:
Form als Dementi. Text- und Strukturanalyse des „Tractatus Logico-Philosophicus“
. Paris-Lodron-Universität Salzburg.
1975–1978
Gesamtleiter und pädagogischer Leiter der Intersport-Lehrlingsschule in Wels (Österreich). Verantwortlich für die Entwicklung des Curriculums.
1975–2014
Lektor für deutsche Sprache und österreichische Literatur an der Universität Helsinki, Finnland – ab 1981 in Festanstellung, ab 2004 als Universitätslektor.
1991–2014
Dozent für Ideen- und Wissenschaftsgeschichte an der Universität Oulu, Finnland.
1993–1995
Stellvertretender Assistenzprofessor für Germanische Philologie an der Universität Helsinki.
Bemerkenswerte Texte bemerkenswerter Autoren
Vorbemerkungen des Herausgebers
Georg Gimpl, am 26. Mai 1949 geboren, wuchs als Sohn eines Schumachers in Rußbach im Salzkammergut auf. Der intelligente Junge wurde bald auf eine Schule der Jesuiten in Salzburg geschickt. In der Regel mit dem Fahrrad fuhr er am Wochenende zu seinen Eltern ins fast 55 km entfernte Rußbach: in Richtung seines Heimatdorfes die meiste Zeit bergan, am Sonntagabend dann in oft hohem Tempo Richtung Salzburg bergab.
Ende der 1960er Jahre begann Georg Gimpl sein Studium an der Paris-Lodron-Universität Salzburg. Als Student verdiente er sich in den Ferien als Kellner sein Geld in der Schweiz, nahe der Eiger Nordwand; später, ab dem Frühjahr 1975, also kurz vor Abschluss seines Studiums, dann mehrere Jahre in der Lehrlingsausbildung bei Intersport.
„Die INTERSPORT-Lehrlingsschule dient der Schulung von Lehrlingen, welche in der Ausbildung zum Sportartikel-Fachhändler stehen, und umfasst eine jährliche 4-wöchige Ausbildung durch 3 Jahre hindurch.
Dies bedeutet, daß Herr Mag. Gimpl durchschnittlich 12 – 14 Wochen im Rahmen dieser Lehrlingsschule tätig ist.
Herr Mag. Georg Gimpl war maßgeblich am Aufbau dieser Lehrlingsschule beteiligt und es ist seinen pädagogischen und menschlichen Qualitäten zu verdanken, daß die INTERSPORT-Lehrlingsschule als freiwillige Schule einen großen Aufschwung nahm und sich zunehmender Bedeutung erfreut“,
heißt es in einem Zeugnis des Schulleiters Dr. Schwab, gerichtet an den Leiter des Germanistischen Instituts der Universität Helsinki, Prof. Kaj B. Lindgren, vom 19. Jänner 1978.
Sein Studium schloss Georg Gimpl am 8. Juni 1975 als Magister der Philosophie (mit den Hauptfächern Deutsche Philologie und Philosophie) ab. Fünfeinhalb Jahre später, am 30. Dezember 1980, wurde er dort mit der Arbeit „Form als Dementi. Text- und Strukturanalyse des ‚Tractatus logico-philosophicus‘“ von Ludwig Wittgenstein zum Doctor philosophiae promoviert. Bevor ihn seine Wege 1975 nach Finnland führten, verbrachte er fast ein Jahr in Island.
Im Jahre 1975 war der 1919 geborene Lektor für deutsche Sprache an der Universität Helsinki Dr. Ferodoro Nikolowski überraschend verstorben. Wie der damalige Ordinarius für germanische Philologie und Leiter des „Deutschen Instituts“ der Universität Helsinki, Prof. Dr. Kaj B. Lindgren, in seinem Besetzungsvorschlag an die damalige Historisch-sprachwissenschaftliche Abteilung der Humanistischen Fakultät der Universität Helsinki vom 9. Februar 1981 (s. Abbildung 1) rückblickend schrieb, hatte er sich 1975 schriftlich an seine Amtsbrüder an den Universitäten Wien, Innsbruck und Salzburg gewandt, um möglichst schnell eine geeignete Person für die Wahrnehmung der verwaisten Lektorenstelle zu finden. „Als Ergebnis der Erkundigungen blieb als einzige geeignete Person, die die Stelle anzutreten bereit war, der damalige Magister Georg Gimpl, der seither die Lektorenstelle hier wahrgenommen hat. Er hat alle seine Aufgaben auf hervorragend gute Weise erfüllt, sowohl die Institutsleitung als auch die Lehrerkollegen und die Studierenden sind mit ihm sehr zufrieden. Auch die Botschaft und andere die Kulturbeziehungen pflegende Experten halten ihn für eine gut geeignete Person für diese Stelle. Unter diesen Umständen erachte ich seine Festanstellung in diesem Amt als Vorteil für die Universität.“ [Übersetzung von mir – H. L.] Dieser Vorschlag hatte erst nach dem Abschluss der Promotion von Georg Gimpl erfolgen können, und der Verfasser „glaube auch nicht, dass eine neue Erkundigung in Österreich ein besseres Ergebnis zeitigen würde, denn eine andere so geeignete Person wird man kaum finden können“.
Abb. 1: Brief von Prof. Kaj B. Lindgren an die Historisch-sprachwissenschaftliche Abteilung der Humanistischen Fakultät der Universität Helsinki vom 09.02.1981. Quelle: Privatarchiv.
Neben einigen sprachpraktischen Kursen gehörten schon von der Definition der Stelle her literaturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen zu den Schwerpunkten des Unterrichtsprogramms von Dr. Gimpl. Da die finnische Germanistik vor allem sprachwissenschaftlich orientiert war (und zu einem großen Teil immer noch ist) und da die StudienanfängerInnen aus der Schule in der Regel nur geringe Kenntnisse der Literatur der deutschsprachigen Länder mitbrachten, eröffnete er für viele seiner Kursteilnehmenden neue Horizonte. Als Lehrer stellte er hohe Forderungen an die Leistungsbereitschaft der Studierenden. Natürlich führte das dazu, dass sich an ihm die Geister schieden. Auch im Kollegenkreis und in der Hochschulpolitik setzte er sich für eine stärkere Berücksichtigung der Literatur und der Literaturwissenschaft in der germanistischen Lehre und Forschung ein. Die öffentlichen Kontroversen, die auf wissenschaftlichen Konferenzen, aber z. B. auch in Vorträgen etwa im Goethe-Institut Helsinki ausgetragen wurden, sind vielen, die dabei gewesen sind, noch in lebhafter Erinnerung – nicht zuletzt auch wegen ihres von finnischer Zurückhaltung oft deutlich abweichenden polemischen Stils, dessen sich Georg Gimpl schon als Student befleißigte: In seiner mit der Bestnote bewerteten pädagogischen Abschlussarbeit zum Thema „Zeitgenössische Probleme der Pädagogik und ihr bildungspolitischer Niederschlag“ formuliert der Vorsitzende der Prüfungskommission, Univ.-Professor Dr. Rudolf Gönner, in seinem Gutachten u. a. Folgendes:
„Der Verfasser analysiert die neuralgischen Punkte des Bildungswesens und gelangt, versehen mit einem guten fachlichen Rüstzeug, zu recht guten Gedankengängen und Überlegungen, die der Tiefe nicht entbehren (gelegentliche Polemik jedoch enthalten und ab und zu gar „flotter“ Stil). Die Stellung des Erziehungswesens im gesellschaftlichen Rahmen wird gut herausgearbeitet, die Weite der Problemstellungen erkannt und betont. Kulturphilosophische Aspekte sind an richtiger Stelle verfolgt. Der Verfasser ist in den einschlägigen Fragen belesen, entwickelt aber durchaus eigene und z. T. interessante Betrachtungen.“1
Diese Formulierungsgewohnheiten, die sich auch in den hier veröffentlichten Nachlasstexten zeigen, schlugen sich auch in einigen seiner hochschulpolitischen und kultur- und wissenschaftsgeschichtlichen Publikationen nieder. Dr. Gimpl war eben auch ein aktiver Forscher, obwohl die Aufgaben eines Lektors nach damaligem Recht dafür keine Verpflichtung und auch keine Arbeitszeit vorsahen. Die Gewinnung und Veröffentlichung von Forschungsergebnissen wurde in Bezug auf (speziell: ausländische) Lektoren von Seiten der Universität damals eher als persönliche Angelegenheit, als Hobby betrachtet. Dies galt erst recht, wenn sie sich disziplinär auf einem „Nebengleis“ der Germanistik, wie im Falle Dr. Gimpls in der Ideengeschichte und Philosophie, ansiedelte. Die ihm am heimischen Institut mitunter versagte Anerkennung seiner Leistungen in der Forschung auf diesem Gebiet erwies sich indes als Ansporn bei der Etablierung eines weiten internationalen Netzwerkes und für neue Projekte.
Es war daher keineswegs überraschend, dass Dr. Georg Gimpl zu den ersten Lektoren gehörte, die sich im Jahre 2004 um eine Umberufung auf das neu geschaffene Amt des Universitätslektors bemühten. Zu den Aufgaben eines Universitätslektors gehörten sowohl Aktivitäten in der Forschung (die auch in der Arbeitszeitplanung bilanziert wurden) als auch die Betreuung von Magister- bzw. später Masterarbeiten und von Dissertationen. Bereits im Juli 1991 war Dr. Gimpl an der Universität Oulu im Norden Finnlands zum „aate- ja oppihistorian dosentti“ (Privat-Dozent für Ideengeschichte) ernannt worden.
Ende Mai 2014 war Georg Gimpl 65 Jahre alt geworden. Das Mindestalter für den Renteneintritt hatte er zu dieser Zeit längst erreicht. Das finnische Arbeitsrecht erlaubt aber eine Fortsetzung der Erwerbstätigkeit bis zur Vollendung des 68. Lebensjahres (für nach 1961 Geborene bis zum 70. Geburtstag). Georg Gimpl genoss die Möglichkeit, weiterhin in Lehre und Forschung tätig zu sein, zugleich aber die Möglichkeit zu haben, das Arbeitsverhältnis mit der Universität jederzeit beenden zu können und die Rente zu beziehen.
Für den Beginn des Studienjahres 2014/15 hatte sich Georg Gimpl eine knapp zweimonatige Befreiung von den Lehrverpflichtungen zugunsten eines Forschungsvorhabens gesichert. Er hatte sich vorgenommen, das Projekt eines virtuellen Dorfmuseums seines Heimatortes Rußbach am Pass Gschütt im Salzkammergut entscheidend voranzubringen. Schon seit Jahren hatte er dafür Material gesammelt, war bei den Dorfbewohnern von Haus zu Haus gegangen, hatte alte Fotos digitalisiert und diverse Urkunden und Archivdokumente kopiert und studiert. Nicht zuletzt seine gute Vertrautheit mit dem Lateinischen bot ihm dafür beste Voraussetzungen. Vorträge, die er im Rahmen seines Projekts vor den Ortsansässigen und anderen Landsleuten hielt, waren auf reges Interesse gestoßen, und auch die Kolleginnen und Kollegen aus vieler Herren Länder, mit denen gemeinsam Georg Gimpl in Helsinki regelmäßig Mittag zu essen pflegte, waren aufmerksame und ermutigende Zuhörer seiner inoffiziellen Forschungsberichte. Zu diesem Kreis, dem auch ich angehörte, zählten Kolleginnen und Kollegen aus Finnland (mit Finnisch und Schwedisch als Muttersprache), aus England und Schottland, aus Tschechien und dem Libanon, aus Island und Deutschland.
Am 17. September 2014 reiste Georg Gimpl in seine österreichische Heimat ab. Ich hatte gerade die Vertretung einer der beiden Germanistik-Professuren und die Leitung des Fachgebiets übernommen. Um die Kolleginnen und Kollegen für die Studierenden besser sichtbar zu machen, planten wir eine Fototafel, wie sie auch andere Fachbereiche in den Fluren aushängten. Daher nahm ich meinen Fotoapparat zum Mittagessen mit und bat Georg Gimpl, einige Aufnahmen von ihm machen zu dürfen. Er willigte gern ein und befand einige der Schnappschüsse auch für gelungen. Niemand von uns ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass dies die letzten Fotos sein sollten, die von unserem Kollegen gemacht würden.
Als Mitglied der Forschergemeinschaft CoCoLaC (Comparing and Contrasting Languages and Cultures2), der auch Dr. Georg Gimpl angehörte, veranstaltete ich am Freitag, dem 14. Oktober 2014 gemeinsam mit meiner Kollegin aus der Italianistik ein Symposium zum Thema Sprache im Comic mit Gästen aus mehreren europäischen Ländern.3 Am Tag zuvor erfuhr ich von der Institutssekretärin, dass Dr. Gimpl mit einer schweren Erkrankung in ein Spital eingeliefert worden sei. Als ich mich am Morgen nach dem Symposium bei seiner Ehefrau Pirkko Sallinen-Gimpl (1940–2022) nach dem Befinden von Georg erkundigen wollte, erfuhr ich die schreckliche Nachricht, dass er am Tage zuvor verstorben sei. Diese Nachricht wirkte im Kollegenkreis und bei den Studierenden wie ein Schock. Die Betroffenheit und Erschütterung waren groß.
Dabei hatte Dr. Gimpl in Forschung und Lehre doch noch so spannende Vorhaben. Für das Frühjahr 2015 war z. B. eine Vorlesungsreihe mit dem Titel „Finnland von Krieg zu Krieg. Zur deutschsprachigen finnischen Informations- und Propagandaliteratur während des zweiten Weltkriegs“ angekündigt, in der wohl auch manch unbequeme Wahrheit zur Sprache gekommen wäre.
Das umfangreiche Material, das Dr. Gimpl für das virtuelle Museum seines Heimatortes Rußbach gesammelt hatte, ist von dreien seiner Jugendfreunde teilweise publiziert worden.4 Der Band war sehr schnell vergriffen.
Im Nachlass von Georg Gimpl fanden sich auch zwei längere, bislang unveröffentlichte wissenschaftliche Texte, um deren Edition mich seine Witwe und sein Sohn Martin baten. Die Texte lagen mir lediglich als Kopie eines Papier-Ausdrucks, nicht als elektronische Datei vor. Sie mussten also eingescannt und bearbeitet werden. Der eine, zum Roman Ahnung und Gegenwart von Joseph von Eichendorff, enthielt im Fußtext als Datumsangabe den 3. Oktober 1993, wies aber einzelne handschriftliche Korrekturvermerke auf. Georg Gimpl hat ihn also offensichtlich später noch einmal zur Hand genommen und redigiert. Der andere, eine Studie zu Otto Weiningers Geschlecht und Charakter, ist später entstanden, wahrscheinlich 2003, wie man schließen kann, wenn man die im Text erwähnten Tagungen und Quellen berücksichtigt. – Die zahlreichen Verpflichtungen als (ab 2017 einzig verbliebener) Germanistik-Professor und Fachverantwortlicher an der Universität Helsinki (von 2014 bis 2021) ließen mich erst nach der Emeritierung dazu kommen, mich mit der Vorbereitung dieser Texte für die Publikation zu befassen.
Natürlich stellte sich mir auch die Frage, ob eine Publikation nach nunmehr fast zwanzig bzw. dreißig Jahren noch gerechtfertigt sei. Wenn man bedenkt, was diese beiden Texte inhaltlich vereint, so kann man diese Frage durchaus positiv beantworten. Es handelt sich um Texte über wichtige Arbeiten von zwei sehr einflussreichen Autoren ihrer Zeit. Dass sich ein katholisch sozialisierter Ideenhistoriker aus Österreich intensiv mit Joseph von Eichendorffs Frühwerk auseinandersetzt, liegt vielleicht nahe. Warum eine Beschäftigung mit dem streckenweise misogynen und antisemitischen Text Otto Weiningers aufgrund seiner bemerkenswerten kulturellen Wirkungsgeschichte sinnvoll und erforderlich ist, begründet Georg Gimpl selbst am Ende seiner Analyse.
Gemeinsam ist beiden Texten in einem allgemeineren Sinne ihr interdisziplinärer Zugriff, der literaturwissenschaftliche bzw. philosophische Fragestellungen mit kulturhistorischen und ideengeschichtlichen Ansätzen sowie einer gründlichen Textanalyse verbindet, und im Speziellen, dass der Einfluss der jeweils zeitgenössischen Malerei, der sich in den Texten manifestiert, eine zentrale Rolle spielt. Eine solche Berücksichtigung der Malerei im verbalen Text wird in der Geschichte der Literaturwissenschaft schon seit längerem mit dem Begriff der Intermedialität5 bezeichnet und ist mit dem Begriff der Multimodalität6 in der Medienwissenschaft und -linguistik kompatibel. Die Zusammenhänge, denen Georg Gimpl in den beiden hier publizierten Texten nachgeht, sind also von hoher wissenschaftlicher Aktualität; sie sind des Bemerktwerdens würdig, sie sollten von der Gemeinschaft der Forschenden wahrgenommen werden können.
Für die Veröffentlichung wurden, einer besseren Lesbarkeit zuliebe, alle Endnoten in Fußnoten umgewandelt. Ebenfalls in die Fußnoten wurden ein Verzeichnis der Abkürzungen integriert, das dem Weininger-Text nachgestellt war. Generell erfolgen alle Literaturangaben in den Fußnoten – so, wie es vom Autor vorgesehen war. (Auf ein nachgestelltes Literaturverzeichnis wird verzichtet.) Die konkrete Zitierweise in den beiden Texten wurde für die Publikation in diesem Band einheitlich gestaltet.
In den beiden mir vorliegenden Typoskripten verzichtete Georg Gimpl auf die Verwendung des Buchstabens ß. Ich habe ihn überall dort eingesetzt, wo er in den originalen Quellen vorhanden war und wo es nach den heute geltenden orthographischen Regeln gefordert ist. Auch bei der Groß- und Kleinschreibung, etwa bei Fügungen wie im Besonderen, im Folgenden oder im Einzelnen, wurde der reformierten Orthographie von 1996/2006 gefolgt. Ansonsten habe ich bei Eingriffen in den Text größte Zurückhaltung geübt. Nur offensichtliche Fehler wurden (stillschweigend) korrigiert, nur ganz vereinzelt habe ich um einer besseren Verständlichkeit des Textes willen in die Formulierung eingegriffen. Der für Georg Gimpl typische Stil blieb durchweg erhalten.
1 Bundesstaatliche Prüfungskommission für das Lehramt an höheren Schulen in Salzburg, Anlage zum Brief an Dr. Georg Gimpl vom 11. Mai 1988, Gutachten zur Hausarbeit von cand. phil. Georg Gimpl vom 4.12.1973. Quelle: Privatarchiv.
2https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/comparing-and-contrasting-languages-and-cultures(letzte Verifizierung 14.03.2022)
3 Vgl. Lenk, Hartmut E. H. / Suomela-Härmä, Elina (Hrsg.): Sprache im Comic – Il linguaggio dei fumetti – La lengua de los cómics. (Mémoires de la Societé Néophilologique de Helsinki; XCVIII). Helsinki 2016.
4 Gimpl, Georg: Mein Rußbach. Herausgegeben von Peter Hafner, Norbert Höll und Paul Hager. Rußbach 2017.
5 Vgl. dazu beispielsweise Rajewsky, Irina O.: Intermedialität. Tübingen und Basel 2002, sowie Robert, Jörg: Einführung in die Multimedialität. Darmstadt 2014.
6 Vgl. u. a. Ledin, Per; Machin, David: Introduction to Multimodal Analysis. Revised and updated second edition. London / Oxford 2020, sowie Giessen, Hans W. u. a. (Hrsg.): Medienkulturen – Multimodalität und Intermedialität. Bern u. a. 2019.
Verzeichnis der Veröffentlichungen
Qualifizierungsschriften
1975
Hauptprobleme der Gegenwartspädagogik und ihr bildungspolitischer Niederschlag. Diplomarbeit im Fach Philosophie, Psychologie und Pädagogik. Salzburg. 75 S.
Wittgensteins Ästhetik und Sprachspieltheorie in ihrer Beziehung zur Gegenwartsliteratur. Diplomarbeit im Fach Germanistik.
Salzburg. 108 S.
1980
Form als Dementi. Text- und Strukturanalyse des Tractatus Logico-Philosophicus. Dissertation. Salzburg. 329 S.
Wissenschaftliche Monographien und andere selbstständige Publikationen
1989
Gruppenbild mit Haken. Bedenken zur (Ausländer-)Germanistik in Finnland. Vaasa: Deutsche Abteilung der Universität Vaasa. 32 S. (Saxa 1, Germanistische Forschungen zum literarischen Text)
1990
Vernetzungen. Friedrich Jodl und sein Kampf um die Aufklärung. Oulu: Oulun yliopisto. 241 S. (Veröffentlichungen der Universität Oulu, No. 2)
1991
Kuka oli Wilhelm Bolin? (Ausstellungskatalog). Juha Manninen / Georg Gimpl. Hrsg. von Kristiina Hildén. Helsinki: Helsingin yliopiston kirjasto. 92 S.
1992
Sperrfeuer. Zwei Reden zur aktuellen Hochschulpolitik. Oulu: Universität Oulu. 113 S. (Veröffentlichungen des Historischen Instituts der Universität Oulu; Ideen- und Wissenschaftsgeschichte, Bd. 3)
2000
Weil der Boden selbst hier brennt. Aus dem Prager Salon der Berta Fanta (1865– 1918). Prag: Vitalis. 432 S. + 32 S. Bildbeilage.
2017
Georg Gimpl – Mein Rußbach. Peter Hafner / Paul Hager / Norbert Höll (Hrsg.). Salzburger Bildungswerk Russbach.
Herausgegebene Sammelbände und sonstige Werke
1986
Weder – Noch. Tangenten zu den finnisch-österreichischen Kulturbeziehungen. Helsinki / Helsingfors: Deutsche Bibliothek. 513 S.
Rezensionen:
Tuva Korsström – Finländsk-österrikiska paralleler: I landet Varken-Eller. In: Hufvudstadsbladet, 6 Mai 1987.
Jaan Undusk – Nende ja meie Austria. In: Keel ja Kirjandus, 1988, Vol. 6, S. 374–379.
1990
Unter uns gesagt. Friedrich Jodls Briefe an Wilhelm Bolin. Mit einer Einführung von Juha Manninen und Georg Gimpl: Ego und Alterego. Wilhelm Bolin und sein Kampf um die Aufklärung. Wien. 309 S.
1995
Christmases – Jouluja. Helena Lehečková / Georg Gimpl / Andrew Chesterman (Hrsg.). Helsinki: Yliopistopaino. 86 S.
1996
Ego und Alterego. Wilhelm Bolin und Friedrich Jodl im Kampf um die Aufklärung. Festschrift für Juha Manninen. Frankfurt a. M. / Berlin / Bern / New York / Paris / Wien. 416 S.
Mitteleuropa – Mitten in Europa. Der Ginkgo-Baum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa. Helsinki. 14. Folge, 379 S.
1997
Jarmo Korhonen / Georg Gimpl (Hrsg.): Kontrastiv. Der Ginkgo-Baum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa.. Helsinki. 15. Folge, 550 S.
2003
Alfred Waldau. Böhmische Nationaltänze. Mit einer Einleitung von Georg Gimpl: Herder in Böhmen. Prag / Furth i. W.: Vitalis. 188 S.
2007
Juhani Aho: Dies und das aus Tirol. Aus dem Finnischen übertragen von Laura Sinivaara. Mit Bildern von Björn Wasastjerna und Paul Lechner sowie mit Zeichnungen von Venny Soldan-Brofeldt. Herausgabe und Redaktion der Übersetzung von Georg Gimpl. Helsinki / Helsingfors: Unifada. 162 S.
2014
Gabi Haller: In blindem Vertrauen. Herausgegeben von Georg Gimpl.
Artikel in Sammelbänden, wissenschaftlichen Zeitschriften und Handbüchern
1983
Der Fall Molnar. Tangenten zu einem Lebensbericht. In: Jahrbuch für finnischdeutsche Literaturbeziehungen. Helsinki / Helsingfors, No. 17, S. 72–87.
1986
Tangenten zu den finnisch-österreichischen Kulturbeziehungen. In: Georg Gimpl (Hrsg.): Weder – Noch. Tangenten zu den finnisch-österreichischen Kulturbeziehungen. Helsinki / Helsingfors: Deutsche Bibliothek, S. 9–24.
Wilhelm Bolin: Aus dem Briefwechsel mit Ludwig Anzengruber. In: Georg Gimpl (Hrsg.): Weder – Noch. Tangenten zu den finnisch-österreichischen Kulturbeziehungen. Helsinki / Helsingfors: Deutsche Bibliothek, S. 48–70.
Ludwig Wittgenstein: Briefe an Georg Henrik von Wright. In: Georg Gimpl (Hrsg.): Weder – Noch. Tangenten zu den finnisch-österreichischen Kulturbeziehungen. Helsinki / Helsingfors: Deutsche Bibliothek, S. 339–356.
Ludwig Wittgenstein und Georg Henrik von Wright. Ein Doppelportrait. In: Georg Gimpl (Hrsg.): Weder – Noch. Tangenten zu den finnisch-österreichischen Kulturbeziehungen. Helsinki / Helsingfors: Deutsche Bibliothek, S. 357–386.
Kai von Fieandt: Wien 1935. Augenzeuge bei Egon Brunswik und Karl Bühler. Nach einem Interview von Manu Jääskeläinen. In: Georg Gimpl (Hrsg.): Weder – Noch. Tangenten zu den finnisch-österreichischen Kulturbeziehungen. Helsinki / Helsingfors: Deutsche Bibliothek, S. 277–286.
1987
Logik versus Physikalismus? Zu Wittgensteins Begründung der Logik und Naturwissenschaft. In: 8th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Vol. 3, Section 13. Moskau, S. 115–118.
1988
Kein schöner „Land“ als „Finnland“? – Textlinguistische Bedenken zu Lektüre und Interpretation einer Gedichtübertragung. In: Neuphilologische Mitteilungen LXXXIX. Helsinki, No. 4, S. 651–658.
Monadologie der Fakultäten. Leibniz und der Paradigmenwechsel der österreichischen Philosophie im Maria-Theresianischen Reformkatholizismus. In: Leibniz. Tradition und Aktualität. V. Internationaler Leibniz-Kongress. Hannover, S. 305–311.
1989
The State's Line. On the Change of Paradigm of Austrian Philosophy within Maria-Theresian Reform-Catholicism. In: Topoi. Vol. 8, No. 2, S. 75–96.
Die Staatslinie. Zum Paradigmenwechsel der österreichischen Philosophie im Maria-Theresianischen Reformkatholizismus. In: Aufklärung und Französische Revolution III. Hrsg. von M. Kusch / Juha Manninen / Erkki Urpilainen. Oulu: Oulun yliopisto, S. 244–302.
Die „zweite Aufklärung“ oder Die Auferstehung des k.u.k. Pallawatsch in Budapest. In: FORVM, Jg. XXXVI. Wien, Heft 423/424, S. 47–49.
Wittgensteins Weichselstock. Symposiumsbericht von Georg Gimpl. In: FORVM, Jg. XXXVI. Wien, Heft 426/427, S. 75.
1990
Ego und Alter-Ego. Wilhelm Bolin und sein Kampf um die Aufklärung. Juha Manninen / Georg Gimpl. In: Georg Gimpl (Hrsg.): Unter uns gesagt. Friedrich Jodls Briefe an Wilhelm Bolin. Wien, S. 11–76.
Waffenbrüder der Aufklärung. Friedrich Jodls Briefe an Wilhelm Bolin. In: Finnland-Studien. Hrsg. von Edgar Hösch. (Veröffentlichungen des Osteuropa-Institutes München. Reihe Geschichte, Bd. 59) Wiesbaden, S. 118–150.
Ethisch oder sozial? Zur missglückten Synthese der Ethischen Bewegung. (Erweiterte Fassung) In: Ludwig Feuerbach und die Philosophie der Zukunft. Hrsg. von Hans-Jürg Braun / Hans Martin Sass / Werner Schuffenhauer / Francesco Tomasoni, Berlin, S. 729–762.
From Dialectics to Dialogue: A replay to Hanke. In: Journal of Pragmatics. Vol. 14, S. 489–493.
Mutter trinkt ein Bier. In: Die Ginkgo-Wurzel. Arbeitsheft für den Deutschunterricht. Helsinki, No. 3, S. 23–31.
1991
Ethisch oder sozial? Zur missglückten Synthese der Ethischen Bewegung. In: Der Ginkgo-Baum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa. 10. Folge. Helsinki, S. 43–72.
Ethisch oder sozial? Zur missglückten Synthese der Ethischen Bewegung. (Zweite erweiterte Fassung) In: Angelica Bäumer / Michael Benedikt (Hrsg.): Dialogdenken – Gesellschaftskritik. Wider die allgegenwärtige Gewalt der gesellschaftlichen Vereinnahmung. Wien, S. 49–88.
Juha Manninen / Georg Gimpl: Prometheus im Abseits? Andreas Wilhelm Bolin und sein Kampf um die Aufklärung. In: Kuka oli Wilhelm Bolin? (Ausstellungskatalog). Hrsg. von Kristiina Hildén. Helsinki, S. 58–92.
Kuka oli Wilhelm Bolin? In: Yliopisto. Acta Universitatis Helsingiensis, Jg. 39, No. 13, S. 28–35.
1992
Aus dem Hauptquartier des Feuerbachianismus. Wilhelm Bolin und sein Kampf um die Aufklärung. In: Der Ginkgo-Baum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa. 11. Folge. Helsinki, S. 285–293.
Die wahre Philosophie. Zum Paradigmenwechsel der österreichischen Philosophie im Maria-Theresianischen Reformkatholizismus. In: Michael Benedikt u.a. (Hrsg.): Verdrängter Humanismus – Verzögerte Aufklärung. Österreichische Philosophie zur Zeit der Revolution und Restauration (1750–1820). Wien: Turia & Kant, S. 279–327.
Der Nikolaus. In: Sauerkraut H. 4/1992, S. 13–15.
1993
Bolzano und Brentano, die bedeutendsten Philosophen Österreichs im 19. Jahrhundert. In: Eduard Winter. Ausgewählte Schriften aus dem Nachlass, eingeleitet und herausgegeben von Edgar Morscher. (Beiträge zur Bolzano-Forschung 3). St. Augustin, S. 31–49.
Dee. In: Der Ginkgo-Baum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa, Estland, Lettland und Litauen. Helsinki, 12. Folge, S. 140–148.
Aladins Comeback oder eine Zwischenbilanz. In: Kielikeskustelua. Vol. 5, S. 2– 12.
1994
„In Freiheit und Einsamkeit“? Die Universität Humboldts auf dem Prüfstein. In: Manfred Buhr (Hrsg.): Das geistige Erbe Europas. Neapel, S. 656–686.
Verlust des Dialogischen? Friedrich Jodl im Spannungsfeld von Personleben und Gemeinschaftsleben und die Tradition der Rechtsfeuerbachianer. In: Hans-Jürg Braun (Hrsg.): Solidarität und Egoismus. Studien zu einer Ethik bei und nach Ludwig Feuerbach. Berlin, S. 167–224.
„In Einsamkeit und Freiheit“? Die Humboldtsche Idee auf dem Prüfstand. In: Thomas Brose (Hrsg.): Umstrittene Menschenwürde. Beiträge zur ethischen Debatte der Gegenwart. Hildesheim, S. 121–156.
Vaarallisilla teillä Pakistanin vuoristossa [Bertil Tikkanen] In: Yliopisto. Acta Universitatis Helsingiensis. Helsinki, Vol. 3, S. 4–9.
An Austrian Christmas. Aus: Das Christkindl, tausendprozentig. In: Universitas Helsingiensis. The quarterly of the University of Helsinki. Helsinki, Vol. 13, No. 4, S. 10.
1995
Der Preusse in Österreich. Adam Müller, Joseph von Eichendorff und die deutschrömische Schule der österreichischen Philosophie. In: Michael Benedikt / Reinhard Knoll (Hrsg.), Josef Rupitz (Mithrsg.): Verdrängter Humanismus – Verzögerte Aufklärung. Philosophie in Österreich (1820–1880). Klausen-Leopoldsdorf / Ludwigsburg / Klausenburg (Cluj-Napoca), S. 157–195.
Promethiden versus Brentanoiden. Friedrich Jodl und die „Österreichische Philosophie“. In: Michael Benedikt / Reinhard Knoll (Hrsg.), Josef Rupitz (Mithrsg.): Verdrängter Humanismus – Verzögerte Aufklärung. Philosophie in Österreich (1820–1880). Klausen-Leopoldsdorf / Ludwigsburg / Klausenburg (Cluj-Napoca), S. 825–837.
Paradigmentreue. Emil Öhman und sein Selbstverständnis einer Germanischen Philologie. In: Der Ginkgo-Baum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa. 13. Folge. Hrsg. von Jarmo Korhonen und Jorma Koivulehto. Helsinki, S. 270–289.
De nalatenschap van Erasmus. Nederland, Ostenrijk en de Europese analytische traditie. Georg Gimpl / Michiel Wielema. In: Wijsgerig perspectief. Jg. 35 (1994/95, No. 4), S. 129–132.
Das Christkindl, tausendprozentig. In: Helena Lehečková / Georg Gimpl / Andrew Chesterman (Hrsg.): Christmases – Jouluja. Helsinki, S. 24–35.
1996
Fronde gegen die „philosophierenden Physiker“. Friedrich Jodls Auseinandersetzung mit Ernst Mach und Ludwig Boltzmann. In: Georg Gimpl (Hrsg.): Ego und Alterego. Wilhelm Bolin und Friedrich Jodl im Kampf um die Aufklärung. Frankfurt a. M. / Berlin / Bern / New York / Paris / Wien, S. 287–330.
Viktor Erich Frankl an Wilhelm Börner. Briefe 1945–1949. In: Georg Gimpl (Hrsg.): Ego und Alterego. Wilhelm Bolin und Friedrich Jodl im Kampf um die Aufklärung. Frankfurt a. M. / Berlin / Bern / New York / Paris / Wien, S. 391– 416.
Einsturzgefährdet? Nachlese zu Ivo Andrics Roman „Die Brücke über die Drina“. In: Georg Gimpl (Hrsg.): Mitteleuropa – Mitten in Europa. Der Ginkgo-Baum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa. 14. Folge. Helsinki, S. 193– 204.
Die Jahre der „Erfüllung“? Eduard Winter oder Gelenkte Kulturgrenzforschung im Geiste des Historischen Materialismus. In: Georg Gimpl (Hrsg.): Mitteleuropa – Mitten in Europa. Der Ginkgo-Baum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa. 14. Folge. Helsinki, S. 251–282.
Naturfilosofi in der Sackgasse? Bedenken zur Edition von Ludwig Boltzmanns Briefwechsel. In: Nachrichten. Forschungsstelle und Dokumentationszentrum für österreichische Philosophie. Graz, Vol. 7, S. 40–53.
1998
Philosophie und Interesse? Bernard Bolzano im Tauziehen nationaler Inanspruchnahmen. In: Nachrichten. Forschungsstelle und Dokumentationszentrum für österreichische Philosophie. Graz, Vol. 9, S. 19–46.
Franz Brentano und die Wiederaufnahme des ontologischen Gottesbeweises. Vom Blickwinkel einer empirischen Linguistik. Die Kopula im Existentialsatz. In: Thomas Brose (Hrsg.): Religionsphilosophie. Europäische Denker zwischen philosophischer Theologie und Religionskritik. (Religion in der Moderne, Bd. 4) Würzburg, S. 233–256. 2., unveränderte Auflage 2001.
Achtung Mensch! In: Josef Rupitz, Elisabeth Schönberger, Cornelius Zehetner (Hrsg.): Achtung vor Anthropologie. Interdisziplinäre Studien zum philosophischen Empirismus und zur transzendentalen Anthropologie. Festschrift für Michael Benedikt. Wien, S. 39–41.
Anreyss auf Umbweegen. Eine Annäherung an die Kulturhauptstadt Helsinki. In: Literaturstadt (Sondernummer). Prag, S. 8–9.
2002
„Eine ganze Wolke Philosophie kondensiert zu einem Tröpfchen Sprachlehre“ (Ludwig Wittgensten) – Das Modalfeld des Tractatus Logico-Philosophicus. In: Oddný Sverrisdóttir und Peter Weiss (Hrsg.): V. Treffens der nordeuropäischen Germanistik. 1.–6. Juni 1999 in Reykjavík, Island. Reykjavik, S. 258–275.
Späte Heimkehr? Leo Perutz und das jüdische Prag. In: Brigitte Forster und Hans-Harald Müller (Hrsg.): Leo Perutz. Unruhige Träume – Abgründige Konstruktionen. Dimensionen des Werks – Stationen der Wirkung. Wien, S. 219– 245.
„Weil der Boden selbst hier brennt!“ Aus dem Prager Salon der Berta Fanta (1865–1918). In: M. Oberhammer (Hrsg.): Das Wesen Österreichs ist nicht Zentrum, sondern Peripherie. Eine Gedenkschrift für Hugo Rokyta (1912–1999). Prag / Furth i. Wald, S. 57–81.
2003
Realismus im Erkennen – Idealismus im Handeln. Friedrich Jodl (1849–1914). In: Internationale Bibliographie zur österreichischen Philosophie, Bd. 9. Bearbeitet von Thomas Binder, Reinhard Fabian, Ulf Höfler, Jutta Valent, S. 7–100.
2007
Fern- und Fehlzündungen: Bedenken zu Ingeborg Bachmanns Wittgenstein-Interpretation. In: Eve Pormeister / Hans Graubner (Hrsg.): „Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“. Beiträge zur Internationalen Konferenz anlässlich des 80. Geburtstages von Ingeborg Bachmann. Tartu, S. 28–62.
Max Brod und sein erster Weltuntergang. In: Stefan Neuhaus / Johann Holzner (Hrsg.): Literatur als Skandal: Fälle – Funktionen – Folgen. Göttingen, S. 266– 277.
2008
'Phrasen stehen auf zwei Beinen.' (Karl Kraus). Sprachkritik als Gesellschaftskritik. In: Carmen Mellado Blanco (Hrsg.): Beiträge zur Phraseologie aus textueller Sicht. Hamburg, S. 135–152.
2010
'Unter sich'. Stichproben zur Mentalitätsgeschichte des Philosophischen Seminars in Prag. In: Blanka Mouralová (Hrsg.): Die Prager Universität Karl IV. Von der europäischen Gründung bis zur nationalen Spaltung. Potsdam, S. 114–155.
Rezensionen
Erich Kunze: Deutsch-finnische Literaturbeziehungen: Beiträge zur Literatur- und Geistesgeschichte. In: World Literature Today. Vol. 58 (1988). Winter Issue, S. 244–302.
Susanne Frejborg. Ein Buch der Freundschaft über getrennte Welten hinweg. Die Korrespondenz zwischen Wilhelm Bolin und Paul Heyse. Frankfurt a. M. u. a.: Peter Lang, In: Der Ginkgo-Baum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa, Estland, Lettland und Litauen. Helsinki, 12. Folge (1993), S. 263–265.
Frank Hadler (Hrsg.): Weg von Österreich! Das Weltkriegsexil von Masaryk und Benes im Spiegel ihrer Briefe und Aufzeichnungen aus dem Jahre 1914–1918. Eine Quellensammlung. Berlin: 1995. In: Georg Gimpl (Hrsg.): Mitteleuropa – Mitten in Europa. Der Ginkgo-Baum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa. 14. Folge (1997). Helsinki, S. 320–323.
Übersetzung
1997
Der traurige Stiefsohn der Natur und die Nymphe vom Saima-Strand. In: Pekka Pesonen: Texts of life and art – articles on Russian literature. Helsinki: Department of Slavonic and Baltic Languages and Literatures. S. 27–36. (Slavica Helsingiensia, Bd. 18)
Mitherausgabe wissenschaftlicher Publikationsreihen
Jarmo Korhonen / Jorma Koivulehto / Markku Moilanen / Georg Gimpl / Gérard Krebs: Der Ginkgo-Baum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa. 12. bis 16. Folge. Helsinki: Finn Lectura 1994–1998.
Georg Gimpl / Juha Manninen (Hrsg.): Europäische Studien zur Ideen- und Wissenschaftsgeschichte. Frankfurt a. M. / Berlin / New York / Paris / Wien: Peter Lang.
Bd. 1:
Juha Manninen: Feuer am Pol. Zum Aufbau der Vernunft im europäischen Norden (1996)
Bd. 2:
Erkki Patokorpi: Rhetoric, Argumentative and Divine (1996)
Bd. 3:
Arve Brunvoll: „Gott ist Mensch”. Die Luther-Rezeption und die Entwicklung seiner Religionskritik (1997)
Bd. 4:
Timo Kaitaro: Diderot’s Holism (1997)
Bd. 5:
Hans Gerald Hödl: Decodierungen der Metaphysik (1998)
Bd. 6:
Juhani Ihanus: Multiple Origins. Edward Westermarck in Search of Mankind (1999)
Bd. 7:
Maria Suutala: Zur Geschichte der Naturzerstörung. Frau und Tier in der wissenschaftlichen Revolution (1999)
Bd. 8:
Nikolai Veresov: Undiscovered Vygotsky (1999)
Bd. 9:
Risto Nurmela: Die innere Freiheit. Das jüdische Element bei Viktor E. Frankl (2001)
Bd. 10:
Merja Kylmäkoski: The Virtue of the Citizen. Jean-Jacques Rousseau’s Republicanism in the Eighteenth-Century French Context (2001)
Bd. 11:
Sun-Kyu Ha: Vernunft und Vollkommenheit (2005)
Bd. 12:
Jarmo Pulkkinen: Thought and Logic (2005)
Bd. 13:
Thomas Brose: Johann Georg Hamann und David Hume (2006)
Bd. 14:
Juhani Sarsila: Being a Man (2006)
Bd. 15:
Terhi Kiiskinen: Sigrid Aronus Forsius (2007)
Bd. 16:
Renate Haas / Albert Hamm: The University of Strasbourg and the Foundation of Continental English Studies (2009)
Nachruf für Dozent Dr. Georg Gimpl
26.05.1949 – 14.10.2014
Die Nachricht, dass unser Kollege Dozent Dr. Georg Gimpl am 14.10.2014 in Linz völlig unerwartet einem Schlaganfall erlag, hat uns zutiefst erschüttert.
Dr. Georg Gimpl war seit dem 1.9.1975 als Lektor für deutsche Sprache und österreichische Literatur am damaligen Germanistischen Institut und der heutigen Fachrichtung Germanistik im Institut für moderne Sprachen der Universität Helsinki tätig, seit 2004 als Universitätslektor. Vom 01.08.1993 bis 31.12.1994 und im Frühjahrssemester 1995 vertrat er eine Assistenzprofessur für Germanistik. Im Juli 1991 wurde er zum Dozenten für Ideengeschichte an der Universität Oulu ernannt.
Georg Gimpl hat neben den sprachpraktischen Kursen und den Vorlesungen zur Landeskunde Österreichs vor allem die literaturwissenschaftliche Ausbildung der Germanistik-Studierenden entscheidend gefördert und geprägt. Der österreichischen und der deutschsprachigen Literatur fühlte er sich besonders eng verbunden.
Daneben richtete sich sein Forschungsinteresse auf die Geschichte der Philosophie im Allgemeinen und der österreichischen Philosophie im Besonderen: Er befasste sich schon in seiner Salzburger Dissertation und auch später mit dem Tractatus logicus philosophicus von Ludwig Wittgenstein. Die Namen einiger anderer Philosophen, deren Schaffen und Wirken er untersuchte, sind Eduard Winter, Franz Brentano und Bernhard Bolzano. Spezielle Untersuchungen widmete Georg Gimpl den Beziehungen zwischen Wilhelm Bolin und Friedrich Jodl sowie dem Prager Salon der Berta Fanta. Die Geschichte der deutschsprachigen Kultur in Böhmen, darunter der jüdischen, faszinierte ihn in besonderem Maße. In den letzten Jahren widmete er sich mit voller Kraft dem Aufbau eines virtuellen Dorfmuseums seines Heimatortes Russbach.
In seinen fachhistorischen ebenso wie in seinen hochschulpolitischen Schriften bediente sich Georg Gimpl stets einer geschliffenen Rhetorik. Nicht immer stieß sein mitunter zuspitzender, polemischer Stil auf ungetrübte Gegenliebe. Doch mit der Brillanz seiner dialektischen Betrachtungsweise und der unbestechlichen Stringenz in der Argumentation erwarb sich Dr. Georg Gimpl sowohl in seinem unmittelbaren Kollegenkreis wie auch auf der internationalen Bühne des wissenschaftlichen Diskurses das ehrenvolle Image eines messerscharfen Denkers. Er war alles andere als autoritätsgläubig. Durch seine große Belesenheit, durch seinen Kenntnisreichtum in der Geschichte der Philosophie, der Literatur und der Gesellschaft war er ein gefragter Diskussionspartner, Referent, Rezensent und Wissenschaftler.
Auch in der Lehre stellte Georg Gimpl stets hohe Anforderungen an sich und an seine Studierenden. Er verstand es, begabte Studierende für die Beschäftigung mit der Literatur echt zu begeistern. Sein Unterricht wurde von den meisten Studierenden als eine wirkliche Bereicherung, ja oft als eine Horizonterweiterung erlebt. Als Hochschullehrer half er den von ihm Betreuten mit Geduld und Konsequenz, ein möglichst hohes Niveau in ihren Abschlussarbeiten zu erzielen. Auf seinen kompetenten Rat und auf seine Hilfe konnten sich die Studierenden stets verlassen.
Nicht nur in der sorgfältigen Vorbereitung und Durchführung seines akademischen Unterrichts zeigte sich die Achtung, die Dr. Georg Gimpl den Studierenden entgegenbrachte. Auch außerhalb der Lehrveranstaltungen nahm er regelmäßig teil an den Veranstaltungen beispielsweise unserer Fachschaft. Dort erlebte man ihn, wie auch in seinem Freundeskreis, als einen fröhlichen, lebenszugewandten und großzügigen Zeitgenossen.
Sowohl als international bekannter Wissenschaftler wie auch in Helsinki war Georg Gimpl bestens vernetzt. Zu seinem Freundeskreis zählten interessante Persönlichkeiten ganz unterschiedlicher Herkunft und Ausbildung. Für ihn als Menschen war eine sehr soziale Haltung charakteristisch. Er fühlte mit den sozial Benachteiligten, setzte sich für die Interessen der Schwächeren ein. Persönliche Eitelkeit und Geltungssucht waren ihm gänzlich fremd.
Der plötzliche Tod von Dr. Georg Gimpl hinterlässt eine große Lücke in seiner Familie wie auch in unserer Fachrichtung. Wir vermissen ihn als Mensch und als Kollegen sehr. Wir werden unseren Kollegen, Lehrer und Freund Dr. Georg Gimpl stets in ehrender Erinnerung bewahren.
Die Studierenden und Lehrkräfte der Fachrichtung Germanistik der Universität Helsinki
Georg Gimpl
Bild vor Bild die Wunderdonau hinab
Joseph von Eichendorffs Roman an die Nation
Wie eines Stromes Dringen
Geht unser Lebenslauf,
Gesanges Macht und Ringen
Tut helle Augen auf.
Und Ufer, Wolkenflügel,
Die Liebe hoch und mild –
Es wird in diesem Spiegel
Die ganze Welt zum Bild […]
Doch wolle nie dir halten
Der Bilder Wunder fest,
Tot wird ihr freies Walten,
Hältst du es weltlich fest.7
Dem Grafen Leontin legt der junge Eichendorff dieses Lied in den Mund – aber es besteht kein Zweifel, dass aus dem Munde des Hals über Kopf verliebten Herzensbruders von Graf Friedrich Eichendorffs eigenes Credo spricht. Hält man sich den bereits mächtig rauschenden Blätterwald der Eichendorff-Literatur vor Augen, so kann einem nicht entgehen, wie leitthematisch und stimmführend darin immer wieder Begriffe wie Allegorie, Symbol, Emblematik und Bild geworden sind. Auch – und gerade – Eichendorffs erster großer Wurf, Ahnung und Gegenwart, ist dabei zum akademischen Turnierplatz der scharfsinnigsten und spitzfindigsten Differenzierungen und Kontroversen geworden. In Anbetracht der tragenden Bedeutung der Bilder bei Eichendorff kann das ja auch gar nicht verwundern.
Ins Auge sticht dabei aber zugleich auch eine frappierende Defizitbilanz der Forschung: die lange Zeit kaum marginal recherchierte, ja sogar bestrittene Querbeziehung von Eichendorffs Wortkunst zur eigentlichen Bildkunst und Malerei seiner Zeit.8
Dabei war das Interesse Eichendorffs an der Malerei, wie ich hier zeigen werde, beachtlich. Erst in den letzten zehn Jahren der Eichendorff-Forschung wird diesem eklatanten Nachholbedarf einer interdisziplinären Forschung Rechnung getragen. Mangelhaft freilich bleibt dabei weiterhin, dass diese Erforschung methodisch im Bannkreis singulärer Beziehungen Eichendorffs zu einzelnen Malern geblieben ist – eine eigentliche Vernetzung des ganzen Umfelds der romantischen Malerei jedoch immer noch aussteht.
Das sieht vom Blickwinkel der Malerei aus nicht erheblich günstiger aus: Anstatt die parallel einherlaufenden und vielfach ineinander verwickelten Fäden der tatsächlich gegebenen Querbeziehungen zu verknüpfen, operiert die Wissenschaft auch dort nach wie vor reichlich eigenbrötlerisch in ihren Schächten. Es lässt sich dies speziell am Fall Eichendorff bis in die jüngste Gegenwart herauf nachvollziehen.
1 Wallfahrten in Natur und Kunst. Die Lukasbrüder
Die biographisch-historische Evidenz der Querbeziehungen Eichendorffs zu den einzelnen Vertretern der (früh)romantischen Malerei ist durchaus gesichert. Dass sie – wie bei ihm so vieles – oft nur tangentiell und bloß indirekt, aus dem Werke selbst, erfassbar wird, hat mit der von Paul Stöcklein so gültig festgestellten Neigung Eichendorffs zur eigenen manipulatorischen Verdunkelung des Lebens und seiner ’Lebensreise incognito’ zu tun.9 Doch lässt sich auch aus den vorhandenen Andeutungen ein reichlich konturiertes Gesamtbild erstellen, fügt man die einzelnen Puzzles der Forschung nur richtig zusammen.
Da sind zunächst einmal systematisch all die Lineamente von Eichendorffs Interesse für die Malerei festzuhalten, wie sie sich allein schon an Hand der Notizen des Tagebuchs10 nachziehen lassen. Eichendorffs Begeisterung für die Malkunst gibt sich bereits kund, als sich die beiden Brüder zum Studium nach Halle begeben – und dabei selbstverständlich in Dresden Station machen, „… besahen früh die Bildergalerie“, lautet die knappe Eintragung ins Tagebuch vom 27. April 1805 (T, 96) – es ist das Erste, was sie sich dort ansehen müssen. Nicht minder dürfen dann die „Morgenspaziergänge auf den giebichsteiner Felsen mit Sternbalds Wanderungen v. Tieck“, laut einer Eintragung vom 13. August 1805 (T, 106), auch als kaum verhehlte Begeisterung für die Malerei interpretiert werden.
Einfach klassisch romantisch! geht es dann wieder zu, als die beiden Brüder im September desselben Jahres ihre „hamburger