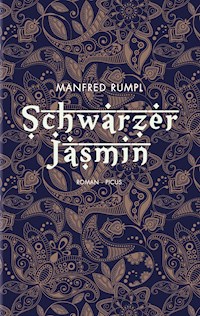
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Journalist Jakob und die Sozialarbeiterin Julia haben sich ein Ultimatum gestellt: Ihre Beziehung steht am Scheideweg. Der tunesische Flüchtling Eymen schwankt zwischen den Verlockungen des westlichen Lebens und seiner religiösen Überzeugung. Und der Polizist Frank übernimmt einen letzten großen Fall vor seiner Rente. Er und sein Team müssen sich gegen ihre opportunistische Vorgesetzte und für die Sicherheit entscheiden: Sie stoßen auf Eymen, der in Julias Beratungsstelle aufgetaucht ist, als möglichen Gefährder, den es zu fassen gilt, bevor er zuschlägt. Die Wege dieser so unterschiedlichen Figuren scheinen schicksalhaft verwoben und alles läuft auf ein dramatisches Finale hinaus … Zwischen der tunesischen Jasminrevolution, die den kurzen Arabischen Frühling auslöste, und der Fluchtbewegung nach Europa siedelt Manfred Rumpl seinen spannenden und vielschichtigen Thriller an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Copyright © 2020 Picus Verlag Ges.m.b.H., WienAlle Rechte vorbehaltenGrafische Gestaltung: Dorothea Löcker, WienUmschlagabbildung: © Tetyana Anisimova / 123RFISBN 978-3-7117-2097-9eISBN 978-3-7117-5434-9
Informationen über das aktuelle Programmdes Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at
Manfred Rumpl, 1960 in der Steiermark geboren, jobbte in verschiedenen Sparten in Österreich und Deutschland, bevor er in Graz und Wien Philosophie studierte und mit einer Arbeit über Baudelaire abschloss. Für seine Romane erhielt er unter anderem den »aspekte«-Literaturpreis des ZDF und den Deutschen Kritikerpreis. Manfred Rumpl lebt in Wien und in der Steiermark. Im Picus Verlag erschien 2015 »Reisende in Sachen Relativität«, ein Roman über Erwin Schrödinger, 2016 »Dieser Tage«, im Frühjahr 2018 »Finns Irrfahrt«. 2020 erscheint »Schwarzer Jasmin«. www.manfredrumpl.com
MANFRED RUMPL
ROMAN
PICUS VERLAG WIEN
Dass in den Kirchen gepredigt wird,macht deswegen die Blitzableiter aufihnen nicht unnötig.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Inhalt
PROLOG SIDI BOUZID, 17. DEZEMBER 2010
I BERLIN, 16. DEZEMBER 2016
QUESLATIA, TUNESIEN, 1998
BERLIN, 16. DEZEMBER 2016
QUESLATIA, TUNESIEN, 2009
BERLIN, 16. DEZEMBER 2016
QUESLATIA, TUNESIEN, 2010
BERLIN, 16. DEZEMBER 2016
QUESLATIA, TUNESIEN, 2010
BERLIN, 16. DEZEMBER 2016
II BELPASSO, ITALIEN, 2011
BERLIN, 16. DEZEMBER 2016
CATANIA, ITALIEN, 2015
BERLIN, FEBRUAR 2016
PALERMO, ITALIEN, 2015
BERLIN, FEBRUAR 2016
HILDESHEIM, 2015
BERLIN, 17. DEZEMBER 2016
BERLIN, MÄRZ 2016
BERLIN, 17. DEZEMBER 2016
III BERLIN, MAI 2016
BERLIN, 17. DEZEMBER 2016
BERLIN, MAI 2016
BERLIN, MAI 2016
BERLIN, MAI 2016
BERLIN, 17. DEZEMBER 2016
BERLIN, MAI 2016
IV BERLIN, JUNI 2016
BERLIN, JUNI 2016
BERLIN, JUNI 2016
BERLIN, JULI 2016
BERLIN, AUGUST 2016
BERLIN, SEPTEMBER 2016
BERLIN, 17. DEZEMBER 2016
BERLIN, OKTOBER 2016
V BERLIN, NOVEMBER 2016
BERLIN, 17. DEZEMBER 2016
BERLIN, DEZEMBER 2016
BERLIN, DEZEMBER 2016
BERLIN, 18. DEZEMBER 2016
BERLIN, 19. DEZEMBER 2016
BERLIN, 19. DEZEMBER 2016
BERLIN, 19. DEZEMBER 2016
BERLIN, 19. DEZEMBER 2016
BERLIN, 19. DEZEMBER 2016
BERLIN, 20. DEZEMBER 2016
PROLOG
SIDI BOUZID, 17. DEZEMBER 2010
Mohamed Bouazizi winkt seiner Mutter zum Abschied, bevor er den Karren voller Birnen, Äpfel und Mandarinen in Richtung Zentrum schiebt. Die Mutter ist im Olivenhain so in ihre Arbeit vertieft, dass sie kaum wahrnimmt, wie ihr Sohn sich auf den Weg macht.
Sie weiß, dass er lieber lernen würde, studieren vielleicht sogar, als seine Familie mit illegalem Handel durchzubringen. Vater ist keiner mehr im Haus, dafür aber fünf Geschwister, die, wie viele in der von der Regierung aufgegebenen Gegend, nichts verdienen. Beinahe täglich hat ihr Sohn Probleme mit der Stadtpolizei, die behauptet, die Lizenzen der Händler nie anders zu kontrollieren, als es die Behörden der Hauptstadt vorschreiben.
Als sie sich aufrichtet, sieht sie noch, wie ihr Sohn in der Gasse verschwindet, die in Richtung Zentrum führt.
Die blassrosa Wintersonne, die sich über den östlichen Rand der Berge erhebt, taucht den noch jungen Tag in kühles Licht.
Während er darauf achtet, in den holprigen Gassen keine Ware zu verlieren, überlegt er, welcher der Märkte heute nicht kontrolliert werden wird. Aus seinen Erfahrungen hat er ein System abgeleitet, auf das nur leider viel zu selten Verlass ist. Tatsächlich profitieren ja die Behörden von den Launen ihrer Subalternen. Und die von der Obrigkeit angeordnete Willkür verhindert, dass er sich auf das System hinter den Schikanen einstellen kann.
Er wird sich mit dem Karren wieder dort hinstellen, wo die attraktivsten Frauen zu sehen sind. Wie jeden Tag schaut er bei einem Freund vorbei, der ihm die elektronische Waage über Nacht auflädt. Mit der Waage gewinnt er erst das Vertrauen der jungen Kunden. Ältere Leute muss er davon überzeugen, dass es sich bei dem Ding, das ohne Gewichte auskommt, um ein Präzisionsgerät handelt.
Er schiebt den Karren an den Rand eines Platzes, der von Frauen frequentiert wird, die für Familien im wohlhabenden Nachbarviertel einkaufen, putzen und kochen; darunter auch Zweit- und Drittfrauen, die er sich in seinen Schwärmereien so unglücklich ausmalt, dass sie sogar an ihm Gefallen finden könnten, wenn er sie nur zuvorkommend genug behandelte.
Ein paar Stunden lang geht alles gut. Mohamed macht seine Geschäfte, der Berg Obst auf seinem Karren schrumpft. Die meisten Kundinnen sind gut gelaunt und lassen nebenbei nette Worte fallen, Trinkgeld für die Seele. Er kann es sich gar nicht leisten, ans Heiraten zu denken, es fehlt ihm die Mitgift. Noch ist es aber nicht verboten, an all das zu denken, was er mit einer der Frauen erleben könnte, wenn sie mit ihm zusammen wäre.
Dann geschieht, was immer wieder passiert.
Er ist von seinen Schwärmereien so abgelenkt, dass er es auch diesmal zu spät kommen sieht: In hohem Tempo schießt ein Polizeiauto aus einer der Gassen, hält in der Mitte des Platzes. Türen fliegen auf, die Uniformierten schwärmen aus, um die Händler, Waagen und Lizenzen zu kontrollieren.
Er schafft es nicht mehr, den Karren in eine der Gassen zu schieben und in der Menge unterzutauchen. Eine Polizistin steuert geradewegs auf ihn zu.
Ohne ihre Uniform, denkt er noch, mitten im Versuch zu türmen erstarrt, sähe sie einer der Kundinnen ähnlich, an die er soeben gedacht hat, da stellt sie ihn schon zur Rede.
»Salam aleikum! Ausweis und Lizenz, bitte!«
»Alhamdulillah«, erwidert er zaghaft. Er ahnt, dass die Strafe wieder einmal höher sein wird als die Einnahmen des Tages. Nachdem er es nicht geschafft hat, rechtzeitig von hier wegzukommen, wird das Verhängnis seinen Lauf nehmen. Er wird bezahlen, was sie als Strafe festsetzt, und als Versager nach Hause kommen, wo sie mit den Einnahmen des Tages rechnen. Dass die Polizistin ein »Bitte!« an ihren Befehl knüpft, was noch keiner ihrer männlichen Kollegen je getan hat, lässt ihn hoffen, ohne Geldbuße davonzukommen. Steckt sie auch in einer Uniform, denkt er, so ist und bleibt sie doch eine Frau.
Blicke von Kundinnen brennen sich in sein Bewusstsein. Trotz der winterlichen Temperaturen breitet sich Hitze in ihm aus, die ihn schließlich dazu zwingt zu sagen: »Aber Sie sind doch eine Frau!«
»Wie bitte?«
Es dämmert ihm, dass das vielleicht keine gute Antwort auf ihre Aufforderung war, sich auszuweisen. Nun wird er das Gefühl nicht mehr los, sie könnte alles, was er noch zu sagen hat, falsch verstehen. »Ich meine, Sie haben vielleicht Kinder, für die Sie sorgen, wie ich für meine Geschwister.«
»Das geht nur mich etwas an«, sagt sie und streckt einen Arm über den Karren, um die Papiere entgegenzunehmen.
Es ist sinnlos, denkt er, sie ist der verlängerte Arm der Regierung. Und erst dann eine Frau, von der er nicht einmal weiß, ob sie nicht zu Hause ihren Mann unterdrückt, wie sie ihn hier vor allen bloßstellt. »Ich habe keine Lizenz«, sagt er und will ihr mit einem Lächeln zu verstehen geben, dass er einsichtig ist. Er holt den Strauß getrockneter Jasminblüten, die seit dem Sommer schwarz geworden sind, unter dem Karren hervor und hält ihn ihr hin.
Sein Lächeln verfängt nicht.
»Das macht dann zwanzig Dinar«, sagt sie, ohne mit der Wimper zu zucken. Den schwarzen Jasmin übersieht sie mit Absicht.
»So viel habe ich aber noch nicht eingenommen«, sagt er. Er spürt, wie ihm die Hitze aus dem Bauch in den Kopf steigt. Im Gesicht läuft er dunkel an. Täuscht er sich, oder kichern die anderen Frauen um ihn herum und machen sich über ihn lustig?
»Dann muss ich die Waage konfiszieren«, sagt sie. »Wenn Sie die Strafe auf unserer Wache bezahlen, bekommen Sie die natürlich zurück.« Sie füllt ein Strafmandat aus und steckt es zwischen die Mandarinen. »Und jetzt geben Sie mir die Waage, bitte!«
Von diesem zweiten »Bitte« geradezu entwaffnet, nimmt er die Waage und kommt damit hinter dem Karren hervor. Sie greift danach. Aber er kann nicht loslassen. Sie lächelt kühl und kurz, versucht es noch mal. Er kann aber seine Waage nicht loslassen, sosehr er es auch will: Nicht die Vorstellung von einer gerechten Welt, nicht die Verpflichtung der Familie gegenüber, nicht die Gewissheit, dass eine Frau ihm nichts zu sagen hat, und schon gar nicht diese Waage, die er sich vom Mund abgespart hat, kann er im Moment loslassen.
»Lassen Sie doch endlich los!«
»Nehmen Sie sie«, sagt er. Die Knöchel an seinen Händen treten weiß hervor, so klammert er sich an die Waage.
»Idiot«, zischt sie ungeduldig, holt mit der Hand aus und gibt ihm eine Ohrfeige.
Er weiß nicht, wie ihm geschieht. Hat die Polizistin ihm, Mohamed Bouazizi, etwas aus dem Gesicht gewischt? Eine der lästigen Fliegen vielleicht, die sonst ums aufgeplatzte Obst schwirren? Er weiß es einfach nicht! Er nimmt nur wahr, wie die Stimmen um ihn herum auf dem Platz anschwellen und sich zu einer Welle aufwerfen, die ihn unter sich zu begraben droht.
Er lässt die Waage los und läuft in die Gasse hinter sich davon.
Mohamed irrt durch die Stadt, ohne zu wissen wohin. Das Feuer der Schande lodert in ihm. Hat ihm die Polizistin tatsächlich eine Ohrfeige gegeben, vor den Augen der anderen Frauen? Das fragt er sich, während er mit sich selbst hadert. Er streitet mit Stimmen, die ihn ihm sprechen.
Eine Weile läuft er planlos durch die Gassen.
An Blicken und Bemerkungen vermeint er zu erkennen, dass alle wissen, was auf dem Markt geschehen ist. In aller Öffentlichkeit von einer Frau geschlagen zu werden! Das ist schlimmer, als sich keine Frau leisten zu können.
Was hat der Vater gesagt? Während sich die Wahrheit in Tunis noch die Sandalen schnürt, ist die Lüge schon längst in Mekka.
Irgendwann hält er inne, geht in die Hocke und horcht in sich hinein. Er muss etwas dagegen tun!
Die Stimmen in seinem Kopf reden alle durcheinander. Als sich sein Puls beruhigt, werden auch sie ruhiger; bis auf eine, die nun deutlicher hervortritt. Er konzentriert sich, will wissen, was sie zu sagen hat. Es ist eine väterliche Stimme, guttural, streng, wohlwollend. Je mehr er sich konzentriert, desto klarer wird ihre Botschaft.
Es geht darum, den Kreislauf des Duldens zu stoppen. Darum, auf keinen Fall sein Gesicht zu verlieren. Und darum, dass es besser ist, nicht mehr zu sein, als mit der Schande zu leben.
Es geht um Respekt, um Würde, um …
Er richtet sich auf, lächelt in sich hinein. Warum hat er diese Stimme, die ihn doch so gut kennt, nicht schon früher gehört? Es ist wohl das Beste, sagt er sich, ihr einfach zu folgen und sich nicht länger den Kopf zu zerbrechen.
Auf der Polizeiwache lachen sie ihn aus. Sie klopfen ihm auf die Schulter wie einem Idioten, als er die Herausgabe der Waage fordert, und schicken ihn zum Haus des Gouverneurs, ohne seine Waage, mit leeren Händen. Hinter seinem Rücken, er hört es, machen sie sich wieder einmal über ihn lustig. Der Palast des Gouverneurs, rufen sie ihm nach, sei zweifellos der Ort, um seine Rechte einzufordern!
Auf einmal weiß er, was zu tun ist. Seine Gedanken sind klar und kühl. Obwohl die blasse Wintersonne im Zenit steht und eine milde Wärme verbreitet, fröstelt ihn.
Wie konnte er sich nur in dieser Stadt verlaufen, in der er sein Leben verbracht hat? Er orientiert sich und geht los. Der Platz, wo sein Karren steht, liegt in der Mittagszeit verlassen da. Die Frauen sind längst zu Hause und bringen ihre Männer zum Lachen mit der Geschichte vom Gemüsehändler, der sich nach Küssen sehnt, aber von einer der Angebeteten nur eine Ohrfeige bekommt.
Er arrangiert Obst und Gemüse auf seinem Karren und schiebt ab.
Vor dem Palast des Gouverneurs stellt er seine Ware ab. Leute hasten und schlendern vorüber, nehmen von ihm Notiz, als sähen sie ihn zum ersten Mal oder als wüssten sie bereits alles.
Doch das betrifft ihn nicht länger.
Er nimmt die Flasche, die er sich vor Kurzem besorgt hat, und entleert den Inhalt über seinem Kopf. Es riecht penetrant. Es rinnt an ihm herunter wie die Scham, er kennt das. Ohne zu zittern, mit einem Willen, der stärker ist als der Tod, entfacht er ein Streichholz.
Der dürre Jasmin, den er sich über dem Herzen in die Brusttasche gesteckt hat, lodert kurz auf. Wie leicht es doch ist, nicht zu schreien, denkt er. Er dreht sich um seine Achse und schlägt neben dem Karren hin.
Eine Rauchsäule steigt von dem sich unter den Flammen aufbäumenden Körper in den Himmel auf. Sogar die Luft um Mohamed Bouazizi, der keinen Laut von sich gibt, scheint zu brennen. Die Hitze verwandelt Körper und Karren in eine Fata Morgana.
Er wird nicht erfahren, dass der Gouverneur inzwischen am Fenster steht und sich fragt, ob er das Fenster aufmachen soll oder nicht.
Der Gouverneur mag es einfach nicht, wenn es in seinen Gemächern nach den Ausdünstungen der Straße riecht.
I
BERLIN, 16. DEZEMBER 2016
Er wusste nicht, wie lange er schon unterwegs war. Als er stehen blieb und sich umschaute, kam ihm vor, die Dinge wiederholten sich. Leuchtschriften, Ampeln, Kioske, Schilder, Gebäude, Graffitis und die Festbeleuchtung über dem Markt, Gold, Silber und Blau, den er, in Gedanken versunken, wie in Trance umrundete.
Wiederholt tauchte der Torso der Gedächtniskirche auf. Der Stumpf eines Versehrten, in den grauen Himmel ragend, oder, wie man früher auch gesagt hatte, der hohle Zahn. Die Silhouetten der Passanten, die Jakobs Gesichtsfeld kreuzten, unterschieden sich kaum. Hastig brachten sie ihre Beute für Weihnachten in Sicherheit.
Blieb er nicht in Bewegung, begann er zu frieren. Sollte er zu Julia fahren und reinen Tisch machen? Endlich! Oder nach Hause? In seine vielleicht doch viel zu stur behauptete Singlewohnung: Charlottenburg, Altbau, Hoflage, eineinhalb Zimmer, ein kleiner Balkon. Neben dem Weinkühlschrank im Flur hing der Autograf, den ihm Julia in viel besseren Zeiten geschenkt hatte. Eine Notiz Egon Schieles, verfasst und signiert mit schwarzer Tinte. Die Kalligrafie erinnerte ihn an Japan.
Sobald er länger zu Boden sah, schweiften seine Gedanken in die Vergangenheit ab, während sie versuchten, die Zukunft zu erahnen, wenn er über dem noch hellen Horizont der Stadt nach einer Lösung für sein Dilemma suchte.
Seit Julias Geburtstag kreisten sie um die Frage, wie es mit ihnen weitergehen könnte. Sie fand, sie waren an eine Kreuzung gelangt, die eine grundsätzliche Entscheidung verlangte: zusammenleben, und dann mit allen Konsequenzen, oder getrennte Wege gehen. Halbe Sachen, sagte sie seit Kurzem, waren im Grunde nicht ihres. Nach der Tunesienreise hatten sie sich auf einen Termin für eine endgültige Entscheidung geeinigt. Nun empfand er es wie ein Ultimatum, das übermorgen ablief.
Die Zeit tickte in ihm.
Was die Zukunft bringen würde, wusste er im Moment so wenig, dass es ihm Angst machte.
Große Flocken schwebten in Zeitlupe durch die Luft zu Boden und füllten die Spuren der Passanten im frischen Weiß.
Sie würde nicht auf ihn warten, hatte sie erst vor Kurzem gesagt, aber auf seine Entscheidung. Worin bestand nun der Unterschied? Das hatte er sich gefragt, während er ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange gab, weil er es eilig gehabt hatte, an die Arbeit zu gehen. Immer öfter sagte sie etwas, das er nicht oder irgendwie falsch verstand. Etwas, das alles und nichts bedeuten konnte.
Er sollte sich irgendwo aufwärmen, wenn er nicht krank werden wollte. Seit Wochen zog eine Grippewelle durchs Land. Er hasste es, krank zu werden und dann zu Hause bleiben zu müssen. Bis zu einem gewissen Grad eine Frage der Willenskraft, hatte er einmal bemerkt, Julia hatte ihn ausgelacht. Die Zumutung war nicht das Kranksein an sich, es verschaffte einem die Zeit zu tun, was man längst hätte tun sollen, sondern das Schwinden jeglicher Lebenslust. Wenn die Farben plötzlich stumpf wurden, alles schal schmeckte und einem die Lust auf das verging, was das Leben kostbar machte.
Sie waren seit fünf Jahren zusammen. Es war möglich, dass es mit Ablauf des Ultimatums genau fünf Jahre waren. Mit Zahlen hatte er es nicht so. Julia traute er zu, dass sie in dieser Sache auf eine runde Zahl setzte. Das gab ihr jene Art Sicherheit, die er ihr wohl bisher schuldig geblieben war.
Eine Zeit lang hatte es Julia fasziniert, dass er sich mit Dingen beschäftigte, die sich die meisten Leute nicht oder nur selten leisteten. Früher war sie so gut wie immer zu haben gewesen für die Abenteuer des Aufspürens von Aromen und Duftnoten in Weinen. Es gefiel ihr, sich selbst als sinnliche Offenbarung zu verstehen. Die Geliebte, die einen Genuss verkörperte, den ihm sonst nichts auf der Welt verschaffen konnte.
Er sah das prosaischer. Sein Interesse für Weine hatte nichts mit der Liebe zu einem Menschen zu tun. Das waren zwei verschiedene Seiten des guten Lebens, die er auf keinen Fall vermischen wollte.
Seit Julia begonnen hatte, sich beruflich zu engagieren, betrachtete sie die Welt zusehends durch die moralische Brille. Ihrer Moral, die sie sogleich zu einer Moral für alle erheben wollte. Ihn ließ sie immer öfter spüren, dass es moralisch fragwürdig war, an Texten über den Charakter von Weinen zu feilen, während im Mittelmeer Flüchtlinge ertranken. Um ja nicht als Ignorant dazustehen, begann er auch über die Probleme im Land zu reden.
Julia verzehrte sich nach einer Auseinandersetzung mit aller Welt. Ihn irritierte es, persönlich für die halbe Welt verantwortlich zu sein.
Mit dem Ultimatum, auf das sie sich im Streit geeinigt hatten, war seine letzte Hoffnung verflogen, Julia könnte wieder werden wie zuvor, wenn die Euphorie über ihren neuen Job sich erst in Routine verwandelte. Job sei das sicher keiner, hatte sie ihn zurechtgewiesen, als er dieses Wort, das er doch selbst nicht mochte, nebenbei hatte fallen lassen.
Wenn er jetzt, dachte er, fröstelnd auf der Stelle tretend, in die nächste Kneipe am Bahnhof Zoo ging und trank, um dem Ganzen den Stachel zu nehmen, würde er es anderntags bereuen. Julia könnte es als Kapitulation vor dem Problem sehen, mit dem sie sich konfrontiert hatten.
Er stellte den Mantelkragen hoch, ballte die Hände in den Taschen, um die Blutzirkulation anzuregen, und ging los.
Julias Wohnung lag im Prenzlauer Berg, unweit vom U-Bahn- Bogen und der Schönhauser Allee.
QUESLATIA, TUNESIEN, 1998
Es ließ sich nicht länger schönreden. Was sollte nur aus einem werden, der in der Moschee immer wieder auffiel? Nicht erst einmal war dem Vater diese Frage vom Imam nach der Predigt gestellt worden.
Eymen war ein aufgewecktes Kerlchen, das im Freiraum der Moschee, zwischen Männern und Frauen, wo die Kinder sich aufhielten, nicht einmal ruhig bleiben konnte, wenn alle andern sich ins Gebet vertieften. Er gab übermütige Laute von sich, alberte herum, konnte einfach nicht stillhalten.
Immer wieder brachte er den Imam aus dem Konzept. Der nun drohte der Familie damit, Eymen vom Freitagsgebet auszuschließen, wenn es so weiterging.
Eymen, das jüngste von acht Kindern – fünf Schwestern und drei Brüdern –, neigte früh zur Unbändigkeit. Von Mutter und Schwestern verwöhnt und bedrängt, wusste er nie, ob er sich hingeben oder abgrenzen sollte, um nicht, wie Jonas vom Wal, von der Familie verschlungen zu werden. Im Bauch des Monstrums war es heimelig, ein vor den Gefahren des Lebens geschütztes Reich, manchmal aber auch gruselig. Viel zu eng, feucht, finster und ohne jede Aussicht auf etwas anderes.
Die Brüder gängelten ihn, nahmen ihn lange vor der Zeit in die Pflicht, ein richtiger Mann zu sein. Einer, der alle unter seine Kontrolle bringen musste, die Schwestern, alle Frauen. Die Mutter vor allem, die ihn sogar noch darin bestärkte, den kleinen Macho zu geben, wenn es gegen sie selbst ging.
Eymen, dieser Dreikäsehoch, der nicht wusste, was ein richtiger Mann war, auch wenn er jeden Tag zu hören bekam, wie ein solcher zu sein hatte. Er, der sich im einzigen Zimmer in den Schlaf weinte, weil Allah es zugelassen hatte, dass der Vater bei der Arbeit den rechten Arm verloren hatte, und der länger ins Bett nässte, als die Brüder es getan hatten.
Den Knirps überkam oft ein Zorn, der sogar der Mutter Angst machte, die den Zorn der Männer, wie auch den Zorn Gottes, für unvermeidlich hielt.
Dass die Wutausbrüche des Sohnes der Weisheit Gottes entsprangen, lag für die Mutter auf der Hand. Allah konnte Vulkane ausbrechen lassen, hatte der Imam in einer Predigt gesagt. Warum, in seinem gerechten Zorn, sollte er vor einem Kind haltmachen? Es musste ja ein Zeichen sein, wenn der gerechte Zorn Gottes sich in einem Kind manifestierte. Dass ihr dieser Sohn ähnelte, bestätigte ihre eigenen Gefühle. Was in ihr schlummerte, brach spontan aus ihm heraus, wenn die Umstände danach waren.
Seit Wochen zog der Frühling von Sousse, das am Meer lag, nach und nach ins Innere des Landes, hoch in die Berge. Die ärmlichen Häuser der Stadt lagen wie hingestreut auf die Ebene vor dem kargen Tal. Als hätte jemand mitten in einem Würfelspiel plötzlich das Interesse an der Partie verloren.
Nach zu viel Regen und Dunst trocknete die Sonne den Matsch auf Wegen, Plätzen und Straßen, der zu Staub zerfiel und vom Wind in alle Richtungen getragen wurde. Hier und dort das Leuchten von Blüten im monotonen Braun und Grau der Gegend.
Es dauerte nicht lange, bis der Staub, der durch alle Ritzen drang, die Farben der Blumen und Sträucher ebenso dämpfte wie die Farben der Fliesen in den Häusern und der Graffiti an den Wänden und Mauern der Stadt. An glorreiche Zeiten appellierende Parolen und Suren. Mit schwarzer Farbe auf helle Wände gepinselte Warnungen der Salafisten an alle, die vom rechten Glauben abgefallen waren, vor allem aber an die Machthaber in Tunis. Düster widersprachen sie den Slogans der Popkultur des Westens, die mit ihnen um die Aufmerksamkeit der Passanten buhlten.
In diesem letzten Jahr vor der Schule durfte Eymen den Vater hin und wieder zu Kunden begleiten.
Wenn Eymen dem Vater beim Anschirren des Esels und Beladen des Karrens zur Hand ging, weil der sich mit einem Arm schwertat, spürte er, wie ihn ein unbenennbares Gefühl überkam. Während es zu einer Flut anschwoll, fürchtete er, auf die Größe eines Granatapfels zu schrumpfen.
Nur wenn er Mut und Wut zusammennahm, konnte er verhindern, dass die Ungerechtigkeit, die sein Vater erleiden musste, auch ihn zunichtemachte. Und nur wenn er diesen Zorn zuließ, der ihm die älteren Brüder vom Leib hielt, konnte er den Prozess des Schrumpfens umkehren und die Flut, in der er unterzugehen drohte, zurückdrängen.
Nach allem, was er so aufgeschnappt hatte, war er sich sicher, dass man den Vater, einen Landarbeiter, in den Unfall gehetzt hatte. Die Gier seiner Arbeitgeber, der Landbesitzer in Tataouine, wo die Familie vor seiner Geburt gelebt hatte, war verantwortlich dafür, dass dem Vater ein Arm fehlte.
Dann waren sie in dieses Nest am Rand von nirgendwo übersiedelt. Und dann hatte auch die Mutter arbeiten gehen müssen, um die Familie durchzubringen, putzen und kochen für Fremde, eine Schande. Und der Vater rumpelte mit Esel und Karren durch die Gassen des Kaffs, um sich als Lieferant zu verdingen, weil er seit dem Unfall sonst nicht mehr viel tun konnte.
Diesmal lief es ganz gut. Am Samstag waren die meisten Kunden besser gelaunt als an den anderen Tagen. Am Vortag hatten sie in der Moschee gebetet. Am Wochenende mussten sie es dann nicht mehr so genau nehmen.
Zu Mittag schon floss in manchen Kneipen der Vorstadt der Alkohol. Eymen hatte gehört, dass Rashid, der einzige Grossist unter den Alkoholhändlern, stets für Nachschub sorgte. Aus den Hinterzimmern drangen der Beat des Hip-Hops und der Qualm des Haschischs. Hier, wo die Alten krank und die Jungen arbeitslos waren, musste Eymen meist draußen warten, während der Vater drinnen seine Geschäfte erledigte.
Er vertrieb sich die Zeit mit Filou, kämmte mit den Händen sein borstiges Fell und behielt dabei den Eingang der Kneipe im Auge.
Es kam vor, dass Salafisten anrückten, um das Treiben in der Kneipe mit ihren Stöcken zu durchkreuzen. Sie verdroschen, wen sie erwischten, während sie Allah, Mohammed und die Frömmigkeit priesen.
Dann war Eymen gefordert, Filou ruhig zu halten, bis die sich an ihrer Empörung berauschenden Männer alle Flaschen mit Alkohol zerbrochen und in den Rinnstein geleert hatten.
Dieses Mal waren keine Salafisten im Spiel.
Auf einmal wurde es laut. Stimmen plärrten und Glas klirrte, etwas fiel mit einem trockenen Laut zu Boden. Dann war es wieder still, ja geradezu unheimlich ruhig. Eymen ließ den Esel stehen, um nach dem Vater zu sehen.
Er wollte die Tür öffnen, als sie ihm entgegenschlug und ihn fast umwarf. Er taumelte zurück. Vor ihm bauten sich zwei Männer auf, die den Vater in der Zange hatten und so plötzlich von sich stießen, dass er im Fallen seinen Turban verlor.
Der Sturz des Vaters, der sich mit nur einer Hand kaum abfangen konnte, wirbelte eine Menge Staub auf. Die Männer waren total betrunken, fluchten und beschimpften den Vater. Sie spuckten auf ihn. Er, Yasser Ayari, solle sich nicht wieder blicken lassen! Eymen ignorierten sie.
Als sie vom Vater abließen, sich umdrehten und in die Kneipe zurückwollten, stürzte Eymen sich auf den, der ihm am nächsten war. Eymen schlang die Arme um den Mann. Er krallte sich fest und biss mit aller Kraft zu.
Nach Sekunden erst reagierte der Mann, packte Eymen bei den Ohren und verdrehte seinen Kopf, bis der losließ. Als würde er eine lästige Zecke entfernen. Dann schlug er ihn mit der flachen Hand zu Boden.
Inzwischen war Yasser Ayari wieder auf den Beinen. Er griff sich Turban und Esel und scheuchte seinen Sohn, der in die Kneipe stürmen wollte, um sich für den Schlag zu rächen, mit barschen Worten vor sich her.
Später, als im Kreis der Familie einmal die Rede auf den Vorfall kam, sagte der Vater, der sich sonst seit seinem Unfall ausschwieg, er habe damals nur alte Schulden eingefordert.
BERLIN, 16. DEZEMBER 2016
Nach ihrem Studium war Julia im Statistischen Bundesamt für die Datenerhebung in den Ländern des sogenannten Arabischen Frühlings zuständig gewesen. Als die Migrationsbewegungen an Europas Grenzen aus dem Ruder zu laufen begannen, war sie dieser Arbeit überdrüssig geworden und hatte sich eine Aufgabe gesucht, bei der sie nicht nur zur Dokumentation verurteilt war.
Jetzt arbeitete sie im Projekt »Migrant«, betreute Asylwerber und Migranten, die bereits eine Arbeitsbewilligung hatten. Sie half beim Weg durch das Behördendickicht, wenn es um die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse ging.
Wie um Jakob zu zeigen, was Engagement war, gab sie an den Wochenenden Deutschkurse für Flüchtlinge. So blieb ihnen, wie Jakob bemängelte, immer weniger Zeit, das Leben zu leben, das sie bis dahin gehabt hatten.
Auch diesen Freitag führte sie Gespräche mit Asylwerbern, die oft nicht wussten, wohin sie sich mit ihren in der Heimat erworbenen Zeugnissen wenden sollten. Während vor dem Fenster der Schnee fiel, spendete sie Trost und Rat.
Viele sprachen in der Erwartung vor, dass es nicht schwierig sein würde, einen Abschluss aus Afrika oder dem Orient nostrifizieren zu lassen. Es fiel ihr nicht leicht, die oft viel zu optimistischen und bürokratisch etwas naiven Kunden zu enttäuschen. Es widerstrebte ihr erklären zu müssen, dass ein Uniabschluss aus bestimmten Ländern weniger wert war als ein deutscher Lehrabschluss oder das Abitur.
Vor allem wenn ihr jemand sympathisch war, schämte sie sich für ihr Land, das solche Regeln aufstellte. Wäre es nicht einfacher, vor allem menschlicher, fragte sie sich, während sie in ein frustriertes, beleidigtes oder wütendes Gesicht blickte, die Zeugnisse nur zu übersetzen und deren Inhalt als das zu nehmen, was auf dem Papier stand, schwarz auf weiß? Maschinenbauer aus Nigeria, Schweißer aus dem Irak, Ärztin aus Afghanistan.
Jakob hingegen meinte, es sei nicht nur unverantwortlich, sondern gefährlich, wenn man bedenke, dass ein Maschinenbauer oder Schweißer aus diesen Ländern noch nie von deutschen Normen gehört hatte und vielleicht auch die Ausbildung der Ärztin dem Niveau einer hiesigen Krankenschwester entsprach.
In solchen Momenten, wenn sie Erwartungen zerstören musste, kam sie sich vor wie eine Rassistin, die Menschen nach bürokratischen Vorgaben und wegen ihres Andersseins ausgrenzte: Menschen, die zu viel Leid gesehen oder selbst erlebt hatten. Unschuldige, die verletzt, gefoltert und verfolgt worden waren.
Geboten es nicht die Nächstenliebe, der Anstand oder die Pflicht, zu helfen und Schikanen zu unterlassen?
Abgesehen davon beschäftigte sie zur Zeit hauptsächlich, wie es mit ihr und Jakob weitergehen konnte.
Sie war sich ja nicht sicher, ob sie das Ultimatum nicht vor allem gesetzt hatte, weil Jakob scheinbar kaum etwas dagegen gehabt hatte. Nun war es kaum mehr rückgängig zu machen, ohne dass sie als die dastand, die zu gut war für diese Welt und sich vom Gefühl diktieren ließ, was die Vernunft in Zweifel ziehen sollte.
Wenn sie an die Reise nach Tunesien dachte, auf der sie sich getrennt hatten, so hatte sie allen Grund, ihn zu einer Entscheidung zu drängen, zu der er sich in fünf Jahren nicht hatte durchringen können.
Jakob war von einem der Magazine, für die er über Weine schrieb, nach Tunesien geschickt worden, um über die Wahrscheinlichkeit einer Renaissance des tunesischen Weins zu recherchieren. Er hatte ihr den Vorschlag gemacht mitzukommen. Sie hatte gezögert, weil sie ihn im Verdacht gehabt hatte, sich nur für die ästhetische Seite der Reise zu interessieren und die politische Dimension auszuklammern.
Dann war sie doch mitgekommen. Um mit eigenen Augen zu sehen, warum schon so kurz nach der Jasminrevolution vor allem die jungen tunesischen Männer sich aufmachten, ihre Heimat in Richtung Europa zu verlassen.
In ihre Überlegungen, ob Jakob sich für eine gemeinsame Zukunft entscheiden könnte oder sie endgültig getrennte Wege gehen würden, platzte ein Kunde. Ohne auf eine Aufforderung zu warten, nahm er Platz.
Ein junger Mann, dunkle Augen und Haare, schlank, ein aufgedunsenes Gesicht. Er duftete über den Tisch hinweg, ein Hauch von Jasmin wehte sie an. Er war frisch rasiert, die Backen glänzten. Das etwas zu süße Rasierwasser überdeckte den Geruch nach Alkohol und Haschisch kaum.
Er sah sie herausfordernd an, die Arme vor der Brust verschränkt. Sein rechtes Bein vibrierte vor Ungeduld. Julia dachte an eine Nähmaschine. Seine Pupillen waren geweitet.
»Was kann ich für Sie tun?« Dieser Mann, der jung war, aber nicht jung wirkte, hatte etwas Sonderbares an sich. Gut möglich, dass es ihm nicht gut ging. Vielleicht konnte sie ihm ja helfen.
»Man hat mir geraten herzukommen«, sagte er.
Julia nahm den maghrebinischen Akzent zur Kenntnis. »In welcher Angelegenheit?«
»Ich will heiraten.« Er lächelte etwas verlegen.
Interessant, dachte Julia. »Und wo liegt das Problem?« Jakob war sich noch immer nicht sicher, ob er so weit gehen sollte, mit ihr zusammenzuleben, zu heiraten, ein Kind zu kriegen.
»Meine Geburtsurkunde«, sagte er. »Sie muss übersetzt und beglaubigt werden.«
»Der Reihe nach«, sagte sie, um die etwas ungewöhnliche Situation in den Griff zu kriegen. »Geben Sie mir Ihre Papiere.« Sie erwiderte sein Lächeln. Noch während sie den ägyptischen Text überflog, stellten sich Bedenken ein. Das Dokument sah eindeutig zu neu aus, wenn sie von den Knicken absah, die durchs Falten entstanden waren.
In der arabischen Welt wurden Dokumente gefaltet, um in Kleidung verstaut zu werden, indes Deutsche im Falten von Dokumenten fast eine Straftat sahen. In ihrem Land gehörten Dokumente in eine Hülle und eine Mappe.
Sie nahm ihre Lupe zur Hand, prüfte das Schriftstück kursorisch. Sein nervöses Bein erhöhte die Frequenz.
Dieses Schriftbild war ohne Zweifel viel zu neu, um aus dem Kairo des Jahres 1992 zu sein. Es war mit einem Computer erstellt worden. Über ihren Schreibtisch waren schon Dokumente aus der Zeit und diesem Land gegangen, doch so etwas hatte sie noch nicht gesehen.
»Alles okay?« Die Ungeduld in der Stimme des Klienten drängte auf Erledigung.
»Nein, Herr Labidi, das kann ich leider nicht sagen. Wo haben Sie diese Urkunde ausgestellt bekommen, und wann?«
»Es ist ein Duplikat. Ich habe das Original verloren und mir die Urkunde in Kairo ausstellen lassen, als ich vor dem Militär flüchten musste, weil ich für Freiheit und Demokratie gekämpft habe.«
»Tut mir leid«, sagte Julia. »Ich habe erhebliche Zweifel an der Echtheit des Schriftstücks. Doch ich gebe zu, ich bin keine Expertin auf diesem Gebiet. Abgesehen davon sind Sie hier ohnehin an der falschen Stelle, weil wir uns um Bildungsabschlüsse kümmern. Wofür, sagten Sie, benötigen Sie die Geburtsurkunde?« Sie hatte es nicht vergessen, wollte es nur noch einmal hören.
»Um zu heiraten«, sagte er. Sie hörte eine solche Sorge um die möglicherweise verpatzte Hochzeit aus ihm heraus, dass sie ihn und die Braut bedauerte. Sein zuckendes Bein erlahmte. Der entschlossene Blick erlosch.
Die einzige Möglichkeit, ihm zu helfen, bestand darin, ihn an eine zuständige Stelle zu verweisen. Sie kritzelte die Adresse des zuständigen Amtes auf die Rückseite einer Visitenkarte und reichte sie über den Schreibtisch. »Hier. Dort wird man Ihnen helfen. Ich möchte nicht, dass die Braut zu lange auf ihren großen Tag warten muss.«
Labidi nahm die Karte und steckte sie, ohne einen Blick darauf zu werfen, in seine Hosentasche. Als er etwas zu rasch aufsprang, war er wieder der, der er beim Betreten des Büros gewesen war. Ein Mann, fest dazu entschlossen, für etwas zu kämpfen.
Kein Wunder, dachte sie, dass er trank, rauchte und womöglich Drogen nahm, wenn ihm hier, in ihrem Land, das sich der Menschlichkeit entschlug, Knüppel zwischen die Beine geworfen wurden.
Sie streckte ihre Hand über den Schreibtisch, um den Klienten mit ein paar aufbauenden Worten zu verabschieden. Da hatte er sich bereits mit einem »Inschallah« zum Gehen gewandt, ohne sie noch eines Blickes zu würdigen.
Auf dem Gang holte er die Karte aus seiner Hosentasche und zerriss sie in Stücke, die er hinter sich warf. Allein im Lift, holte er eine Pistole aus der Jacke und versetzte dem Spiegel mit dem Knauf einen Schlag. Mit dem Glas zerbarst sein Bild in viele Teile.
QUESLATIA, TUNESIEN, 2009
Die Tage wären einander hier seit Jahrzehnten zum Verwechseln ähnlich gewesen, hätte es nicht die Nachrichten aus Tunis und anderen Orten des Landes geben.
Die alte Ordnung mit dem die Zukunft des Volkes opfernden Clan an der Spitze verlor seit Jahren an Zustimmung. Viel zu lange waren Geld und Macht in nur eine Richtung geflossen. Weite Teile Tunesiens lagen brach.
Immer mehr hofften auf etwas anderes, und wie eh und je versprach die Führung Reformen. Es waren vor allem die Salafisten, die eine minutiöse Vorstellung von der Zukunft hatten. Eine Zukunft aus dem Geist der Vergangenheit. Eifrig rieben sie sich an Aladins Lampe die Zeigefinger wund, um den Geist der alten Zeit zu entfachen. Nicht viel mehr als eine üble Raubkopie der Vergangenheit, wie ein Gutteil der zu kurz kommenden Jugend fand. Nur eine Illusion, die chancenlos sein würde gegen die Rhythmen, Sounds und Texte ihres Rap.
Es braute sich etwas zusammen.
Einem feuchten Frühjahr folgte ein Sommer, in dem zu Staub zerfiel, was nicht aus Holz, Metall oder Plastik war. Es war, als wucherte der Jasmin in diesem Sommer besonders wild. In den Köpfen der Menschen begann es zu rumoren. Ein Chaos befiel die alten Ordnungen. Man versammelte sich in Schwärmen. In Moscheen, in Kneipen und auf Plätzen. Man wollte sich über das Schicksal erheben, die Verhältnisse, die auf allem lasteten, endlich hinter sich lassen.
Es sollte nicht mehr lange dauern, bis die ersten Blitze über den Horizont zucken würde.
Eymen Ayari war Teil des Chaos. Aber das Chaos wurde auch zu einem Teil von ihm. Früh wegen seiner Quirligkeit aus der Moschee verbannt, eckte er in den Jahren des Heranwachsens bei jeder Autorität an. Die Wut über den Lauf der Welt, die sich zum ersten Mal am Leid des Vaters entzündet hatte, steckte in ihm drin. Er kümmerte sich rührend um seine Geschwister, wenn der Vater nicht da war, rastete aber auch total aus, wenn etwas nicht so lief, wie er es sich vorstellte. Niemand wusste, ob er sich das zweite Gesicht zugelegt hatte, weil er ein Außenseiter war, oder ob er zum Außenseiter wurde, weil es schon immer ein Teil von ihm gewesen war.
Bis zur Trennung der Eltern, die nur mehr geschwiegen hatten, hatte er den Vater bei den Lieferungen zu dessen Kunden begleitet. Man kannte ihn, den Sohn des Yasser, in den Kneipen und auf den Märkten der Stadt. Man wusste, dass er nicht in die Moschee durfte und trotz seines Milchgesichts so wütend werden konnte, dass er seine älteren Brüder verdrosch, wenn sie nicht spurten. Die Mutter, verhärmt von der Sorge, keinen Mann mehr im Haus zu haben, gab ihm zu verstehen, dass er sich um die Familie kümmern müsse.
Als der Vater auszog und den geliebten Filou mitnahm, verfiel Eymen in ein Schweigen, das das Schweigen seines Vaters beim Abschied von der Familie fortsetzte.
Lange Zeit ging Eymen kaum aus dem Haus.
Er hockte im gemeinsamen Zimmer und verfolgte alles, was die andern taten, mit Skepsis und Missbilligung. Klopften Salafisten an die Tür, um für ihre Sache zu werben, wimmelte er sie mit Blicken und ein paar Worten ab, die einen mit allen Wassern gewaschenen Handlungsreisenden vertrieben hätten. Die meiste Zeit brütete er über seinem Smartphone, von dem niemand wusste, woher er es hatte. Er hörte Rap und Hip-Hop und las Nachrichten aus der Ferne des eigenen Landes.
Er wurde das Gefühl nicht los, dass vieles, was irgendwo im Land passierte, mit ihm zu tun hatte.
In die Schule ging er, wenn ihm danach war, was immer seltener vorkam. Wurde er von der Lehrerin aus seinen Tagträumen gerissen, konnte er charmant überspielen, dass er nicht aufgepasst hatte. Oder aber er ging zum Angriff über und stellte ihr Fragen, die eine Frau in Verlegenheit brachten. Oder er gab ihr zu verstehen, dass es ihr nicht zustand, ihm Fragen zu stellen.
Bald brach er den Kontakt zu seinen Mitschülern ab. Nur mit Karim und Ahmed verkehrte er weiterhin.
Es waren die üblichen Probleme eines Kindes, das früh zum Mann werden musste. Im Grunde jedoch, dachten viele, die mit ihm zu tun hatten, war er nur einer, hinter dessen rauer Fassade ein zu verletzliches Herz schlug.
Die Lehrerin war sich da nicht so sicher. Ein paarmal war sie gezwungen, die Mutter vorzuladen, weil sie nicht mehr wusste, wie sie Eymen zur Räson bringen sollte. Einmal ertappte sie ihn dabei, wie er in der letzten Reihe unter der Bank zu Bildern auf seinem Smartphone onanierte. Dann erzählten Schüler, Eymen habe sich mit seinem Messer die Arme geritzt, um zu zeigen, wie hart er sei. Und dann gab es diesen Vorfall, der fast zum Rauswurf durch den Direktor führte, der mit den Salafisten sympathisierte.





























