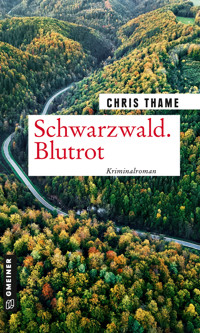
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Niels Kielsen
- Sprache: Deutsch
Der Lehrer und Krimiautor Nils Kielsen macht sich mit Eifer an einen neuen Krimi im Kirchenmilieu. Sein Einstieg: Ein Priester wird während der Messe von einem herabfallenden Kruzifix erschlagen. Die Kripo findet Hinweise auf das biblische Buch Amos und vermutet einen Racheakt. Doch noch bevor Kielsens Ermittler auf eine heiße Spur stoßen, wird ein Schwarzwalddorf zum reellen Schauplatz seiner Krimifantasie und Nils Kielsen gerät schließlich selbst unter Verdacht. Ein Vexierspiel zwischen Fiktion und Realität beginnt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Chris Thame
Schwarzwald. Blutrot
Kriminalroman
Zum Buch
Reelle Fiktion Ein Kruzifix löst sich von der Kirchenwand und erschlägt den Priester, der gerade die Messe hält. Ein Zettel auf dem Kreuz verweist das Ermittlerduo von der Kripo auf das alttestamentliche Prophetenbuch Amos. Bald darauf explodiert der Altar der Kirche. Und wieder tauchen Zeilen aus dem Buch Amos auf. Die Idee zu diesem Plot hat der Krimiautor und Biologielehrer Nils Kielsen aus dem Religionsunterricht seiner Tochter. Mit viel Schwung schreibt er neben seinem Lehrerdasein Kapitel um Kapitel. Doch noch bevor seine Ermittler dem Täter auf die Spur kommen, wird sein Krimi von der Wirklichkeit eingeholt. Ein Priester stirbt durch ein herabfallendes Kreuz, ein Altar wird zerstört, und dann passiert auch noch ein Mord direkt im schulischen Umfeld von Nils Kielsen. Jetzt gerät er selbst unter Verdacht. Doch welche Rolle spielt eigentlich der Lektor des Autors? Und was hat es zu bedeuten, dass der Bürgermeister des Schwarzwalddorfs ganz offensichtlich Feinde hat? Nils Kielsen wird Teil seiner eigenen Geschichte – und wehrt sich nach Kräften dagegen …
Chris Thame ist das Pseudonym einer deutschen Autorin, die im schwäbischen Reutlingen geboren wurde. Noch zu Schulzeiten hat sie ein Jahr in den USA verbracht und später in Marburg, Straßburg und Tübingen evangelische Theologie studiert. Vor rund 20 Jahren ist Thame ins Pfarramt ordiniert worden. Die Liebe zur Theologie konnte die Pfarrerin in einer späten Promotion ausleben. Für die Liebe zur Sprache hat sie verschiedene Einsatzorte: Radioansprachen, Gottesdienste, Unterricht. Erdung erfährt Thame immer wieder aufs Neue im Gespräch mit ihrem Mann und den drei Töchtern. Über die Jahre sind Freiburg und der Schwarzwald zu ihrer Heimat geworden, die Neugier auf Menschen und ihre Geschichten ist geblieben.
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Lektorat: Susanne Tachlinski
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Marcus Witte / shutterstock.com
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6306-8
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
1. Kapitel (Montagabend)
Keine Ahnung, wie ich überhaupt noch unterrichten könnte ohne Eva-Maria. Regelmäßig frage ich mich, wie andere ohne eine solche Frau das schaffen. Wie kann man bei vollem Deputat normal bleiben, und wenn ja, wie lange?
Jede Schule ist eine Vorhölle aus stimmbrüchig pubertierenden Siebtklässlern, chauvinistischen oder psychokastrierten Kollegen und sozial überambitionierten Kolleginnen. Und selbst falls diese Mischung aus undurchsichtigen Gründen noch irgendwie erträglich sein sollte – es gibt ja auch noch die Eltern. Von Zeit zu Zeit bekomme ich E-Mails, in denen Eltern mir klarmachen wollen, dass die 4–5 ihres Kindes in Englisch nie und nimmer dessen Leistungsstand abbilde, sondern eher das Niveau meines Unterrichts. Neulich bekam ich sogar einen Brief von einem Anwaltsbüro. Im Auftrag eines Vaters einer meiner Neuntklässlerinnen, die auch nach vier Jahren Englischunterricht noch nicht über das Niveau von »he-she-it:-das-s-muss-mit« gekommen ist. Das Büro fragte mich allen Ernstes nach meiner Lehrbefähigung und drohte mir ein Verfahren wegen Erschleichung von Steuergeldern an.
Wenn ich Eva-Maria von diesen Demontagen meiner Autorität erzähle, hört sie mir zwar aufmerksam zu. Aber dann macht sie eine Bemerkung, und ich kann plötzlich mit ihr darüber lachen.
Heute Morgen zum Beispiel: Lion aus der 7d liest einen selbst geschriebenen Dialog zur Bildergeschichte im Englischbuch vor. In der Story geht es um einen Mann, der einen Schneeball ins Gesicht kriegt und sich die Hände vor die Augen schlägt. Lion lässt den Mann rufen – ohne zu wissen, dass er damit einen klassischen Vokabelfehler begeht: »My eggs, my eggs – it hurts me!« Passiert öfters mal: Die Kinder denken in einer Doppelschlaufe: Auge – eye – Ei – egg … Heute Morgen jedenfalls verhakte sich Lion in dieser Doppelschlaufe. Die anderen starrten ihn erst entsetzt an, dann brach das Gelächter los. Den Rest der Stunde brüllte immer ein anderer »My eggs, my eggs« und hielt sich prustend die Hände vor die Augen. An einen ordentlichen Unterricht war nicht mehr zu denken. Dagegen ist man irgendwie machtlos.
Und Eva-Maria? Hört sich am Mittag meine Pein an, lächelt verwegen und fragt: »And what about yours? How about some recreation?« Wäre nicht Henriette gerade aus der Mittagsschule gekommen, hätte sie mich mitten am Tag ins Bett geschleift.
Henriette allerdings hat mich dafür auf eine neue Krimi-Idee gebracht!
Jedes Mal, wenn sie montags aus der Schule kommt, verwendet sie ihre letzte Energie darauf, ihre Schultasche in die hintere Ecke unseres nicht gerade kleinen Flurs zu schleudern. Dann stapft sie in die Küche, fragt: »Was gibt’s?«, und hängt ohne eine Antwort abzuwarten noch ein »der ist sooo blöd!« dran.
Sie meint damit ihren Relilehrer, den sie schon seit der fünften Klasse blöd findet und wohl erst nächstes Jahr im Kurssystem loswird. Der arme Kerl – er tut mir leid. Das harsche Urteil hat er vermutlich nicht verdient. Aber Gemeindepfarrer an Gymnasien sind selten eine Idealbesetzung. Immerhin hat er immer mal wieder Beerdigungen, dann kommt Henriette freudestrahlend früher nach Hause. Heute allerdings war alles wie immer. Eva-Maria und ich reagierten auch wie immer: Augenbrauen hoch und einmal tief im Chor geseufzt.
Anders als sonst redete Henriette aber weiter: »Wieso kommt der uns jetzt in der zehnten Klasse noch mit Amos? Amos! Das ist siebte Klasse. Der ist wahrscheinlich noch nie über den Lehrplan von Klasse sieben rausgekommen. Und überhaupt – wen interessiert schon Amos mit seinen abgedrehten Visionen. Obstkörbe, Bleilote, Heuschrecken – und Altäre mit Hörnern … Soll er doch zu Hause bleiben und den Kirchenaltar schmücken, wahlweise mit faulem Obst oder gegrillten Heuschrecken.«
Und dann, mit einer schwungvollen Drehung zu mir: »Papa, findest du, man muss Amos unbedingt zweimal durchnehmen?«
»Äh, also Amos, äh …«, mehr fiel mir nicht ein. Ich wusste nicht, wer das sein sollte, dieser Amos. Jedenfalls konnte ich mich nicht daran erinnern, dass das bei mir je Unterrichtsstoff gewesen wäre.
»Ja, klar«, sagte aber meine wunderbare Frau, »Amos ist ein Klassiker der Sozialkritik. Sozusagen der Vorläufer von Marx. Und außerdem sind es nur neun Kapitel oder so. Stell dir vor, dein Lehrer hätte sich auf Jesaja spezialisiert. 66 Kapitel, und dann auch noch auf drei unterschiedliche Zeitepochen verteilt – dann doch lieber Amos. Und jetzt gibt es Essen: gegrillte Heuschrecken mit Obsthörnchen. Guten Appetit!«
Die gefüllten Pfannkuchen beruhigten Henriette eine Weile. Aber dann ging es wieder los: »Ich meine, warum sollte mich – eine kosmopolitische Bürgerin einer Großstadt im dritten Jahrtausend – interessieren, was irgend so ein dahergelaufener Feigenzüchter einem Underdog-König im achten Jahrhundert vor Christus zu sagen hat?«
»Er war Maulbeerfeigenzüchter, das ist was anderes. Und außerdem erfolgreicher Viehzüchter.«
Ich bin immer wieder erstaunt, was meine mir angetraute OP-Schwester alles weiß. Je abstruser ein Sachverhalt ist, desto sicherer kann sie ihn sich behalten. Offensichtlich gehörte Amos also doch auch schon zu unseren Schulzeiten zu den Unterrichtsthemen.
»Na und? Das macht ihn auch nicht gegenwartsbezogener«, patzte Henriette zurück. Ein Vokabular wie ein altkluges Lehrerkind. Sie sollte vielleicht doch öfter mal Comics lesen.
»Nils, du bist schon fertig mit Essen. Hol doch mal die Bibel.« Eva-Maria lächelte mich an.
Ich stand auf, blieb dann aber unschlüssig im Raum stehen: »Wo haben wir denn eine?«
»Na, links oben im Regal im Flur, in der Reihe bei den Lexika.«
In der Tat: In blaues Leinen gebunden fand ich jene Bibel, die ich vor rund 25 Jahren zur Konfirmation geschenkt bekommen hatte. »In des alten Bundes Schriften, merke an der ersten Stell: Mose, Josua und Richter, Ruth und zwei von Samuel …« – ich war baff, dass ich das noch konnte. Jedenfalls hatte ich erstaunlich schnell Amos aufgeschlagen, ohne das Inhaltsverzeichnis zu bemühen, und blieb die nächste Viertelstunde gebannt vor dem Regal im Flur stehen. Wow – das war eine Sozialkritik, die sich gewaschen hatte. Da könnte sich so mancher SPD-Politiker eine Scheibe abschneiden.
Als mich Eva-Maria im Stehen lesend im Flur fand, war meine Idee bereits geboren: Amos im Schwarzwald! Dieser Prophet traf meines Erachtens mit seinem Privilegiertenrundumschlag den Nerv unserer Zeit. Mir schwebte eine saftige Gesellschaftskritik vor, die ich mit einem Mord im römisch-katholischen Tannenwipfelmilieu verbinden wollte.
Als es an der Tür klingelte, schlug ich die Bibel zu, küsste Eva-Maria auf die Stirn und sagte geheimnisvoll: »Ich werde nachher meinen Lektor anrufen – eine Idee ist geboren!« Dann öffnete ich Frieda die Tür.
Reinkommen und Losplappern waren eins: »Ich weiß schon, ich hätte mir die Haare föhnen sollen. Aber dann wäre ich noch später gekommen, safe! Waren drei Leute vor mir dran.«
Die Elfjährige wartete meinen Kommentar gar nicht ab, sondern ließ mir die Schultasche auf den Fuß fallen und rannte in die Küche; »Ist-noch-was-übrig«-Rufen und Losessen ging gleichzeitig. Ich nahm Friedas Schultasche und stellte sie vor ihr Zimmer. Dann schnappte ich mir die blaue Lutherbibel und zog mich in mein Arbeitszimmer zurück.
Wenn ich meine Idee sofort aufschrieb, würde mir nichts wegrutschen. Alle Unterrichtsunterlagen auf meinem Schreibtisch verfrachtete ich dazu stoßweise auf den Boden. Am Ende hatte ich vier adrette Stapel: Englisch Kursstufe, Englisch Unterstufe, Bio Kursstufe und einen Stapel mit Klassenarbeiten, die ich eigentlich dringend korrigieren sollte. Doch jetzt breitete ich einen Doppelbogen Karopapier auf dem Schreibtisch aus und malte eine Ellipse in die Mitte, in die ich das Wort »Schwarzwalddorf« schrieb. Dann setzte ich meine weiteren Gedanken in Form von Begriffsellipsen dazu: »Kruzifix«, »Gottesdienstkritik«, »Emanzipation versus Konservativismus«, »Bereicherung« und so weiter. Schließlich verband ich die Stichwörter mit verschiedenfarbigen Linien, auf die ich teilweise Personenbeschreibungen und Handlungsmöglichkeiten setzte. Innerhalb kürzester Zeit nahm meine Mindmap zum Thema Amos im Schwarzwald Gestalt an. An den Rand schrieb ich Personennamen, die mir passend schienen, und verfasste kurze Charakterisierungen. Es hatte mich richtig gepackt. Ich sah den Ort des Verbrechens bereits vor mir: eine barocke Kirche mit Zwiebeldach, davor ein kleiner Brunnen, dahinter der Friedhof, nur mit einer niedrigen Steinmauer vom Kirchenareal getrennt. Kletterrosen am Kirchenkorpus. Ein Dorf, das einmal hübsch gewesen war, bis es in den 70ern wesentlich erweitert wurde und in den 90ern schließlich mehr und mehr auch von Menschen bewohnt wurde, die jeden Morgen den Weg nach Freiburg auf sich nahmen.
Eine Stunde später rief ich bei meinem Lektor Behringer an. Eine junge Frau, deren Namen ich nicht verstand, nahm ab. Als sie meine Verwirrung bemerkte, erklärte sie mir, dass sie für einige Wochen ein Praktikum bei Herrn Behringer mache, der gerade nicht da sei. Sie würde ihm jedoch gerne mein Anliegen ausrichten und so weiter und so fort. Ich skizzierte ihr in wenigen Sätzen meine Idee zu einem neuen Krimi, bei dem ich Motive aus dem Buch Amos mit einer katholischen Dorfgemeinde in Verbindung bringen wollte. Ich hörte, wie sie mitschrieb.
Eine Stunde später rief Behringer persönlich zurück: »Prima Sache! Darf nur nicht zu holzschnittartig werden. Es soll nicht rauskommen, dass die katholische Kirche verlogen ist oder so, okay? Die haben ja genug mit den ganzen Missbrauchsskandalen zu tun. Da hauen Sie bitte nicht in dieselbe Kerbe.«
»Nee, ist klar. Das wäre zu billig«, beschwichtigte ich, »soll ich Ihnen die fortlaufenden Kapitel mailen oder lieber erst, wenn ein größerer Teil fertig ist?«
»Nun ja, in zwei Wochen ist ein wichtiges Meeting mit der Verlagsspitze. Wenn Sie mir bis dahin genügend Material geliefert haben, kann ich versuchen, Ihren Krimi in die neue exklusive Freiburg-Edition reinzubekommen. Das wäre für Sie lukrativ und für uns ein authentischer Freiburger Name mehr in der Edition. Schaffen Sie das?«
»Mal schauen. Ich hab gerade nicht viel Stress in der Schule. Also, ich fange einfach mal an und schicke Ihnen dann immer meine jeweiligen Fortschritte.«
»Abgemacht! Dann lassen Sie Ihren Amos mal losmarschieren!«
Ich legte zufrieden auf. Dabei fiel mein Blick noch mal auf den Stapel mit der Englischarbeit der zehnten Klasse. Schnell schaute ich weg. Erst mal joggen gehen. Die kleine Runde. Und dann recherchieren, wer Amos eigentlich gewesen ist und auf welche Probleme seiner Zeit er damals reagiert hat.
Wie gut, wenn man eine Universität in der Stadt hat mit echten Büchern. Den Nachmittag verbrachte ich in der theologischen Fakultät in der Abteilung Altes Testament. Sehr schnell hatte ich eine erste Erkenntnis: Auch in der Theologie gehörte Amos offensichtlich nicht zu den allerheißesten Themen. Der neueste Kommentar zu Amos, den ich in den Regalen fand, war von 2013. Davor gab es zwei Bücher vom Anfang der 2000er. Ich nahm die drei voluminösen Bände mit an einen Arbeitstisch und schrieb mir die interessantesten Fakten raus.
Bevor ich wieder nach Hause radelte, trank ich noch einen Espresso im »Kolbenkaffee«. Obwohl es schon nach fünf war, musste ich mich an einen der Stehtische dazudrängeln. Die Kombination von richtig gutem Kaffee und den Nusshörnchen, die es hier gibt, lohnt aber jede Enge. Die Nussfüllung steckt in einem Mürbeteig, der ganz leicht salzig schmeckt und den speziellen Reiz dieses Gebäcks ausmacht. Obwohl es dort auch noch jede Menge anderer wunderbarer Backkunstwerke gibt – zum Beispiel Millefeuilles und Eclairs –, nehme ich doch fast jedes Mal ein Nusshörnchen.
Noch vor dem ersten Abbeißen bekam ich plötzlich ein schlechtes Gewissen. Für Amos hätte ich damals wohl zur dekadenten Oberschicht gehört, die sich jeden Luxus gönnt und sich einen Dreck um die Unterschicht schert.
Als ich später mein Geschirr in die Durchreiche stellte, warf ich einen Euro in das Trinkgeldtöpfchen am Tresen und fühlte mich etwas besser.
2. Kapitel (Dienstag)
Eberhard Reuter liebte die Dienstagvormittage. Dienstags begann Frau Kärnten ihren Dienst erst um 11 Uhr. Wenn er gegen halb neun die schwere Eichentür aufschloss, den extragroßen Briefkasten leerte und dann mit dem großen Packen Post die Sandsteintreppe nach oben ging, fühlte er sich wichtig und unabhängig. Auch an diesem Dienstag gelang ihm das Kunststück, mit nur einer Hand die Tür zu seinem Büro aufzuschließen. Von einer tiefen Zufriedenheit erfüllt warf er die Post mit einer eleganten Bewegung auf seinen Schreibtisch und zog die schweren Gardinen vor dem Fenster zurück. Sofort flutete das Morgenlicht Reuters Schreibtisch.
In perfekter Ordnung und Harmonie lagen dort wenige Utensilien. Er setzte sich in den modernen mit Leder bespannten Arbeitssessel und griff nach seinem silbernen Brieföffner. Er atmete tief durch – jetzt begann sein größter Genuss an den Dienstagen: Mit dem passgenau in der Hand liegenden Brieföffner an der einzig richtigen Stelle eines verschlossenen Umschlags anzusetzen und mit einer minimalen, exakt bemessenen Bewegung das Kuvert zu öffnen. Er schloss die Augen, wenn das säuselnde Ssssssd der Klinge das Papier zerschnitt. Insgeheim stellte er sich dabei vor, er sei ein Schächter, der das zum Essen bestimmte Schaf in liebevoller Verbundenheit mit den Ahnen schnell und schmerzlos tötete. Um den Genuss zu verlängern, öffnete er jeweils nur einen Brief, nahm den Bogen heraus, übersah den Inhalt und entschied dann, ob die Angelegenheit auf seinem Schreibtisch bleiben, oder ob er es an Frau Kärnten weiterreichen würde. Zu letzterem Behuf stand ein silberner Aktenkorb in Reichweite. Was bei ihm bleiben sollte, strich er glatt und legte es, bis alle Post geöffnet war, auf die linke Seite seines Schreibtischs. Das erste Schreiben, das er schächtete, war eine Einladung des Schützenvereins zum nächsten Schützenfest. Es kam in den Korb für die Sekretärin, sie würde entscheiden, ob sein Terminkalender eine solche Einladung hergab. Den nächsten Umschlag öffnete er erst, nachdem er liebevoll das gepolsterte Papier ein wenig gedrückt hatte. Dieses Schreiben würde bei ihm bleiben: das Protokoll der letzten Aufsichtsratssitzung des SC, seinem Fußballklub in Freiburg. In Gedanken an den Ausgang des letzten Spiels versunken, bemerkte er nicht, dass der nächste Brief keinen Absender trug. Als die Klinge durch das Papier schnitt, ärgerte er sich über dessen offenkundig mindere Qualität, da das Ssssssd keinen satten Klang hatte. Der Briefbogen war mit einer herausgerissenen Bibelseite beklebt. Er las die unterstrichenen Sätze: »Ruft es aus über den Palästen … versammelt euch auf den Bergen … seht euch das wilde Treiben in der Stadt an und die Unterdrückung, die dort herrscht. Sie kennen die Rechtschaffenheit nicht – Spruch des Herrn – sie sammeln Schätze … Darum – so spricht Gott, der Herr: Ein Feind wird das Land umzingeln; er wird deine Macht niederreißen und deine Paläste werden geplündert. … Ja, an dem Tag … werde ich an den Altären von Beth-El die Strafe vollziehen … Ich zerschlage den Winterpalast und den Sommerpalast … und mit den vielen Häusern ist es zu Ende – Spruch des Herrn.«
Reuter runzelte die Stirn. Entschlossen warf er das anonyme Schreiben in den Papierkorb.
Er nahm den nächsten Brief zur Hand. Alarmiert nahm er zur Kenntnis, dass er von seiner Exfrau war. Das Ssssssd klang genauso schrill wie ihre Stimme. Zum Glück schrieb sie nichts, was ihn ärgern konnte. Das Schreiben enthielt eigentlich nur die sachliche Information, dass die studierende Tochter eine Mieterhöhung bekommen hätte und deshalb der monatliche Betrag um 30 Euro aufgestockt werden musste.
Kein Problem, dachte er und legte den Briefbogen links ab. Ihm fiel ein, dass er seine Tochter seit Beginn ihres Studiums nicht mehr gesehen hatte. Womöglich schrieb sie gerade ihre Bachelorarbeit.
Er spürte etwas wie einen Nadelstich in der Herzgegend. Ich sollte mal wieder zum Arzt, überlegte er und nahm den nächsten Brief zur Hand, der das Signet der Pfarrgemeinde trug – eine Art Standarte, an deren Spitze ein Kreuz rankte, darum herum in einer Ellipse angeordnet die Adresse des Pfarramts. Das Signet war erträglich, doch das billige Papier ließ es beliebig erscheinen. Er hatte Hans schon oft geraten, ja, ihm sogar angeboten, anderes Büropapier zu besorgen, aber der hatte nie darauf reagiert. Entsprechend enttäuschend war das Geräusch beim Öffnen des Umschlags. Die Spendenbescheinigung über 200 Euro legte er in den Korb für Frau Kärnten, sie würde es bei den Unterlagen für seine Steuererklärung abheften.
Zwei weitere Briefe warf er ungeöffnet in den Papierkorb. Werbepost fand er seines Brieföffners unwürdig. Den letzten Umschlag schlitzte er zwar genussvoll auf, legte ihn dann jedoch als Ganzes in den Korb seiner Sekretärin; es war die Telefonrechnung.
Eine plötzliche Unruhe brachte ihn dazu, nicht gleich seinen Terminkalender zu öffnen, sondern doch noch einmal das anonyme Schreiben aus dem Mülleimer zu ziehen. Diesmal las er die Sätze aufmerksamer.
Wer konnte dahinterstecken? Hing es mit dem Grundstücksverkauf der Kommune zusammen, oder spielte der Absender auf seine erst kürzlich erworbene Stadtwohnung an?
Aber er hatte sich nichts vorzuwerfen. Als Mitglied des SC-Aufsichtsrats musste er auch mal in Freiburg übernachten können. Das war vermutlich sogar steuerlich absetzbar, so ein Wohnungskauf wegen vereinsbedingter Pflichten. Sein Steuerberater würde das schon deichseln. Und er war ja bescheiden geblieben, nichts Großes. Zwei Zimmer in der Wiehre, 75 Quadratmeter. Kleiner Dachgarten anbei. Plus Stellplatz im Hof. Schließlich wollte er seinen Volvo XC40 nicht einfach irgendwo in der Zasiusstraße abstellen müssen. Die parkten da immer so eng, dass Nummernschilder Dellen abbekamen. Und die Versicherung zahlte solche Schäden nicht. Aber konnte dieser bescheidene Luxus Anlass für einen anonymen Briefautor sein, ihm Bibelzitate zu schreiben? Wer würde ernsthaft Anstoß nehmen an juristisch einwandfrei zu rechtfertigenden Entscheidungen?
Sollte seine Katze ihm sein Refugium in Freiburg missgönnen? Nur wegen der kleinen Auseinandersetzung neulich?
Reuter verwarf den Gedanken: Eher nicht, sie war immer direkt. Anonyme Briefe passten nicht zu ihrem Temperament.
Ob seine Exfrau fähig war, so ein Schreiben aufzusetzen?
Schon eher denkbar. Aber wenn er richtig darüber nachdachte: Nein, Alexandra würde niemals eine Bibel zerreißen. Nicht mal, um ihn zu provozieren.
In seine Überlegungen hinein klingelte es an der Tür.
Reuter fuhr hoch, schlug mit der einen Hand den Terminkalender auf, mit der anderen bediente er den Türöffner. Ach ja, Hans hatte sich angemeldet. Er stieß sich mit den Füßen ein wenig ab, ließ sich im Stuhl zum Regal rollen und hatte mit einem einzigen Handgriff den rot-schwarzen SC-Ordner aus dem Regal geholt. Die Satzung des Aufsichtsrats war vorne eingeheftet. Heute wollte er mit Hans noch mal über seine Chancen reden, in Bälde einen der beiden Vorstandsposten beim SC zu besetzen. Es ging darum, wie er die übrigen Aufsichtsräte unauffällig dazu bewegen konnte, seinen Namen ins Spiel zu bringen. Zum Ehrenrat hatte Hans noch viele Kontakte; da würde er hilfreich tätig werden.
3. Kapitel (Dienstag)
Dienstage fand ich schon immer großartig. Der Wocheneinstieg am Montag ist geschafft; von Dienstag an kann man sich zwischen Gasgeben und Routine entscheiden. In diesem Schuljahr sind meine Dienstage besonders prima: eine Doppelstunde Englisch in der Neunten und dann am späten Nachmittag noch eine Stunde Bio bei den Kleinen. Ansonsten: Joggen oder Schreiben! Von halb zehn bis zwölf und dann noch mal nach der Mittagspause von zwei bis halb vier.
Ich setzte mich an diesem Morgen gleich an den Schulcomputer und begann mein erstes Kapitel:
Immerhin sieben! Mit einem Blick aus dem Augenwinkel hatte er sie gezählt. Er konnte es einfach nicht lassen: Jeden Morgen beim Umdrehen zum Kreuz erfasste er alle Anwesenden und zählte sie. Sieben, dachte er zufrieden und beugte sein rechtes Knie tief vor dem gekreuzigten Christus, das linke bildete einen rechten Winkel. Die alte Weber war da, verdrießlich und verlässlich wie jeden Morgen um sieben. Die Nolte – gut befreundet mit Magda Weber und außerdem zuverlässige Kuchenbäckerin für Gemeindefeste, seine Nichte Ann-Katherine mit ihrer Tochter, Kommunionskind, dann noch Alois, der wohl gerade vom Zeitungsaustragen zurückkam und – und das überraschte ihn – ein junger Mann, den er bisher noch nie gesehen hatte, vielleicht ein Tourist. Seine Haushälterin Berta war natürlich auch da, aber das verstand sich von selbst. Genauso wie sein Diakon.
Sein Mund berührte den Altar, Zeichen der Präsenz Christi.
Er hatte ein wenig zu lange über den jungen Mann nachgedacht, das spürte er an seinem Knie, als er sich wieder aufrichtete. Denn eigentlich vollzog nicht er selbst den Gottesdienst, sondern seine Körperteile feierten die Messe selbstständig. Sie hatten die Bewegungen, Drehungen, Beugungen über die Jahre aufgesogen. Sobald er diese Kirche betrat, erinnerten ihn seine Beine, Gelenke, Arme an den jeweils nächsten Schritt. Auch jetzt breiteten sich seine Arme aus und seine Stimme folgte der Bewegung: »Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.«
Sein rechter Arm führte die Hand zum Kreuzzeichen. »Der Herr sei mit euch«, sprach es wie von selbst aus ihm. Und die kleine Gemeinde murmelte ihm entgegen: »Undmitdeinemgeist«.
Er verzichtete am Morgen auf das Bußgebet und ließ stattdessen ein Bußlied singen.
Sein Körper stemmte sich aus dem schweren Stuhl empor. Sein Mund sang, seine Augen waren starr auf das Gotteslob gerichtet, und doch nahm er jede Bewegung der vier Ministranten wahr, die heute Frühdienst hatten.
Die Kyrierufe des Kantors ließen seine Beine aufstehen. Gloria, Tagesgebet, Lesung. Der Diakon las den Abschnitt aus dem Alten Testament. Und mit der Gemeinde hörte er sich antworten: »Dank sei Gott«. In seiner Brust sammelten sich Kraft und Klang, um in das Responsorium des Psalmes einzustimmen. Die Melodie brach sich durch seine Lungen und über den Kehlkopf hinaus Bahn.
Wie jeden Tag genoss er den Einklang seines Körpers mit dem feierlichen Geschehen, das sich selbst trug.
Zweite Lesung, Antwort und dann das Halleluja! Vorbereitung des Evangeliums. Jetzt war er an der Reihe mit Lesen, nein, mit Bezeugen. Die Größe Gottes in den Worten des Evangeliums. Ein Ereignis, an dem er teilhatte. Von innen heraus. Er spürte es in der Tiefe seines Körpers. Mit der Gemeinde sprach er stehend das Glaubensbekenntnis.
Dann kam der Moment der Gabenbereitung, der Vollzug des Mysteriums durch seine Glieder, seine Stimme, sein Gebet. Aus der Tiefe seines Körpers stiegen die alten gesegneten Worte in den akustischen Raum, der alle umgab. Geheimnis des Glaubens. Er fühlte am ganzen Körper, wie richtig es war, den Tag mit solch einer Messe zu beginnen.
Die Anwesenden sagten später aus, dass ihr Pfarrer an diesem Morgen besonders durchgeistigt gewirkt hätte. Als sei seine Seele von höheren Mächten durchdrungen gewesen.
Womöglich war dies aber auch das Resultat der versuchten Verarbeitung des Geschehens. Alle Anwesenden waren zur Kommunion gegangen, hatten den Leib Christi empfangen. Der Diakon hatte assistiert und den Kelch gleich gereinigt. Auf dem Hostienteller waren noch zwei Hostien übrig. Der Eifer des Diakons mochte den Priester auf die Idee gebracht haben, noch vor den Entlassworten und dem Segen diesen Teller in den Tabernakel zu stellen. Jedenfalls ging er mit dem Teller zur heiligen Wand mit dem bronzenen Kruzifix, während die Kommunikanten noch betend an ihren Plätzen knieten.
In jenem Moment, als er die Tür des Tabernakels öffnete, ging ein Ruck durch die Kirche.
Der Leuchter flackerte. Ein tiefes, unheimliches Krachen lähmte den Priester. Sein Blick ging nach oben. Und so wurde er erschlagen. Vom Kreuz seines Herrn, oder genauer: vom leidenden Corpus Christi.
Die Kirche bebte noch, als das Kreuz schon am Boden lag und das Blut des Priesters den Steinboden langsam und stetig färbte.
Als Erstes regte sich der Diakon. Er machte drei schnelle Schritte auf den Priester zu, hob dann allerdings nur die am Boden zerbrochenen Hostien auf und legte sie mit vorsichtigen Bewegungen in den Schrein in der Wand.
In diesem Moment begann Maria zu schluchzen. Sie war die jüngste Ministrantin und hatte eben einen Spritzer Blut auf ihrem Messgewand entdeckt. Dann bewegten sich alle auf einmal.
Der Diakon eilte mit wenigen Schritten zu Johannes, der ebenfalls am Boden lag. Der Ministrant war von dem Querbalken des Bronzekreuzes getroffen worden und blutete. Seine Schwester Lena hatte er mitgerissen, sie war über die Altarstufen gestürzt und lag äußerlich unversehrt immer noch dort.
Die Haushälterin stürzte auf den Priester zu und begann sofort, laut über seiner Brust zu klagen.
Der Kantor betrachtete verwirrt den Mauerstaub auf seinen Jackenärmeln. Das Choralbuch hatte er reflexartig gerettet; es steckte unter seinem linken Arm.
Der junge Mann verließ fluchtartig die Kirche.
Die Witwen Weber und Nolte waren auf ihre Plätze gesunken und fächelten sich gegenseitig Luft mit dem Gesangbuch zu.
Alois murmelte ohne Unterlass: »Und das vor dem Segen. Er hat uns keinen Segen gegeben. Keinen Segen haben wir!«
Die Nichte des Erschlagenen schließlich zog ihr Kind aus der Kirche und rief über die Schulter: »Ich rufe den Krankenwagen und die Polizei!«
Kommissar Jean Meinte bot sich kurz darauf ein bizarres Bild: Die Sanitäter trugen eben zwei Kinder auf Bahren hinaus. Ein Mann stand stumm mit einem Buch unter dem Arm herum. Der Diakon riss an einer Frau herum, die laut weinend bei dem toten blutigen Priester kniete, ein Mann stammelte: »Segen-Segen-Segen«, und zwei übrige Ministranten starrten bleich und reglos auf das Kruzifix.
Meintes Partnerin Amrei Klume ging zu ihnen. Sie berührte beide mit je einer Hand an der Schulter und sprach sie leise an. Meinte selbst ging zu dem Toten. Der Diakon stellte sich als Stefan Schultes vor – mit ausnehmend ruhiger Stimme, wie der Kommissar sofort feststellte – und nannte den Namen des Priesters: Hans Stolze.
Meinte hörte nur mit halbem Ohr, was der Diakon sagte. Er hatte den Namen der weinenden Frau nicht verstanden. Aber dass sie die Haushälterin des Pfarrers war, hatte er mitbekommen. Und dass sich diese Haushälterin absolut nicht für die anwesende Polizei interessierte, war allzu deutlich.
Ratlos schaute er zu seiner Kollegin – er hoffte, sie könne die heulende Haushälterin irgendwie beruhigen. Doch Klume hörte gerade einem der Kinder, die ministriert hatten, zu. Meinte konnte Bruchstücke verstehen. »Ist das eine Gottesstrafe?«, das war die entsetzte Stimme des Mädchens. »Das hat der nicht überlebt!«, hörte er den Jungen sagen und fand, dass in seiner Stimme nicht nur Entsetzen mitschwang.
Meinte ging zu dem Mann mit dem Buch unter dem Arm. Der Diakon begleitete ihn. »Das ist unser Kantor Ralf Fünfgeld«, stellte er ihn vor, als seien sie auf einem Empfang. Der Kantor nickte nur. »Er hat oben auf der Orgelempore gesessen, als es passiert ist«, fügte Schultes noch hinzu.
Meinte sah den Diakon verärgert an und fragte dann Fünfgeld direkt: »Wie haben Sie den Vorgang erlebt?«
Der Kantor nahm sein Choralbuch in beide Hände, als müsse er sich daran festhalten. »Ich habe die Registrierung für das nächste Lied vorgenommen.« Er sprach sehr leise. »Als ich das Oktavpfeifenregister gezogen habe, ging diese Erschütterung durch den Raum. Für einen kurzen Moment dachte ich, es läge an der Orgel. Dann kam das Kruzifix runter. Ich habe das Orgelbuch zugeschlagen, unter den Arm geklemmt und bin die Treppe runtergerannt. Ich war überzeugt davon, dass jetzt alles einstürzt. Ich wollte raus.«
Meinte musterte den blassen Mann und fragte dann: »Herr Fünfgeld, ich habe noch ein paar Fragen an Sie. Fühlen Sie sich dem gewachsen, oder sollen wir Sie besser zu einem späteren Zeitpunkt befragen?«
Der Kantor schaute ihn eine Weile schweigend an. »Was wollen Sie denn noch wissen?«, fragte er dann langsam.
»Zum Beispiel wie lange Sie schon den Orgeldienst hier verrichten, wie Sie bezahlt werden, wie Ihr Verhältnis zu den Hauptamtlichen ist.«





























