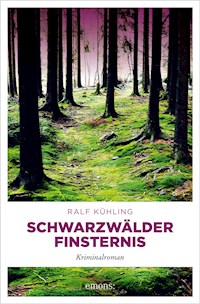
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Carl Christopher Moderski
- Sprache: Deutsch
Rasant, actionreich, aufrüttelnd. Carl Moderski, offiziell noch im Krankenstand, bekommt es nach dem Auffinden von drei toten Frauen mit alten und neuen Feinden zu tun. Die Spur führt ihn zu internationalen Verbrechern, die nicht nur den Tod in den Schwarzwald gebracht haben. Gleichzeitig kämpft eine französische Kollegin gegen eine beispiellose Mordserie, die Ausläufer bis nach Deutschland hat. Es herrscht höchste Gefahr für Leib und Leben – nicht nur für Moderski selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Ralf Kühling, Jahrgang 1958, wuchs im Ruhrgebiet auf. Er ist Goldschmiedemeister und seit 1990 in Calw im Nordschwarzwald selbstständig. Seinen vier Kindern erzählte er jahrelang Gutenachtgeschichten, bevor er zum Schreiben kam.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: pip/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Dr. Marion Heister
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-797-2
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die wahren Feinde sind die Gier und die Ungerechtigkeit!
Theresa Demsey
EINS
Der Tag, an dem mich Nadija besuchen kam, war so etwas wie ein Schicksalstag. Im Nachhinein denke ich, dass mein Leben anders verlaufen wäre, wenn sie nicht ausgerechnet an dem Tag gekommen wäre.
Vielleicht hätte es aber auch keine Rolle gespielt, schließlich müssen wir uns immer wieder aufs Neue entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen. Und ist es nicht so, dass wir sind, wer wir sind, und keiner aus seiner Haut herauskann?
Der Tag hatte ganz gut angefangen. Ich hatte mich, nach inzwischen fast vier Wochen, an die penetrant spießige Atmosphäre in meinem Kurheim gewöhnt und endlich so viel innere Kraft gewonnen, dass ich mich dazu in der Lage sah, mich auf einen Gesprächskreis mit anderen Patienten einzulassen. Ich war also zum ersten Mal zu einer Gruppentherapie gegangen, die mein Therapieplan für mich vorsah.
Nachdem mich alle Teilnehmer, die mich nur von flüchtigen Begegnungen im Speisesaal oder im Park kannten, wohlwollend begrüßt und in ihre Gruppe aufgenommen hatten, sprachen nacheinander einige offen über ihre Probleme. Mobbing am Arbeitsplatz – ja, wer kennt das nicht? Alle waren sehr verständnisvoll. Der Psychologe hörte zu und empfahl Übungen. Auch ihn hatte ich bisher nur auf den Gängen gesehen. Er war jung, mit einem unsteten Blick, den er fast bemüht konzentriert auf denjenigen richtete, zu dem er sprach.
Das dramatische Ende einer Liebe, mit Gewalt und Nachstellungen. Verständnisvolles Nicken und In-den-Arm-Nehmen. Der Psychologe sprach über gute und schlechte Bindungen und empfahl, das mentale Training zur Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins fortzusetzen.
Burn-out, man sah sich durch die Fülle der Aufgaben und Anforderungen vor einem unüberwindlichen Berg. Mehr Berg als Kraft. Ja. Ja. Ja. Das kennen wir. Breite Zustimmung. Jeder Zweite fühlt sich seinem Leben nicht mehr gewachsen. Der Psychologe lächelte mit müden Augen. Rieb immer wieder sein linkes Ohrläppchen, bevor er Tipps wie aus dem Lehrbuch gab. Es schien, sie halfen ihm selbst nicht mehr.
»Und du, Carl, wie ist es dir ergangen?«, fragte er, nach einem neuen Thema suchend.
Ich neige nicht zur schonungslosen Offenheit, aber dann dachte ich: Was soll’s? Vielleicht tut es denen ja auch gut, zu hören, dass das Leben manchmal wirklich hart ist. Und wozu bin ich sonst hier?
Ich erzählte also in einfachen Sätzen, dass ich Kriminalkommissar sei, drei Jahre undercover auch in Russland gegen verschiedene Mafia-Organisationen ermittelt und am Schluss sechs Menschen erschossen hatte, weil sie meine Kinder in einem Brunnenschacht ertränken wollten. Dass meine Ehe und meine Familie dadurch zerstört wurden, was mich mehr verletzt hatte als die Verwundungen bei der Schießerei. Die zum größten Teil labilen Zuhörer hatten die Münder offen und waren sprachlos.
Also erzählte ich weiter, wie ich mich auf eine vermeintlich ruhige Dienststelle nach Friederichsburg hatte versetzen lassen, wo mich schon am ersten Arbeitstag eine Leiche und ein neuer Fall erwartet hatten und ich es mit üblen Profis zu tun bekam, die mir heftig zusetzten. Wobei der Haupttäter, Paul Hogmann, entkommen konnte, nur um mir, kaum dass ich genesen war, wieder zu begegnen, als ich einen UNO-Kongress über die Bekämpfung des internationalen Menschenhandels besuchte. Ich verhinderte ein von ihm geplantes Verbrechen, wurde von ihm gefangen genommen und gefoltert und tötete im Verlauf der Ereignisse nochmals zwei Menschen. Paul Hogmann und der noch gefährlichere Erich Dimaschewski, den ich aus meiner Zeit in Russland kannte und der gemeinsam mit Hogmann im Auftrag des mir wohlbekannten russischen Mafia-Konsortiums arbeitete, waren entkommen. Und ich? Ich hatte eine posttraumatische Belastungsstörung, die es mir kaum ermöglichte, ein normales Leben zu führen.
Schweigen. Kein mitfühlendes Verstehen. Ungläubiges Kopfschütteln im Kreis der Leidenden.
Der Psychologe ergriff schließlich das Wort: »Es kommt immer wieder vor, dass Menschen, die sich ihrer Aufgabe nicht gewachsen fühlen, sich in ihrer Phantasie überhöhen, sich quasi zum Superhelden hochstilisieren …«
Hatte er denn meine Akte nicht gelesen?
»… um sich der Realität nicht stellen zu müssen. Daran musst du noch arbeiten, Carl. Ich werde der Klinikleitung vorschlagen, dies in einer Kombination von Medikation und intensivierter Einzeltherapie zu forcieren.«
Ich hatte mir das ganz ruhig angehört, aber dann muss ich wohl ausgerastet sein …
Ich wurde mit so was wie einem Kater wach, mir war schummerig und übel, und ich hatte Orientierungsprobleme, außerdem konnte ich mich nicht bewegen.
Zuerst sah ich Nadija, meine Kollegin und direkte Vorgesetzte im Kommissariat 11 von Friederichsburg. Wir mochten uns und standen uns nahe. Nadija wirkte besorgt. Dann sah ich den großen Pfleger hinter ihr. Und dann merkte ich, dass ich mich nicht bewegen konnte, weil ich mit einer Art Zwangsjacke an mein Bett fixiert war.
»Wir mussten ihn ruhigstellen«, sagte der Pfleger.
Nadija nickte ihm verstehend zu. »Ich denke, Sie können ihn jetzt wieder losmachen.«
»Das muss der Arzt entscheiden.«
»Keine Sorge, ich kenne ihn, das geht schon klar.« Nadijas ruhige Art war so bestimmend, dass der Pfleger sich ein »Sind Sie sicher?« verkniff.
Wenig später gingen wir nebeneinander durch den spätsommerlichen Garten der Kurklinik, bis Nadija das Schweigen brach. »Wie geht es dir?«
»Ich dachte, gut … besser, bis ich heute –«
»Ich habe davon gehört. Ich habe ihnen gesagt, dass du nicht geschwindelt hast.«
»Das ist gut. Dann glauben sie mir jetzt?«
»Der Chefarzt kennt deine Akte, klar glaubt er dir. Der Therapeut war wohl etwas überfordert. Trotzdem glauben sie, dass du völlig überzogen reagiert hast und noch ein langer Weg vor dir liegt.«
»Das weiß ich selbst. Körperlich bin ich wieder voll da, aber die Welt ist nicht mehr wie früher. Es gibt kein Bunt mehr, keine Farben. Verstehst du das?«
Nadija schüttelte den Kopf.
»Ich sehe Farben, aber ich nehme sie nicht mehr wahr. Ich sehe sie mit den Augen, aber nicht mehr mit meiner Seele, mit meinem Herzen. Alles ist mehr oder weniger grau – oder schwarz. Und bei Schwarz raste ich aus.«
»Wie bei dem Psychologen?«
»Einem verlogenen Heuchler, der mir nicht geglaubt hat und sicher nicht helfen kann.«
»Glaubst du? Vielleicht bist du nur noch nicht so weit. Lass dir Zeit, Carl, das wird wieder. Mach was Schönes, geh in die Natur. Die Natur ist bunt, das wird deiner Seele guttun.«
Ich nickte, die Hoffnung war so klein wie ein einzelnes Saatkorn in der dunklen Erde eines weiten Feldes. »Ja, die Natur ist toll. Ich gehe viel spazieren, mache Waldläufe. Aber weißt du, was mir wirklich fehlt?«
Sie wusste, was jetzt kommen würde, ich sah es ihr an. Wir kannten uns inzwischen gut genug.
»Eine Aufgabe. Gib mir einen Job, ein paar kniffelige alte Akten von Gerl und Oppermann. Es ist doch klar, dass unsere Ex-Kollegen jede Menge Fälle manipuliert und vergeigt haben.«
Nadija wusste auch, dass die beiden, Gerl war sogar mal ihr Vorgesetzter gewesen, nicht immer korrekt ermittelten, bis sie es bei dem Toten im Wald übertrieben hatten und wir sie gemeinsam überführen konnten. Sie ließ mich mit der Antwort warten, und ich sah, dass sie wirklich darüber nachdachte, weil sie sich kurz mit der Zunge über die Oberlippe leckte, aber dann …
»Tut mir leid, Carl. Nach dem Vorfall heute Morgen, ich weiß doch, wie das bei dir ausgeht – du beißt dich in den kleinsten Zweifel wie ein Terrier, und am Ende gibt es eine Schlägerei oder eine Schießerei wie in einem Italowestern.« Sie lachte dabei, obwohl es ihr ernst war. Und ich musste mitlachen, obwohl mir nicht zum Lachen zumute war.
Wir gingen eine Weile schweigend nebeneinanderher, auf einen sonnigen Flecken zu, wo wir stehen blieben und noch unverbindlich über die Arbeit im K11, die Kollegen, Robert Schuler und Mehmet Sivrikozoglu, und unseren Chef Winfried Großhans sprachen. Als Nadija gerade von ihrem Sohn David erzählen wollte, klingelte ihr Handy. Sie ging ein paar Schritte zur Seite, um zu telefonieren.
Ich dachte an David, den zarten Zwölfjährigen mit dem großen Kopf. Seine Andersartigkeit hatte Nadija großen Kummer bereitet. Dabei war es die Gesellschaft, die Menschen, die anders waren, als behindert ansah, ohne ihre speziellen Fähigkeiten zu würdigen. David ist ein absoluter Autonarr, er weiß, so schwer ihm das Denken auch sonst fällt, alles über Autos, und alles, was er mit Autos in Verbindung bringt, kann er sich leicht merken und verstehen. Außerdem ist er der liebenswerteste, ehrlichste Mensch, den ich kenne.
»… ja. Ich komme so schnell wie möglich«, hörte ich Nadija sagen. Ihre Stimme klang angespannt. »Sperren Sie inzwischen den Fundort ab und rufen Sie die Spurensicherung. Ah, schon geschehen. Das ist gut, gute Arbeit. Ich brauche«, sie sah auf ihre Uhr, »eine halbe Stunde. Bis gleich.«
»Was ist los?«, fragte ich.
Nadija winkte ab und wählte eine Nummer.
»Mehmet, was machst du gerade? Nein, lass das. Fahr bitte gleich zu dem Fundort und überprüfe dabei, ob es irgendwelche Überwachungskameras auf den möglichen Zufahrtswegen gibt. Ja ich weiß, dass das total im Wald ist.«
Nadija war hoch konzentriert. Es musste etwas wirklich Außergewöhnliches passiert sein. Mein Herz hämmerte in meiner Brust.
»… aber in den Ortsdurchfahrten, irgendwelche Banken oder Gewerbebetriebe.«
Das war nicht mein Fall, ich war … krank. Aber mein Körper reagierte, als steckte ich mittendrin, dem Täter dicht auf den Fersen.
Wie oft hatte schon ein Anruf oder eine Anweisung von oben einen neuen Fall für mich bedeutet. Manchmal ging man unbeteiligt darauf zu, was vielleicht das Beste war. Ein andermal begann es langsam, und ich wurde, durch die nach und nach zutage tretenden Fakten, wie in einem Strudel, tiefer und tiefer hineingezogen. Dabei entwickelt sich bei mir häufig eine innere Kraft, ein Flow, ein siebter Sinn, was einige Kollegen Besessenheit nennen.
Und manchmal genügt ein Blick auf das Opfer oder ein einzelner Fakt, der mich triggert, sodass ich sofort auf hundertachtzig bin. Jetzt waren es Nadijas Stimme, das Entsetzen, der Zorn darin, wie Gewürze in einer gewöhnlichen Suppe, die den Geschmack veränderten. Es war etwas Außerordentliches geschehen. Obwohl ich wusste, dass es mich nichts anging, stand ich unter Hochspannung.
»Und dann befragst du mit Robert die umstehenden Gaffer. Wer an so einen Ort kommt, ist vielleicht öfter da und hat was gesehen.«
Ich konnte nicht mehr still stehen.
»Also, ich bin in einer halben Stunde da, sieh zu, was du tun kannst.« Nadija schnaubte wie ein Stier und blaffte mich an: »Du machst mich ganz nervös mit deinem Gerenne!«
Ich baute mich breitbeinig vor ihr auf und wollte von ihr wissen, was denn passiert sei.
»Carl, tut mir leid, ich hab jetzt keine Zeit. Ich muss sofort los.«
»Was ist denn passiert, verdammte Scheiße? Du kannst mich doch nicht einfach so stehen lassen!«
Sie war schon ein Stück den Weg hinunter, drehte aber noch mal um und kam zwei Schritte auf mich zu. »Entschuldigung, das schafft mich echt.« Nadija konnte so taff sein, aber jetzt wirkte sie für einen ganz kleinen Augenblick so verletzlich wie ein Kind, das, aus Angst vor der Welt, in den Arm genommen werden will. Dieser Augenblick war magisch; obwohl sie zwei Meter vor mir stand, waren wir verbunden, als lägen wir uns in den Armen.
Sie schüttelte den Moment ab wie eine Spinnwebe und würgte unter innerem Zwang das Maximum an Information hervor, das sie mir geben konnte: »Drei tote Frauen … in einem Transporter … im Wald.« Dann war sie verschwunden.
Keine fünf Minuten später stand ich schon im Behandlungszimmer des Chefarztes.
»Sie können hier nicht einfach so in eine Therapiestunde hereinplatzen. Raus!«
Die Patientin war in ihrem Sessel zusammengesunken und zitterte am ganzen Körper. Ich reichte ihr meine Hand, lächelte sie freundlich an und führte sie zur Tür hinaus. »Nur einen kleinen Moment.« Dann schloss ich die Tür hinter ihr.
»Was erlauben Sie –«
»Hören Sie, ich muss hier raus, sofort. Ich bin Polizist, in meinem Zuständigkeitsbereich sind drei Leichen gefunden worden!« Das erklärte doch wohl alles.
»Seit Ihrem Auftritt heute Morgen wissen wir ja alle, dass Sie der Feind aller Verbrecher sind. Aber ich weiß, dass Sie nicht nur eine Gefahr für sich selbst sind, sondern auch …«
Warum wirkt die Selbstsicherheit von Ärzten nur so schnell selbstgefällig und arrogant?
»Es tut mir leid, Sie werden noch geraume Zeit benötig–«
»Sie können mich nicht gegen meinen Willen hierbehalten, ich bin hier nicht in einer geschlossenen Anstalt.«
»Herr Moderski, Sie können doch nicht glauben, dass Sie schon wieder alleine klarkommen. Heute Morgen erst haben Sie völlig die Kontrolle über sich verloren. Wir brauchten drei Pfleger, um Sie ruhigzustellen. Drei erfahrene, starke Männer.«
Warum konnte ich mich nicht daran erinnern? Nicht zu wissen, was ich getan hatte, machte mich unsicher.
»Infolge der Injektion, die wir Ihnen geben mussten, dürfte Ihnen der Vorgang nicht mehr ganz präsent sein.«
Ach so, dann war ja alles klar, bloß chemisch ausgelöste Amnesie. Ich hatte wieder Oberwasser.
»Nur drei«, sagte ich ironisch. »Wie geht es den Männern? Sind sie im Krankenhaus?«
»Nein, es geht ihnen gut!«
»Sehen Sie, ich hatte mich doch unter Kontrolle. Wenn ich die Kontrolle verloren hätte, lägen jetzt ein paar von ihnen im Krankenhaus.«
Der Arzt sah mich lange nachdenklich an. Dann sagte er ganz langsam, jedes einzelne Wort betonend: »Herr Moderski, obwohl Ihre Kollegin, Frau Hammerschmitt, genau das Gleiche gesagt hat, denke ich, dass Sie sehr, sehr krank sind …«
Ich drehte mich um und stapfte zur Tür. »Ich gehe, Sie können mich nicht gegen meinen Willen hierbehalten! Sie arroganter Fachidiot! Sie können sich gar nicht vorstellen, dass es Leute gibt, zu denen Ihre Durchschnittsparameter nicht passen!« Ich knallte die Tür hinter mir zu.
Kurz darauf wurde die Tür wieder aufgerissen, und der Arzt rief mir über den Flur nach: »Moderski!« Als ich mich zu ihm umgedreht hatte, sagte er leiser: »Ich kann Sie nicht zwingen, hierzubleiben, aber ich bin nicht für das verantwortlich, was Sie da draußen anrichten! Hören Sie. Ich schreibe Sie nicht dienstfähig. Sie sind nicht dienstfähig!« Seine Stimme drückte eine boshafte Zufriedenheit aus. »Nicht dienstfähig! Nie! Nie wieder!«
Das Geschwätz von diesem Idioten perlte von meinem breiten Rücken ab wie Tautropfen von einem Lotosblatt. Ich ahnte nicht, wie viel Verdruss mir diese Worte noch bereiten sollten.
Im Taxi nach Friederichsburg bat ich den Taxifahrer, den Polizeifunk einzuschalten, und hielt ihm meinen Polizeiausweis hin. Auf der Frequenz vom K11 herrschte reger Funkverkehr. Schon nach kurzer Zeit konnte ich dem Fahrer sagen, wo er mich absetzen sollte. Ich war keine Viertelstunde nach Nadija am Fundort der Leichen. Einem Waldparkplatz in den ausgedehnten Wäldern oberhalb von Friederichsburg, der für Touristen und Wanderer angelegt worden war, aber nur wenig benutzt wurde. Ein Dutzend Schaulustiger stand an der Absperrung und versuchte Neuigkeiten zu ergattern. Ich ließ sie hinter mir und trat an den werkstattblauen Mercedes Sprinter heran.
Die Türen standen offen. Im Inneren sah Nadija der Gerichtsmedizinerin zu. Die beugte sich über drei menschliche Bündel, die zu einem Haufen zusammengeschoben in der rechten vorderen Ecke der Ladefläche lagen. Bei einer nur mit einem Slip bekleideten Person sah ich, dass es sich um eine sehr junge Frau handelte. Eine andere trug schäbige Sportbekleidung, die dritte war von sehr viel Stoff eingehüllt. Vielleicht ein orientalisches Gewand? Um den Wagen und besonders am Eingang zur Ladefläche schwirrten sehr viele Fliegen. Nadijas Gesicht zeigte keine Spur von Ekel, sie war ganz professionell konzentriert und sprach leise mit der Ärztin.
Eine Träne hatte eine Spur in ihr Gesicht gezeichnet und war getrocknet.
Ich sah Robert Schuler und trat zu ihm. »Was habt ihr bis jetzt?«
Robert sah mich erstaunt an. »Was machst du denn hier?«, wollte er wissen.
»Nadija war bei mir, als die Nachricht kam.« Ich ließ ihm keine Zeit, auf die Idee zu kommen, dass das keine Antwort auf seine Frage war. »Kannst du mich ins Bild setzen?«
»Der Wagen steht schon seit circa zwei Wochen da. Verschiedene Passanten haben ihn gesehen. Heute Morgen hat dann einer die Polizei informiert, weil es so verdächtig gestunken hat. War ja relativ warm in den letzten Tagen. Drei tote Frauen, zwei so um die dreißig, eine fast noch ein Kind … Diese Schweine!«
Robert war ein alter Hase, der kurz vor der Pensionierung stand. Zu sehen, wie er mit seiner Fassung kämpfte, sagte mir mehr über den Zustand der Toten, als er mit Worten hätte ausdrücken können.
»Sie wurden gefoltert und zusammengeschlagen, bestimmt auch vergewaltigt … Aber das kannst du ja alles später im Bericht lesen.«
Das musste ich nicht; was ich gehört hatte, reichte mir. Ich legte Robert eine Hand auf die Schulter und dachte: Kopf hoch, Alter. Dann ging ich wieder zu dem Wagen.
Nadija sah mich und kam raus. »Was machst du hier?«
Ich war etwas verlegen, weil mir klar war, dass ich nicht hier sein sollte. Aber ich konnte nicht anders. »Ich dachte, ich schau, ob ich helfen kann.«
Nadija sah mich lange an. Ihr Ausdruck wechselte zwischen Dankbarkeit und der ihr eigenen starken, klaren Härte.
Ich liebte sie dafür, dass sie mich an ihren Gefühlen auf diese Weise teilhaben ließ. Ich hasste sie für ihre Entscheidung.
»Misch dich nicht in meinen Fall ein! Verschwinde!« Mit diesen Worten ließ sie mich stehen.
Es war, als hätte mir jemand eine große, sehr schwere eiserne Tür vor der Nase zugeschlagen. Ich fiel ins Nichts.
Nicht dienstfähig! Verschwinde!
Während ich mich immer weiter von dem Ort entfernte, betrat die Spurensicherung den Tatort und begann mit ihrer Arbeit. Einer Arbeit, die von mir so weit weg war wie der nächste Stern. Ich sah Nadija, weit entfernt, ihre Arbeit tun.
Weißt du eigentlich, wie wenig man ist, wenn man nichts mehr ist? Kein Freund? Kein Polizist? Keiner, für den die Farben leuchten?
Ich war die ersten paar Kilometer zu Fuß gegangen. Ohne zu merken, dass die Sonne warm durch die Blätter schien und goldene Flecken auf das erste welke Laub am Boden warf.
Dann hatte ich einen Wagen angehalten, der mich mit nach Friederichsburg nahm. Ich war durch die Stadt gegangen, vorbei an den Geschäften und den Leuten, die ihre Einkäufe und Besorgungen machten. Beim Bäcker holte ich mir ein Laugenbrötchen mit Salami und einen Kaffee to go. Ich warf den leeren Becher in den Eimer an der Bushaltestelle und nahm den Bus zur Kranichstraße. Um kurz nach achtzehn Uhr schlich ich in mein Zimmer, zog die Vorhänge zu und ließ mich aufs Bett fallen. Am liebsten wäre ich einfach eingeschlafen und erst irgendwann wieder wach geworden, in besseren Zeiten.
Doch ich war zu aufgewühlt, und in mir rumorte der Kaffee. Scheißkaffee! Scheißtag!
Irgendwann kam Lydia herein, setzte sich wortlos auf mein Bett und sah mich an. Lydia Sokolowsky ist meine Vermieterin. Sie hatte, als ihr Mann starb, von der gemeinsamen Künstler- und Konzertagentur nur eine heruntergekommene Fabrikantenvilla behalten können. Wenn man sie heute fragte, was sie beruflich mache, antwortete sie meist: »Ich vermiete Zimmer an Damen, die gerne Herrenbesuch haben.« Aber Lydia tat mehr als das, sie gab den Menschen, die in ihrem Haus lebten und arbeiteten, und damit dem ganzen Etablissement Seele.
»Du bist wieder da. Wie geht es dir?« Sie wartete meine Antwort nicht ab. »Scheiße?«
»Ja.«
»Was war los?«
»So eine Reha-Klinik ist nichts für mich. Ich muss mit mir alleine klarkommen.«
»Das wirst du, Schätzchen. Komm erst mal rüber zu uns, ein paar der Mädchen kommen zum Abendessen.«
Lydia kochte jeden Abend für alle ihre Damen. Ihre große Wohnküche stand jederzeit offen, jede konnte kommen, keine musste.
Ich machte mich frisch, zwang mich zu einem Lächeln und folgte Lydia nach ein paar Minuten.
Neben zwei anderen, die ich kannte, waren Melissa und Pauline da, beiden hatte ich schon mal aus der Patsche geholfen. Die zarte, kleine Melissa himmelte mich von unten an. »Hey, Carl, schön, dass du wieder da bist. Du weißt ja, wenn ich was für dich tun kann … Sag einfach Bescheid.«
Melissa war achtundzwanzig, machte aber immer noch auf Schulmädchen. Lydia ermahnte sie lachend und schickte sie wieder auf ihren Platz. Melissa kicherte, und Lydia schüttelte den Kopf. Nachdem die anderen Frauen mich auch begrüßt hatten, aßen wir Kalbsrouladen mit Salzkartoffeln und Rotkraut.
Mein Smartphone vibrierte, eine Nachricht von Nadija: »Hi.«
»Hi.«
»Schon mal gesehen?«
Dann wurden Fotos geladen.
Eine junge Frau, die ich noch nicht kannte, kam rein, nickte allen zu, sah mich mit großen, ängstlichen Augen an und setzte sich wortlos zum Essen.
Lydia stellte sie vor: »Das ist Nesrin, sie ist erst seit ein paar Tagen da, stand einfach plötzlich vor der Tür. Nesrin hat Stinas Zimmer, das ist ja jetzt frei. Nesrin, das ist Carl.« Lydia sprach jetzt langsamer und deutlich. »Carl ist bei der Polizei, er wohnt bei uns, er hat die beiden Zimmer unten.«
Über Nesrins Gesicht huschte der Schatten eines unsicheren Lächelns, als sie mir zunickte.
»Was ist eigentlich mit Stina?«, fragte ich.
»Stina ist im Moment in Spanien. Sie machen Testfahrten«, sagte Lydia.
Und die Mädchen erzählten mir noch mal die Geschichte von Stinas Rennen.
Stina Nereni hatte davon geträumt, Rennfahrerin zu werden, und ihre Autoleidenschaft und Rennambitionen damit finanziert, dass sie sich prostituierte, bis ich ihr die Chance verschafft hatte, bei Schneller Racing einen Platz im Jaguar F-Type für die GT3-Serie zu bekommen, wenn sie schneller war als der erfahrene Rennfahrer Ricardo Mansarini, der die Nummer eins im Team war. Ihre Chance hatte Stina wahrlich genutzt und mir außerdem das Leben gerettet. Ich vermisste sie.
Die Bilder, die Nadija mir geschickt hatte, waren in der Zwischenzeit fertig geladen worden. Ich sah sie mir unter der Tischkante an.
Lydia fragte: »Was hast du da?«
Sie trat hinter mich. Ich drehte das Handy in ihre Richtung und wischte über das Display, um ihr nacheinander die Bilder der drei toten Frauen zu zeigen, die offensichtlich inzwischen in der Gerichtsmedizin waren.
»Oh, Scheiße.« Lydia stockte der Atem. »Wer ist das?«
»Ein neuer Fall. Heute Morgen gefunden.«
»Dein Fall?«
»Nadijas. Ich bin nicht dienstfähig.«
»Aber du bist deshalb da!«
»Ja.«
Lydia wusste, dass mich der Tod der drei Frauen nicht kaltließ und dass ich alles daransetzen würde, die Täter zu finden.
»Du kannst die Bilder ja gleich mal den Mädchen zeigen, vielleicht haben sie die schon mal gesehen. Aber nach dem Essen«, fügte sie an.
Die Frauen waren inzwischen natürlich alle neugierig, und so reichten sie direkt nach dem Essen mein Handy herum.
Sie reagierten schockiert auf die nüchterne Brutalität der Polizeibilder, manche schienen persönlich betroffen. Die Bilder weckten Erinnerungen, die sie lieber vergaßen.
Leider konnte mir keine mehr dazu sagen, was sie zu bedauern schienen. Auch Nesrin schüttelte den Kopf, aber ich hatte die Angst in ihren Augen gesehen.
Mit ihr würde ich noch mal reden müssen.
Nadija hatte mir die Bilder nicht ohne Grund geschickt. Ich wusste nur nicht, ob sie sich damit für ihre barsche Zurückweisung entschuldigen wollte oder ob sie wirklich meine Hilfe brauchte. Ihr standen alle polizeilichen Möglichkeiten offen. Was konnte ich für sie tun?
Gut, nicht ich, aber vielleicht Eddy. Ich wählte die Nummer von Eduard »Eddy« Bachmeier, meinem Kollegen bei VIM, der Verbindungsstelle für Internationalen Menschenhandel des BKA.
VIM war keine Ermittlungseinheit, sondern eher so was wie eine PR-Agentur. Ihre Mitglieder waren zum größten Teil zivile Spezialisten. Eddy war ITler, aber es gab auch Journalisten, Kommunikationswissenschaftler und andere. Ich war den kriminalistischen Laien als Praxisberater zugeordnet worden. VIM sollte Inhalte zusammenfassen und an die unterschiedlichen Dienststellen publizieren, sie anpreisen und regelrecht vermarkten. Auf diese Weise würden Ermittlungsergebnisse von Polizei und Nachrichtendiensten, aber auch Erkenntnisse nicht polizeilicher Stellen und nicht staatlicher Organisationen aus dem Bereich Menschenhandel miteinander verknüpft und zur Verbreitung gebracht werden.
In meiner Funktion als Mitarbeiter von VIM hatte ich den Kongress über Menschenhandel besucht, bei dem der Redner erschossen worden war.
Eddy meldete sich mit einem kurzen »Ja?«, das deutlich machte, dass er mit seiner Aufmerksamkeit woanders war.
Deshalb fackelte ich nicht lange. »Hi, Eddy. Ich brauch jetzt deine Hilfe!«
»Carl.« Er war jetzt ganz bei mir. »Wenn du anrufst, wird’s meist spannend –«
»Eddy, ich schick dir drei Bilder. Guck mal, ob du irgendwas über die finden kannst.«
»… einerseits, weil du einen echt aus dem Alltagstrott reißt, andererseits, weil ich jedes Mal meinen Job riskier, wenn der Chef das mitkriegt.«
»Muss er ja nicht.«
Eddy hatte allem Anschein nach die Bilder inzwischen auf seinem Bildschirm. »Wow, was ist das?«
»Drei tote Frauen in einem Transporter, bei uns im Wald. Wurden heute Morgen gefunden, sind aber schon mindestens vierzehn Tage tot.«
»Bist du der zuständige Ermittler? Warum sucht ihr nicht auf den offiziellen Wegen? Du weißt, wir sind für so was nicht zuständig. Wir machen eher Gru–«
»Grundlagenforschung, ich weiß. Nadija Hammerschmitt leitet die Ermittlungen. Sie ist sicher dran. Aber du hast andere Möglichkeiten, bei dir läuft doch alles zusammen, und du bist schneller.«
Eddy ließ sich breitschlagen. Er war immer gerne für eine praxisorientierte Ablenkung von seinem üblichen Job, dem trockenen Filtern und Aufbereiten von Daten, zu haben.
»Wenn sie offiziell eingereist oder irgendwo schon mal aktenkundig geworden sind, finde ich sie. Ich sag dir morgen Bescheid.«
Es war inzwischen halb zehn abends. Im Haus herrschte der übliche Betrieb eines Wochentages. Ich hörte Männer kommen und gehen und noch andere Dinge. Die Damen hatten jetzt Hauptgeschäftszeit, ich war müde.
Ich wurde von einem leisen Klopfen wach. Meine Uhr auf dem Nachttisch zeigte ein Uhr zweiunddreißig.
»Ja?«
»Bist du wach?« Melissa steckte ihren Kopf herein.
»Jetzt ja.«
Hinter ihr kam Pauline.
»Ich wollte dich nicht wecken«, flüsterte Melissa.
»Hast du aber. Du brauchst jetzt nicht mehr zu flüstern.«
»Oh, ja.«
Hinter Pauline schlich Nesrin ins Zimmer.
»Sie will dir was sagen«, begann Melissa. »Aber sie hat Angst vor der Polizei.«
»Deshalb seid ihr mitgekommen.«
»Das ist wichtig, ehrlich«, sagte Pauline.
Ich saß in meinem Bett, die drei Frauen standen davor. Ich sah Nesrin an. »Und? Was willst du mir sagen?«
Sie blickte zu Boden. Melissa gab ihr einen Schubs.
»Ich gesehen. Mädchen mit Mann.«
Melissa und Pauline stellten das richtig. Sie hatte gesehen, wie das Mädchen, die jüngste Tote, mit einem Mann fortgegangen war.
»Nesrin ist illegal über die Grenze. Da war die eine dabei. Sie ist mit einem der Fluchthelfer weggegangen.«
Nesrin nickte. »Du fragen Mann.«
»Und wo soll ich den Mann finden?«
Nesrin gab mir einen Zettel: Bunkier Café, Szczepański-Platz 3a, eine Handynummer. »Das Krakau.«
»Du bist über Polen eingereist.«
Sie nickte. »Mädchen Pole.«
»Woher kommst du denn?«
»Ich Afghanistan.«
»Ein weiter Weg.«
Sie sah mich mit ausdruckslosem Gesicht an. Ein schwerer Weg.
Ich ließ mir den Mann noch beschreiben, was aber aufgrund der mangelhaften Deutschkenntnisse von Nesrin nicht besonders ergiebig war. Ich dankte allen dreien, dass sie zu mir gekommen waren.
»Dann muss ich wohl nach Polen, wenn ich den Mann finden will.«
Pauline und Melissa bestätigten das erwartungsvoll, während Nesrin nur dabeistand, und wandten sich dann zum Gehen. Es war spät, und sie hatten einen langen Tag hinter sich. Ich sah die Müdigkeit in ihren Gesichtern und ihren Körpern. Die Müdigkeit vieler harter Tage.
Melissa zögerte etwas und kam dann noch mal zurück.
Sie stand still vor mir und sah mich mit einer Frage im Blick an, die sie nicht zu stellen wagte.
Ich schwang meine Beine aus dem Bett und setzte mich ihr zugewandt auf die Bettkante. »Ja? Was ist los? Was willst du mir sagen?«
»Nesrin ist nicht normal«, konstatierte Melissa, »sie ist krank. Im Kopf.«
Ich sah sie an und fragte mich, was für Melissa, die mit bis zu zehn Männern am Tag schlief, wohl normal wäre. Anscheinend erriet sie, was ich dachte, sie biss sich auf die Lippen, und ihre Augen wurden wässrig.
Als sie weitersprach, war ihre sonst so niedliche Stimme brüchig. »Sie lässt Dinge mit sich machen, die …« Sie brach ab. Sie litt – mit Nesrin.
Ich ließ ihr Zeit.
»Kannst du ihr nicht helfen?« Sie lächelte, wohl weil sie wusste, wie hilflos ihre Bitte klang.
»Vielleicht, mal sehen, aber du musst mir erzählen, was wirklich mit ihr ist.«
»Sie liebt den Schmerz.« Nein, das war nicht richtig, sie schüttelte den Kopf. »Sie …« Jetzt kamen ihr wirklich die Tränen. »Sie fürchtet ihn … Aber sie braucht ihn. Du musst ihr helfen.«
Das war’s. So einfach – so schrecklich.
»Was meinst du mit ›sie braucht ihn‹? Wie ein Trinker den Suff?«
»Schlimmer. Wie ein Junkie die Nadel. Sie lässt sich von Kunden erniedrigen und quälen. Sie fügt sich selber Schmerz zu.«
Ich versprach ihr, mir Gedanken um Nesrin zu machen.
Erst mal wollte ich mit Lydia über sie sprechen, und dann würde ich mich um einen Dolmetscher bemühen müssen.
An Schlaf war erst mal nicht mehr zu denken. Ich zog mein Sportzeug an und ging auf die Straße. Es war eine milde Spätsommernacht, der Himmel war fast klar, und der Mond schien hell. Ich lief los, von Straßenlaterne zu Straßenlaterne durch die Nacht, alleine – mit meinen Gedanken.
Was war mit Nesrin los? Ein Trauma, klar. Von ihrer Flucht oder dem, wovor sie geflohen war?
Hatte das auch was mit dem Mädchen aus Krakau zu tun?
Warum hatte Nadija mir die Fotos geschickt?
Hatte sie gesehen, wie sehr sie mich getroffen hatte? Ich würde mit ihr reden müssen. Ich sah auf meine Uhr, zwei Uhr dreißig, noch vier Stunden bis zum Frühstück. Noch mal zu Nesrin. War es nicht merkwürdig, dass ich über diese Zeugin geradezu stolperte? Nadija würde auf der Basis der Erkenntnisse von Spurensicherung und Forensik sicher nach Zeugen suchen lassen, die irgendwas über die drei Frauen wussten, vermutlich auch in den Bordellen der Gegend. Wenn die Kollegen überhaupt Antworten bekommen würden, würde das Tage oder Wochen dauern. Nesrin war seltsam, sie war offensichtlich eingeschüchtert und voller Angst, vor der Polizei – hatte sie schlechte Erfahrungen gemacht? – und sicher auch vor Männern im Allgemeinen. Warum suchte sie Unterschlupf ausgerechnet in einem Puff, warum lieferte sie sich Situationen aus, vor denen sie möglicherweise sogar geflohen war? Ich musste mehr über Nesrin erfahren, und ich musste Nadija informieren.
Ich lief. Mein Körper funktionierte einwandfrei. Nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden war, hatte ich viel dafür getan, wieder in Form zu kommen. Gesunder Körper – gesunder Geist. Wirkte leider nicht so unmittelbar, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber es half. Beim Laufen wird der Kopf frei, der Rhythmus des Atmens nimmt einen mehr und mehr ein. Die Muskeln geben ein Feedback, das an das vertrauenerweckende Brummen einer zuverlässigen Maschine erinnert.
Dinge zogen an mir vorbei, Asphalt, Gullydeckel, Hauseingänge, Schaufenster, Kippen im Rinnstein … Gesehen, erkannt, vergessen. Mein kleiner Finger wurde mir schmerzlich bewusst. An den zwei Fingergliedern, die mir vor ein paar Monaten abgeschnitten worden waren, zog der Wind – Phantomschmerz. Ein anderer Schmerz machte sich bemerkbar, meine Frau Julia, meine Kinder, die Scheidung, auch abgeschnitten – Einsamkeit. Ich blieb stehen und schlug ein paar Haken und Gerade in die Luft. Schattenboxen – gegen die Schatten der Vergangenheit. Noch zweieinhalb Stunden. Ich sollte schlafen gehen. Ich würde nach Polen müssen. Ich brauchte ein Auto. Die Vergangenheit holt einen an den unmöglichsten Orten ein, sogar nachts auf der Straße.
Nachdem ich aus Russland zurückgekommen war, also eigentlich nachdem Julia mit den Kindern wieder zu ihren Eltern nach Stuttgart gezogen war, hatte ich meinen Führerschein für drei Monate abgeben müssen, nachts auf der Autobahn, irgendwo zwischen Dortmund und Stuttgart. Der Wagen war auch Schrott, und ich hatte mir seitdem keinen mehr gekauft. Aber jetzt brauchte ich einen eigenen. War Quatsch, da zu sparen, das Ding musste ein Werkzeug sein, schnell und unauffällig. Davon hatte ich schon früher geträumt, ein Wolf im Schafspelz.
Ich lief wieder. Im Gewerbegebiet befanden sich mehrere Autohändler. Im Osten wurde es langsam hell. Die Gebrauchtwagen lagen im Dämmerlicht, wie tote Kadaver, von der Mittelschicht zurückgelassene Einheitskarossen, mal mit Stern und mal mit zwei oder drei Buchstaben.
Frustriert wählte ich Stinas Nummer.
»Carl?«
»Guten Morgen, Stina.«
»Weißt du, wie spät es ist?«
»Entschuldigung, habe ich dich geweckt?«
»Nee, natürlich nicht. Ich sitze jeden Morgen um halb vier am Telefon und warte auf deinen Anruf.«
»Stina, ich brauch ein Auto.«





























