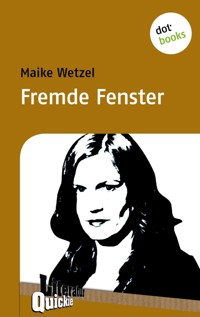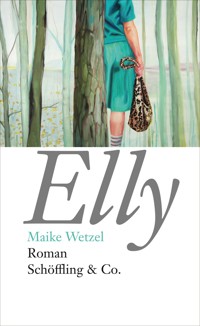17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Sonntag am See. Eine Frau sitzt am Ufer und hält ihre beiden kleinen Kinder im Arm. Was eine Wochenend-Idylle sein sollte, kippt ins Gegenteil. Das Segelboot ist gekentert, der Vater wird vermisst. In diesem harmlosen Badesee kann er doch unmöglich ertrunken sein. Sicher taucht er wieder auf und wird über die Angst seiner Frau lächeln. Während der Rettungshubschrauber über ihr kreist, erinnert sich die Erzählerin an ihr Leben mit diesem Mann, ihrem Gegenpart in einer bewegten Ehe. Maike Wetzel schreibt in Schwebende Brücken mit schonungsloser Aufrichtigkeit und hoher sprachlicher Präzision über das Weitermachen, nachdem nichts mehr ist wie zuvor. Und darüber, wo wir Trost finden - in unseren Erinnerungen und in der Literatur. In der Traditionslinie von Joan Didion, Maggie Nelson, Ocean Vuong und Marguerite Duras erzählt die Autorin sehr persönlich, dabei gleichzeitig beeindruckend universell über Liebe, Trauer und Elternschaft. So entsteht ein soghafter Abschiedsgesang und dabei ein ehrlicher und ergreifender Roman über das Weiterleben als Mutter und als Schriftstellerin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Motto
Manches, was auf diesen Seiten zur Sprache kommt, hat sich auf diese oder jene Weise ereignet. Die Personen und Geschehnisse sind jedoch nicht mit der Wirklichkeit gleichzusetzen.
Es gibt keinen Schrei, kein Glucksen. Nur eine karierte Picknickdecke. Und zwei Kinder in meinen Armen. Ich bin still. Aber nicht ruhig. Über uns der graue Himmel, unter uns das Gras. Ich fühle meine Haut erblassen, wächsern werden, kalt. Die Kinder geben keinen Laut von sich. Der eineinhalbjährige Theo bewegt sich kaum. Hannes, der vor einem Monat sieben Jahre alt geworden ist, hat aufgehört, mir Fragen zu stellen. Ich sitze auf der karierten Picknickdecke, zwei Kinder in meinen Armen, und starre auf den See. Es ist mitten im Sommer und die Blütenpollen taumeln wie Schneeflocken vom Himmel herab. So weiß wie Schnee, so rot wie die Wangen der tobenden Kinder, so schwarz wie die Krähen in den Bäumen. Kein Spiegel und auch kein Mensch spricht zu mir. Mein Blick fällt auf das Getränk in meinem Schoß. Ich erinnere mich, dass es wichtig ist, etwas zu trinken. Ich biete den Kindern die Apfelsaftschorle an. Sie wollen nichts. Umständlich schraube ich die Plastikflasche auf und nehme einen Schluck. Die Kohlensäure-Bläschen platzen an meinem Gaumen, das Gemisch aus Apfelsaft und Wasser schmeckt säuerlich-süß. Meine Geschmacksnerven filtern vor allem die Säure heraus.
Am ersten Jahrestag deiner Beerdigung besuchen wir in Irland eine Nutztierschau. Ich sage den Kindern nicht, um welchen Tag es sich handelt. Ich will nicht daran denken und ich will nicht, dass sie sich daran erinnern, wie ihr Vater unter die Erde kam. Wir laufen über eine große, unglaublich grüne Wiese, umgeben von Weiden und mit einigen abgesteckten Gattern darauf. Riesige Traktoren, Gummistiefelwetter. Ein kleiner Junge steht hinter einem Esel. Dieser keilt aus. Das Kind fliegt auf den Boden. Es weint. Truthähne stolzieren umher. Sie sehen aus, als wären sie von einem verrückten Puppenmacher gebaut worden. Mit ihren hässlichen, baumelnden Hautlappen unter dem Schnabel, dem übertrieben buschigen Gefieder unter dem kahlen, stoppeligen Hals. Plötzlich bemerke ich meine Gänsehaut. Hast du die Haare an meinem Unterarm aufgestellt? Was bist du jetzt? Ein Gespenst? Eine Erinnerung? Rauschst du in den Adern, in den Gedanken deiner Kinder? Steigst du wie Rauch zum Himmel auf? Wo bist du? Bist du in den sanften Augen der Kühe, im Huf des Esels? Bist du ein Moor-Pony? Klein, zottelig und unbeugsam? Oder sitzt du da hinten im Damensattel auf dem hohen Ross und schaust mich durch den Trauerflor unter deinem Zylinder an? Musterst du mich durch die Augen dieser irischen Reiterin und fragst dich, was aus mir geworden ist?
Bis heute grübele ich immer wieder, warum du gestorben bist. Ich weiß, dass es ein Unglück war, dennoch suche ich nach Verbindungen, nach einem Faden, der mich führt, der mir Anfang und Ende verrät und mich gleichzeitig vor dem Monster flüchten lässt, damit das Labyrinth unserer Geschichte, dieser steinerne Irrgarten, mir nicht zum Verhängnis wird. Ich suche nach dem rettenden Faden, den ich entrolle auf dem Weg zum Ochsengesicht. Ein Knäuel, das abnimmt in meiner Hand und sich nicht verknotet. Ich suche nach dem Monster, ich will ihm ins Auge sehen. Behaupte ich. Bin ich diejenige, die den Faden spinnt, oder bin ich am Ende das Ungeheuer? Was unterscheidet Ariadne vom Minotaurus? Was trennt Orpheus von Eurydike? Die Rollen in den antiken Geschichten scheinen starr, während meine, deine, unsere Rollen flottieren, schwebende Brücken auf dem Wasser sind. Unsere gesamte Existenz fußt auf Fiktion. Auf Verbindungen, Scharnieren, die wir bauen, um Sinn zu schaffen, wo keiner ist. Wir wollten uns halten, stützen und kickten einander doch immer wieder die Beine unter dem Körper weg. Sich verlieben, verzeihen, verlieren. Die Perspektive springt. Von mir zu dir. Alles hängt davon ab, wo du stehst. Ich bin hier. Du bist dort. Ich weiß nicht, wo dieser Ort ist. Doch ich weiß, ich erkläre es mir immer wieder, dass dein Körper jetzt unter einem Haufen Erde liegt und ich hasse diesen Hügel. Ich hasse die Vorstellung davon, wie du verwest. Wie deine Haut zerfällt, wie dein Fleisch sich auflöst, wie deine Knochen zerfallen. Ich weiß, du bist nicht dort unten. Du bist hier. Du stehst vor dem Wandmosaik an der Bücherei. Ich beäuge dich aus der Bibliothek heraus. So, wie ich dich zum ersten Mal sah. Drei Kinder dichtete ich dir damals an, ohne ein Wort mit dir gewechselt zu haben. Ich machte mir ein Bild von dir. Lang, bevor ich mit dir sprach. Denn nur ich sah dich. Du blicktest mich nicht an. Und ich wagte mich nur kurz hervor, stand wortlos vor dir, bat dich um Feuer, zog mich mit der Flamme in meiner Hand wieder hinter das Glas der Fensterscharte zurück. In der Lesenische kritzelte ich eckige Worte auf meinen Block. Als ich aufschaute, warst du fort. Ich rauche nicht. Das Wasser in dem flachen, hellblauen Becken vor der Bibliothek glitzert. Jemand hat eine Münze hineingeworfen. Es ist nicht der Kopf, der nach oben zeigt.
Wie gewöhnlich dieser Sonntag im Juni ist, wie friedlich, wie unzerstörbar, geradezu langweilig. Die Sonne ist nicht zu sehen, der Himmel ist milchig, bedeckt. Die Blütenpollen taumeln wie Schneeflocken von ihm herab. Erst weiß, dann rot, dann schwarz. Als ich morgens verschlafen, mit meiner Zahnbürste in der Hand zum Badehaus trotte, komme ich an der Elterngruppe vorbei, die mit ihren Grundschulkindern seit gestern an der Kreuzung campiert. Ein hochgewachsener Mann mit Vollbart schenkt dort an den Biertischen Kaffee aus. Ich erkenne ihn. Ich habe den Schauspieler in verschiedenen Rollen im Kino und im Fernsehen gesehen. Aufgeregt wie ein Teenager kehre ich zum Wohnwagen zurück und berichte, wie bereit ich bin, Rolle und Mensch zu verwechseln. Ich foppe dich mit meiner Schwärmerei. Du grinst gutmütig und sagst: »Ich vertraue auf deine Feigheit.« Sagst du das wirklich? Ich habe es jedenfalls gehört. Dein Bruder kneift skeptisch die Augen zusammen. Vielleicht ist ihm auch einfach die Sonne zu hell. Ihr habt lang geredet in der Nacht und seid gerade erst aufgestanden. Ich versuche weiter, dich zu provozieren, indem ich beteuere, wie beeindruckend, wie begeisternd stark und ausladend das breite Kreuz des ehemaligen Leistungsschwimmers sei. Als meine Worte keine Wirkung zeigen, schnappe ich mir demonstrativ unseren jüngsten Sohn und verkünde, dass ich nun zum Schaulaufen auf den Badesteg gehen werde, um den Schauspieler dort mit Hilfe von Theo zu verzaubern. Du lächelst nachsichtig und lässt mich ziehen. Es ist kurz vor Mittag. Manche Familien sitzen noch beim Frühstück, diejenigen mit sehr kleinen Kindern bereiten schon das Mittagessen vor. Die Zelte, Wohnmobile und Wohnwagen stehen inmitten eines lichten Kiefernwalds am Ufer des Sees, dessen Wasser so klar, so frisch, so verführerisch ist. Selbst an diesem eher kühlen Tag würde ich gern hineinspringen. Auf dem Steg läuft unser Sohn vor mir auf seinen kurzen Beinen, er steuert direkt auf den grinsenden Schauspieler und dessen Frau zu. Das Paar steht eng umschlungen. Ich behalte alle drei im Blick. Unser Sohn wankt breitbeinig wie ein Seemann an Land. Vielleicht ist es seine Ungeübtheit, vielleicht einfach eine Unebenheit in den Planken des Stegs, jedenfalls stolpert Theo plötzlich. Instinktiv schnellt mein Arm vor und zerrt das Kind kurz vor der Kante zurück. »Gute Reflexe«, lobt mich der Schauspieler und diese kurze Ansprache reicht, um mich einsehen zu lassen, dass er ein Mensch und keine Geschichte ist. Trotzdem erzähle ich dir kurz darauf stolz von diesem Kompliment. »Tun Sie doch nicht so. Sie wissen doch Bescheid. Sie sind doch präpariert. Und ich – ich separiere mich jetzt. Halten Sie an.« So schnippisch und spröde spricht die spätere Geliebte in einem seiner Filme zu dem Schauspieler und er schaut in dieser Szene bloß leicht irritiert vom Lenkrad des Trabis herüber. In dieser Rolle liebt er die Frau trotz ihrer abweisenden Art. Dennoch, so meine ich mich zu erinnern, hilft er ihr später, in den Westen zu flüchten. Damit wird er die Geliebte gehen lassen, sie sogar selbst auf die ungewisse Reise schicken. Mich hat das zu Tränen gerührt. »Gute Reflexe«, wiederhole ich stolz, als ich an unserem Wohnwagen ankomme. Ich schmücke die Szene auf dem Steg etwas aus, lasse Theo durch die Luft segeln, fast das Wasser streifen. »Gute Reflexe! Die hat nicht jeder!« Die Furchen auf der Stirn deines Bruders werden tiefer, als ich meine ausdrückliche Begeisterung für den fremden Mann auf dem Steg, den ich als den Helden aus dem Film wahrnehmen will, höhere und höhere Volten schlagen lasse. Ich schildere Theos Sturz so, als hätte ich unser Kind beinahe meinem Begehren geopfert. Ich spiele mit dem Feuer. Du lächelst nur still und lässt dich nicht von mir erregen. Eifersucht gehört nicht zu deinen Anfälligkeiten. Es ist Sonntag. Der ganze Tag liegt vor uns, ein Leben. Am Vorabend waren wir mit deiner Familie essen. Wir haben deine Eltern für einige Nächte in einen Gasthof in der Nähe eingeladen. Dein Bruder campiert im Zelt vor unserem Wohnwagen. Nach dem Frühstück will unser Ältester mit dir auf den See hinaus. Er bettelt und drängt. Du sagst: »Warte, bis wir zurück sind.« Unser Sohn versucht, dich umzustimmen. Doch du willst zuerst allein mit deinem Bruder segeln. Der Himmel scheint etwas grau. Am Ufer weht ein leichter Wind. Die Bäume rauschen.
Du bist müde, du willst endlich heimkehren, nicht mehr in der Ferne schuften, hast du eine Woche vor deinem Tod am Telefon zu mir gesagt. Du arbeitetest in einer anderen Stadt. Ich sog scharf die Luft ein und sagte nicht: »Reiß dich am Riemen.« Aber vermutlich war das die Botschaft, die in meiner Stimme mitschwang, als ich beschloss, das Gespräch an dieser Stelle abzubrechen. In jenem Moment glaubte ich, ich sei selbst müde, unendlich erschöpft. Inzwischen habe ich erfahren, was wirkliche Erschöpfung ist. Wenn du Angst hast, dass du beim nächsten Schritt zusammenbrichst. Weil das Schwarz wie Erdöl deine Augen füllt und dein Gesicht eine spitze Hasenmaske ist. Mit großen Ohren, die alles Ungesagte hören. Die Welt ist voller Zeichen, seitdem du nicht mehr in ihr bist. Der grimmige Gesichtsausdruck der Busfahrerin, die vermeintliche Schärfe im Ton ihrer nur an mich gerichteten Durchsage: »Bitte durchgehen. Bewegung! Da ist noch Platz.« Ich komme nicht voran. Ich stecke fest. Ich werfe mich gegen eine Wand aus Menschen und pralle ab an dieser daunengefütterten, nach Schweiß und Streusalz riechenden Wand. Beim Putzen stieß ich vor einiger Zeit deine Taufkerze um, die neben den Büchern im Regal stand. Sie zerbrach in zwei Teile. An beiden Enden ragen nun spitze Zacken empor. Es war unmöglich, die Kerze zu kitten. Das Erhitzen des Wachses jedenfalls reichte nicht. Du warst noch am Leben, als das geschah. Ich vertuschte den Bruch vor dir. Als du starbst, warf ich die Reste der Kerze weg. Jetzt meine ich, das Vorzeichen zu erkennen. Die Kerze stand für dein Leben. Sie zerbrach. Alles fügte sich zum Verhängnis zusammen. Ich habe ungeschriebene Gesetze missachtet und deinen Tod damit herbeigehext. Mein Aberglaube ist plötzlich stärker als mein Verstand. Und dein tatsächliches Ende spukt durch meine Tage. Das Wasser des Sees rauscht und blubbert in meinen Ohren. So präsent, so eng verkettet mit allem, was ich sehe, fühle, denke, dass ich die Doppelbelichtung meiner Augenblicke gar nicht bemerke. Ich sehe den Schatten nicht, weil er immer da ist. Er fällt mir erst auf, als er erlischt. Da sind bereits mehr als zwei Jahre vergangen. Vielleicht war es auch ein Zeichen, dass du deinen Geburtstag, zwei Wochen vor deinem Tod, nicht mehr groß gefeiert hast, sondern stattdessen eine fremde Gartenparty mit uns kapertest. Du, der nie um einen Grund für eine aufwändige Feier verlegen warst. Du hast deinen letzten Geburtstag nicht mehr gefeiert. Hattest du da schon aufgegeben? Hast du es da schon gewusst? Ärgerlich klatsche ich mir selbst gegen die Wangen. Blödsinnige, magische Gedanken. Dann erinnere ich mich an die Taube, diese unwahrscheinliche Taube. In einer Astschlinge hatte sie sich selbst erdrosselt. Ich habe sie nicht gesehen, doch du schworst, es sei wahr. Sie sei da gewesen, die ganze Zeit, während meiner letzten Schwangerschaft. Ihr verwesender Kadaver hing in dieser Astschlinge, direkt vor unserem Balkon, einige Meter von unserem Geländer entfernt in der Baumkrone. Jeden Tag lehnte ich an dem Geländer, während mein Bauch wuchs und wuchs, ich das Kind darin jeden Tag mehr spürte. Es war ein ruhiges, kräftiges Kind. Es trat nur gelegentlich, dann aber entschlossen. Ich freute mich darauf, dieses Kind kennenzulernen. Ich sprach ihm zu, während ich die Witterung prüfte. Dazu streckte ich den Handteller in Richtung der Taube, um eventuellen Niederschlag zu spüren. Den Kadaver bemerkte ich nicht. Dabei war er vor mir in luftiger Höhe drapiert wie die Hinrichtungsopfer im Mittelalter. Ich aber sah nur den Himmel: langgestreckte Wolkenbänder, dahinter das Firmament. Erst grau, dann blau, schließlich weiß. Den Bahnhof und die Zugtrasse in der Ferne, den Dampf aus den Schornsteinen, die Kräne und Hochhäuser. Ich blickte nach vorn. Die tote Taube bemerkte ich nicht. Du hattest sie da schon lang entdeckt. Jeden Tag befürchtetest du, dass ich sie sehen würde. Stumm sahst du zu, wie ich auf den Balkon trat, meine Nase in die Luft reckte, um frische Luft und Sonne zu tanken. Ich suchte Ruhe. Doch du begannst plötzlich zu fegen, fegtest mich förmlich vom Balkon. Ärgerlich zog ich mich in die Wohnung zurück. Ich ahnte nicht, wieso du zum Besen griffst. Unwillkürlich blendete ich die tote Taube aus. Die Brennweite meiner Augen war zu lang eingestellt. Obwohl ich die Leiche nun schon über so viele Wochen hinweg nicht bemerkt hatte, fürchtetest du, dass ich irgendwann die kahlen Zweige des Baums nicht mehr in der Unschärfe verschwinden lassen würde. Du glaubtest, die tote Taube werde mich aufregen und diese Erregung dem ungeboren Kind schaden. Du wolltest mir den Anblick ersparen. Heimlich warfst du mit einem Stein nach dem Kadaver und versuchtest, ihn so zu beseitigen, damit die Leiche endlich nach unten stürzte. Stattdessen fiel der Stein acht Stockwerke tief auf den asphaltierten Weg vor unserem Haus. Du kamst nicht auf die Idee, dass unter unserem Balkon jemand ausgerechnet in diesem Moment vorbeigehen könnte. Eine der vielen weißgelockten Nachbarinnen, die ihren Trolley zum Einkaufszentrum zogen. Ihren »Hackenporsche« hättest du den Rollkoffer in deinem üblichen Jargon genannt. Deine Berliner Schnauze war antrainiert, mit solchen Sprüchen markiertest du den Heiteren, Unverwüstlichen – deine Paraderolle. Doch es war niemand bei dir auf dem Balkon, als du den Stein warfst. Du verfehltest die Taube. Der Stein prallte ungebremst auf den Asphalt. Wie durch ein Wunder verletzte er niemanden. Der Tierkadaver baumelte weiter in der Astschlinge. Der Hals der Taube streckte sich lang und länger, ihr Gefieder wurde struppiger, ihr Körper zerfledderte. Irgendwann war sie plötzlich verschwunden. Vielleicht war es ein Windstoß, vielleicht sogar ein Sturm, vielleicht lag es allein an der Verwesung. Ihr Körper löste sich auf, verschwand, pulverisierte. Wahrscheinlich stürzte das, was von der Taube übrig war, in die Tiefe. Ich nehme an, der Hausmeister kehrte ihre Überreste weg und warf sie in die Mülltonne. Das Kind in meinem Bauch kam auf die Welt. Die Krankenschwestern schoben es gleich auf die Intensivstation. Ich wurde angewiesen, das zu tun, was nach den Strapazen der Geburt nötig war, mir jedoch unmöglich schien. Schlafen. Ruhen. Mich erfrischen. Kräfte sammeln, um das Bündel Mensch zu betten, wenn die Kabel und Schläuche gelöst würden. Der Säugling und ich feierten Weihnachten im Krankenhaus. Seine Krankenhaus-Wiege stand neben meinem Bett. Hinter den Gitterstäben schlummerte er friedlich und ich studierte sein Gesicht. Ich versuchte, mir seine Züge einzuprägen. Es war ein stilles Fest mit einem Kirschkern-Kissen und einem gelben Schlafsack als Werbe-Geschenk von der Klinik. An Silvester waren wir schon wieder zu Hause. Als du stirbst, ist unser Jüngster, Theo, gerade achtzehn Monate alt. Er hält sich für unbesiegbar. Er lacht, wenn er die Augen öffnet. Er brüllt, wenn seine Wünsche nicht erfüllt werden. Von einem Augenblick auf den nächsten bricht er in Tränen aus. Verblüfft starren sein Bruder und ich ihn an. Wir kennen so ein Weinen nicht. Wie ist das möglich? Die Tränen spritzen Theo aus den Augenwinkeln. Ich wische sie weg und nehme ihn in den Arm. Immer noch perplex über seinen Ausbruch. Er schmiegt sich an mich, beruhigt sich, richtet seinen Blick wieder nach außen. Er ist zwei Jahre alt, als er mich fragt, warum die junge Frau am Nebentisch traurig sei. Ich habe nur gesehen, dass eine fröhliche Geburtstagrunde dort Platz genommen hat. Weiter achte ich nicht auf den Nachbartisch. Ich bin zu beschäftigt damit, das stockende Gespräch zwischen deinen Eltern und Hannes zu moderieren. Deine Eltern sind allein mit dem Auto zu uns nach Berlin gefahren, doch am Stadtrand fiel ihnen auf, dass sie unsere Adresse nicht finden konnten und dass auch das Portemonnaie deines Vaters verschwunden war. Er hat es wahrscheinlich an einer Tankstelle liegengelassen. Die Gedächtnislücken machten sich schon lange vor deinem Tod bemerkbar. Doch dein Tod hat das Gedächtnis deiner Eltern vollends durchlöchert. Manche Informationen verschwinden darin und tauchen nie wieder auf. »Warum ist die Frau traurig?«, fragt mich Theo erneut und ich schaue mich endlich um. Auf den ersten Blick sehe ich nur die fröhlich Feiernden, erst dann bemerke ich, dass eine junge Frau die Ausgelassenheit nur mimt. »Was ist mit ihr los?« Theo lässt nicht locker. Ich entgegne, »Ich weiß es nicht.« Der Großvater der Kinder will uns gerade einladen. Er zückt seine Karte, doch dann erinnert er sich nicht mehr an die Geheimzahl. Geplauder, um von der Peinlichkeit abzulenken, hilft jetzt nicht mehr. Hannes muss zum fünften Mal beantworten, in welcher Klassenstufe er ist. »Oma, das hast du mich gerade schon mal gefragt«, bemerkt er. Sie lächelt und Hannes ist derjenige, der verwirrt aussieht. Verwirrt und ungläubig. Wollen sie ihn aufziehen? Oder ist er so unwichtig, dass sie sofort vergessen, was er ihnen sagt? Hannes will seine Großeltern nicht verletzen, doch er begreift nicht, dass ihr Bewusstsein eigene Wege geht, Wege, auf denen er ihnen nicht folgen kann. Auch Theo in meinem Arm ist empfindsam wie ein Seismograf. Unsere Söhne sind wunderbar. Und gerade deshalb pocht nach deinem Tod in meinem Hinterkopf die Frage: Ob dieser zweite Junge, ob diese Wette mit dem Schicksal, eine zu viel war? Quid pro quo. Diese fixe Vorstellung, dass wir beide vielleicht zu viel verlangt haben von einer Instanz, die niemand kennt. Ein Leben geben, ein anderes nehmen. Meine Brille ist zerkratzt. Sie bricht das Licht nicht mehr an den richtigen Stellen. Da sind plötzlich Schlieren, Schatten, Gespenster. Quid pro quo. Du liegst neben mir im Bett. Deine vollen Lippen, dieser Teppich aus Haar, deine Schlupflider. Ich streiche über die zarte Haut eines Siebenjährigen.
Dieser Sonntag im Juni ist etwas kühl, wenig sommerlich. Die Sonne ist nicht zu sehen, der Himmel weißlich-grau. Blütenpollen taumeln wie Schneeflocken herab. Kaum jemand springt vom Badesteg in das dunkle Wasser des Sees. Ich liege auf einer karierten Picknickdecke und stille unseren jüngsten Sohn. Die Wiese am Ufer ist beinahe leer. Ich stütze mich auf der Seite ab, während ich auf den See hinausblicke. Ich schaue zu, wie du mit deinem Bruder die Faltjolle zu Wasser lässt. Du hast dir das Boot zu deinem Geburtstag im vergangenen Jahr gewünscht. Gebraucht hast du es von einem Mann im Oderbruch erstanden. Gemeinsam mit Hannes hast du es abgeholt und aufgebaut. Eigentlich handelt es sich um ein Paddelboot, genauer gesagt ein DDR-Faltboot, Marke Delphin, doch es besitzt einen zusätzlichen Mastaufbau. Du besteigst die Jolle, du setzt die Segel und fährst davon. Ohne dich zu verabschieden. Der Wind greift in die Segel. Dein Bruder und du saust mit dem Boot über den See, verschwindet bald am Horizont. Ich liege mit dem Kleinen auf der Picknickdecke am Ufer und stille ihn. Er saugt und saugt. Ich stütze mich auf dem Ellbogen auf, um auf das Wasser hinauszuschauen. Das Boot ist nicht mehr auszumachen. Das Segel ist verschwunden. Ich halte das Kind so, dass es besser nuckeln kann. In der Hoffnung, es schlafe dabei ein.