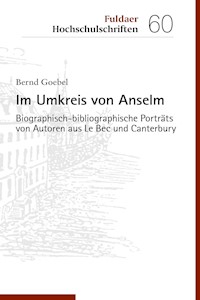Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Königshausen & Neumann
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mexiko. Ein Hotel am Rand des Urwalds. Empedokles Emil Zapata schließt endlich wieder Freundschaft mit dem Leben. Besonders die heiße Schwefelquelle übt eine geradezu magische Wirkung auf ihn aus. Doch in der ehemaligen Hazienda mit dem internationalen Publikum ist nicht nur das Wasser am Brodeln. Immer merkwürdigere Dinge geschehen, bis ein Orkan und ein Mörder den Gästen auch die letzte Ruhe rauben. Von seiner Vergangenheit als Kommissar eingeholt, ist Zapata einem Verbrechen auf der Spur, das ihn mitten in das Drama der Ureinwohner und bis an den Rand des Abgrunds führt. Schwefel, Wasser, Stoff ist ein literarischer Kriminalroman, der seine Leser an faszinierende Schauplätze nimmt. Er thematisiert die bis in die Gegenwart andauernde Ausbeutung der Téenek, einer indigenen Ethnie im Osten Mexikos. Der Protagonist und die meisten anderen Hauptpersonen sind Touristen aus Europa und Nordamerika.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernd Goebel — SchwefelWasserStoff
Bernd Goebel
SchwefelWasserStoff
Zapata ermittelt
Königshausen & Neumann
Die in diesem Roman geschilderten Handlungen und Charaktere sind, von historischen Persönlichkeiten abgesehen, frei erfunden. Ähnlichkeiten mit Lebenden oder Verstorbenen - mit Ausnahme historischer Persönlichkeiten - sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibhothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Verlag Königshausen & Neumann GmbH, Würzburg 2017 Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier Umschlag: skh-softics / coverart Umschlagabbildung: Cenote Ik Kil, Yucatán, Mexiko.© Anna Subbotina - Fotolia.com/Datei #42544908 (Detail).Bindung: docupoint GmbH, Magdeburg Alle Rechte VorbehaltenDieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in German
ISBN 978-3-8260-8034-0
www.koenigshausen-neumann.dewww.libri.dewww.buchhandel.dewww.buchkatalog.de
Und einige von euch wird man töten.
Lukas 21,16
Prolog
Die Sklaverei wurde in meinem Land am 15. September 1829 per Dekret abgeschafft. So steht es in den Schulbüchern. Es gibt längst keine Sklaven mehr, sagen die Herren, aber das ist nur eine Frage der Nomenklatur. Wir Téenek sind alle von Geburt an Sklaven bis zum heutigen Tag. Meine Brüder und Schwestern, meine Söhne und meine Töchter. Wie unsere Väter und Mütter. Wie die Frau, die meine Kinder gebar und nun schon so lange tot ist.
Wir wurden zu Sklaven, damals, als sie mit ihren Schiffen den Strom hinauffuhren und Blei und Feuer spuckten. Als ihr Anführer mit den Federn am Helm die Alten verbrennen ließ und die Jungen in Käfigen auf die Inseln brachte. Als er die Krieger aus Tenochtitlán unsere Dörfer versengen hieß, obwohl sein Heiland doch den Frieden auf Erden verkündet hat. Nur wenige von ihnen haben begriffen, was das heißt. Die Männer in den schwarzen und braunen Kutten vor allem. Aber sie hatten bei ihnen nie das Sagen und kamen fast immer zu spät. Ich, Ehécatl, bin stolz darauf, einem Volk anzugehören, das von den großen Maya abstammt. Das von den Küsten vertrieben wurde, weil die Sklaven aus Afrika in den Häfen härter waren als wir. Weil sie nicht so schnell an ihren Krankheiten und Peitschenhieben zugrunde gingen. Das man aus den Ebenen vertrieb, um Platz zu schaffen für die Pferde und das Vieh. Das sie dezimierten, so oft es sich im Mut der Verzweiflung erhob. Das trotz allem überlebt hat. Das in mir und meinen Kindern fortlebt, auch wenn der Alkohol mir meinen Sohn geraubt hat.
Ich, Ehécatl der Gärtner, bin ein Sklave wie die Schuldknechte, denen Emiliano Zapata vor hundert Jahren zu Freiheit verhelfen wollte und zu Land. Als von fünfzig Bauern bei uns nur einer Grund besaß. Emiliano Zapata, dem man hier in der Nähe ein großes Denkmal errichtet hat. Der gegen die zweiten Eroberer zu Felde zog, die kaum besser waren als die ersten. Jetzt im Drogenkrieg fällt den Herren die Kontrolle über die Sklaven leichter denn je. Wer sich zu unserem Anwalt macht, dem trachtet man nach dem Leben. Das Ölfeld vor unserer Küste ist das reichste im Land, aber unsere Dörfer und Städte sind die ärmsten. Sie haben die Flüsse und das Meer vergiftet und den Wald schrumpfen lassen wie zuvor schon mein Volk. Mit den Geistern aus ihren Fabriken vergiften sie unsere Körper und unsere Seelen. Ich, Ehécatl, der Gärtner von Taninul, bin Teil eines fünfhundert Jahre währenden Trauerspiels. Weiß Gott, ob es enden wird, bevor mein Volk vom Antlitz der Erde verschwunden ist.
In den alten Liedern heißt es, Zapata würde einst wiederkehren. Sie hätten ihn nicht wirklich getötet. Oder er würde wiederauferstehen, so wie Christus. Vielleicht ist es das, was die Huasteca braucht. Einen Messias für die Téenek. Für ihre Nachbarn, die Nahua, Pame und Otomi. Einen neuen Zapata.
Erster Teil: Die Rückkehr
1
Im Spiegel blickte er noch einmal zum Fahrweg zurück. Ein Streifen aus Schotter und Asphalt, der die Savanne zerschnitt. Auf halber Strecke konnte er das Wärterhaus erkennen. Die Schranke, der man angesehen hatte, dass sie nie geschlossen wurde. Dahinter erhob sich wie eine Flamme am Horizont das koloniale Einfahrtstor.
Empedokles Emil Zapata stellte den Motor ab. Er öffnete die Tür und hielt inne. Die feuchtheiße Luft betäubte ihn. Mühsam stieg er aus. Er setzte den Strohhut auf, den er beim Halt an einer Ampel von einer alten indígena erstanden hatte, und zog ihn tief ins Gesicht. Die Sonne hatte den Zenit längst überschritten. Obwohl die kreisförmige Zufahrt für Busverkehr ausgelegt war, konnte er weit und breit nur eine Handvoll Autos ausmachen. In ihrer Mitte ragten, als wollten sie durch den Staub nach Luft schnappen, drei Palmen auf gekalkten Stämmen empor. Er betrachtete die Eingangshalle des langgestreckten Gebäudes, dessen Flügel in einem Meer aus Grün versanken.
Die weite Reise lag hinter ihm. HOTEL TANINUL stand in von der Sonne gebleichten Lettern über der Veranda geschrieben. Vom gleißenden Licht wurde ihm schwindelig. Er schloss die Augen. Sofort zogen die Serpentinen erneut an ihm vorbei, mit denen sich die carretera nacional von der Provinzhauptstadt durch die Wüste und den Nebelwald hinab in die Ebene gewunden hatte. Eine berauschende Fahrt durch die Sierra auf einer Strecke, die zweifellos zu den gefährlichsten des Planeten gehörte. Bereits ihr Bau musste unzählige Menschenleben gekostet haben. Sie war von Gedenkstätten für die Verunglückten gesäumt gewesen. Es gab Kruzifixe, die mit Girlanden behängt waren, Altäre mit frischen Blumen, Altäre mit welken Blumen und mit Blumen aus Plastik. Modelle von Unfallfahrzeugen und Ambulanzen, Erinnerungsstücke aus dem Besitz der Opfer. Auch ganze Familiengräber hatte er aus dem Fenster erkennen können. Während Zapata an diesen Zeugen der Vergänglichkeit vorbeigeflogen war, hatte er sich vorstellen müssen, wie ein klappriger, mit drei Generationen beladener Pick–up in einer Kurve sein altersschwaches Rad verlor und mitsamt den gerade noch winkenden Kindern in die Schlucht stürzte. Eigentlich fühlte er sich zu alt für solche Abenteuer.
2
Ein Hotelboy eilte herbei und half ihm beim Tragen des Gepäcks. Vorbei an der Kutsche, einem Museumsstück, betrat er den Empfangsbereich der einstigen Hacienda. Der ausgetretene Keramikboden reflektierte das Licht der Sonne. Jetzt kam ihm der Schwefelgeruch entgegen. Damals, vor vielen Jahren, als seine Kinder noch Kinder und seine Frau bei Kräften gewesen waren, hatten die Badesachen noch lange nach dem Schwefel gerochen.
An der Rezeption stand eine junge Frau mit nassem Haar. In einer Mischung aus Spanisch und Italienisch fragte sie die Empfangsdame nach einer Schwimmbrille. In der linken Hand hielt sie eine zerlesene Taschenbuchausgabe von Italo Calvinos Unter der Jaguarsonne.
„Paolo, bleib endlich stehen!“
Paolo war ihr etwa zweieinhalb Jahre alter verhaltensauffälliger Sohn. Über der Rezeption öffnete sich das breite Treppenhaus. Die Wände waren mit den Werken eines Muralisten geschmückt. Überlebensgroße Vögel auf fruchtbeladenen Bäume genossen, von einem gutmütigen Jaguar bewacht, ihr idyllisches Dasein. Beim Anblick des Gemäldes fühlte sich Zapata noch fremder.
„Buenas tardes, Señorita“, sagte er in akzentfreiem Spanisch, nachdem der Wunsch der Italienerin in der Hotelboutique in Erfüllung gegangen war. „Mein Name ist Zapata. Empedokles Emil Zapata. Ich habe ein Zimmer reserviert. Für vierzehn Tage. Im ersten Stock. Mit Blick auf das Schwefelbecken. Zimmer einhundertvier.“
Die Rezeptionistin, durch ein messingfarbenes Schildchen auf dem Kostüm als Empfangsdirektorin namens Claudia Zaragoza ausgewiesen, blätterte in ihren Unterlagen. Er fügte hinzu:
„Hatte mir allerdings schon gedacht, dass es um diese Jahreszeit nicht nötig sein würde zu reservieren.“
„Ja, wir sind erst wieder über Ostern ausgebucht“, antwortete Fräulein Zaragoza, die noch nicht fündig geworden war, mit einem Lächeln.
„Obwohl viele der Meinung sind, dass es jetzt am Ende des Winters am schönsten bei uns ist. Zapata ... Zapata, da haben wir Sie ja. Sagten Sie Emiliano?“
„Empedokles Emil. Meine Freunde nennen mich Emiliano.“
Die Rede vom Winter irritierte ihn im ersten Augenblick. Aber er begriff schnell, dass er das Wort in seiner astronomischen Bedeutung zu nehmen hatte. Als ihm der Schlüssel ausgehändigt wurde, stellte er Fräulein Zaragozas Zurückhaltung auf die Probe.
„Dem Parkplatz nach zu urteilen, haben Sie momentan nur wenige Gäste. Einheimische, nehme ich an. Und sicher auch den einen oder anderen Nachbarn aus dem Norden.“
Trotz seines Alters konnte es Zapata an Neugier mit den meisten Kindern aufnehmen.
„No, Señor. Fast keine einheimischen Touristen. Ein einziger, genau genommen.“ Und mit einer Spur von Stolz in der Stimme: „Wir haben zur Zeit eine internationale Klientel. Eine Familie aus Italien. Zwei Gäste aus Frankreich. Und eine Dame aus Kanada – sie ist sogar Schauspielerin. Drei Amerikaner. Oder vielmehr ... nein, nur zwei, der eine Herr ist ja Engländer. Ein anderer Gast aus Ihrem Land ist übrigens auch schon da.“
Da ihr Gegenüber immer noch große Augen machte, fügte sie hinzu:
„Und morgen erwarten wir noch zwei Spanierinnen. Gäste aus Spanien haben wir nicht oft.“
„Die Vereinten Nationen von Taninul“, bemerkte Zapata, der sich als Kosmopolit verstand, in feierlichem Ton. Das versprach ein unterhaltsamer Urlaub zu werden.
„Bin übrigens selbst so eine Art vereinte Nation. Dieser Pass hier“ – er tippte mit dem Finger auf das Raubtier – „ist zwar in Deutschland ausgestellt. Aber ich trage nicht nur einen spanischen Namen. Ich besitze auch einen mexikanischen Pass. Ist bloß abgelaufen. Mein Vater stammte aus Michoacán.“
Er seufzte. „Ich hatte leider nie das Vergnügen, in Mexiko zu leben.“
Die Rezeptionistin äußerte sich anerkennend über die Schönheit des Staates Michoacán. Sie erinnerte sich an einen Besuch der dortigen Überwinterungsplätze der mariposa monarca. Eines Wanderfalters, der gewaltige Strecken zurücklegt. Da sie dem noch weiter gereisten Gast ansah, dass ihn nach seinem Zimmer verlangte, beendete sie mit einem besonders herzlichen Lächeln ihr Gespräch.
„Willkommen also in der zweiten Heimat, Caballero. Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Aufenthalt und stehen Ihnen für Ihre Wünsche zur Verfügung. Ihr Gepäck befindet sich bereits auf Ihrem Zimmer.“
Zapata bediente sich noch von einem Stapel Hotelbroschüren, bevor er die Treppe hinaufstieg. Obwohl er schwere Beine hatte, nahm er erfreut zur Kenntnis, dass immer noch kein Fahrstuhl existierte. Erst auf halber Höhe entdeckte er den schwarzen Leuchter, der tonnenschwer über der Rezeption an einer einzigen Kette hing. Er bewegte sich kaum wahrnehmbar im Kreis. In die Wand war eine Gedenktafel eingelassen, die festhielt, dass in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein Staatspräsident höchstpersönlich das neue Hotel eingeweiht hatte und dass es sich im Besitz der Genossenschaft der Zuckerrohrarbeiter befand. Durch den Einbau eines Aufzugs hätte sich Taninul vielleicht einen vierten Stern verdienen können. Aber offenbar hatte die Genossenschaft der Zuckerrohrarbeiter keinerlei diesbezüglichen Ambitionen. Seine Hoffnung wuchs, dass er in seinem Zimmer nicht den fast unvermeidlichen Fernseher vorfinden würde.
Seine Hoffnung wurde nicht enttäuscht. Der Platz auf der Eckkommode, der bei seinem letzten Aufenthalt vor fast zwanzig Jahren leer war, war leer geblieben. Zapata ließ die Genossenschaft der Zuckerrohrarbeiter innerlich hochleben. Auch sonst hatte sich nicht viel verändert in dem einfachen, aber bequemen Raum mit seinem altertümlichen Schloss an der Kassettentür. Den Möbeln aus lackiertem Mesquite- und Pinienholz. Mit der rau verputzten Decke in frischem Weiß, dem quadratischen Bett, den einnehmenden Nachttischlampen, dem Holzschnitt an der Wand und der dröhnenden Klimaanlage. Gegen sie hatte Zapata mit Ohrenstöpseln von höchster Schalldämmung vorgesorgt. Er setzte sich und warf einen Blick auf die Broschüre. Dort war zu lesen, dass Taninul bedeutete: „Der-Ort-an-demdie-Wasser-brodeln“, und dass sie mit annähernd zweiundvierzig Grad Celsius brodelten. Er fühlte sich müde. Aber stärker noch als seine Müdigkeit waren sein Hunger und der Wunsch, das Wasser zu spüren. Er entschied, ein leichtes Abendessen zu sich zu nehmen und danach die Quelle aufzusuchen.
3
Der Speisesaal des Hotels war nicht ganz so groß wie in seiner Erinnerung. Ein monumentales Fresko zog den Blick auf sich: eine Frau mit schwarzem, Blüten besetztem Haar, lässig in einer Hängematte ausgestreckt, mit großen Brüsten und liebeshungrigem Blick. Diese Venus von Taninul war vor zwanzig Jahren blasser gewesen. Jetzt hatte ein neuer Anstrich sie noch attraktiver gemacht.
Zapata setze sich an einen der einladenden Tische des fast leeren Restaurants. Nichts schien sich hier in all den Jahren verändert zu haben. Das Lokal bei ihm zu Hause um die Ecke hatte in der Zwischenzeit gut und gerne fünfmal Besitzer und Inneneinrichtung gewechselt. Nur ein weiterer Tisch war noch besetzt: In einer Ecke speisten Paolo und seine Mutter in Begleitung eines blonden Mannes. Er trug ein frischgebügeltes Hemd, machte einen dynamischen Eindruck und war augenscheinlich Paolos Vater. Ihnen gegen- über saß sein Antagonist. Ein Bär von einem Mann, in grü- nem Tropenhemd, mit kurzgeschnittenem weißen Bart und rotem Kopf. Aber nicht dieser Trikolore, sondern seinen mit kräftiger Stimme gesprochenen Worten entnahm Zapata, dass er sich einem Italiener gegenübersah. Allem Anschein nach handelte es sich um Paolos Großvater. Zapata bestellte eine sopa azteca, ein leichtes Tortillagericht und einen licuado de papaya. Dass er genau dies an seinem ersten Abend in Taninul bestellen würde, hatte er schon gewusst, als er die Reise plante.
Als sich der Kellner gerade abwenden wollte, erinnerte sich Zapata.
„Sie haben schon als junger Mann in diesem Hotel gearbeitet. Oder täusche ich mich, joven?“
Der Angesprochene war der Jugend eindeutig entwachsen, aber in Mexiko konnte man selbst einen uralten Kellner einen jungen Mann rufen. Er schien nicht überrascht und lächelte verlegen.
„Ihr Gedächtnis ist gut, Señor. Ich arbeite hier seit meinem fünfzehnten Lebensjahr.“
Zapata schüttelte ungläubig den Kopf.
„In Taninul scheint sich seit meinem letzten Besuch nicht viel verändert zu haben. Freut mich, Sie wiederzusehen. Ich bin übrigens Emiliano.“
„Fernando“ entgegnete der kleine Kellner. Er lächelte noch verlegener.
„Ich habe Sie gleich erkannt, Herr Emiliano. Sie waren einmal einen ganzen Monat hier zu Gast. Ein paar Jahre nach dem großen Erdbeben. Mit Ihrer Familie. Ich hoffe, Ihrer Frau und den Kindern geht es gut. Zwei Mädchen, glaube ich.“
„Den jungen Damen geht es bestens. Danke der Nachfrage. Nur meine Frau ...“
Er machte eine Pause. Sein Blick senkte sich.
„Sie ist leider verstorben. War lange krank.“
Fernando schien aufrichtig betroffen. Erst als sich Zapata nach der Familie des Kellners erkundigte, strahlte er wieder: zwei Mädchen und ein Junge, vier Monate alt die Jüngste. Das Essen, das er bald darauf servierte, war einfach wie das Blechbesteck, mit dem es von Zapata zerlegt wurde, aber schmackhaft. Wie fast immer bewirkte seine erste Mahlzeit auf mexikanischem Boden, dass ihm die Strapazen der Reise unerheblich vorkamen. Während er zufrieden aß, betrat ein schlanker Endvierziger mit gepflegtem Schnurrbart und schütterem Haar das Restaurant und setzte sich an den Nebentisch. Er lächelten ihm zu. Das muss der einheimische Vertreter sein, dachte Zapata. Der Neuankömmling beugte sich zu ihm herüber, fixierte zuerst sein Getränk und dann seine müden Augen:
„Ah, ein licuado de papaya! Da haben Sie die richtige Wahl getroffen. Es gibt nirgends im Staat San Luis Potosí einen so vorzüglichen wie hier. Die Papayas werden gepflückt, wenn Sie die Bestellung aufgeben.“
„Ganz Ihrer Meinung“, entgegnete Zapata. Er freute sich darüber, dass man ihn auf Spanisch anredete. „Sie ... äh ... sind also nicht zum ersten Mal hier?“
„Ich komme jedes Jahr um diese Zeit nach Taninul. Jetzt in der Vorsaison sind die Preise erträglich und es wird nicht so heiß. Gestatten Sie: Juan Antonio Echeverría, Imker.“
„Emiliano, sehr erfreut.“
Zapata unterhielt sich noch eine Weile mit dem neuen Bekannten. Er bereicherte sein Wissen über Bienen, Honigarten und Honigkooperativen. Über das Hotel Taninul, seine glanzvolle Vergangenheit und gegenwärtigen Gäste und über den Staat Querétaro, in dem Juan Antonio mit seinen Bienen wohnte.
Dann endlich, draußen war es bereits dunkel, ging er mit lahmen Beinen zum Schwefelbad. Das große, kreisrunde Becken war von Strahlern erleuchtet und bis zum Rand mit dampfendem Wasser gefüllt. Es ergoss sich in einen Kanal, stürzte nach wenigen Metern einen künstlichen Katarakt hinunter und mündete, immer noch dampfend, ins graugrüne Bett eines Bachs. Hinter dem Becken erhoben sich Mangobäume und hinter den Bäumen eine mit dichtem Grün bewachsene Felswand. Überdimensionierte Kakteen hielten gespenstisch Wache. Zapata sah die Treppen, auf denen man mit wenigen Schritten zum Eingang der Höhle gelangte. Bei seinem letzten Besuch hatte sie den grünen Papageien als Schlafquartier gedient. Zu den Glanzzeiten des Hotels war dort, so hatte er der Broschüre entnommen, eine Bar untergebracht gewesen. Neben dem Bach, der sich den östlichen Flügel des Hotels entlang schlängelte, stand eine Hütte, durch deren Ritzen er den Schein eines Feuers erkennen konnte. Das musste ein temazcál sein. Die Schwitzhütte der Ureinwohner Mexikos, in der unter den maskierten Augen des Schamanen Krankheiten und böse Geister ausgetrieben wurden.
Ein Nachtfalter flog geräuschvoll an seinem Kopf vorbei. Da sah Zapata, wie dem Dunst der Hütte zwei Geister entfuhren. Verwundert rieb er sich die Augen. War er überhaupt noch wach? Zwei Hotelgäste nur, ein Mann und eine Frau. Sie redeten Französisch und verglichen den Nutzen nicht-steroidaler Antirheumatika mit der therapeutischen Wirkung hyperthermischer Applikationen. Zwei Ärzte zweifellos. Sie grüßten einander kurz.
Das Wasser war noch heißer als erhofft. Zapata musste sich anstrengen, die Augen offen zu halten. Er tauchte und ließ sich auf den Boden sinken. Als er wieder die Oberfläche erreichte, kam ihm die warme Luft kühl vor. Das Becken mochte einen Durchmesser von gut dreißig Metern haben. Es besaß in knapp zwei Metern Tiefe – seine Zehenspitzen berührten gerade noch den Boden – einen halbmondförmigen Grund aus Beton, der jäh wegbrach, wenn man sich der Quelle näherte. Dort war die Temperatur kaum zu ertragen. Er erinnerte sich: In vier oder fünf Metern Tiefe stieß man hier auf einen grauen, stark schwefelhaltigen Schlamm. Wenn man dem Hotelprospekt Glauben schenken durfte, war er schon den Prinzessinnen der Ureinwohner ein bevorzugtes Mittel gewesen, ihre Schönheit zu steigern. Ein intensives Aroma schwebte über dem ganzen Bad. In Zapatas Erfahrung fühlten sich die Menschen vom Geruch des Schwefels entweder angezogen oder abgestoßen. Ihn selbst zog der gelbe Duft magisch an.
Die Ärzte hatten in einer am Beckenrand postierten palapa Platz genommen, einem reetgedeckten Pavillon, und erlabten sich an Longdrinks in leuchtendem Grün und Blau. Zwei weitere Gäste bevölkerten das Becken. Eine ältere Lady, blond und bleichgesichtig, war auf einer Liege ausgestreckt. Zwischen ihr und der Felswand stand ein nur wenig jüngerer Hotelangestellter. Der grau bemähnte, mit Rechen und Eimer bewaffnete Eingeborene war allem Anschein nach ein Gärtner von Taninul. In unregelmäßigen Abständen riss er seinen Besen in die Höhe wie ein Hexer.
Zapata schwamm gerade durch die Mitte des Beckens, als er neben sich eine Stimme hörte. Er drehte sich um. Niemand war zu sehen. Erneut hörte er die Stimme, ganz nahe. Sie war laut, deutlich zu vernehmen, redete Englisch und schien ihn zu tadeln. Von den beiden Saunagängern fehlte jede Spur. Das ungleiche Seniorenpaar auf der anderen Seite des Schwefellochs war gut und gerne zwanzig Meter von ihm entfernt. Wer sprach ihm dann ins Ohr? Wieder vernahm er wie durch einen unsichtbaren Kopfhörer einen Satz, diesmal in gebrochenem Englisch.
Endlich begriff Zapata. Die konkave Felswand reflektierte den Schall ihrer Stimmen und trug ihn gebündelt übers Wasser zu ihm. Er befand sich genau im Brennpunkt. Während er über diese verblüffende Wirkung staunte, konnte er für einige Augenblicke nicht umhin, dem Gespräch der beiden zuzuhören:
„... Das Schwefelbecken ist in einem tadellosen Zustand. Die Algen auf dem Wasser sind kein ,Dreck‘. Sie wachsen auf dem Boden und steigen nach oben. Sie sind eine edi–zin. Schon meine Vorfahren wussten um ihre Heilkräfte.“
„Sie sind einfach ekelerregend! Ich werde mich beschweren. Warum öffnet man nicht den kleinen Pool mit dem gechlorten Wasser? Ich habe einen Badeurlaub gebucht. Keinen Abenteuerurlaub!“
„Der kleine Pool wird erst im April geöffnet. Wenn es draußen so heiß ist, dass man es im großen Becken nicht aushält. Die Algen sind wirklich nicht schlecht für Sie. Aber Sie sind schlecht zu den Algen.“
„Unverschämtheit! Ich werde mich auch über Sie beschweren. Und, sagen Sie, warum gehen Sie eigentlich nicht zum Zahnarzt? Ein Hotelangestellter sollte keine solche Zahnlücke haben. Selbst wenn er nur im Garten arbeitet.“
Der Alte riss den Besen ein letztes Mal in die Höhe und stieß ein paar Worte in seiner Muttersprache hervor, die nicht Spanisch war. Dann trat er, indem er mit jugendlicher Leichtigkeit die Treppen zur Höhle emporstieg, ab. Auch Zapata hatte nun genug. Die Hitze des Wassers war ihm zu Kopf gestiegen wie ein schwerer Rotwein. Langsam schritt er die Außentreppen des Hotels hinauf. Bevor er den langen Gang betrat, in dem es nach Terpentin roch, ließ er noch einmal den Duft der Tropen durch die Nase strömen. Wenig später fiel er in einen tiefen Schlaf.
4
Es dauerte eine Weile, bis ihm klar wurde, wo er sich befand. Benommen kramte er den Wecker aus seiner Reisetasche hervor. Viertel nach neun. Zapata war verwirrt. Dann war es in Taninul erst kurz nach zwei. Ungläubig ging er zum Fenster und schob den Vorhang zur Seite. Nur der Mond erhellte etwas die wolkenlose Nacht. Lange hatte sein Schlaf nicht gedauert. Kein Wunder, spätestens um diese Zeit stand er zu Hause gewöhnlich im Klassenzimmer. Oder saß am Wochenende am Frühstückstisch. Er spürte, wie seine Schläfrigkeit vollends verflog. Von früheren Reisen wusste Zapata, dass es jetzt zwecklos war, sich wieder ins Bett zu legen. In zwei oder drei Stunden erst würde die Müdigkeit zurückkehren, früher nicht. Wie sollte er sich die Zeit vertreiben? Nicht wieder mit trübsinnigen Gedanken. Er dachte an die Wettervorhersage, die er vor seiner Abreise studiert hatte. Die Temperatur in der Nacht würde in Taninul nicht unter vierundzwanzig Grad sinken. Der Sinn stand ihm nach einem Spaziergang im Garten. Kurz entschlossen kleidete er sich an, verließ sein Zimmer und drehte den schweren alten Schlüssel im Schloss herum.
Der Nachtportier zeigte keine Anzeichen von Überraschung über den späten Gast. Oder den frühen, ganz wie man wollte. Er grüßte ihn wie selbstverständlich. Zapata ging zuerst zum Parkplatz. Ein Nachtwächter in Hoteluniform drehte seine Runden. Er schien ihn nicht weiter zu beachten. In der warmen, bewachten Dunkelheit fühlte sich Zapata fast so sicher wie zu Hause. Er holte eine Brille und eine Taschenlampe aus seinem Wagen. Erneut passierte er den Nachtportier und bog in den Gang ein, der zum Schwimmbecken führte. Der Schwefelgeruch neben dem von einem einzigen Strahler erleuchteten Becken war noch erdrückender als am Abend. An einer vom Mondlicht geschützten Stelle nahe der Felswand entdeckte er zu seiner Freude eine Sitzbank. Er setzte die Brille auf, legte sich auf den Rücken und betrachtete mit Bewunderung die Sterne.
Als er fast eine halbe Stunde so dagelegen hatte, hörte er ein Geräusch, das nicht zu dem Zirpen der Grillen passte. Die Schritte eines Menschen, kein Zweifel. Sie näherten sich. Zapata hielt den Atem an. Für einen Moment überlegte er, ob er sich zu erkennen geben sollte. So wie er es im Dampfbad zu tun pflegte, wenn ein Neuankömmling über ihn zu stolpern oder sich auf ihn zu setzen drohte. Die Schritte dieses Neuankömmlings waren leise, dabei flink und zielstrebig. Zapata erachtete die Gefahr einer Kollision für gering. Er unterließ es, sich zu räuspern. Regungslos versuchte er stattdessen, den auf ihn Zukommenden in der Dunkelheit auszumachen. Er hörte, dass keine zwei Meter entfernt jemand an ihm vorbeilief. Spürte die Nähe. Aber er hatte sich eine besonders finstere Ecke im Schatten der Mangobäume ausgesucht und konnte nicht einmal den Schatten eines Umrisses erkennen. Wer mochte das sein? Ein Angestellter oder ein Hotelgast? Ein Mann oder eine Frau? Eine merkwürdige Zeit für einen Spaziergang im Garten jedenfalls. Andererseits – er selbst war schließlich auch hier. Vielleicht war es jemand, der den Lärm der Klimaanlage nicht ertrug und es nicht länger in seinem feuchtwarmen Zimmer aushielt. Oder ein Leidensgenosse, den die Reise durch die Zeitzonen um den Schlaf gebracht hatte.
Da bemerkte Zapata das Flackern einer Taschenlampe. Der nächtliche Spaziergänger war wenige Schritte weiter bei der Felswand stehengeblieben. Das schwache Licht war schon wieder erloschen. Zapata verspürte den Drang, sich aufzusetzen, um besser sehen zu können, falls das Licht erneut aufscheinen würde, blieb aber dennoch liegen, um den anderen nicht auf sich aufmerksam zu machen. Abermals sah er für Sekunden das Licht. In seinem Kegel erkannte er ganz deutlich eine Hand. Sie schien einen Stein aus der Wand zu ziehen. Kurz darauf erleuchtete das Licht noch einmal blitzartig einen Punkt auf den Felsen. Danach blieb es dunkel. Wieder Schritte. Diesmal entfernten sie sich von ihm. Schließlich war nur noch das gewohnte Zirpen der Grillen zu hören, unterbrochen vom Geschrei der Nachtvögel. Ganz so, als sei nichts geschehen.
Aber es war etwas geschehen. Zapata wartete. Da er nichts Ungewöhnliches hörte, setzte er sich auf. Wagte es endlich, tief durchzuatmen. Was hatte das zu bedeuten? Was hatte der Unbekannte an der Felswand zu suchen? Und warum um alles in der Welt trug er Handschuhe? Oder zumindest einen Handschuh, Zapata hatte ihn ganz deutlich gesehen. Bei einer Temperatur von nicht unter vierzundzwanzig Grad. Er konnte sich keinen Reim darauf machen. Noch einmal legte er sich auf die Bank und blickte hinauf zum Sternenhimmel. Keine Anzeichen von Müdigkeit, wie gehabt. Ob er die Felswand einmal näher inspizieren sollte? Warum eigentlich nicht? Häufig kam es nicht vor, dass er die Zeit totschlagen musste. Er hätte auf sein Zimmer gehen und in seinem Detektivroman lesen können. Aber im echten Leben den Detektiv zu spielen, hier und jetzt in Taninul, erschien ihm nach seinen Beobachtungen von eben viel reizvoller. Als nach zwanzig Minuten keine weiteren außergewöhnlichen Geräusche an sein Ohr gedrungen waren, machte er sich an die Arbeit
Die Stelle zu finden, bereitete ihm keine große Mühe. Dort, wo der Unbekannte zugange gewesen war, gab es in der Felswand nur einen beweglichen Stein. Er ließ sich mit beiden Händen ohne Mühe herausziehen. Der Hohlraum, der sich vor ihm auftat, schien leer, aber als er ihn gründlicher ausleuchtete, bemerkte er ganz hinten einen weißen Fleck. Zapata musste sich etwas verbiegen, dann hatte er das kleine Blatt Papier aus dem Spalt gefischt. Er entfaltete es an Ort und Stelle und runzelte die Stirn. Es enthielt, in sorgfältiger Druckschrift, die folgenden Sätze:
Tu. Dieciocho tres tres. Un astro que cae en un cielo vacio.
Einigermaßen enttäuscht prägte er sich die Worte ein, bevor er den Zettel an seinen Fundort zurücklegte. Den Stein schob er wieder in den Felsen. Du. Achtzehn drei drei. Ein Stern, der in einen leeren Himmel fällt. – Was konnte das bedeuten? War es ein Rätsel? Eine verschlüsselte Botschaft? Der letzte Satz erinnerte ihn an etwas. Aber woran? In Gedanken versunken ging er zu seinem Zimmer zurück. Hinter keiner der Türen war Licht zu sehen. Achtzehn drei drei, das könnte für das Jahr 1833 stehen. Oder für achtzehn Uhr dreiunddreißig. Letzteres erschien ihm eher unwahrscheinlich; denn hätte es dann nicht Achtzehn dreiunddreißig geheißen oder Eins acht drei drei? Eher bedeutete es den achtzehnten Dritten, drei Uhr. Ja, das war gut möglich. Heute war der fünfzehnte März, genau genommen schon der sechzehnte. Der achtzehnte war übermorgen. Drei Uhr. Drei Uhr nachmittags oder drei Uhr nachts? Und warum das vorangestellte Du?
Im Bett dachte er noch lange über die Bedeutung der Worte nach. Als er schon fast eingeschlafen war, kam ihm mit einem Male, woher er den letzten Satz kannte. Die letzte Strophe. Er stammt aus einem Gedicht von Octavio Paz. Oder beinahe.
Dos cuerpos frente a frente son dos astros que caen en un cielo vacio.
Zwei Körper. So hieß, wenn er sich recht erinnerte, das Gedicht. Zwei Körper, Stirn an Stirn, sind zwei Sterne, die in einen leeren Himmel fallen. Die Botschaft hatte aus den zwei Körpern und Sternen einen einzigen gemacht, aber die Anspielung auf die Verse war nicht zu übersehen. Dort waren die Sterne die Körper zweier Liebender. Von was für einem Stern war hier die Rede? Und was war damit gemeint, dass er in einen leeren Himmel fiel? Zapata tröstete sich mit dem Gedanken, dass es unmöglich sein würde, das durch bloßes Nachdenken herauszufinden, und schlief endlich wieder ein.
5
Es war längst Tag, als er erwachte. Sein Wecker zeigte Viertel nach vier. Also war es erst kurz nach neun, obwohl die Sonne schon höher stand als zu Hause am Mittag. Er hatte das Frühstück noch nicht verpasst. Zapata vergeudete keine Zeit mit der Morgentoilette, schlüpfte in ein Paar Badeshorts, griff nach einem Handtuch und ging wie von einem Magneten angezogen zum Schwefelbecken. Frisch herabgefallene Mangoblüten säumten den Weg. Genüsslich ließ er sich in die Fluten sinken. So ähnlich dürfte es sich einst im Mutterleib angefühlt haben. Als sein Blick auf die Felswand fiel, musste er kurz an sein nächtliches Erlebnis denken. Aber er verfiel jetzt nicht ins Grübeln. Für den Augenblick schienen ihm alle Probleme dieser Welt gelöst.
Kurze Zeit später saß er im Speisesaal vor einem üppigen Frühstück. Er hatte sich für das Tropenfrühstück entschieden, das mit einem in einer Melonenhälfte servierten Obstsalat begann. Neben ihm stand, vor einem Turm leerer Teller und bereits im Aufbruch begriffen, Juan Antonio Echeverría. Am Tisch saß außerdem eine schlanke, elegant gekleidete Gestalt. Ein gebräunter Gentleman mit leicht ergrauten Schläfen, kantigem Gesicht und stahlblauen Augen.
Juan Antonio rieb sich den Bauch.
„Mit so einem Frühstück kann der Tag beginnen! Emiliano, ich glaube Sie haben Herrn Salisbury noch nicht kennen gelernt. William D. Salisbury, um genau zu sein. Er ist Apotheker und kommt aus England. Darf ich vorstellen – Herr Emiliano aus Deutschland, mit Wurzeln bei uns in Mexiko. Ist gestern angekommen.“
Zapata nickte dem Engländer zu.
„Aber jetzt muss ich mich leider von Ihnen verabschieden“, fuhr der Imker fort. „Ich will heute einen kleinen Ausflug unternehmen. Zu einem Wasserfall. Hoffentlich bleibe ich nicht wieder“ – er verdrehte die Augen – „in einer dieser lästigen Militärkontrollen stecken. Adiós allerseits!“
„Militärkontrollen?“ fragte Zapata unsicher, nachdem Juan Antonio gegangen war.
„Ach, nichts Ernstes“, beruhigte ihn sein Gegenüber. „Jedenfalls nicht, wenn man Ausländer ist. Ich meine, Deutscher oder Brite. Amerikaner. Uns gegenüber verhalten sie sich wie zivilisierte Menschen. Meistens zumindest.“
Und nach einer Pause, da Zapata ihn mit fragenden Augen ansah: „Nun, ganz offiziell sind sie da, um zu verhindern, dass eine Mafia aus Ex-Polizisten die Bevölkerung terrorisiert. Und die Drogenkartelle abschlachtet. Oder umgekehrt, so genau habe ich das nicht begriffen. Und alles, was ihnen in die Quere kommt. Leider Gottes“ – er setzte eine besorgte Mine auf – „wird der Gouverneur von beiden ehrenwerten Gesellschaften zugleich erpresst. Entführungen, Waffenschmuggel. Menschenhandel und derlei Lappalien. Schutzgelder. Enthauptete und gevierteilte Polizeichefs, zu Tode gefolterte Bürgermeister und Bürgermeistergattinnen. Mancherorts schicken die Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Schule. Aus Angst. Natürlich heizt das Militär die Lage nur noch an.“
Er schüttelte nachsichtig den Kopf, als amüsiere er sich über einen Dummejungenstreich. „Nun ja, in Afrika habe ich Schlimmeres erlebt.“
„Das Sicherheitsproblem in der Huasteca“, fuhr er fort, „ist der Bundesregierung ein willkommener Vorwand, die unliebsamen Indianeraktivisten ein wenig einzuschüchtern. Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmungen. Einmal tief in den Gewehrlauf blicken lassen. Manöverschäden, eine gebrochene Rippe, die eine oder andere Verhaftung. Das letzte große Massaker liegt schon dreißig Jahre zurück. Sie haben gemerkt, dass die zarteren Methoden wirksamer sind. Die meisten lassen sich auch so die Courage abkaufen. Mit den Übrigen wird man leicht fertig.“
Und nach einer weiteren Pause, nachdem Zapata immer noch nichts sagte: „Ist in letzter Zeit etwas heruntergekommen, diese Gegend. So wie das ganze Land. Im Grunde genommen. Und wie dieses Hotel.“
Zapata hatte aufmerksam zugehört.
„Das sind betrübliche Neuigkeiten für mich. Als ich das letzte Mal hier war, galt die Huasteca als eine der friedlicheren Gegenden des Landes. Ich hatte gehofft, das sei immer noch so. Liegt also nicht nur an der Jahreszeit, dass das Hotel so leer ist. Gefällt es Ihnen denn nicht?“
„O nein, im Gegenteil. Nein, es ist ein ... ganz entzückender Ort. Nun ja, es hat schon bessere Tage gesehen. Nehmen Sie zum Beispiel den Tennisplatz. Ein unebener Tennisplatz ist eine fast ebenso große Herausforderung wie ein schiefer Billardtisch. Der Billardtisch im Festsaal ist nebenbei bemerkt tatsächlich schief. Und der nächste anständige Golfplatz befindet sich über eine Stunde von hier. Kein Fernsehen, kein Internet, abseits aller Mobilfunknetze, Telefon nur an der Rezeption. Aber das macht wohl gerade den Reiz dieses – wie soll ich sagen? – Refugiums aus.“
„Was, wenn ich fragen darf, führt Sie eigentlich in diese Wildnis? Warum nicht ein Ressort in der Karibik?”
Mr. Salisbury schien für einen Moment perplex. „Ich, also … ich bin aus einer ganzen Reihe von Gründen hier. Der therapeutischen Wirkung des Wassers wegen vor allem.“
Er tippte sich ans Knie.
„Fibromyalgie, die Geisel des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Eine solche Quelle“ – seine Augenbrauen waren wieder erhoben – „finden Sie weder auf Barbados noch auf den Bahamas oder Balearen. Außerdem liebe ich es, die Natur zu beobachten. Die Artenvielfalt hier ist fast einzigartig. Und auch die Mexikaner sind mir eigentlich nicht zuwider. Die Dagos liegen uns nicht, hat mir ein Freund gesagt. Kein Tee, nur Zimtkaffee. Gelbe Galle und arabisches Blut, hat er gesagt.“
Er lachte. „Nun, sie scheinen mir doch ganz nett zu sein.“
Zapata lächelte etwas gezwungen und sagte: „Da Sie die Eingeborenen erwähnen – ich besuchte damals die Fabrik eines berühmten Naturheilkundlers. Vielleicht haben Sie als Apotheker von ihm gehört. Er wurde bereits zu Lebzeiten von den Einheimischen verehrt wie ein Heiliger. Vor ein paar Jahren ist er gestorben.“
„Ich habe von ihm gelesen. In der Tat. Hab mich aber nie näher mit Pflanzenheilkunde befasst. Schon gar nicht mit der außereuropäischen. Eine Wissenschaft für sich. Mein Vater hatte noch ein ganzes Arsenal von Rinden, Wurzeln und Blättern in der Apotheke. Den Giftschrank. So hab ich ihn immer genannt. Ich selbst kann gerade noch den Geruch von Kamillen- und Pfefferminztee unterscheiden. Obwohl die Kräuter vielleicht nicht ganz unnütz sind. Besonders wenn sie mit viel Hokuspokus verabreicht werden. Traurig nur, dass jener Heiland schon mit Anfang siebzig verstarb. Als Mexikaner war seine Lebenserwartung eine Spur größer, wie mir scheint.“
„Wirklich große Menschen“, warf Zapata ein, „haben nicht selten Probleme mit der mittleren Lebenserwartung.“
„Dann will ich hoffen, dass ich nicht zu den wirklich großen gehöre“, entgegnete der Engländer.
Den restlichen Vormittag verbrachte Zapata auf dem Zimmer und erholte sich von seinem Tropenfrühstück. Nach dem Mittagessen machte er sich auf, die abgelegeneren Teile der Anlage zu erkunden. Die Hacienda Taninul verfügte über einen Flügel, in dem keine Hotelzimmer untergebracht waren. Dort befand sich ein kleines Museum. So viel jedenfalls hatte Zapata der Hotelbroschüre entnommen. Er konnte sich vage daran erinnern, dass es bei seinem ersten Aufenthalt in Taninul wegen Renovierungsarbeiten geschlossen war. Jetzt sah er das Türschild mit der Aufschrift Museo Universitario Parias. Ein kleines Museum war ganz nach seinem Geschmack. Lange hielt er es erfahrungsgemäß nie in Museen aus, es sei denn vor den Vitrinen von naturkundlichen Sammlungen. Das Museum war der Huaxteken-Kultur gewidmet. Eine Wandtafel belehrte den Besucher, dass man sie respektvoller, der Selbstbezeichnung dieser Ethnie folgend, als Téenek bezeichnen sollte. Es war nicht nur klein. Es war winzig und umfasste drei enge Räume mit Fundstücken von zwei nahe gelegenen archäologischen Stätten namens Tamtoc und Tamohí. Wie Zapata feststellte, hatte er Glück, denn es war nur drei Mal in der Woche für wenige Stunden geöffnet. Flüchtig betrachtete er eine hölzerne Maske, einen steinernen Kalender, ein verwittertes Relief, einen Hund aus Terrakotta.
Im Nebenraum galt sein erster Blick nicht den Exponaten, sondern dem Ärztepaar aus der Schwitzhütte. Es beugte sich gerade interessiert über einen Gegenstand, der aus messerscharfen, mit Erschlagungsszenen verzierten Steinen bestand. Die Steine waren in Holz eingefasst. Das Artefakt ließ sich augenscheinlich ebenso gut als Axt wie als Keule einsetzen, ein unverhohlenes Mordinstrument. In einem Museum in Paris, so belehrte ihn die Ärztin, gebe es ein fast identisches Stück zu bewundern. Die Tonfiguren hätten eine frappierende Ähnlichkeit mit jenen, die noch heute auf Bali angefertigt würden, und das Klima in der Huasteca jetzt im Winter ähnele dem von Martinique im Herbst. Das Essen im Restaurant sei zwar bestenfalls correct. Aber alles in allem sei dies ein reizendes Hotel. Ob er wusste, dass es früher sogar einen kleinen Zoo beherbergt habe? Das Museum sei eine Außenstelle des Archäologischen Instituts von Tamuín und die Ausstellungsstücke Leihgaben des viel größeren Museums Tamuantzán.
Zapata fragte sich, wie er sich diese Namen merken sollte. Sie fingen alle mit derselben Silbe an. Er stellte sich vor, bei einer Ausgrabung im Einsatz zu sein, ertappte sich aber dabei, wie er, anstatt die Grabeinlagen freizupinseln, den Schmetterlingen nachblickte. Die Ärztin unterbrach seine Gedanken.
„Falls Sie noch nicht dort waren, müssen Sie unbedingt den Wasserfall in Tamasopo und vor allem den von Tamul besuchen.“
Sie wandte sich wieder den Exponaten zu.
„Sieh nur, Jean-François, die Verzierung auf diesem Gefäß. Was für ein schöner Schmetterling!“
„Die dürfte eine Nymphalis antiopa darstellen“, belehrte Zapata die Weitgereiste. „Fliegt Ihnen mit etwas Glück auch zu Hause über den Weg. Ein Trauermantel. Können Sie sich vorstellen, dass es in der Huasteca über tausend Arten von Tagfaltern gibt? Bei uns zu Hause sind es knapp über hundert.“
Seine Augen leuchteten. Nun meldete sich Jean–François zu Wort:
„Ah, sieh an, ein Lepidopterologe.“
Er strich sich über den Bart, mit dem er aussah wie ein Gelehrter vom Anfang des vorigen Jahrhunderts. Durch seine kleine runde Brille fixierte er Zapata.
„Wie romantisch. Mich dagegen erfüllen nicht die Geschöpfe der Natur, sondern die Schöpfungen des Menschen mit Bewunderung.“
„Hat das ein französischer Philosoph gesagt?“, riet Zapata.
„Nein, das hat Jean-François Le Boulanger gesagt. Obwohl sicher nicht als erster und einziger.“
„O Jean-François, sei nicht so vermessen!“, ermahnte ihn seine Gattin. „Diese Tiere sind von vollkommener Schönheit. Im Gegensatz zu dir. Ich wundere mich nur, dass so wenige Stämme eine Schmetterlingsgottheit verehrten. Das ist doch viel erhebender, als vor einer gefiederten Schlange auf die Knie zu fallen. Oder vor weiß ich was für einem Ungeheuer.“
„Zu kurzlebig, Martine“, wandte Monsieur Le Boulanger gekränkt ein, „Wo denkst du hin? Es sei denn, Du wolltest schon die erhabenen Raupen anbeten, während ihnen alle fünf Minuten ein Kügelchen aus dem Hintern rollt.“
6
Die Schwefelquelle wurde sein Lieblingsort. Er konnte Stunden im und am Becken verbringen. Er sah den Tieren zu und studierte Pflanzen, die er nur aus Büchern kannte. Seinen obligatorischen Kriminalroman schlug er beim ersten Mal kurz auf und ließ ihn fortan im Zimmer liegen. Das Buch der Natur war spannender als die Bewandtnisse der Kommissare in London, Paris und Reykjavik; seine Geräuschkulisse fesselnder als die Flüche sizilianischer und die Sozialkritik südschwedischer Polizisten. Jedes Mal, wenn er dem Becken entstieg, war es ihm, als habe er eine tiefere Schicht Eis abgestreift, in die ihn der heimatliche Winter gebannt hatte. So hatte er auch nach dem Museumsbesuch nichts Eiligeres zu tun, als sich den gelben Dämpfen folgend hinab in sein Caldarium zu begeben.
Das Becken war leer; aber am anderen Ufer erblickte er auf einer der Liegen aus Beton den bulligen Italiener. Er erinnerte ihn an einen Schauspieler, der es in seinen Filmen mit Dutzenden kleiner Bösewichte zugleich aufnahm. Juan Antonio hatte ihn als Isidoro Di Stéfano vorgestellt, Professor für Komparatistik an der Universität von Bologna. Auf einer Wiese neben dem Paket von Professor lag eine blonde Schönheit, die langen Beine ausgestreckt wie frisch geschnittene Blumenstile. Zapata machte ein paar Züge unter Wasser.
Als er auftauchte, war sie wieder da. Die Stimme. Nein, zwei Stimmen. Diesmal abwechselnd in amerikanischem und in gebrochenem Französisch. Und diesmal verstand Zapata sofort, was es mit ihnen auf sich hatte. Er war gerade daran, anstandshalber weiterzuschwimmen, als er sich darauf besann, dass er diese akustische Warte nicht mit Absicht angesteuert hatte. Das beruhigte sein Gewissen. Er legte sich auf den Rücken und nahm die Hellhörigkeit seiner Position in Kauf. Trotz des Abstands und des Rauschens der Quelle war die Stimme des Italieners fast so deutlich zu vernehmen, als käme sie aus einem Megaphon. Die weibliche Stimme dagegen, mit dem unverwechselbaren Akzent aus Québec, war zart und wurde bisweilen vom Gesang der Vögel übertönt:
„... nicht zum ersten Mal hier. In Taninul, wenn Sie das meinen. Mexiko kenne ich eigentlich ganz gut. Meine Tochter und mein unerträglicher Schwiegersohn wollten schon lange mal ins Land der Azteken. Da habe ich ihnen diese Gegend vorgeschlagen. Weil Mexiko hier noch Mexiko ist. Weil hier noch mit Pesos bezahlt wird und nicht mit den verfluchten Dollars. Aber was glauben Sie? Die drei beginnen sich schon zu langweilen! Ich hätte es wissen müssen. Entzugserscheinungen ohne den beschissenen Informationsterror von zu Hause. Ohne die Hausaltäre und Ikonen der Verblödungsindustrie. Können Sie sich vorstellen, wie sich ein dreijähriges Kind in diesem Paradies langweilt? Ein dreijähriges Kind!“
Er lachte verächtlich.
„Ich selbst könnte hier meinen Lebensabend beschlie- ßen. Das heißt, natürlich nur in Gesellschaft von so charmanten Gästen wie Ihnen. Aber was eigentlich führt Sie ans Ende der zivilisierten Welt?“
„Ich habe nach etwas ganz anderem gesucht. ... ein wenig nervlich angespannt nach einer Scheidungsgeschichte. Montreal kann im Winter so grausam sein. Ich schauspielere fürs Fernsehen, und für eine Folge sind wir nach Kuba geflogen. Dort hat mir ein mexikanischer Bekannter von diesem Hotel ...“
Eine Schar grüner Papageien war kreischend von einem hohen Baum aufgeflogen. Zapata machte weiter den toten Mann.
„... haben Recht, bin fast jeden Tag mit dem Jeep unterwegs. Sehe mir hauptsächlich die Huaxtekendörfer an. Bin mit einer Recherche beschäftigt. Für ein Buch. Aber zum Abendessen bin ich immer zurück. Wir können uns gerne wieder treffen, das würde mich für die vielen Mahlzeiten mit meinem kongenialen Schwiegersohn entschädigen.“
„... “
Zapata hatte den Fokus verloren. Mit leichten Handbewegungen manövrierte er sich wieder in Position.
„Nein, kein Roman. Romane über Mexiko gibt’s schon viel zu viele. Ha, ich wünschte, es wäre nur ein Roman! Sagen wir, ich arbeite an einer Dokumentation.“
Er nahm einen Schluck, selbst das konnte Zapata hören.
„Nicht, dass mich das ausfüllen würde. Morgen wollte ich eigentlich nach Tanchachín und Tambaca fahren. Aber wenn Sie mitkommen, Lucie, zeige ich Ihnen stattdessen Tamazunchale. Dort gibt es das beste Fischrestaurant weit und breit und einen Kaffee, der die ganzen Hochglanzbars bei uns zu Hause alt aussehen lässt.“
Zapata beschloss, dass er genug ausgekundschaftet hatte. Er schwamm weiter in Richtung der beiden und stellte fest, dass sich der ohnehin geringe Abstand zwischen ihnen weiter verringert hatte. Die schöne Kanadierin trug einen rot-weiß gestreiften Bikini. Ihre Brüste konnten sich durchaus mit jenen der Venus auf dem Fresko im Speisesaal messen. Nur dass sie bei ihr wie aufgesetzt wirkten auf die schlanken Linien. Zapata erinnerte sich daran, was der Arzt über die Geschöpfe der Natur und die Schöpfungen des Menschen gesagt hatte. Vermutlich lag hier ein Phänomen vor, das selbst nach den strengen Maßstäben des Monsieur Le Boulanger bewundernswert war.
Er holte einen herrenlosen Plastikbecher vom Beckenrand, tauchte in die Hitze hinab und füllte ihn zur Hälfte mit dem Schlamm. Als kein Dampf mehr von ihm aufstieg, machte sich Zapata daran, auf dem Wasser schwimmende Algen abzuschöpfen, bis der Becher voll war. Jene Algen, die der Gärtner als Medizin und seine Kontrahentin abschätzig als Dreck bezeichnet hatten. Mit diesem Gebräu rieb er seinen Körper ein und maskierte sein Gesicht. So bemalt, legte er sich an den Beckenrand.
Bald darauf bemerkte er, wie ein eleganter Schatten über sein Gesicht huschte. Di Stéfanos Begleitung hatte wohl genug von der Hitze, die sich nun auch an den schattigeren Plätzen breitmachte. Der Literaturwissenschaftler hingegen verharrte ungeachtet seines roten Kopfes auf der Liege, ließ sich seinen dritten oder vierten Tequila bringen und kritzelte rasant auf einem Notizblock herum. Kurze Zeit darauf bekam er erneut Gesellschaft, diesmal von seiner Tochter und ihrer Familie. Der Schlamm auf Zapatas Haut war mittlerweile getrocknet. Er kam sich vor wie Max und Moritz in dem Teigmantel, der sie vor dem Feuer des Ofens beschützte. Er schloss die Augen.
„Schmeiß deinen Calvino in die Mülltonne!“
Di Stéfanos dröhnende Stimme riss ihn jäh aus der Ruhe. „Dorthin, wo er hingehört! Der hat am Ende wirklich jede verdammte Mode mitgemacht. War sich für nichts zu schade! Wenn es schon Calvino sein muss, kauf dir lieber eins seiner frühen Werke. Bevor er sich zum Harry Potter gemacht und am Ende aus lauter Einfallslosigkeit den Roman verarscht hat.“
„Ja, ja, ich weiß. Aus der Zeit, als er noch Kommunist war. Für dich taugen Schriftsteller nur etwas, solange sie bei der Partei sind.“
Bei Di Stéfano saß jetzt nur noch seine Tochter. Sie fing an, die Nationalhymne der Sowjetunion zu intonieren.
„Red keinen verdammten Unsinn, Luisella. Ich habe nie verstanden, wie ausgerechnet meine eigene Tochter diesen hirnverbrannten Dekonstruktivisten in die Hände fallen kann. Die kotzen sich doch mit jedem Satz aus ihren unverschämten Mäulern selbst aufs Hemd. Willst du wissen, was du machen kannst, wenn deine Doktorarbeit über diese Klugscheißer fertig wird? Auf Klopapier kannst du sie drucken lassen! Aber selbst dann wird sie niemandem nützen, weil sie schon von vorne bis hinten beschissen ist.“
Zapata fragte sich, wovon Luisellas Doktorarbeit wohl handelte. Wahrscheinlich hätte er nicht einmal die Fragestellung verstanden. Unschwer zu verstehen war dagegen, dass Isidoro Di Stéfano für die intellektuellen Vorlieben seiner Tochter nicht viel übrig hatte.
„Hör auf so zu reden, Papa. Das ist unter deinem Niveau. Wenn sie fertig ist, hat man mir eine Dozentenstelle in Aussicht gestellt. In Genua, wo Mama wohnt.“
„Mit dir rede ich Klartext. Weil du mir nicht egal bist. Weil ich mir Sorgen mache um dich. Darum!“
Er hatte sich erhoben.
„Lass dich von diesen Denkzwergen verdammt noch mal nicht an der Nase herumführen! Lass dir lieber noch ein Kind machen von deinem Christoph. Oder besser von jemand anderem. Der denkt ja doch nur an seine gottverdammte Karriere. Steuerberater, ha! Geld, Geld, immer nur Geld! Fährt jeden Tag zur Hauptstraße, nur um seine Wirtschaftsnachrichten empfangen zu können. Deprimierend zu sehen, was der Mammon aus Menschen machen kann.“
„Ich will jetzt aber kein zweites Kind. So wie du auch keines wolltest. Und hör auf, so über Christoph zu reden. Und kannst du mir vielleicht erklären, warum gerade du mich nicht an der Uni haben willst? Noch dazu in deinem eigenen Fach? Tut mir Leid für dich, wenn du deinen Job nicht magst. Mir macht die Literaturwissenschaft Spaß.“
Die Gesichtsfarbe ihres Vaters wurde dunkler, seine Stimme noch lauter.
„Weil ich den Laden kenne! All die Profilneurotiker. Die Selbstverliebten. Die Schöngeister, die nur auf den hohen Tasten klimpern. Verbalerotiker, die sich als Avantgarde verstehen und doch nur dem System hinterherlaufen wie die Schafe.“
Sein Kopf wurde immer röter. „Der Andere existiert für die doch gar nicht. Wenn der Mensch kaputt gemacht wird, zucken die nur mit den Achseln. Zeichenfetischisten. Selbstsorge statt Aktivismus. Ich, ich, ich. Das hochheiligste Individuum! Ha! Dass ich nicht lache! Dein Mutterinstinkt sollte genügen, um dich vor diesem Unsinn zu bewahren!“
„Aber ich bin weder Philosophin noch Politologin. Ich will nur Kunst verstehen. Ich will …“
„Überhaupt nichts wirst du so verstehen. Gar nichts! Du wirst nicht einmal begreifen, dass du nichts begriffen hast.“
„Du bist gemein.“
Luisella war den Tränen nahe.