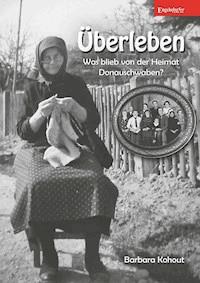Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Best of Edgar Allan Poe
- Sprache: Deutsch
Ein Roman über die Bürden der Kriegsgenerationen, die sie nonverbal an ihre Kinder und Enkelkinder weitergeben. Es sind unbewusste Glaubenssätze, die das Verhalten steuern. Die Kultur des Schweigens, ein Phänomen unserer Zeit, muss beendet werden. Mit seiner Fantasie weitet die Geschichte den Blick auf das unmöglich Mögliche. Sie demaskiert diktatorische Methoden der Unterdrückung. Sie ermutigt den Leser über die Tabus seiner Familiengeschichten zu forschen und zu sprechen. Wenn es gelingt, die traumatischen Erlebnisse, die in den Epigenen gespeichert sind und an die nächsten Generationen weitergegeben werden, aufzudecken, verlieren sie ihre Wirkmächtigkeit. Das ebnet den Weg zur Heilung für geschundene Seelen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchbeschreibung:
Ein Roman über die Bürden der Kriegsgenerationen, die sie nonverbal an ihre Kinder und Enkelkinder weitergeben. Es sind unbewusste Glaubenssätze, die das Verhalten steuern. Die Kultur des Schweigens, ein Phänomen unserer Zeit, muss beendet werden.
Über den Autor:
Barbara Kohout wurde als Kind von 10 Jahren Mitglied bei den Zeugen Jehovas. Sie ist selbst Betroffene eines Kriegstraumas. Nach 60 Jahren hatte sie den Mut, mit Hilfe ihrer Kinder, den Glauben zu hinterfragen. Sie wurde wegen ihrer Zweifel aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und ist seit 2009 damit beschäftigt über fundamentalistische Gemeinschaften aufzuklären und Menschen beim Ausstieg zu beraten. Sie gründete eine Selbsthilfegruppe und den Verein JW Opfer Hilfe, ist medial aktiv und schrieb mehrere Bücher, die verschiedene Aspekte des religiösen Fundamentalismus beleuchten.
Macht ist immer lieblos, doch Liebe ist niemals machtlos.
Sprichwort
Verwundert schaute Fini Oberhäusler an jenem Morgen aus ihrer Haustür. Wotan schlüpfte an ihren Beinen vorbei ins Freie und verschwand bellend zwischen den Obstbäumen. Aufgeregtes Gackern klang aus dem Hühnergehege. Finis Blick schweifte prüfend über ihr Grundstück und den alten Jägerzaun, der es umgab. Er war an vielen Stellen zerfallen und morsch, doch das störte sie nicht. Der Großvater hatte ihn zuletzt repariert. Fini aber hielt nichts von Zäunen.
Suchend wanderten ihre Augen zur Nordseite ihres kleinen Anwesens dem Dorf zu und stoppten am begrenzenden Schuppen. Das Unglück würde von Norden in die Schlucht kommen, doch hier sah sie keine Anzeichen dafür.
Wotan wuselte jetzt unter den dicht hängenden Zweigen des Hollerstrauches mit den hellen, fast tellergroßen Blütendolden. Der üppige Strauch beruhigte Fini. Seit Generationen hatte ihre Familie darauf geachtet, dass er nicht beschnitten wurde, damit er ihre Häusler Kate vor Geistern und Katastrophen beschützte. Da er jedes Jahr wuchs und gedieh, war das ein gutes Omen.
Finis Blick wanderte weiter zur wuchernden Brombeerhecke am Zaun und deren Fruchtstände. Die reifen Beeren wird sie, wie einst ihre Großmutter, zur Herstellung von Gelees und heilenden Säften verwenden. Sie wird genug Beeren hängen lassen, so dass auch den Vögeln ein Festmahl beschert würde.
Seit dem Tod ihres Vaters vor Jahren hatte sich für sie nicht viel verändert. Fini hauste allein mit ihren Tieren abseits des Dorfes. Sie war mit sich im Reinen und hatte nicht das Bedürfnis etwas daran zu ändern. Aus ihrem alten Wissen und den Zeichen der Natur zog sie unbeirrt ihre Schlüsse und ließ sich nicht von der Meinung der Dörfler beirren.
Ihre Kate stand ein Stück außerhalb des kleinen Dorfes. Finis Vorfahren hatten das Fachwerkhaus in der Tradition der Häusler gebaut und sie war die letzte der Familie, die es bewohnte. Kleinbauern waren es gewesen, manche hatten als Schuster und Schneider gearbeitet, ein Urgroßvater war Schulmeister. Sie hatten ein wenig Land. Genug, um ein paar Hühner und ein Schwein zu halten und im Garten Gemüse und Kräuter anzubauen. Großmutter war Hebamme und Kräuterkundige. Sie hatte den größten Teil des Grundstückes für ihre Heilkräuter reserviert. Im Dorf wurde die alte Kate nur ‚das Hexenhaus‘ genannt. Jeder kannte die Oberhäusler Hebamme, denn es gab in der Umgebung keine Familie, in der nicht mindestens ein Kind von ihr beim Start ins Leben begleitet worden war. Vielen hatte sie mit ihrem Heilwissen geholfen und genau darum fürchteten sich manche vor ihr. Landläufig nannte man sie die ‚Kräuterhexe‘. Oft erzählte sie schaurige Geschichten von Geistern und fremden Göttern, aus der Zeit als die Kelten in der Gegend lebten. Die Ängstlichen bekreuzigten sich dann abergläubisch.
Fini war eine wissbegierige Schülerin an der Seite ihrer Großmutter. Das Schicksal schlug zu, als sie drei Jahre alt war. Ihre Mutter starb bei der Geburt ihres Bruders. Es wurde nie viel gesprochen in ihrer Familie. Schweigen und stille Vorwürfe prägten ihre Tage. Einmal hörte Fini einen heftigen Streit zwischen ihrer Großmutter und ihrem Vater. „Ich habe dich doch gewarnt!“, hatte ihre Großmutter geschrien. „Sie hätte kein Kind mehr bekommen dürfen!“ Diese Warnung hatte die erfahrene Hebamme und besorgte Mutter zugleich gegeben. Die Eltern hörten nicht darauf. Das kostete Mutter und Kind das Leben. Finis ohnehin wortkarger Vater redete nach dem Streit noch weniger. War die Sprachlosigkeit ein Zeichen dafür, dass er sich schuldig fühlte? Fini war nicht in der Lage darauf eine Antwort zu geben. So herrschte fortan eisernes Schweigen zwischen den beiden. Vater mied das Haus und ließ seine Tochter in der Obhut der Großmutter. Sie kümmerte sich aufopfernd und nahm ihre Enkelin unter ihre Fittiche. Von ihrem Bruder, dem Sternenkind erzählte sie, den die Mutter in den Himmel begleiten musste und sie berichtete ihr, dass sie von den Sternen aus auf sie schaue. Sie erzählte ihr die alten Sagen und Überlieferungen und unterwies sie im Wissen um die Heilkraft der Kräuter.
Fini hatte ihr ganzes Leben im Hexenhaus verbracht. In ihrer Zeit als Köchin in dem nahen Gasthof, kamen die Gäste von weit her, um ihren Semmelschmarren zu genießen. Ihr Wissen über die Natur und die Sagen und Mythen, die ihr ihre Großmutter beigebracht hatte, teilte sie redselig mit. Es kümmerte sie nicht, dass darum über sie gelacht wurde. Ihr ‚Federvieh‘, wie die Leute sagten, und Wotan, dessen Stammbaum mehr als nur Dackel und Foxterrier aufwies, waren ihr Gesellschaft genug. Fini ergriff den Futtereimer fester. Ihr stattlicher Hahn hatte sie lautstark an ihre Morgenpflicht erinnert. Barfuß stand sie in ihren Filzpantoffeln auf den Stufen zum Hof. Unter dem alten Trachtenjanker reichte das lange, zerknitterte Nachthemd bis zu den dünnen Waden. Sie schlurfte in Richtung Hühnerstall und führte Selbstgespräche: „Schwören könnt‘ ich, dass heute die Schonjahre um wären! Ich hatte das Omen doch zum Ende der Raunächte erkannt, als dem Bäckermeister Huber das Weihwasserfassl zerbrochen war! Er war so ungeschickt drang‘stoßen, dass es von der Wand fiel und zerbrach. Das hatte Unglück zu bedeuten. Ohne das Weihwasser, ließen sich die bösen Geister von den Buttenmandln nicht vertreiben. Für das neue Jahr ein schlechtes Vorzeichen“. Fini hatte eins und eins zusammengezählt: Das Omen kündete ausgerechnet das Jahr an, in dem die Froschgöttin Hekit, die Schutzpatronin der Gewässer, wieder zu dem gefällten Lindenstamm am Eingang zur Mühlbachschlucht kommen würde. Prüfend schaute sie den Bach entlang in seine Richtung. Die Großmutter hatte ihr oft erzählt, dass die Kelten unter den ausladenden Ästen des uralten Lindenbaumes ihren Göttern huldigten. Bei Rechtsstreitigkeiten tagte dort die Dorfgemeinde, um Gericht zu halten. Aus dieser Zeit sind die Sagen und Geschichten von dem Lindenstamm und der Wahrheitsmühle oberhalb der Schlucht überliefert.
Es heißt, dass man die Entscheidung dem Orakel in der Wahrheitsmühle überließ, wenn ein Schuldiger nicht eindeutig feststand. Der Hohe Rat brachte die beteiligten Parteien dann zur alten Mühle hinauf. Es gibt sie noch. Sie ist ein beliebtes Ausflugslokal. Es wird die Geschichte von einem untreuen Ehemann erzählt, der seine Frau des Ehebruchs beschuldigte. Ihr drohte dafür die Todesstrafe. Sein teuflischer Plan war es, sich den Weg zu ebnen, um seine Geliebte zu heiraten. Seine Frau beteuerte indes ihre Unschuld. Es stand Aussage gegen Aussage. Darum wurden beide dem Urteil der Geister überantwortet. Der Rat der Weisen bildete in der Mühle einen Kreis und stellte die Kontrahenten in ihre Mitte. Sie warfen nach dem Zeremoniell die Orakelrunen. Das Ergebnis war zweifelsfrei: Der Schuldige war der Ehemann. Wütend verließ er den Orakelplatz. Er sprang so ungestüm, zornig und wild am Ufer des Mühlbaches herum, dass er ausrutschte, in den reißenden Bach fiel und mit dem Wasser über das riesige Mühlrad gerissen wurde. Er war auf der Stelle tot.
Anlässlich der gewaltsamen Christianisierung der Heiden zerstörten religiöse Eiferer die Linde. Der Stamm blieb am Eingang zur Mühlbachschlucht liegen. Die Kelten ließen sich zwar taufen und Katholiken nennen, doch in ihrem Herzen verehrten sie ihre Götter weiter. Sie waren überzeugt, dass diese sich für den Frevel am heiligen Ort rächen würden. Eine Göttin, die Hekit, soll geschworen haben, ihn jeweils nach siebenmal sieben Perioden Schonzeit, mit Unglück im Gepäck, heimzusuchen. Gelegentlich vermochte sie aber auch gnädig gestimmt zu sein. Finis wissende Augen suchten nach den Anzeichen. Die Schonzeit war heute zu Ende, das stand für sie fest. Heute war Johannis. Doch nichts deutete darauf hin, dass Hekit anwesend war. Der Mühlbach floss friedlich aus der Schlucht und mäanderte durch das Tal an ihrem Grundstück vorbei. In dem kleinen Weiher, den die häufigen Hochwasser an ihrer Flurgrenze zurückgelassen hatten, tauchten die Enten eifrig nach Würmern oder schnappten sich Kaulquappen vor dem schützenden Schilf. Im Wasser spiegelten sich die knorrigen Apfelbäume unter einem blauen Himmel. Sie hatten im Frühling üppig geblüht. Das versprach eine reiche Ernte, wenn nicht diese Prophezeiung wäre. Es würde ein Unwetter kommen, das war ganz sicher!
Auf dem Weg zurück ins Haus schaute Fini nach ihrem Raben. Sie lockte ihn mit einem glucksenden ‚komm, komm‘ und prompt flog er von einem uralten Zwetschgenbaum zu ihr herüber und ließ sich auf ihrer Schulter nieder. „Was sagst du zu dem Wetter, Aaron? Heute wäre doch etwas fällig.“ Aaron gab einen Laut von sich, den sie als Zustimmung zu deuten schien, denn sie nickte zufrieden und sagte Richtung Schulter: „Dann habe ich mich nicht getäuscht. Es wird noch kommen. Wir werden später nochmal nach den Pflanzen sehen.“ Zusammen mit ihrem Raben wackelte sie wieder zurück ins Haus.
Sie schenkte den Autos, die seit dem Ausbau der Straße vermehrt Tagesausflügler und Wanderer zur Schlucht brachten, keine Beachtung. Zur Wahrheitsmühle gelangte man entweder durch die Mühlbachschlucht, vorbei am Stamm der Jahrhundertlinde oder über die Umgehungsstraße, die von den eiligen Ausflüglern und Touristen benützt wird. Fini bemerkte den kleinen grünen Wagen, der an ihrem Haus vorbei zum Gasthaus gelenkt wurde, jedenfalls nicht.
Der Ort der Entscheidung
Die Fahrerin des Kleinwagens hatte keinen Blick für die liebliche Landschaft, die links und rechts der Straße zu sehen war. Sie bemerkte das Hexenhaus am Ortsausgang nicht und ließ sich nicht von dem überwältigenden Panorama der Alpen vor ihr beeindrucken. Sie bog zum Gasthof zum Mühlbach ein.
An der Einfahrt zu dem großen Parkplatz stoppte sie. Seinen Wagen entdeckte sie zwischen den wenigen, geparkten Fahrzeugen nicht. Unschlüssig spähte sie nach einem geeigneten Standort. Sie sah die Frau auf der Bank vor dem Gasthaus, die sie aufmerksam beobachtete. Julia presste ihre rechte Hand auf die linke Brust. In der Erinnerung an ihren ersten Aufenthalt schlug ihr das Herz bis zum Hals. Sie kannte Frau Bachmeier Senior von damals. Um ihren fragenden Blicken möglichst weit zu entfliehen, wählte sie den Platz im hintersten Winkel.
Kopfschüttelnd verfolgte die Seniorchefin des Gasthofes, wie der resedagrüne Fiat 500 umständlich im leeren Parkplatz rangierte. Dem Kennzeichen nach kam das Fahrzeug aus Kassel. Das verstehe einer! Die Fahrerin musste heute schon früh gestartet sein. Es war erst halb acht morgens. Im Gasthof war es still. Es ließ sich noch eine Pause auf der Hausbank genießen und Besinnung finden. Mit ihrem Bernhardiner Benno friedlich zu ihren Füßen, lauschte sie dem klaren Tirilieren der Lerchen. Die Junisonne und die Ruhe der Vorsaison waren wohltuend. Sie dankte ihrem Herrgott für seine Schöpfung und die guten Tage, die ihr geschenkt waren. Dieser Wagen bedeutete das Ende ihrer Ruhe. Gespannt wartete die Seniorchefin darauf, dass ihr neuer Gast aussteigen würde.
Doch die Fahrerin stieg nicht aus. Sie schien reglos hinter dem Steuer zu sitzen. Man sah einen Ellenbogen gegen das Autofenster gestützt und eine Hand, die eine Strähne langer brünetter Haare um die Finger zwirbelte. Was Frau Bachmeier von ihrem Posten aus nicht sah, war, wie die Frau im Handschuhfach nach etwas kramte und eine zerknitterte und zerlesenen Zeitschrift zu Tage beförderte. Es war ein Wachtturm. Mit zittrigen Fingern blätterte sie zu einer Stelle, die sie dick rot markiert hatte. Eine Überschrift prangte in großen Lettern oben auf der Seite:
HALTE TREU UND LOYAL ZU JEHOVA.
Sie las mit leiser Stimme, in dem Artikel, als wolle sie ihn auswendig lernen:
Es kommt vor, dass Personen eine schwere Sünde begehen und die Versammlung gezwungen ist, sie mit Strenge zurechtzuweisen, damit sie im Glauben gesund seien. Einigen muss sogar die Gemeinschaft entzogen werden. Denen, die sich durch diese Erziehungsmaßnahme haben korrigieren lassen, konnte so geholfen werden, wieder ein gutes Verhältnis zu Jehova aufzubauen.
Hier stoppte sie mit einem tiefen Seufzer. Genau das beschrieb ihre Situation. Sie las weiter:
Was aber, wenn wir mit jemand, der ausgeschlossen werden musste, befreundet sind? Dann steht jetzt unsere Treue auf dem Prüfstand, und zwar nicht gegenüber dieser Person, sondern gegen über unserem Gott. Jehova schaut nun darauf, ob wir uns an sein Gebot halten, keinen Kontakt mehr mit jemandem zu haben, der ausgeschlossen ist.
Schwarz auf weiß konnte sie hier lesen, was Jehova von ihr forderte. So schmerzlich diese Erkenntnis auch war. Sie musste mit ihm Schluss machen. Er war ausgeschlossen und sie hatte eben erst die demütigende Tortur hinter sich gebracht, nach einem Gemeinschaftsentzug wieder aufgenommen zu werden. Das wollte und konnte sie nicht noch einmal riskieren. Die Minuten verstrichen, in denen die Spannung bei Frau Bachmeier stieg. Sie wurde zunehmend beunruhigt auf ihrer Hausbank. Warum rührte sich im Wagen nichts? Hatte die Fremde ein Problem?
Ja, das hatte sie. Doch davon konnte ihre Beobachterin nichts ahnen. Das Problem der Frau auf dem Parkplatz war die Liebe zu Josua. Sie hieß Julia Exter. Sie war eine Zeugin Jehovas und hatte gegen zwei Gebote verstoßen: Erstens dürfte sie keinen Sex vor der Ehe haben und zweitens keinen Kontakt mit jemanden, der aus der Gemeinde ausgeschlossen worden war. Sie litt unter schweren Gewissensbissen, weil sie ihre Sünden bisher verheimlicht hatte. Es führte offensichtlich kein Weg daran vorbei, sie war gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Mit der Zeitschrift in den Händen hoffte sie inständig, dass sie die Kraft aufbringen konnte, sich von Josua, mit dem sie verabredet war und auf dessen Ankunft sie wartete, zu trennen.
Frau Bachmeier überlegte, ob sie ihre Hilfe anbieten sollte. Unentschlossen wartete sie ab. Da fuhr ein schwarzer Volvo mit dem Kennzeichen WOR auf den Parkplatz. Frau Bachmeier kannte viele Autokennzeichen. Sie verrieten ihr, woher ihre Gäste kamen. WOR stand für das schöne Wolfratshausen am Starnberger See. Das Rätsel löste sich langsam auf. Ein sportlicher Mittvierziger stieg aus und da öffnete die Fiat-Fahrerin zögernd die Autotür. Sie wand sich aus dem Fahrzeug und blieb verlegen stehen. Er ging mit ausgebreiteten Armen auf sie zu. Sie schmiegte sich an ihn und ließ die Umarmung geschehen. Trotz der deutlich zu vielen Kilos wirkte sie klein und zerbrechlich in ihrem bunten weiten Rock und dem roten T-Shirt.
„Komm, lass uns reingehen. Ich habe uns ein Zimmer reserviert“, klang es zu Frau Bachmeier herüber. Der Mann aus Wolfratshausen übernahm die Führung. Verwundert beobachtete Frau Bachmeier, wie die Dame aus Kassel ihm zaghaft die Führung überließ. Also wie ein glückliches Paar sehen die beiden nicht aus, dachte sie bei sich. Sie sah zu, wie die Frau umständlich ihre zu groß geratene Handtasche und den kleinen Koffer packte und dem Mann mit gesenktem Kopf und hängenden Schultern scheinbar demütig folgte. So würde sie auf dem Weg zum Eingang kaum bemerken, welch Blütenpracht die Balkonkästen trugen. Rote Geranien wechselten sich mit weißen und blauen Petunien ab und tauchten das reich geschnitzte Holz der raumgreifenden Balkone rundum in Farbe. Das stattliche mehrstöckige Haus mit seinem typischen tiefen Spitzdach hatte schon zwei Jahrhunderte allen Unbilden der Zeiten getrotzt, doch es strahlte eine gemütliche Zuversicht aus. Das letzte Mal waren sie vor zwei Jahren im Herbst dagewesen und Julia konnte sich damals an den Farben und der Freundlichkeit der Gegend nicht sattsehen.
Josua und Julia grüßten die Seniorchefin, die sich erhoben hatte und ihnen die Tür aufhielt. An der Rezeption wurden sie herzlich begrüßt. „Willkommen die Herrschaften. Ihr Zimmer ist vorbereitet. Würden Sie bitte das Meldeformular ausfüllen“. Das übernahm Josua. Frau Bachmeier junior überreichte die Schlüssel. Dabei fiel ihr Julias Geburtsdatum auf. „Oh, ich sehe, Sie haben heute Geburtstag. Ich gratuliere herzlich“. „Ich feiere keinen Geburtstag, aber trotzdem dankeschön“, wehrte Julia die Gratulation ab. Mit einem „na dann einen schönen Aufenthalt“, überspielte Marlies Bachmeier ihre Überraschung und verdrängte den Impuls, nach dem Warum zu fragen.
Das Zimmer lag im 1. Stock. Josua ging voraus, Julia folgte ihm zögerlich. Zaghaft verweilte sie an der Tür und schaute sich um. Sie bewunderte die rustikalen Eichenbalken an der Decke, die dunkle Eichenholz-Täfelung der Wände. In der linken Ecke des Raumes hing ein Kruzifix. Darunter das Bild der Jungfrau mit dem Herz Jesu und ein Büschel getrockneter Edelweiß. Erleichtert bemerkte Julia, dass die massiven Betten getrennt standen. Die zwei passenden Nachtschränkchen aus gedrechseltem Eichenholz waren zwischen die Betten gestellt und bildeten einen sicheren Abstand.
Josua kam auf sie zu und schreckte sie aus ihren Gedanken. Er nahm ihr Handtasche und Koffer ab und stellte beides auf die Bank unter der Garderobe. Glücklich strahlend fasste er sie an beiden Händen und zog sie an sich. Seine weiche Stimme sagte: „Komm, hab keine Angst. Deine Hände sind ja ganz kalt. Lass uns die Zeit genießen. So wie an dem Tag, als wir uns hier zum ersten Mal geliebt haben“.
Er schloss sie wieder in seine Arme. Julia genoss seine Wärme, den herben Duft seines Parfums. Alle ihre Sinne verlangten nach ihm. Doch die Erinnerung an jene Liebesnacht lag ihr schwer wie Blei auf der Seele. Es war eine Sünde. Es waren wenige Stunden des glückseligen Vergessens. Wie dreist es war, das wiederholen zu wollen! Sie dürften nicht hier sein! Die ganze Belehrung und was Jehova, erwartet hatte sie doch gerade erst gelesen! Kein Hurer wird ins Paradies kommen. Mein Lohn ist die ewige Vernichtung im Feuersee. Abrupt befreite sie sich aus seiner Umarmung und war mit ein paar Schritten am Fenster. Sie öffnete es geistesabwesend und atmete die frische Bergluft in tiefen Zügen ein. In ihrem Kopf drehte es sich. Sie rang nach Worten, fand aber keine. Und so breitete sich Schweigen aus. Sie hörte, wie Josua den Inhalt seiner Reisetasche in den Schrank räumte. Etwas zu laut. Er war frustriert.
„Lass uns die Betten zusammenschieben“, hörte sie Josua vorschlagen. Panik stieg in ihr auf. Instinktiv war ihr klar, was sie zu tun hatte. Fliehen, sich aus der Gefahrenzone begeben. Das hatte sie gelernt. Der Kluge sieht das Unglück und bringt sich in Sicherheit, steht in der Bibel. Joseph sollte doch mein Vorbild sein. Als Potiphar, die Frau des Pharao, ihn verführen wollte, floh er. Pharao warf ihn in den Kerker. Jehova belohnte ihn. „Ich weiß nicht“, brachte sie hervor, „Ich habe Hunger. Machen wir es am Nachmittag?“
Sie musste Zeit gewinnen. Auf der Fahrt hierher hatte sie Jehova angefleht, ihr Kraft zu geben, Josua um die Trennung zu bitten. Sie hatte die Sätze ein dutzendmal geübt, mit denen sie ihm das schonend beibringen wollte. Jetzt aber beruhigte sich ihr Herzklopfen nicht. Sie hatte ihn so vermisst! Doch ebenso drängend und unmissverständlich war die Mahnung in ihrem Kopf: Mach Schluss, sonst wirst du alles verlieren! Jehova ist deinetwegen traurig! Er wird dich verwerfen. Was wenn Satan Josua wie einen Engel des Lichtes benützt, um dich zu Fall zu bringen? Dann landest du mit ihm und seinen Anhängern in Harmagedon im Feuersee.
Da war eine andere, leise Stimme in ihr. Julia versuchte, sie deutlicher zu vernehmen. Aber was ist mit mir? Ich darf Josua nicht verlieren. Ich liebe ihn. Ist mein Herz wirklich so verräterisch, dass ich ihm nicht vertrauen kann? Dass Josua vor ihr stand und mit ihr sprach, sah und hörte sie nur wie durch eine Schicht aus Watte. Sie kämpfte mit ihrem Gewissen, doch das sah Josua nicht, was seltsam war. Er hätte wissen müssen, welche Kämpfe sich in ihr abspielten, aber er sah nur sich und sein drängendes Verlangen.
Ein Gedankenkarussell in Endlosschleife drehte sich in Julias Kopf und es ließ sich nicht stoppen. Sie rang mit ihrem grausamen Gott. „Dein Sohn sagt: ‚Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig‘. Ich habe für dich meine Mutter verlassen. Wie viele Beweise brauchst Du noch“?
Sie folgte Josua, der darum bemüht war, sich seine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen, in das Restaurant. Er bestellte sich ein üppiges Frühstück. Die gemütliche Gaststube war der ideale Ort, um zu einer besseren Laune zu finden. Vielleicht, so hoffte er, würde das die eisige Stimmung zwischen Julia und ihm, vertreiben. Julia begnügte sich mit Kaffee, frischen Semmeln und der Marmelade aus eigener Herstellung des Hauses. Tapfer versicherte sie, es schmecke ihr gut, doch sie hatte keinen Appetit. Sie schaffte nicht einmal die Hälfte der Portion und Josua verlor die Beherrschung.
„Was ist los mit Dir?“ Herrschte er sie barsch an. „Warum freust du dich nicht? Es ist so ein schöner Tag.“ Obwohl ihr eine zornige Erwiderung auf der Zunge lag, siegte die Konditionierung zur Selbstbeherrschung. „Josua, wir müssen reden. Ich habe nicht die Kraft, diese heimliche Beziehung zu dir weiter fortzuführen. Ich schaffe es nicht, in der Versammlung zu sitzen und mir die Vorträge über die loyale Liebe zu Jehova und den Brüdern anzuhören und genau zu wissen, dass ich sie betrüge. Ich kann nicht immer lächeln und beteuern, dass es mir gut geht, wenn ich gefragt werde. In Wirklichkeit ist mir zum Heulen elend.“ In Julias Stimme lag der verzweifelte Seelenschmerz, der sie quälte. Das war zu viel für Josua. Das hatte er hinter sich gelassen. Diese ganze unehrliche Hyperreligiosität brachte ihn an den Rand des Wahnsinns. Er sah Julia entgeistert an.
„Das ist jetzt nicht dein Ernst! Dafür bin ich nicht hierhergekommen“. Josua schob den Stuhl krachend nach hinten und stand auf. „Bleib doch, bitte, Josua“, war alles, was Julia hervorbrachte. Doch er stürmte aus der Gaststube, die Treppe hinauf ins Zimmer. Hektisch packte er seinen Rucksack. Verzweifelt war ihm Julia gefolgt, doch seine wütende Reaktion zu beobachten war zu viel für sie. Zornig schrie sie ihn an: „Ich bin nun mal kein Klavier auf dem du nach Lust und Laune spielen kannst“. Wortlos rannte er an Julia vorbei und stürmte die Treppe hinab. Sie rief ihm nach: „Ja, ja, anstatt Verantwortung zu übernehmen, hörst du mir nie zu und rennst weg. Du haust immer ab, wenn ich mit dir über meine Probleme reden will“. Josua rannte weiter und verließ den Gasthof. Julia warf sich auf das Bett und schluchzte verzweifelt.
Da war ein Weg durch die Schlucht zur Wahrheitsmühle, er erinnerte sich, dass er letztes Mal mit Julia dort gewandert war. Er brauchte dringend einen kühlen Kopf und so stapfte er los, den Rucksack auf dem Rücken. Unweit des Gasthofes fing er laut an zu fluchen und zu reden. Er war außer sich und konnte gar nicht damit aufhören.
Die ersten Unglücksboten
Zu dieser Zeit stand Fini in ihrem Kräutergarten, um die Zutaten für ihren Salat zu sammeln. Zwischen allen Kräutern, für die es eine medizinische Verwendung gab, pflückte sie junge Brennnesselspitzen, Löwenzahn und würzige Brunnenkresse vom Teichrand sowie etwas Borretsch. Doch wie sie in den strahlend blauen Himmel nach Norden schaute, kräuselte sie die Stirn. Die drei Wolken, die von der Sonne angestrahlt so weiß und harmlos heran schwebten, kündigten den Wetterumschwung an. Bei allem, was Fini für den Tag erwartete, beschloss sie, wenigstens die zarten Arnikablüten für ihren Tee zu retten. Die würden ein Unwetter nicht überstehen. Auch die Hollerblüten wären nach einem heftigen Regenguss nicht mehr zu gebrauchen. Gleich nach dem Mittagessen würde sie diese ernten. Ungezügeltes Schimpfen klang zu ihr herüber. Sie richtete sich auf und sah einen Mann mit Rucksack, der wild gestikulierend Selbstgespräche führte, auf dem Weg zur Mühlbachschlucht. Fini schüttelte den Kopf über den seltsamen Fremden. Immerhin war sie sich, nach einem weiteren Blick in Richtung der Wolken, ganz sicher, endlich das Zeichen für Hekits Ankunft gefunden zu haben.
Die Begegnung
Bäckermeister Anton Huber gönnte sich nach getaner Arbeit, das Vergnügen, in seinem Stammlokal, der Wahrheitsmühle, ein Weißbier zu trinken. Der alte Herr liebte den Zauber der Natur, geschaffen von einem mäandernden Bächlein im Wiesengrund. Jahrzehnte stand er täglich ab drei Uhr morgens in seiner Backstube. Den Betrieb hatte er seinen Söhnen Jakob und Joseph übergeben, die inzwischen seinen Fußstapfen folgten. Er half ihnen noch dabei, den Teig für das vorbestellte Brot, die Semmeln, Brezeln, Rosinenzöpfe und Plunderhörnchen vorzubereiten. Zu Weihnachten kamen Christstollen und Zimtsterne dazu und in der Faschingszeit die Krapfen. Seine Glöcklerkrapfen, die für die Buttenmandl am 5. Januar, der letzten der Raunächte, bestimmt waren, sind legendär. In dem kleinen Laden bediente Afra, seine Frau und bot den Feriengästen Frühstück mit frischen Backwaren aus eigener Herstellung an. Für den Seniorchef war am späten Vormittag Feierabend. Er setzte seinen verbeulten, grünen Trachten-Hut, den ein stattlicher Gamsbart zierte, auf, nahm seinen Gehstock, rief seinen Dackel Oskar und stapfte forschen Schrittes los. Seine Lieblingstour führte ihn entlang des Mühlbaches durch die Mühlbachschlucht aufwärts. Zur Rechten begleitete ihn das plätschernde Wasser und zur Linken erstreckten sich die weiten Wiesen der Bauern. So flankiert atmet Anton regelmäßig mit der klaren Bergluft die pure Lebensfreude in seine Lungen. Der Bach gluckert leise, gesäumt von üppigen Weiden, Weißdornhecken, Schilfteppichen in denen Libellen tanzten, Bachstelzen, Wasseramseln und Eisvögel geschäftig nach Nahrung für ihre Brut suchten. Anton kannte und liebte die ungezählten Tier- und Pflanzen-Schönheiten. Sie zu sehen, veranlasste ihn täglich, seinem Schöpfer für diese Gaben zu danken. Anton ließ die Magie auf sich wirken, die von den Keltensagen in Verbindung mit diesem Ort beschrieben wird.
Die heitere Stimmung verändert sich abrupt, wenn man neben dem mächtigen Lindenstamm, wie durch ein imaginäres Tor in die Klamm eintritt. Der Eingang zur Mühlbachschlucht ist Ehrfurcht gebietend. Links und rechts des Bachlaufes türmen sich schroffe, mit dichtem Moos bewachsene Gesteine in faszinierender Formation. Der schmale Fahrweg schmiegt sich eng an die Felsen. Rechts davon hat das Wasser über Jahrmillionen die Schlucht in das Gestein gegraben. Toni wählte lieber den Aufstieg an der Seite des Baches. Ein Trampelpfad schlängelt sich nach oben. Das Getöse der herabstürzenden Wasserkaskaden ist ohrenbetäubend und steht im Kontrast zu der Stille des Tales, das sich davor erstreckt. Der Bach schäumt gurgelnd über große Gesteinsbrocken. An die steilen Felswände, die nur wenige Sonnenstrahlen bis zum Grund des Hohlweges durchblitzen lassen, krallen sich Krüppelkiefer mit ausladendem Wurzelwerk.
Bei seiner gewohnten Rast auf dem Lindenstamm, am Eingang zur Klamm, beobachtete Toni an jenem Tag einen Fremden, der wild gestikulierend den Bach entlang stürmte. Er führte erkennbar Selbstgespräche. Hin und wieder ballte er die Fäuste. Dann kickte er einen nicht vorhandenen Gegenstand mit heftigen Fußtritten von sich.
„Grüß Gott“, sprach ihn Toni an. „Wohin des Weges so eilig. Sie verpassen ja die schönsten Momente des Tages. Hören Sie doch, wie die Vögel extra für Sie unbekümmert zwitschern. Der helle Klang des Buchfinks übertönt sie alle. Ich erkenne den Zilpzalp trotzdem. Schauen sie nur die Spatzen, ist ihr Gezeter nicht lustig? Die melodischen Stimmen der Amseln finde ich heute extrem schön. Ist die Sonne nicht besonders seidig und wohltuend für das Gemüt“?
Verblüfft blieb Josua, der sich noch immer nicht beruhigt hatte, bei dem Alten stehen. „Sie haben ja so Recht“. Er setzte sich mit einem tiefen Seufzer zu ihm, nahm eine Flasche Wasser aus seinem Rucksack und trank einen kräftigen Schluck. „Ich habe kein Ziel. Ich will mir nur den Kopf freistrampeln. Aber eine kleine Rast ist eine gute Idee“, gab er dem freundlichen Toni Bescheid.
„Na dann wünsche ich ihnen noch einen klärenden Tag. Ich will dann weiter“, verabschiedete sich Toni.
Julia hatte sich in den Schlaf geweint. Sie wachte kurz nach Mittag auf und stellte bekümmert fest, dass Josua nicht zurück war. Vielleicht ist er ja zur Wahrheitsmühle gewandert, überlegte sie. Vor zwei Jahren feierten sie die Halbzeit ihres gemeinsamen Kuraufenthaltes, mit einem Wochenendausflug. Sie buchten hier im Gasthof zum Mühlbach zwei Einzelzimmer. Sie wanderten durch die Klamm zu dem Ausflugslokal. Bei einem frischen Weißbier erzählten sie sich gegenseitig, zum wiederholten Male, ihre Lebensgeschichten. Josua litt unter den emotionalen Verletzungen durch einen grässlichen Rosenkrieg bei seiner Scheidung. Seine Ex-Frau hatte es geschafft, ihn in der Gemeinde wie ein gewissenloses Monster aussehen zu lassen. Um die Demütigungen nicht mehr weiter zu ertragen, erklärte er seinen Austritt. Das kam in der Gemeinde nicht gut an. Er wurde wie einer betrachtet, der geistig tot ist und dem man nicht einmal einen Gruß entbieten darf. Darum stand er mit seinem Kummer und der Überzeugung, in Kürze zu sterben, alleine da. Er hatte keinen Zweifel daran, dass die Zeugen Jehovas die Wahrheit lehrten und das Ende nahe sei. Nach deren Glauben überleben nur die Mitglieder und so sah er für sich selbst nur den Tod voraus. Er versuchte, sich mit Alkohol zu betäuben, mit der Folge, dass er in seinem Beruf versagte. Nach einem Nervenzusammenbruch kam er in die Psychiatrie, gefolgt von dem Aufenthalt in der Kur.
Julia sprach über ihre Affäre mit dem Arbeitskollegen. Josua verurteilte sie nicht dafür. Er war verständnisvoll und mitfühlend. Er verstand, dass sie in einer seelischen Höllenqual steckte, weil sie nach dem Gemeinschaftsentzug, durch das strikte Kontaktverbot, vollständig isoliert von ihren Freunden war. Die Erinnerung an jenen romantischen Tag trieb Julia wieder Tränen in die Augen. Kurz entschlossen zog sie ihren Jogginganzug und die Sneakers an. Beides ein Andenken an ihre Kur. Sie kam sich damals so armselig vor im Vergleich zu den anderen Kurgästen. Bei ihrem Sinn für das Ästhetische, kostete es viel Überwindung, der Forderung nach Demut und Bescheidenheit, den Merkmalen der neuen Persönlichkeit, nachzukommen. Mit ihrem Teilzeitjob war die Auswahl an Kleidung für sie nur in der Abteilung preiswerte Sonder-Angebote bezahlbar. Ihr schlichter blauer Anzug mit den weißen Seitenstreifen, wäre selbst in einem Flüchtlingslager nicht der Hit gewesen. Die zwanzig Euro teuren Schuhe hatten null Marken-Status-Symbole. Doch wie steht es in der Heiligen Schrift? Sei mit den vorhandenen Mitteln zufrieden. Wie macht man das nur, wenn man so oft von etwas Bildhübschem träumt? Mit Mühe stoppte Julia ihre frevelhaften Gedanken, die ihrem Gott vorwarfen, dass er kleinlich ist. Ihm gehören alle Schätze des Universums und von ihr verlangte er Enthaltsamkeit und Verzicht, grollte sie. Eilig schnappte sie ihre Handtasche und hetzte zu ihrem Wagen. Sie war überzeugt, Josua in der Wahrheitsmühle zu finden. Sie stieg in ihren betagten Cinquecento, und fuhr über die Umgehungsstraße zu dem Lokal.
Im großen Biergarten sah sie viele Gäste. Doch Josua entdeckte sie nicht. Er wird sicher noch kommen, redete sie sich ein. Ich warte. Sie suchte sich einen Platz, von dem aus sie den Eingang im Auge behielt und bestellte sich eine Radlermaß. In gespannter Erwartung, die das heftige Drehen ihrer Haarsträhne verriet, ließ sie das Eingangstor nicht aus den Augen.
Die Herren am Nebentisch nervten sie. Sie spielten Karten und riefen pausenlos rätselhafte Worte wie: I Dad, I Dad a, Gras, Schelln Ober, Contra, schwarz, Schneider, Trumpf. Mit Kraft schmissen sie ihre Karten auf den Tisch. Dazwischen erzählten sie lautstark irgendwelche Geschichten, über die sie schallend lachten.
Ohne Absicht hörte Julia den Mann, mit dem moosgrünen Hut mit Gamsbart, berichten: „Heut spinnt die Oberhäusler Fini wiederamal extrem“, schnappte sie seinen Satz auf. „Wiea kimmst denn da drauf“, fragte einer der Kartenspieler. „Sie war heut scho‘ in aller Fruah bei meiner Alten im Lad‘n. Da hads so spinnerte Sachen gsagt, dass ihr Rabenviech ihr an Unglück prophezeit had. Heut is Johannitag. Aber es san a 49 Periodn umma. Des ist der Tag, wo der Keltengott Taranis – ihr wisst scho, der von der Linde am Eingang vo der Mühlbachschlucht, sich wieder an selbigem Frevel rächt. Die Kelt‘n hätt’n a no andere Gottheit’n verehrt und oaner vo dene kimmt heut“. Die Männer quittierten das mit Gelächter. „Außerdem hat die Fini gsagt, dass es heut no a Unwetter gäb. Des wär koa guats Omen net für de Johannisfeu‘r und für die Ernt‘. Regen am Johannistag, nasse Ernt‘ man erwarten mag. Aber glei a Unwetter – die Fini hat halt scho immer gspunna. Wer glaabt ihr scho, dass s‘ mit dem Raben red‘n ko?“
Darin waren sich die Männer einig. Sie glaubten nicht, dass Fini mit dem Raben reden kann. Sie bestellten eine weitere Runde Weizenbier und widmeten sich mit Hingabe ihrem Schafkopfen.
Julia nahm einen tiefen Zug von der kühlen Radlermaß. Dabei erinnerte sie sich daran, wie sie vor zwei Jahren mit Josua unter diesen Kastanienbäumen zum ersten Mal angestoßen und prost gesagt hatte. Sie war so auf Protest und Trotz gegen die Wachtturm Lehren getrimmt. ‚Wieso habe ich nur sogar die Nacht mit ihm verbracht? Mir war doch klar, dass mein Buchhaltergott die Sünde in seinem Buch notieren würde. Ich habe damals neben Josua so eine Geborgenheit empfunden wie niemals in meinem Leben zuvor. Zur Strafe quält mich mein Gewissen seither ununterbrochen‘.
Julia malte sich in Gedanken aus, wie sie, die arme Sünderin, diese Nacht vor den Ältesten gestehen wird. Ihr krampfte sich der Magen zusammen. Wann kommt er endlich? Sehnsüchtig hingen ihre Blicke am Eingang zum Biergarten. Sie registrierte nicht, wie er sich allmählich leerte. In ihrem halbleeren Bierglas schwammen inzwischen drei Wespen. Apathisch ließ sie sie gewähren und drehte unentwegt an ihrer Haarsträhne.
Gundi Bergmüller, die Wirtin der Wahrheitsmühle, hatte diese Frau im blauen Trainingsanzug seit Stunden im Blick. Sie saß, völlig in ihre Gedanken versunken, einsam da. Die Mittagsgäste hatten den Biergarten verlassen. Diejenigen, die das Johannisfeuer anzünden würden, erwartete sie erst später. Die Frau isst nichts, trinkt nichts, zwirbelt immer die gleiche Haarsträhne und starrt in Richtung Eingangstor, stellte Gundi mitfühlend fest. Sie ertrug diesen traurigen Anblick nicht länger. „Möchten Sie vielleicht etwas essen?“ Bei dieser Frage schreckte Julia aus ihren Gedanken. „Nein, danke, es ist schon spät“, wehrte sie erschrocken ab. „Ich will lieber gehen“.
„Ich will ja nicht neugierig sein, aber haben Sie jemanden erwartet?“ Gundula versuchte, die einsame Besucherin zum Reden zu animieren. „Ja, meinen Freund. Er ist heute Vormittag vom Gasthof zum Mühlbach weggegangen. Wir hatten einen Streit. Ich hoffte, dass er hierher kommt“, antwortete Julia kurz.
„Ich verstehe. Aber dann wäre er schon längst hier. Bestimmt hat er bemerkt, dass bald das Gewitter losgeht und sich dafür entschieden, wieder zum Gasthof zurückzugehen“.
Julia hatte nicht bemerkt, wie sich der Himmel mit drohenden, dunklen Wolken zugezogen hatte. Selbst das ferne Grollen von Blitz und Donner hatte sie nicht registriert. Darum sprang sie erschrocken auf. „Ja, natürlich – wie konnte ich nur so unaufmerksam sein“. Sie rannte zu ihrem Auto in der Hoffnung, rechtzeitig vor dem Gewitter den Gasthof zu erreichen. Aber das Gewitter war schneller. Auf halber Strecke öffneten sich die Himmelsschleusen. Es schüttete, donnerte, blitzte so heftig, aus den tiefhängenden, tiefschwarzen Wolken, wie sie es noch nie in ihrem Leben erlebt hatte. ‚Das ist Harmagedon‘, schoss es ihr in den Sinn. Sie hielt am Straßenrand, legte den Kopf auf das Lenkrad, das sie mit beiden Händen fest umklammerte, und erwartete ihr Gottesgericht. Ein greller Blitz mit ohrenbetäubendem Donnerschlag, dessen Druckwelle sogar ihr Auto vibrieren ließ, erschreckte sie. Sie sah sich um und erkannte hinter der Wahrheitsmühle ein loderndes Feuer. Der Blitz musste den Holzstoß entzündet haben, der für das Johannisfeuer vorbereitet war. Der prasselnde Regen verdampfte zischend in der Hitze, noch ehe die Tropfen den Holzstoß erreicht hatten. Julia schlotterten vor Angst die Knie, beim Anblick der Sturzflut, welche die Straße hinab schoss. Sie befürchtete, mit ihrem kleinen Auto mitgerissen zu werden. Doch nichts dergleichen widerfuhr ihr. Der sintflutartige Regen hatte sich nach einer Weile ausgetobt und wurde zum sanften Fließen. Julia schöpfte Hoffnung, dass Josua inzwischen zurück im Gasthof wäre. Sie beruhigte sich etwas und fuhr weiter. Beim Einbiegen auf den Parkplatz registrierte sie, wie die Geranien und Petunien in den Balkonkästen zerzaust und zerfleddert herabhingen. Sie rannte durch den Regen zum Haus und wurde auf der kurzen Strecke vom Parkplatz bis zur Haustüre völlig durchnässt, doch sie achtete nicht darauf. Sie stürmte die Treppe hinauf. Ihr Atem stockte beim eintreten in das Zimmer. Er war nicht zurückgekommen.
Tropfnass, wie sie war, sank sie auf einen Stuhl. Sie schluchzte hemmungslos. Ihre Tränen flossen um die Wette mit den Tropfen aus ihren Haaren.
Die Wolken am Himmel hatten sich leer geweint. Auch Julia schleppte sich ins Badezimmer und trocknete ihre Tränen. Sie zog sich trockene Sachen an.
Sie fragte ihr Gegenüber im Spiegel: „Wer bist du? Wie Viele bist du? Warum kannst du nicht normal sein, wie alle guten Zeugen Jehovas? Warum sind die glücklich und du bist unglücklich? Warum erklärst du mir nicht, wieso es so eine große Sünde ist, Josua zu lieben“? Sie zog eine wütende Grimasse und schrie ihr Spiegelbild an: „Danke, für deine aufschlussreichen Antworten“! Wütend warf sie den nassen Waschlappen auf ihr Gesicht im Spiegel.
Mit diesen Fragen drehte sich das Gedankenkarussell in ihrem Kopf erneut weiter. Sie lief im Zimmer auf und ab, auf und ab, auf und ab. Abwechselnd blieb sie am Fenster stehen, und starrte in die Dunkelheit hinaus. Dann warf sie sich wieder schluchzend auf ihr Bett. Alles wäre anders gekommen, wenn sie am Morgen schon zugestimmt hätte, die beiden Betten zusammenzuschieben. Die schlimmsten Selbstvorwürfe quälten sie. Sie malte sich aus, was ihm zugestoßen sein könnte oder was er sich sogar angetan haben könnte. Dieser Gedanke war unerträglich. Sie nahm ein Kopfkissen und trommelte wütend mit beiden Fäusten darauf herum. Sie biss die Zähne zusammen, um nicht zu schreien. Sie tobte sich müde und fiel in einen Schlaf mit Albträumen. Am Morgen kam die brutale Erkenntnis: Er ist nicht zurückgekommen. Sie befürchtete, dass sich ihre schlimmsten Ängste bewahrheitet hatten. Völlig aufgelöst verständigte sie die Polizei.
Verschwunden
Hauptkommissar Gruber nahm ihre Vermisstenanzeige auf. Die Vermutung, der Mann könnte in die Mühlbachschlucht gegangen sein, lag nahe. Falls er den steilen Weg zur Wahrheitsmühle gewählt hatte, wäre es möglich, dass er gestürzt ist. Für Ungeübte waren einige Passagen riskant. Im Anbetracht der Tatsache, dass das Unwetter am Vortrag den Mühlbach in einen reißenden Fluss verwandelt hatte, der weit über die Ufer getreten war, ordnete er eine sofortige Suchaktion an. Ein Aufgebot von Polizeibeamten durchkämmte die gesamte Schlucht. Für die Hundestaffel war es aussichtslos eine Fährte zu finden. Das Gewitter hatte alle Spuren weggespült.
Fini hatte Recht getan, ihre Heilpflanzen zu ernten und die Fensterläden zu schließen. Im Dorf waren die Bewohner nach vielen Stunden immer noch damit beschäftigt die Spuren der Überflutung zu beseitigen. Die späte Reue: Hätten wir doch auf die Fini gehört, half nichts mehr.
Nach intensiver Suche in der Klamm und den Bachlauf hinunter, traf sich die Suchmannschaft wieder an ihrem Ausgangspunkt am Eingang zur Mühlbachschlucht, in der sie den Unfallort vermuteten. Hinweise auf den Vermissten wurden keine gefunden. Der Mann hatte sich scheinbar in Luft aufgelöst, rätselten sie. Warum gab es keine Spur von ihm? Wohin ist er gegangen? Wieso hatte weder seine Freundin noch die Polizei oder der Notarzt eine Meldung erhalten. Niemand hatte Hilfe angefordert.
Die Spaziergänger, Jogger und Radfahrer, die sich um den Ort versammelt hatten, stellten Vermutungen darüber an, was passiert sein könnte. „Vielleicht hat die Oberhäusler Fini ja doch recht“, spekulierte eine füllige Mittsechzigerin. Sie hatte Mühe ihren Foxterrier an der Leine zu bändigen. „Womit hat die Oberhäusler Fini recht“? Hakte Hauptkommissar Gruber nach.