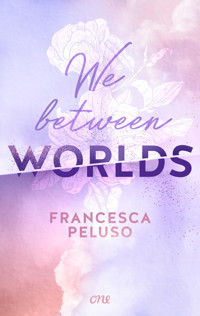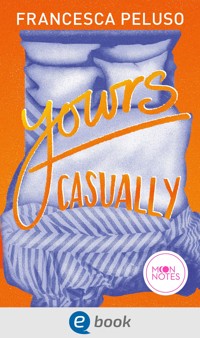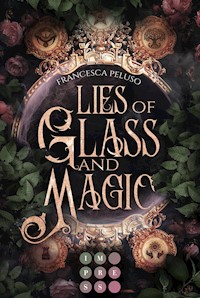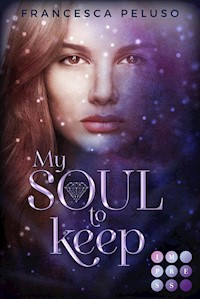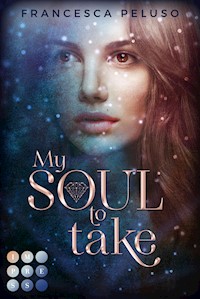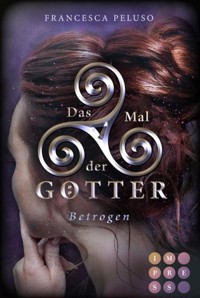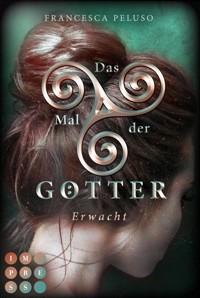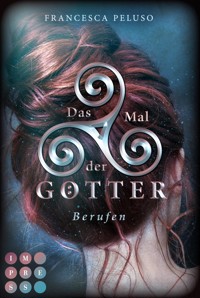6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Ferham Creek
- Sprache: Deutsch
Der emotionale 2. Band der Ferham-Creek-Dilogie: Dark Secrets, Rich Girl & Poor Boy
Mit Farbschnitt und Page-Overlay exklusiv in der 1. Auflage
Eleanor van der Berg ist die Prinzessin der Eastside: ambitioniert, höflich und gutaussehend. Doch tief in sich spürt sie eine Leere, die weder ihre guten Noten noch die schicken Dinnerpartys ihrer Eltern füllen können. Als ihr Wagen auf dem Highway liegen bleibt, lernt sie den Mechaniker Kai kennen, der das genaue Gegenteil von ihr zu sein scheint. Er gehört zu den Ferham Falcons, einer gefürchteten Gang von der Westside. Und ausgerechnet bei Kai fühlt Eleanor sich endlich komplett. Ihre Beziehung steht jedoch unter keinem guten Stern, denn Kai und seine Freunde haben schon oft Bekanntschaft mit dem Gesetz gemacht - und das ist niemand Geringeres als Eleanors Vater ...
Für Fans von Outer Banks, Gossip Girl und O.C. California
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über Francesca Peluso | Autor | 1
Über das Buch
Weitere Titel der Autorin:
Titel
Impressum
Spoiler
Widmung
Kapitel 1 Eleanor
Kapitel 2 Eleanor
Kapitel 3 Kai
Kapitel 4 Eleanor
Kapitel 5 Eleanor
Kapitel 6 Kai
Kapitel 7 Eleanor
Kapitel 8 Kai
Kapitel 9 Eleanor
Kapitel 10 Kai
Kapitel 11 Kai
Kapitel 12 Eleanor
Kapitel 13 Kai
Kapitel 14 Eleanor
Kapitel 15 Eleanor
Kapitel 16 Kai
Kapitel 17 Eleanor
Kapitel 18 Eleanor
Kapitel 19 Kai
Kapitel 20 Eleanor
Kapitel 21 Eleanor
Kapitel 22 Kai
Kapitel 23 Eleanor
Kapitel 24 Eleanor
Kapitel 25 Eleanor
Kapitel 26 Kai
Kapitel 27 Eleanor
Kapitel 28 Kai
Kapitel 29 Eleanor
Kapitel 30 Eleanor
Kapitel 31 Kai
Kapitel 32 Eleanor
Kapitel 33 Eleanor
Kapitel 34 Kai
Kapitel 35 Eleanor
Kapitel 36 Eleanor
Danksagung
Inhaltsinformation
Über Francesca Peluso | Autor | 1
Francesca Peluso wurde 1995 in Hessen geboren. Ihren italienischen Wurzeln verdankt sie ihre Liebe zu Kaffee und Pasta. Schon früh erwachte ihre Begeisterung für Bücher, das Lesen und Schreiben. Dabei taucht sie am liebsten in fantastische Welten mit mutigen Held:innen und großen Liebesgeschichten ein. Wenn sie gerade nicht schreibt, zeichnet sie Landkarten oder steckt in einem ausgiebigen Serienmarathon. Mehr auf Instagram: @booksbyfran
Über das Buch
Der emotionale 2. Band der Ferham-Creek-Dilogie: Dark Secrets, Rich Girl & Poor Boy
Mit Farbschnitt und Page-Overlay exklusiv in der 1. Auflage
Eleanor van der Berg ist die Prinzessin der Eastside: ambitioniert, höflich und gutaussehend. Doch tief in sich spürt sie eine Leere, die weder ihre guten Noten noch die schicken Dinnerpartys ihrer Eltern füllen können. Als ihr Wagen auf dem Highway liegen bleibt, lernt sie den Mechaniker Kai kennen, der das genaue Gegenteil von ihr zu sein scheint. Er gehört zu den Ferham Falcons, einer gefürchteten Gang von der Westside. Und ausgerechnet bei Kai fühlt Eleanor sich endlich komplett. Ihre Beziehung steht jedoch unter keinem guten Stern, denn Kai und seine Freunde haben schon oft Bekanntschaft mit dem Gesetz gemacht – und das ist niemand Geringeres als Eleanors Vater ...
Für Fans von Outer Banks, Gossip Girl und O.C. California
Weitere Titel der Autorin:
We between Worlds
Band 2
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Francesca Peluso wird vertreten durch die Agentur Härle
Copyright © 2025 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Textredaktion: Anne Schünemann, Schönberg
Umschlaggestaltung: © SO YEAH DESIGN, Gabi Braun
Umschlagmotiv: © Sinisha Karich / shutterstock.com; ChunnapaStudio / shutterstock.com; oxygen_8 / shutterstock.com; klyaksun / shutterstock.com
Kartengestaltung & Stadtwappen: © Francesca Peluso
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-7391-1
Sie finden uns im Internet unter one-verlag.de
Bitte beachten Sie auch luebbe.de
Liebe Leser*innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Dazu findet ihr genauere Angaben am Ende des Buches.ACHTUNG: Diese enthalten Spoiler für das gesamte Buch.Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer Team vom ONE-Verlag
Für alle, die manchmal hadern,
von Zweifeln geplagt oder von Ängsten gehemmt werden.
Ihr seid nicht allein.
Kapitel 1 Eleanor
Ferham Creek glich an manchen Tagen einem Gefängnis. Früher hatte Eleanor das nicht so empfunden, doch seit Anna nicht mehr hier war, wurde sie dieses Gefühl nicht mehr los. Die Kleinstadt baute sich in Häusern des Greek-Revival-Stils um sie herum auf. Sie ähnelten eher Anwesen mit ihren hellen Fassaden und den Säulen, die an die Tempel der alten Griechen erinnerten. Wunderschön und makellos mit den niedrigen Satteldächern und den hohen Giebeln, und doch sah jedes Haus gleich aus. So wie sich Zelle an Zelle reihte in einem Gefängniskomplex. Zumindest waren die Häuser in diesem Teil der Stadt recht ansehnlich. Die frisch polierten Fenster blickten stumm auf die Straßen, als würden sie Geheimnisse bewahren, die niemand hören wollte. Oder hören durfte.
»Was schaust du so grimmig?«, fragte Gwen, die gerade ihre Sporttasche in dem neuen Mercedes CLE Coupé verstaute. Ein Geschenk ihres Dads, dafür, dass sie es als Favoriten in die regionalen Fechtmeisterschaften geschafft hatten. »Das Training lief doch super. Coach Johnson war mehr als zufrieden mit uns. Wir haben dieses Jahr sehr gute Chancen auf den Sieg.«
Das hatten sie wirklich. Und im Grunde genommen hatten sie diesen Erfolg einzig und allein Gwen zu verdanken. Als Kapitänin hielt sie das Team zusammen und bestärkte jede von ihnen, ihr Bestes zu geben.
»Es ist nichts«, murmelte Eleanor, doch ihre Stimme klang hohl. Als würde sie ihre eigenen Worte nicht glauben. Ein Gefühl der Enge breitete sich in ihrer Brust aus.
»Bist du sicher?«, hakte Gwen nach. Ihre hellgrünen Augen musterten sie zweifelnd.
Eleanor ließ den Blick über die umliegenden Häuser hinweggleiten. Die Saint Clarice Prep lag nahe dem Hafen und direkt am Stadtpark. Die Luft war geschwängert von Salz und dem Geräusch der Wellen, doch dazu mischten sich das leise Summen von Bienen und die länger werdenden Tage. Es war das Versprechen auf den Frühling, der vor der Tür stand. Ein kleiner Trost, denn auf den Frühling würde irgendwann auch der Sommer folgen und dann endlich der langersehnte Herbst.
»Ich kann unseren Abschluss kaum erwarten«, gab sie zu. »Ich kann Ferham Creek nicht mehr sehen.«
Jeder Tag glich dem anderen, und es gab keinen Ausweg. Kein Entkommen. Als säße sie in einer Zelle fest und zählte die Tage bis zu ihrer Freilassung. Es waren noch genau 126.
Sie hatte das Gefühl, hier festzustecken.
In dieser Stadt. In ihrem Leben.
Gwen lachte leise. »Der Herbst kommt schneller, als du denkst. Dann heißt es: Harvard, Baby.« Ein Lächeln trat auf ihr Gesicht, und Eleanor wusste, dass auch Gwen es kaum erwarten konnte, endlich hier herauszukommen.
Harvard war ihr Versprechen auf einen Neuanfang. Auf ein Leben fernab von Ferham Creek. Es wäre ein Leben, das sie allein bestimmen durfte.
Doch das lag noch in weiter Ferne. Und ein Hindernis gab es vorher noch zu bewältigen.
»Hast du denn noch nichts von Harvard gehört?«, fragte Gwen skeptisch. »Mein Brief kam gestern an. Ich weiß zwar, dass nicht jeder ein persönliches Schreiben bekommt, aber wenn einer Post von Harvard bekommen sollte, dann du.«
Eleanor biss sich auf die Unterlippe, schüttelte aber den Kopf. »Ich muss mich wohl noch gedulden, vielleicht kommt er ja heute.«
Der Brief war bereits gestern eingetroffen. Eleanor hatte ihn vor ihren Eltern versteckt, und sie war froh gewesen, als Erste zu Hause gewesen zu sein. Die Vorstellung, dass ihre Mom oder ihr Dad den Brief gefunden hätten, wäre ein Graus gewesen. Sie war noch nicht bereit, mit ihnen über den Inhalt des Schreibens zu sprechen.
Harvard gehörte zu den renommiertesten Universitäten der Welt. Nicht einmal fünf Prozent der Bewerber erhielten eine Zusage und nur eine Handvoll ein persönliches Schreiben des Dekans. Doch Eleanor hatte es geschafft.
Seit dem Morgen lag der Brief in ihrer Sporttasche. In der oberen linken Ecke prangten das rote Wappen mit den goldenen Ranken und dem in Buchform geschriebenen Wort Veritas.
Veritas. Wahrheit.
Als sie jetzt daran dachte, konnte sie nur darüber lachen. Immerhin hatte sie Gwen erst vor wenigen Minuten dreist ins Gesicht gelogen. Etwas, was sie in letzter Zeit zu oft tat. Eine Lüge folgte auf die nächste, und Eleanor hasste sich für jede einzelne von ihnen.
Sie verstärkte den Griff um ihre Sporttasche und presste die Kiefer aufeinander. Der dünne Papierumschlag wog plötzlich unfassbar schwer in ihrer Tasche. Sie erinnerte sich noch genau an den Moment, in dem ihre Schwester Annabelle den Brief von Harvard bekommen hatte. An die zufriedenen und glücklichen Gesichter ihrer Eltern. Sie waren ebenfalls dort gewesen und hatten sich am College kennen- und lieben gelernt.
Damals hatte Eleanor sich auf den Tag gefreut, an dem es bei ihr genauso sein würde. Aber Freude war das Letzte, was sie momentan verspürte. Heute Morgen war sie per Mail daran erinnert worden, in das Onlineportal der Universität zu schauen, denn dort seien die endgültigen Entscheidungen verkündet worden. Ein einziger Blick hatte gereicht und Eleanor hatte gewusst, dass drei Zusagen auf sie warteten.
Eine für Wirtschaft.
Eine für Jura.
Und eine für Medizin.
Die Zusagen für Wirtschaft und Jura waren keine Überraschung gewesen. Darauf hatte Eleanor ihr Leben lang hingearbeitet. Das waren auch die Fächer, von denen ihre Eltern wussten. Ihre Mom, Josephine van der Berg, war der Spross einer reichen Unternehmerfamilie, die vor allem für den Bau von Dampfschiffen und Eisenbahnen Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt war. Ihre Familie stand im Zusammenhang mit dem Beginn einer wirtschaftlichen Blütezeit in den USA. Wenn es nach ihrer Mom ging, würde Eleanor nach einem erfolgreichen Harvard-Abschluss in besagtem Familiengeschäft, das sich inzwischen zu einem internationalem Logistikunternehmen weiterentwickelt hatte, mitwirken.
Ihr Dad, Wesley van der Berg, war als Bezirksstaatsanwalt tätig. Laut ihm eignete sich Eleanor perfekt für eine Karriere im Gericht.
Und dann war da noch die Medizin.
Eleanor war sich nicht einmal sicher, ob sie es als Wunsch oder Hirngespinst betiteln sollte. Vielleicht war es auch eine Trotzreaktion gewesen, als sie sich für den MCAT, den Medical College Admission Test angemeldet hatte. Ihr wurde immer nachgesagt, eine Eiskönigin zu sein. Unnahbar und kühl, daher vermuteten alle, dass sie in die Fußstapfen ihres Dads treten und zu einer knallharten Anwältin werden würde. Doch das wollte sie gar nicht. Sie wollte im Grunde nicht einmal als unnahbar oder kalt gelten, doch sie kam nicht aus ihrer Haut. Als Ärztin könnte sie vielleicht das Bild, das andere von ihr hatten, ändern.
Sie seufzte und rieb sich frustriert über den Nacken. Eigentlich gab sie Drew die Schuld für diesen Schlamassel. Nur wegen ihm hatte sie Interesse an der Medizin gefunden. Seiner Familie gehörte das Krankenhaus in Ferham Creek, und als sie noch ein Paar gewesen waren, hatte Eleanor dort viel Zeit verbracht. Das Engagement der Ärztinnen und Ärzte und der Zusammenhalt der Krankenpflegerinnen und -pfleger hatten sie fasziniert. Es war wie eine eigene kleine Welt gewesen, von der Eleanor aus mysteriösen Gründen ein Teil hatte sein wollen.
Jetzt konnte sie es.
Zumindest wenn sie den Mut aufbringen sollte, ihren Eltern von dieser Zusage zu erzählen. Medizin hatte in ihrer Zukunftsplanung nie im Raum gestanden. Für sie und ihre Schwester Annabelle hatte es immer nur zwei Wege gegeben: Wirtschaft oder Jura. Mom oder Dad. Ihre Eltern hatten, seit sie sich erinnern konnte, immer nur von diesen beiden Optionen gesprochen. Sie hatten ihre eigenen Studienfächer so in den Himmel gelobt, dass etwas anderes für ihre Kinder nicht infrage kam.
Annabelle hatte sich für Wirtschaft entschieden und studierte bereits im zweiten Semester in Harvard. Niemanden hatte es sonderlich überrascht, dass sie diesen Weg eingeschlagen hatte. Sie kam eher nach ihrer Mutter und somit war es naheliegend, dass sie sich dem Teil der Familie zuwandte.
Demzufolge war jeder davon ausgegangen, dass Eleanor sich für Jura entscheiden würde, wenn es so weit war. Sie war Daddys kleines Mädchen und hatte ihn schon seit dem Kindergarten mit ins Gericht begleitet. Eine Zeit, an die sie gern zurückdachte.
Doch jetzt...
Wenn Eleanor jetzt die Augen schloss und sich ihre Zukunft ausmalte, sah sie sich in einem dunkelblauen Kasack und mit einem Stethoskop um den Hals. In ihrer Vorstellung sah sie dabei immer aus wie April Kepner oder Addison Montgomery aus Grey’s Anatomy. Eine der beiden äußerst talentierten Medizinerinnen aus dem Grey Sloan Memorial Hospital.
Eleanors Gedanken stockten. Sie hatte die Serie nach dem Tod von Dr Dreamy abgebrochen und war demnach so gar nicht auf dem neuesten Stand. Hieß das Krankenhaus in der Serie überhaupt noch so?
Tatsache war jedoch, dass es zwischen ihr und diesen beiden Frauen nur eine einzige Gemeinsamkeit gab: die Haarfarbe. Mehr war da nicht. Und mehr würde es vielleicht auch niemals geben.
»Der Brief wird kommen«, sagte Gwen dann in einem leisen Ton. »Da bin ich mir sicher. Und wenn nicht, auch egal, du wirst auf jeden Fall angenommen.«
Eleanor nickte langsam und zwang sich zu einem Lächeln. »Wie hat dein Dad auf die Zusage von Harvard reagiert?«, versuchte Eleanor ihre Gedanken zu vertreiben.
Gwen strich sich die blonden Haare aus der Stirn. »Eigentlich überhaupt nicht«, gab sie zu. »Er hat es zur Kenntnis genommen. Etwas anderes als eine Zusage wäre schließlich für eine Boyd nicht infrage gekommen.« Sie verdrehte die Augen und betrachtete mit gerunzelter Stirn ihren neuen Wagen. »Ihm war es wichtiger, dass wir als Favoriten in den Meisterschaften gelten. Auch wenn wir mit Boyd Enterprise einen der führenden Konzerne an der Ostküste leiten, sieht mein Dad es nicht ein, auch nur einen Penny für mein Studium zu zahlen.«
»›Eine Boyd verdient sich ihren Platz‹«, äfften sowohl Eleanor als auch Gwen das Oberhaupt der Boyd-Familie nach.
Sie lachten beide, auch wenn das Thema überhaupt nicht lustig war. Gwen war noch mehr Druck ausgesetzt als Eleanor. Ihre einzige Aufgabe hatte darin bestanden, gute Noten und einen tadellosen Ruf mit nach Hause zu bringen. Sie hatte immer gewusst, dass das Geld ihrer Eltern ihr sämtliche Türen öffnen würde. Bei Gwen war das anders gewesen.
Im Kreise der Boyds reichte es nicht aus, gute Noten zu haben und sich an der Spitze der Gesellschaft zu bewegen. Jedes Familienmitglied musste sich den Platz im Unternehmen verdienen. Aus eigener Tasche und eigenem Antrieb. Das hatte Gwen schon seit dem Kindergarten gewusst.
Was auch der Grund war, warum Gwen die Kapitänin ihres Fechtteams war. Sie war die Beste und trainierte am härtesten. Nicht, weil sie es wollte. Sondern weil sie es musste. Das Fechten war ihr Schlüssel nach Harvard.
»Dann können wir ja alle froh sein, dass dir das Stipendium sicher ist«, sagte Eleanor und atmete gespielt auf. »Selbst wenn wir die Meisterschaften nicht gewinnen sollten, wird Harvard es dir nicht streichen.« Eine einzige Niederlage würde nicht über Gwens Zukunft entscheiden. Dafür hatte sie zu hart gearbeitet und zu viel gegeben.
»Das nicht, nein.« Gwen seufzte. »Aber ich mache mir mehr Sorgen um die Reaktion meines Vaters als die des Gremiums. Er ist definitiv Furcht einflößender.«
Dem konnte Eleanor nicht widersprechen. Die Väter in ihrer Freundesgruppe waren allesamt nicht die herzlichsten. Ihren eigenen Vater musste sie außen vor lassen. Allein seines Humors wegen passte Wesley van der Berg nicht zu den anderen Dads. Die machten nie Witze. Eleanor hatte eher das Gefühl, dass sie sich lieber die Zunge abbeißen würden. Wenn sie sich vorstellte, dass Henry McCoy oder William Boyd einen Dad-Joke rissen, konnte sie nur ungläubig mit dem Kopf schütteln. Da fror ja eher die Hölle zu, bevor so etwas passierte.
»Mach dir darum keine Gedanken. Mit deinem Trainingsplan und deinen aufbauenden Worten«, Eleanor grinste, denn sie beide wussten, dass diese Worte eher einem aufbauenden Anschreien glichen, »können wir die Fechtmeisterschaften ja nur gewinnen.«
Gwen biss sich auf die Unterlippe. »Hey! Es ist ein absolut liebevolles Brüllen, das ihr von mir zu hören bekommt.«
Eleanor grinste noch breiter. »Oh ja, der Inbegriff von Zärtlichkeit.«
Gwendolyn boxte ihr gegen die Schulter, lachte aber. »Liebevolles Motivieren liegt mir einfach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das etwas bringt. Manchmal braucht es eine gewisse Strenge.«
»Du hast Laura und Pauline zehnmal um die Halle laufen lassen, weil sie zwei Minuten zu spät kamen.«
»Und sie können froh sein, dass es nicht zwanzig Runden waren«, brummte Gwen und schnaubte. »Wenn wir pünktlich kommen, können die das ja wohl ebenfalls.«
Eleanor lächelte und legte Gwen einen Arm um die Schultern. »Meine kleine Tyrannin«, sagte sie in einem sanften Ton. »Was würden wir nur ohne dich tun?« Das fragte sie sich häufiger. Ohne Gwen wäre sie aufgeschmissen. Jetzt, da Anna nicht mehr da war, wäre sie allein und verkümmert, wie eine vergessene Zimmerpflanze.
Gwen schnaubte und löste sich von ihr. Sie war noch nie der Typ für überschwängliche Berührungen gewesen. »Verlieren, so viel steht fest. Den meisten im Team fehlt es an Disziplin und Durchhaltevermögen.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust.
»Ab und an erinnerst du mich an eine Ausbilderin in der Army«, murmelte Eleanor. »Nur der Chanel-Mantel und die Jimmy Choos passen nicht ins Bild.« Demonstrativ blickte sie an Gwen hinab. Die Sportkleidung hatte sie gegen ihr Designer-Outfit getauscht. Ihre Haare waren perfekt gestylt, ihre schlanken Beine steckten in kniehohen Absatzstiefeln und der Mantel reichte ihr fast bis zu den Waden. Ihre Freundin gab ein eindrucksvolles und perfektes Bild ab, so wie immer.
»Du kannst mich nicht dafür verurteilen, dass ich Stil und Geschmack besitze«, sagte Gwen schulterzuckend und unterdrückte ein Grinsen. Mit einer eleganten Handbewegung schob sie sich die Haare zurück.
Geschmack und Stil waren etwas, das auf der Eastside erwartet wurde. Etwas, das ihnen seit Kindesbeinen an eingetrichtert worden war. Denn der äußere Schein war von enormer Bedeutung. Und all das gehörte zu dem Bild des goldenen Käfigs, das Eleanor immer häufiger von ihrem Leben hatte.
Einem Käfig, den sie frühestens in 126 Tagen entkommen würde.
Kapitel 2 Eleanor
Nachdem sie sich von Gwen verabschiedet hatte, saß Eleanor eine Weile reglos in ihrem Auto, die Hände bereits am Lenkrad, doch den Motor hatte sie noch nicht gestartet. Sie wollte nicht heim. Wollte nicht in dieses Haus, das sich in den vergangenen Wochen nicht mehr nach ihrem Zuhause angefühlt hatte.
Ihr Blick wanderte zu der Sporttasche, die neben ihr auf dem Beifahrersitz lag. Sie stand offen, und ihr Handy lag obenauf. Eleanor starrte auf das schwarze Display, ganz in der Hoffnung, sie könnte mit bloßer Willenskraft dafür sorgen, dass es aufleuchtete und ihr eine neue Nachricht anzeigte. Doch das Handy regte sich nicht. Das Display blieb schwarz, ebenso wie ihre Gedanken.
Warum meldet sie sich nicht?
Diese Frage war so penetrant in ihrem Kopf, dass Eleanor manchmal glaubte, sie würde sie nie wieder loswerden. Und leider auch nie eine Antwort darauf erhalten. Nicht von ihren Eltern. Und erst recht nicht von Annabelle selbst.
Eleanor stieß ein Seufzen aus und schlug frustriert gegen das Lenkrad. Sie traf versehentlich die Hupe und zuckte erschrocken zusammen. Obwohl der Parkplatz der Saint Clarice Prep menschenleer war, sah sie sich hektisch um. Niemand schien das Missgeschick mitbekommen zu haben.
Hinter ihren Augen brannte es, doch sie atmete tief durch, um die Tränen zurückzuhalten. Bloß keine Schwäche zeigen. Nicht hier, nicht jetzt. Niemals.
Hilflosigkeit war ein beschissenes Gefühl, wie sie sich eingestehen musste. Fast so schlimm wie die Einsamkeit, die sich in ihr niedergelassen hatte wie ein kleiner Parasit und einfach nicht mehr verschwinden wollte.
Als Annabelle noch zu Hause gewohnt hatte, hatte sie weder das eine noch das andere gekannt. Und ihr Haus war noch ein Zuhause gewesen. Aber seit ihre Schwester fortgegangen war, spürte Eleanor so viele Dinge, die sie nie hatte fühlen wollen.
Sie wischte sich mit dem Handrücken über die Nase, eine Geste, die sie sich in der Öffentlichkeit niemals erlauben würde, dann startete sie den Motor. Es half nichts, irgendwann musste sie heimfahren. In die leere Villa, in der Stille auf sie warten würde.
Die Saint Prep lag auf der Eastside, nur einen Block vom Whitestone River entfernt und direkt neben dem Stadtpark. Eleanors Elternhaus befand sich einige Blocks weiter in östlicher Richtung. Doch aus irgendeinem Grund fuhr sie nicht auf direktem Weg dorthin, sondern machte einen Umweg in Richtung des Whitestone River.
Auf der anderen Seite des Flusses, der seinen Namen den glatten weißen Steinen verdankte, die auf dem Grund lagen und das Wasser glasklar erscheinen ließen, befand sich die Westside von Ferham Creek.
Die andere Seite, wie Eleanor sie bezeichnete.
Die schlechtere Seite, wie manch andere sie nannten.
Aber das war Unsinn. Zumindest in Eleanors Augen. Eine Stadtseite konnte weder gut noch schlecht sein. Es war nur ein Ort auf einer Karte. West- und Eastside waren nicht mehr als zwei Flecken Erde, die sich geografisch kaum voneinander unterschieden.
Sie fuhr an der Hauptstraße entlang, die parallel zum Whitestone River verlief, als sie ein seltsames Rasseln hörte. Irritiert sah sie sich um. War etwas aus ihrer Tasche gefallen? Hatte sie etwas überfahren?
Das Geräusch verschwand wieder, ebenso wie ihre Sorgen darüber. Doch sie hatte sich zu früh gefreut. Sie hätte nicht gedacht, dass der Tag noch schlimmer werden könnte. Aber sie wurde nur wenige Minuten später eines Besseren belehrt. Erst ihre schlechte Laune, der Harvard-Brief, die Lügen und jetzt das. Das rasselnde Geräusch erklang erneut, dann wurde der Monitor ihres Audi Q3 schwarz und der Wagen ging aus.
»Verdammter Mist«, fluchte sie und versuchte, das Auto wieder zum Fahren zu bewegen. Aber es geschah nichts. Der Schlüssel ließ sich nicht drehen. Der Motor sprang nicht an.
Eleanor lehnte den Kopf gegen das Lenkrad. »Natürlich muss das ausgerechnet heute passieren«, murmelte sie und griff nach ihrem Handy. Es war gerade erst kurz nach vier Uhr abends. Ihr Dad war noch im Büro, und ihre Mom wäre ihr kaum eine Hilfe.
Kurz überlegte Eleanor, wen sie anrufen könnte. Sie war noch nie liegengeblieben und hatte keine Ahnung, was man in solchen Situationen tat. Aber sie war eine selbstständige junge Frau, die das sicherlich allein hinbekam.
Schnell suchte sie im Internet nach Werkstätten und Abschleppdiensten in Ferham Creek. Normalerweise kümmerte sich ihr Dad um alles, was mit den Autos der Familie zu tun hatte. Oder er hatte Leute, die das für ihn erledigten.
Eleanor wurde schnell fündig. Laut der Kartenapp befand sich auf der anderen Seite des Flusses, gar nicht weit entfernt, eine Werkstatt, die auch einen Abschleppdienst hatte.
Sie wählte die Nummer.
»Hier bei Vance’s Werkstatt, Sie sprechen mit Vance. Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Hi, ich bin mit meinem Wagen liegengeblieben und bräuchte Hilfe«, erklärte sie.
»Springt der Wagen noch an?«, wollte der Mann am anderen Ende der Leitung wissen. Seine Stimme klang freundlich, was Eleanor beruhigte.
Sie schüttelte den Kopf, bis ihr auffiel, dass dieser Vance es nicht sehen konnte. »Nein, hier tut sich gar nichts. Ich kann mir das auch nicht erklären. Der Tank war voll, und er war erst letztens in der Inspektion.«
»Wenn Sie mir Ihren Standort durchgeben, schicke ich jemanden vorbei, der sich die Sache ansieht. Wir finden schon raus, was mit dem Wagen nicht stimmt.« Ein Lächeln war in seiner Stimme zu hören.
Eleanor diktierte ihm die Adresse. Als sie auflegte, atmete sie durch und sank ein Stück tiefer in den Sitz.
So hatte sie sich den weiteren Verlauf dieses Tages sicherlich nicht vorgestellt. Auch wenn sie nicht nach Hause hatte fahren wollen, wünschte sie sich gerade nichts sehnlicher, als ihr Gesicht in ihr Kopfkissen zu drücken und nie wieder aus ihrem Bett aufzustehen. Da das gerade nicht möglich war, lehnte sie sich zurück gegen die Kopfstütze und schloss die Augen.
Es hätten Minuten, aber auch Stunden vergangen sein können, als es leise gegen ihre Scheibe klopfte.
Eleanor stieß einen erstickten Schrei aus und blickte hastig aus dem Fenster. Direkt vor ihrem Auto stand jemand. Das Erste, was sie sah, waren Jeans und eine schwarze Lederjacke. Zögernd öffnete sie die Tür, um auszusteigen. Wenn der Typ Ärger machen sollte, würde er ihr Florett zu spüren bekommen.
»Hast du bei Vance angerufen, weil dein Wagen nicht mehr anspringt?«, fragte eine dunkle Stimme, sobald Eleanor die Tür hinter sich geschlossen hatte.
Der Mann, der vor ihr stand, musste ein paar Jahre älter sein als sie. Vielleicht zwanzig. Er war groß und trug derbe Boots. Sein Arm lehnte lässig am Wagendach, und sein Blick lag wachsam auf ihr. Er musste die blauesten Augen haben, die Eleanor jemals gesehen hatte.
Sie schluckte schwer, nickte aber.
Der Blick des Mannes glitt über sie hinweg. Im Gegensatz zu Gwen hatte sie sich nach dem Training keine Mühe gegeben, sich zurechtzumachen. Sie trug Leggings, ein Sportoberteil und ihre Trainingsjacke. Ihre roten Wellen hatte sie zu einem unordentlichen Dutt zusammengebunden.
»Da war ein Rasseln, und dann ging der Motor aus«, sagte sie kurz angebunden. Der Typ irritierte sie. Er war überdurchschnittlich gut trainiert, was sie trotz der Lederjacke deutlich erkennen konnte. Einige Strähnen seines längeren schwarzen Haars fielen ihm lose ins Gesicht. Vielleicht war es der Kontrast seiner dunklen Haare zu den blauen Augen, der Eleanor so irritierte. Aber sie konnte den Blick nicht von ihm abwenden.
»Darf ich mir den Motor mal ansehen?«, fragte er und deutete auf die Motorhaube ihres Audi Q3. Der Wagen war ihr eigentlich zu groß, aber ihr Dad hatte auf das Modell bestanden.
Eleanor nickte sofort und öffnete die Fahrertür, um den Knopf für die Motorhaube zu betätigen. Sie hörte, wie der Werkstatttyp zielsicher um das Auto herumging, und atmete tief durch.
Was war los mit ihr? Sie ließ sich doch sonst nicht so leicht aus der Fassung bringen. Besonders nicht von einem Paar schöner Augen. Auch wenn sie wirklich sehr blau waren. Und sehr schön.
Unsicher, was man in einer solchen Situation tat, entschied sie sich, ihm zu folgen.
Er hatte die Motorhaube bereits geöffnet und überprüfte einige Kabel an der Batterie.
»Ich habe deinem Kollegen bereits gesagt, dass der Tank voll war und das Auto erst aus der Inspektion kam. Da war alles in Ordnung.« Sie wollte nicht, dass er sie für eine Jungfrau in Nöten hielt oder etwas ähnlich Lächerliches. Er sollte bloß nicht glauben, dass sie nicht wusste, wie man ein Auto bediente oder darauf aufpasste.
Er nickte. Dann zeigte sich der Anflug eines Lächelns auf seinem Gesicht. »Ein voller Tank hilft dir bei einem Marderschaden leider nicht weiter«, erwiderte er leise.
»Marderschaden?«, fragte sie perplex.
Er schloss die Motorhaube und wischte sich die ölverschmierten Hände an einem Tuch ab, das er dann zurück in seine Jeans schob. »So sieht es aus. Das Zündkabel ist durchgebissen und einige elektrische Leitungen. Das kann ich hier leider nicht reparieren, aber keine Sorge, ansonsten geht es dem Wagen gut.«
Eleanor nickte. »Und was passiert jetzt?«
Der Mann sah sie an. Neugierde lag in seinem Blick. »Wohnst du hier in der Nähe? Kannst du nach Hause laufen?«
Eleanor schüttelte den Kopf. »Ich wohne auf der anderen Seite der Eastside, einmal quer durch die Stadt.« Sie verfluchte sich dafür, nicht direkt nach Hause gefahren zu sein. Vielleicht hätte sie den Weg noch geschafft, bevor der Wagen liegengeblieben wäre.
»Dann fahr ich dich«, bot ihr neuer Mechaniker an. »Anschließend lasse ich den Wagen abschleppen, dann kannst du ihn in ein paar Tagen abholen kommen. Einverstanden?«
Eleanor nickte zögernd. Was blieb ihr auch anderes übrig? Sie könnte Gwen oder Charles anrufen, ihre besten Freunde würden sie jederzeit abholen kommen, aber sie wollte niemandem die Umstände machen. Außerdem war der Mechaniker bereits hier und bot es ihr an.
»Wenn das in Ordnung für dich ist?«, fragte sie zaghaft.
Er nickte. »Sonst hätte ich es nicht angeboten. Ich rufe kurz Vance an und bitte ihn, einen Abschlepper zu schicken, dann bringe ich dich nach Hause.«
Während er telefonierte, holte Eleanor ihre Sporttasche vom Beifahrersitz und schloss den Audi ab. Kurzerhand schrieb sie Gwen eine Nachricht. Nur für den Fall, dass der Typ mit den hübschen blauen Augen doch ein Psycho war.
Gwens Antwort kam sofort:
Gwen: Schick mir deinen Standort, ich pass auf dich auf und überprüfe, ob der Kerl dich wirklich heimfährt. Falls nicht, bekommt er es mit mir zu tun.
Eleanor schmunzelte und teilte ihren Standort, bevor sie antwortete:
Eleanor: Aye aye, Captain
Auf Gwen war einfach Verlass, und Eleanor fühlte sich sicherer, wenn sie wusste, dass ihre beste Freundin ein Auge auf sie hatte.
»Bist du so weit?«, erklang wieder diese tiefe Stimme, die Eleanor erstaunlich beruhigend fand.
»Ja«, sagte sie und ließ das Handy in ihre Tasche gleiten. »Wird der Wagen nun abgeholt?«
Er nickte. »Ich sehe ihn mir nachher an, dann kann ich sagen, wie lange die Reparatur dauert.«
Sie nickte und hoffte inständig, dass das Austauschen von einigen angeknabberten Kabeln nicht allzu lange dauern würde. Sie brauchte ihren Wagen.
Langsam folgte sie dem Mechaniker zu seinem Auto. Es war ein in die Jahre gekommener Cadillac. Ein sehr schöner Wagen, wenn auch etwas verrostet und dreckig. Verwirrt beobachtete sie, wie der Typ ebenfalls auf die Beifahrerseite zusteuerte. Sollte sie sich etwa selbst nach Hause fahren?
Doch stattdessen öffnete er ihr die Tür und sah sie auffordernd an. »Ich bin übrigens Kai«, sagte er dann.
»Eleanor«, erwiderte sie knapp. Sie verfluchte sich innerlich dafür, dass sie so kurz angebunden war. Das war oft ihr Problem bei fremden Menschen, sie kam einfach nicht aus ihrer Haut. Oder der Typ vor ihr mit der etwas düsteren Aura hatte ihr die Sprache verschlagen.
Seine Mundwinkel hoben sich kaum merklich, als er hinter ihr die Wagentür schloss und auf die Fahrerseite ging.
Im Auto roch es nach Lack und Farbe. Auf dem Armaturenbrett lag ein mit Öl beschmierter Lappen, und der Wagen hätte dringend mal einen Besuch in der Waschstraße vertragen können. Aber Eleanor wollte sich nicht beschweren. Sie war froh, nicht laufen zu müssen.
»Also, wohin geht’s?«, fragte Kai, als er den Motor startete. Im Gegensatz zu ihrem eigenen gab dieser kein Rasseln von sich, sondern sprang anstandslos an.
Eleanor nannte ihm ihre Adresse. »Danke für deine Hilfe«, sagte sie dann. »Ich wollte niemandem Umstände bereiten.«
»Ist das der Grund, warum du eine Werkstatt auf der Westside angerufen hast statt den Mechaniker deines Vertrauens?«, wollte er wissen. »Das ist ganz schön weit weg von zu Hause.«
Wenn sie ehrlich war, kannte Eleanor nicht einmal die Werkstatt, in die ihr Dad ihre Autos normalerweise brachte. »Ihr wart am nächsten dran«, sagte sie kühl. »Ich wollte nicht, dass jemand wegen mir durch die halbe Stadt fahren muss.« Und trotzdem tat Kai genau das in diesem Moment.
Er schien denselben Gedanken zu haben, denn er lächelte. »Das sind keine Umstände, gehört zum Service.«
Ein ausgesprochen zuvorkommender Service, wie Eleanor zugeben musste. Genauso wie seine höfliche Art, die für sie irgendwie nicht mit der Lederjacke und den Boots zusammenpassen wollte. Er hatte das Aussehen eines Bad Boys, verhielt sich aber wie ein Gentleman.
»Bist du schon lange Mechaniker?«, platzte es aus ihr heraus, und sie hob sofort abwehrend die Hände. »Entschuldige bitte, ich wollte nicht implizieren, dass du dein Handwerk nicht verstehst oder etwas in der Art.«
»So kam es auch nicht rüber«, versicherte er ihr. Sein linker Arm lag entspannt auf dem offenen Fenster. Es war zwar noch Februar und die Luft draußen kalt, immerhin befanden sie sich direkt am Atlantik, aber Eleanor fror in diesem Moment überhaupt nicht. Viel eher wurde ihr in Anwesenheit dieses Mannes heiß. »Und ja, ich arbeite schon einige Jahre mit Vance.«
»Und du? Bist du schon häufiger von Fremden eingesammelt worden?« Sein Ton war sanft, doch sie konnte hören, dass ihn die Sache amüsierte.
»Ist mein erstes Mal«, erwiderte sie kühl. Und hoffentlich auch mein letztes, fügte sie in Gedanken hinzu. Nicht, dass die Fahrt schlimm wäre, aber etwas peinlich war ihr die Angelegenheit trotzdem. Kai wirkte so erwachsen, und sie wollte nicht, dass er sie für ein naives Kind hielt.
»Du kannst nichts dafür, falls es dir hilft. Ein Marderschaden kann jedem passieren.«
Überrascht hob sie eine Augenbraue. »Es hilft ein kleines bisschen«, gab sie zu. »Spielst du häufiger den Retter in der Not?«
Kai stieß ein kehliges Lachen aus, das ein warmes Kribbeln ihren Rücken hinabsandte. »Nein, ich fürchte, als Retter in der Not tauge ich nicht viel.«
»Dann fühle ich mich geehrt, dass du bei mir eine Ausnahme machst.« Das tat sie wirklich. Seit er aufgetaucht war, hatte sie nicht einen Gedanken an zu Hause verschwendet, nicht an Annabelle und auch nicht an ihre Einsamkeit. Es war eine willkommene Abwechslung.
Er war eine willkommene Abwechslung.
Kai, der Mechaniker und Retter in Nöten.
»War mir ein Vergnügen«, sagte er lächelnd und schaute kurz in ihre Richtung.
Als er wieder geradeaus auf die Straße sah, musterte sie ihn verstohlen aus den Augenwinkeln. Er hatte einen Dreitagebart, der seine Kieferpartie ausgesprochen gut betonte. Eine schmale, gerade Nase und hohe Wangenknochen. Er sah aus wie die Statue einer römischen Gottheit aus der Renaissance.
»Sind wir hier richtig?«, fragte er plötzlich und betrachtete die Gegend.
Dieser Teil von Ferham Creek galt als der reichste und schönste. Ihr Haus lag nur wenige Meter die Straße hinunter.
»Sind wir«, gab sie leise zu. In diesem Moment war es ihr unangenehm, ausgerechnet hier zu wohnen. Sie kam sich vor wie eine Prinzessin, die ausgerissen war und nun wieder nach Hause gebracht wurde. In dem Cadillac, der die besten Jahre bereits hinter sich hatte, fühlte sie sich wie in einer anderen Welt. Und Kais undurchdringliche Miene deutete darauf hin, dass er ganz ähnliche Gedanken hatte.
Eleanors Kehle wurde trocken. »Du kannst mich hier auch rauslassen, ich wohne gleich dort drüben«, sagte sie und deutete auf die andere Seite der Kreuzung, an der sie gerade hielten.
Kai runzelte die Stirn und begutachtete ihr Haus. Wobei die Bezeichnung Anwesen vielleicht besser passte. Es war eine Villa aus dem 19. Jahrhundert im Stil des Greek Revival. Feiner Stuck zierte die Fassade, und die grünen Fensterläden waren frisch gestrichen.
»Nette Bude«, murmelte Kai, doch er wirkte nicht beeindruckt. Sein Tonfall klang vielmehr gepresst.
Eleanor zuckte mit den Schultern. »Wenn man auf so was steht«, murmelte sie, biss sich dann aber auf die Zunge. Sie spürte Kais verwunderten Blick auf sich und schüttelte den Kopf. »Danke fürs nach Hause fahren«, sagte sie schnell und versuchte damit ihre vorherigen Worte zu überspielen.
»Immer gern.« Er lächelte, und dieses Lächeln betonte seine vollen Lippen.
Eleanor betrachtete den Schlüssel in ihren Händen. An dem Schlüsselring befand sich ein herzförmiger Anhänger, in dem ein Foto von Anna und ihr steckte. Da war wieder das nagende Gefühl in ihrer Brust.
Damit sie nicht weiter auf das Bild ihrer Schwester schauen musste, hielt sie Kai ihre Autoschlüssel hin. Als er sie entgegennahm, streiften seine Finger ihre. Sie waren warm, aber rau. Ein Zeichen dafür, dass er viel mit den Händen arbeitete.
»Du bekommst deinen Wagen wohlbehalten wieder«, versprach er. Seine Stimme war seltsam sanft, als würde er wissen, dass ein einziges harsches Wort sie in diesem Moment zum Weinen bringen würde. Sie konnte sich selbst nicht erklären, warum sie sich ihm gegenüber nicht so kühl zeigte wie vor anderen Fremden. Lag es an seiner Empathie? Er schien genau zu wissen, wie er auf sie reagieren musste.
»Ich habe nichts anderes erwartet«, gab sie leise zu. Auch wenn sie ihn nicht kannte, hatte sie das Gefühl, dass er wusste, was er tat. Und dass ihr Wagen bei ihm in den besten Händen sein würde. So viel Selbstsicherheit strahlte er mit jeder Bewegung und mit jedem Wort aus.
Sein Lächeln wurde breiter. »Wir sehen uns, Eleanor.«
Überrascht wandte sie sich ihm zu und spürte, wie sich ihre Augen unmerklich weiteten. Ein Prickeln fuhr über ihre Haut, als er ihren Namen aussprach. Noch nie hatten vier kleine Worte eine solche Vorfreude in ihr geweckt.
»Bis dann«, sagte sie mit erstickter Stimme und stieg aus. Ihre Beine waren wie Wackelpudding.
Nur die Außenbeleuchtung erhellte die Auffahrt zu ihrem Haus. Zu dieser Jahreszeit wurde es bereits früh dunkel, sodass sie hinter den Fenstern einige Lichter brennen sah. Zögernd drehte Eleanor sich um und warf Kai einen letzten Blick zu.
Der Gedanke daran, ihn bald wiederzusehen, ließ sie unwillkürlich lächeln. Vielleicht sollte sie den Marder suchen und sich bei ihm bedanken. Dieses gefräßige kleine Wesen hatte dafür gesorgt, dass sie zumindest für einen Moment all ihre Sorgen hatte vergessen können.
Die Einsamkeit in ihrem Zuhause.
Den Brief.
Und die Dutzenden Nachrichten, die sie Annabelle geschickt hatte, aber bis heute unbeantwortet blieben.
Kapitel 3 Kai
547 Tage war es her, dass seine Eltern Ferham Creek verlassen hatten und er entschied zu bleiben. Er hatte zwar schon sein ganzes Leben in dieser Stadt mit den zwei Gesichtern verbracht, doch erst, seitdem er allein wohnte, kam sie ihm wie ein Zuhause vor. Es war die Heimat, die er gewählt und die ihn gewählt hatte.
Eigentlich war das ein absurder Gedanke, wenn man bedachte, dass der Tag, an dem Ferham Creek sein wahres Zuhause geworden war, der Tag war, an dem seine Eltern es verlassen hatten. Immerhin bedeutete Zuhause für die allermeisten der Ort, an dem die Familie war. An dem man umgeben war von den Menschen, die man liebte.
Auch auf Kai traf diese Definition zu. Ferham Creek war sein Zufluchtsort, an dem er sich geborgen und sicher fühlte. An dem er angekommen war. Doch seine Familie bestand nicht nur aus seinen Eltern. Da waren noch so viele andere Menschen in seinem Leben, die ihm wichtig waren. Vance zum Beispiel, er war mehr als nur sein Boss, er war ein wahrer Freund, der ihn aufgefangen hatte, als sich seine Eltern dazu entschieden hatten, Ferham Creek und ihr Leben hier hinter sich zu lassen. Kai hatte eine andere Wahl getroffen.
»Hat alles funktioniert mit dem liegengebliebenen Wagen?«, hörte er Vance fragen, als Kai noch am selben Nachmittag die Werkstatt betrat. Vance wischte sich gerade die schmutzigen Hände an einem Lappen ab. »Du warst recht lange weg.«
Der Q3 stand bereits in der Werkstatt. Er hatte eben die defekten Kabel inspiziert. Lange würde die Reparatur nicht dauern. Der Marder hatte Gott sei Dank nicht allzu viel Schaden angerichtet.
Er schüttelte den Kopf. »Es gab keine Probleme, ich habe nur den Fahrdienst für unsere Kundin gespielt. Irgendwie musste sie ja nach Hause kommen.«
Eleanor, rief er sich ihren Namen in Erinnerung, und hätte ihm am liebsten laut ausgesprochen, um ihn auf der Zunge zu testen. Ihm war die junge Frau mit den roten Haaren und den olivfarbenen Augen gleich bekannt vorgekommen. Er hatte sich zwar nicht mehr an ihren Namen erinnern können, aber er wusste, dass sie eine Klassenkameradin seiner besten Freundin Peyton war. Peyton, die wie er von der Westside kam, aber eine Eliteschule auf der Eastside besuchte. Er war Eleanor im letzten Herbst bei einem Event für die Bürgermeisterwahl begegnet, das Peyton organisiert hatte.
Aber Eleanor schien ihn keineswegs wiedererkannt zu haben. Das überraschte ihn nicht sonderlich. Was ihn jedoch überrascht hatte, war ihr Auftreten.
Kai erinnerte sich noch gut an den Tag an der Westside High, an dem er Peytons Freund Charles und dessen Clique kennengelernt hatte. In ihren Schuluniformen hatten sie wie Klone gewirkt. Sie alle hatten dasselbe Bild verkörpert: den Inbegriff von Perfektion.
Doch heute hatte das Bild von Eleanor, der perfekten Eastside-Schülerin, einen Riss bekommen. Und diese Tatsache ging ihm nicht mehr aus dem Kopf.
»Was war das Problem bei dem Wagen?«, wollte sein Boss wissen.
»Nur ein kleiner Marderschaden«, erklärte Kai. »Nichts Wildes. Wenn ich mich jetzt ransetze, kann sie ihn morgen schon wieder abholen.« Eigentlich hatte er es mit solchen Reparaturen nicht eilig, aber es juckte ihn in den Fingern, Eleanor wiederzusehen.
Sie hatte ganz anders auf ihn gewirkt als bei ihrer letzten Begegnung. Ihre Haare waren unordentlich in einem Knoten zusammengebunden, sie trug Sportkleidung und ihr Gesicht ... Hätte Kai ein Beispiel für Traurigkeit geben müssen, wäre der Ausdruck auf Eleanors Gesicht genau das gewesen.
Da war kein Leuchten in ihren Augen gewesen, kein Leben. Die dunklen Ringe unter ihnen ließen vermuten, dass sie mit Schlafproblemen kämpfte. Was auch immer sie so mitnahm, die Spuren waren deutlich zu sehen.
Hatte es denn bisher niemand außer ihm bemerkt?
Das konnte er sich nicht vorstellen. Auch wenn er nicht die beste Meinung von den Bewohnern der Eastside hatte, so kannte er zumindest Charles inzwischen etwas besser. Er war ein loyaler Typ, der sich sogar ans Messer lieferte, um seine Freunde zu beschützen. So jemandem musste doch auffallen, wenn es einer Freundin nicht gut ging.
»Dann sag mir bitte, dass du nicht mit der Kawasaki gefahren bist«, meinte Vance im Scherz.
Kai schielte zu seinem Motorrad hinüber und schmunzelte. »Ausnahmsweise nicht. Da du mir nicht gesagt hattest, wer da liegengeblieben ist, wollte ich nicht riskieren, einer älteren Dame eine Fahrt darauf zuzumuten.«
Wenn er allerdings daran dachte, dass er Eleanor auf der Kawasaki hätte mitnehmen können, bereute er es, nicht mit dem Motorrad gefahren zu sein.
Vance lachte leise. »Das wäre ein Anblick gewesen.«
Kai nickte gedankenverloren, auch wenn er nicht an die ältere Dame auf seinem Motorrad dachte, so wie es Vance vermutlich gerade tat.
Ein Klingeln erklang und kündigte neue Kundschaft an. Vance ließ das Rolltor hinauffahren und zum Vorschein kam Tasha. Sie lächelte zaghaft.
»Hättet ihr Zeit für einen kleinen Notfall?«, fragte sie kleinlaut. Tasha war neben Peyton seine beste Freundin. Sie waren, seit er denken konnte, ein Dreiergespann gewesen.
Kai wandte sich von dem Q3 ab und betrachtete skeptisch ihren alten Wagen, der draußen auf dem Hof parkte. »Was ist los?«
»Irgendwas ist mit der Batterie nicht in Ordnung, die spinnt seit gestern. Wir haben einen Termin beim Arzt und ich will nicht auf halber Strecke plötzlich liegenbleiben«, erklärte sie und warf einen besorgten Blick zu ihrem Großvater, der auf dem Beifahrersitz saß.
Vance tauschte einen kurzen Blick mit Kai, der daraufhin nickte. »Ich kümmere mich zuerst um Tashas Wagen, bevor der Marderschaden dran ist«, entschied Kai dann. Vance würde damit kein Problem haben. Der Audi war zwar vorher gekommen, aber sie beide wussten, dass Tashas Problem Priorität hatte. Wenn ihr Grandpa zum Arzt musste, würden sie alles daransetzen, dass das Auto sie problemlos dort hinbringen würde.
Kai schlenderte nach draußen und klopfte auf das Dach des alten Golfs. »Schön dich zu sehen, Owen. Wie geht’s dir?«, fragte Kai mit einem Lächeln auf den Lippen.
Owen Redfield war ein siebzigjähriges Mitglied der Ferham Falcons und in seiner Jugend ein leidenschaftlicher Boxer gewesen. Vor einigen Jahren hatte er MS diagnostiziert bekommen, und aus dem lebensfrohen alten Mann war ein grummelnder Griesgram geworden. Kai konnte es ihm nicht verdenken. Wenn das Leben nur noch aus Abstrichen, Medikamenten und Schmerzen bestand, war ein Lächeln an manchen Tagen bereits zu viel verlangt.
»Mhm«, war die einzige Antwort, die Kai bekam.
»Willst du aussteigen und dich in der Küche bedienen? Ricarda hat heute Morgen ihre berühmten Ensaimadas vorbeigebracht«, bot Kai ihm an.
Ricarda Hernández wohnte mit ihrer Familie im Woodside Trailerpark, ganz in der Nähe von Kai. Er kannte die Frau schon seit seiner Kindheit, da sie gut mit seinen Eltern befreundet gewesen war. Schon damals war sie eine ausgezeichnete Bäckerin gewesen und ihre Backwaren waren auf der ganzen Westside bekannt.
So bekannt, dass sogar Owen grummelnd aus dem Wagen stieg und in Richtung Küche davontigerte. Er beachtete dabei weder Kai noch Vance. Nicht einmal für seine Enkelin hatte er einen weiteren Blick übrig.
»Er hat seine Medikamente heute nicht genommen«, sagte Tasha leise und als Erklärung für Owens Verhalten.
Kai nickte nur. Sie musste ihm rein gar nichts erklären oder etwas schönreden. Owen verdiente von jedem Verständnis und Rücksichtnahme.
»Du sagst, mit der Batterie stimmt was nicht?«, fragte er an Tasha gewandte und öffnete die Motorhaube.
»Der Motor ist nur schwer angesprungen, und da war so ein klickendes Geräusch beim Starten. Aber wenn die teure Karre da drinnen Vorrang hat, dann ist das in Ordnung, Kai. Du musst mich nicht vorschieben, immerhin war das nicht eingeplant.«
Er sah kurz zu dem Q3 hinüber, winkte aber ab. »Kein Problem. Notfall ist Notfall.«
»Danke«, sagte Tasha und atmete erleichtert auf.
»Nicht der Rede wert.«
Er kontrollierte alle Kabel und die Batterie auf sichtbare Schäden oder Korrosion, doch da war alles, wie es sein sollte. Kurzerhand machte er einen Batterietest, um zu sehen, ob diese hier noch funktionsfähig war oder ersetzt werden musste. Leider war Letzteres der Fall.
»Die ist hinüber«, verkündete er und sah zu Tasha.
Er besorgte sich alle Werkzeuge, die er für den Wechsel der Batterie brauchte, und machte sich umgehend an die Arbeit. Tasha setzte sich neben ihn, lehnte sich an die Motorhaube und betrachtete sein Tun.
»Du warst in letzter Zeit selten im Tipsy Cow. Die Jungs haben nach dir gefragt«, sagte sie in einem ruhigen Ton. Doch Kai hörte die Neugierde darin.
Er zuckte mit den Schultern, während er die Batterie entfernte. »Hatte einfach keine Lust«, gab er kurz angebunden zu.
»Du kapselst dich aber nicht ab, oder?«
»Warum sollte ich mich abkapseln?«, gab er die Frage zurück.
Tasha lachte leise. »Sag du es mir. Man trifft dich nur noch hier an, nicht im Cow, bei keinem der Jungs zu Hause ... seit Jax ...«
»Ich hatte einfach viel zu tun. Mach keine große Sache aus etwas, die keine ist«, schnitt er ihr das Wort ab.
»Bist du sicher?«, hakte Tasha nach.
»Ganz sicher. Die Arbeit hat mich eingenommen, und mir war nicht groß nach Trinken oder Gesellschaft.«
Er war gern allein. Große Menschenmengen waren nicht sein Ding, er genoss es, Zeit für sich zu haben. Seine spärliche Freizeit musste er nicht immer mit den Falcons verbringen, die Gang konnte an manchen Abenden auch auf ihn verzichten. Tasha mochte da anders sein, immerhin war sie recht gesellig, aber er war nun einmal nicht so. Auch er unternahm gern etwas mit den Falcons, schließlich waren sie seine Familie, aber auf der Arbeit war viel los gewesen und er hatte Zeit für sich gebraucht.
Peyton und Tasha waren die Ausnahmen gewesen. Seine beiden besten Freundinnen konnte er nicht abweisen. Sie kamen ohnehin, wann sie wollten.
»Hast du mit deinen Eltern mal gesprochen?«, fragte Tasha weiter. Sie war für Kais Geschmack meistens zu neugierig.
»Ich telefoniere jeden Samstag mit meiner Mom.«
Tasha nickte, immerhin waren das keine neuen Infos für sie. »Wie geht’s Mary? Haben sie sich gut eingelebt?«
Er hielt mit der Reparatur inne und sah Tasha an. Sie war die Einzige der Falcons, die sich nach seinen Eltern erkundigte. Seit seine Eltern Ferham Creek und damit die Falcons verlassen hatten, waren sie für viele andere Mitglieder gestorben.
»Sie sind gut in Tallahassee angekommen. Dad hat einen Job als Klempner gefunden, und Mom arbeitet in einem Blumenladen. Beide sind von der Hitze Floridas begeistert. ›Die Winde hier sind so herrlich warm und mild, ganz anders als die kalte Brise in Ferham Creek‹«, zitierte er seine Mom aus ihrem letzten Gespräch.
»Bereust du es?«, wollte Tasha leise wissen.
Verwirrt sah er sie an.
»Dass du sie nicht begleitet hast«, fuhr sie fort.
Er schüttelte den Kopf. »Florida ist nichts für mich, Ferham Creek ist mein Zuhause.«
»Dann macht es dir nichts aus, dass deine Eltern weg sind?«
Ein Seufzen entkam ihm und er fuhr sich durch die Haare. »Ist nicht so, als hätten sie eine andere Wahl gehabt, Tasha. Sie wollten raus aus der Gang, und der einzige Weg war, Ferham Creek zu verlassen.«
Die Ferham Creek Falcons waren ein eingetragener Motorradclub, doch die Gang verband so viel mehr als nur die Liebe zu den Bikes. Sie waren eine Familie, die in guten und schweren Zeiten zusammenhielt. Und wie bei einer echten Familie gab es da kein Entkommen. Die Falcons waren kein Sportclub, aus dem man einfach austreten konnte. Doch die Gang hatte auch ihre Schattenseiten, ebenso wie ihre schwarzen Schafe. Einige Mitglieder verdienten ihr Geld mit illegalen Geschäften wie Autodiebstahl oder Drogenhandel. Sein Dad war eines dieser Mitglieder gewesen. Auch er hatte mehrfach gegen das Gesetz verstoßen, auch wenn er nie erwischt worden war. Was bis heute an ein Wunder grenzte. Doch irgendwann war es genug. Sein Dad wollte sich ändern, ein besserer Mensch werden, doch hier in Ferham Creek als Mitglied der Falcons war ihm das nicht möglich gewesen. Da war es das Beste, wenn sie die Falcons und die Stadt hinter sich ließen.
»Aber sie haben dich zurückgelassen.«
»Ich bin kein ausgesetzter Welpe, Tasha. Ich bin zwanzig Jahre alt und wohne nun allein. Das nennt man Erwachsenwerden. Wird dir auch bald passieren.«
Tasha verdrehte die Augen und streckte ihm die Zunge raus. »Du weißt ganz genau, dass ich es so nicht gemeint habe.«
Erneut entkam ihm ein Seufzen. »Mir geht’s gut mit ihrer Wahl. Sie haben eine Entscheidung getroffen, und ich ebenfalls. Es war nicht dieselbe, aber das ist ok. Ich kann damit leben, kannst du es auch?«
Tasha biss sich auf die Unterlippe. »Wenn es um meine Mom oder Paps gehen würde ... nein, vermutlich könnte ich das nicht«, gab sie leise zu.
»Owen und Linda sind anders«, versuchte Kai die Lage zu erklären. »Sie haben sich nie etwas zuschulden kommen lassen. Mein Dad hingegen ...«
Jacob Wright hatte sich von Ärger nie fernhalten können. Kneipenschlägerei, Autodiebstahl, Steuerbetrug. Sein Dad hatte alles durch. Vieles davon hatte mit den Falcons zusammengehangen, aber eben nicht alles. Man konnte nicht die Schuld nur auf die Gang abschieben, so wie es sein Vater oft getan hatte. Der Ausstieg bei den Falcons und das Verlassen von Ferham Creek war vermutlich das Beste, das seinen Eltern hätte passieren können. Vielleicht bekam sein Dad so endlich die Kurve.
Die Falcons hatten nur höchst widerwillig ihren Austritt akzeptiert, und durch den Verkauf ihres kleinen Hauses hatten sie sich den Umzug nach Tallahassee finanziert, denn nur so hatten seine Eltern sich das leisten können. Das war auch der Grund, warum er nun im Trailerpark lebte.
»Wir wollten ihm doch helfen«, flüsterte Tasha. Mit wir meinte sie alle Mitglieder der Ferham Falcons.
»Das weiß ich«, versuchte Kai ihr schlechtes Gewissen zu mildern. »Aber das konntet ihr nicht. Mein Dad konnte sich nur selbst helfen, und dafür musste er die Falcons verlassen.«
Er nahm es seinen Eltern nicht übel. Sie brauchten diesen Neuanfang in Tallahassee. Doch bei ihm war es anders. Er liebte die salzige Luft des atlantischen Ozeans. Er mochte die kurvigen Highways, die bis nach Boston an der Küste entlangführten. Er genoss die Fahrten mit den Falcons, die Zeit allein in seinem Trailer und die Unterhaltungen mit seiner Nachbarin Alba, wenn sie ihn abends zu einem Bier auf ihrer Veranda einlud. Das hier war sein Leben, seine Heimat. Das würde er für nichts auf der Welt eintauschen.
Kapitel 4 Eleanor
Zu Hause angekommen empfing Eleanor ein unerwarteter Anblick. Ihre Eltern waren bereits da, obwohl ihr Dad selten vor sieben Uhr nach Hause kam. Sie hörte ihre gedämpften Stimmen aus dem Wohnzimmer.
Sie stellte ihre Sporttasche auf die Treppe, um sie später mit in ihr Zimmer zu nehmen. Bevor sie Richtung Wohnzimmer lief, warf sie einen letzten Blick über die Schulter.
Kai war bereits verschwunden.
Eleanor wusste nicht, was sie erwartet hatte. Aber ein kleines bisschen hatte sie sich gewünscht, dass er noch immer dort stand. Was absurd war. Warum sollte er ihr dabei zusehen, wie sie zur Haustür lief? Er hatte schließlich Besseres zu tun.
Langsam schüttelte sie den Kopf, um wieder Herrin ihrer Sinne zu werden und diese abstrus blauen Augen aus ihren Gedanken zu vertreiben.
Als sie das Wohnzimmer betrat, blickten ihre Eltern nicht auf. Sie saßen zusammen auf dem Sofa, zwischen ihnen hielt ihre Mom ihr Handy hoch, während sie sprachen. Offenbar hatten sie auf Lautsprecher gestellt. Eleanor wollte auf sich aufmerksam machen, doch dann hörte sie die Stimme am anderen Ende der Leitung: Annabelle. Ihr Herz machte einen Satz.
»Deine Genesung steht an oberster Stelle, Liebling. Tu nichts, was dem im Weg steht«, sagte ihre Mom sofort.
»Wir wollen nur das Beste für dich, Anna. Wenn du der Meinung bist, dass du Zeit für dich brauchst, dann verstehen wir das. Und Len sicherlich auch«, pflichtete ihr Vater bei.
Verstehen? Was genau sollte sie verstehen?
Etwa, dass ihre Schwester sie seit Wochen ignorierte?
»Ich hoffe es, denn ich will nicht mit ihr sprechen«, hörte sie Annabelles Stimme durch den Hörer – schwach, aber doch voller Entschlossenheit.
Dieser eine Satz traf sie wie ein Schlag ins Gesicht. Es war, als könnte sie spüren, wie ihr Herz kleine Risse bekam, die sich unaufhörlich vergrößerten, bis das bescheuerte Organ drohte, gänzlich zu zerbrechen.
Eleanor fühlte sich, als würde ein kalter Schatten über sie fallen. Die Worte ihrer Schwester schnürten ihr die Kehle zu und ließen sie kaum atmen. Der Schmerz war überwältigend ... als würde die schwache Verbindung, die sie zu Annabelle hatte, nun gänzlich reißen.
Tränen stiegen ihr in die Augen, während sie versuchte, ihre Emotionen zu bändigen. Warum wollte Anna nicht mit ihr sprechen? Was hatte sie getan, um so behandelt zu werden? Die Fragen schwirrten in ihrem Kopf und verstärkten den stechenden Schmerz in ihrer Brust. Es war nicht nur die Traurigkeit über die Distanz zwischen ihnen – es war das Gefühl der Ablehnung, das wie ein glühendes Messer in ihr Herz schnitt.
»Wir respektieren deine Entscheidung«, bekräftigte ihre Mom. »Wir werden nichts tun, was du nicht möchtest. Versprich uns nur, dass du weiterhin dein Bestes gibst. Die Klinik ist die beste im Bundesstaat, du wirst bald wieder auf den Beinen sein.«
Eleanor ballte die Hände, die schlaff an ihren Seiten herunterhingen, zu Fäusten. Vor einigen Wochen war Annabelle nach Hause gekommen. Aber nicht, um sie zu besuchen.
Sie war nach Ferham Creek geflohen, damit sie ihrer Sucht entkam. Der Sucht nach Ritalin, auch bekannt als Methylphenidat, das eigentlich für die Behandlung von ADHS und Narkolepsie eingesetzt wurde. Anna hatte nichts von beidem. Sie hatte es zu sich genommen, um ihre Leistung und Konzentration zu steigern.
Niemand schien bemerkt zu haben, in welche Abhängigkeit Anna gerutscht war. Bis es kaum mehr zu übersehen gewesen war. Die Schlaflosigkeit, ihre andauernde Nervosität, die beinahe Paranoia geglichen hatte, ihr erhöhter Herzschlag, die Appetitlosigkeit und die Angstzustände.
Auch Eleanor war es nicht aufgefallen. Erst als sich Anna mehr und mehr isolierte, wurde sie misstrauisch. Aber mit einem Suchtproblem hätte sie niemals gerechnet.
Anna war wegen Thanksgiving nach Hause gekommen, doch statt einem schönen Familienfest hatte eine dunkle Überraschung auf sie gewartet. Anna hatte Hilfe gebraucht. Und diese Hilfe hatte sie bekommen, nur nicht hier, sondern in einer speziellen Klinik für Suchtopfer.
Seitdem war ihre Schwester nicht mehr dieselbe. Ob ihre Mom recht behielt und Anna wieder auf die Beine kam, blieb abzuwarten.
Eleanor jedenfalls hoffte es, denn mit der aktuellen Situation kam sie nicht zurecht. Sie kam nicht damit klar, dass die Schwester, zu der sie aufgesehen hatte, suchtkrank war. Sie kam nicht damit klar, dass Anna keinen Kontakt zu ihr wollte. Und sie kam nicht damit klar, dass das für ihre Eltern völlig in Ordnung war.
Das Fechttraining und die Autopanne hatten sie ausgelaugt. Sie hatte den ganzen Tag bereits das Gefühl gehabt, gegen unsichtbare Gegner zu kämpfen. Doch das war nicht der Grund für ihre anhaltende Erschöpfung. Es war das ständige Gefühl der Einsamkeit, das sie wie ein schwerer Mantel umhüllte. Jetzt noch stärker als zuvor.
Sie fühlte sich wie ein Schatten in ihrem eigenen Zuhause. Bei den wichtigen Entscheidungen und Gesprächen wurde sie außen vor gelassen. Ins Abseits gestellt. Sie wollte nichts mehr, als zu ihren Eltern zu treten und Teil dieses Telefonats zu sein. Doch das wurde ihr verweigert.
Eine Mischung aus Schluchzen und Schnauben entkam ihr, und ihre Eltern wurden auf sie aufmerksam. Beide verstummten sofort und sahen sich an – ein stummer Austausch voller Besorgnis und unausgesprochener Worte. Einer Besorgnis, die ihnen seit Wochen anhaftete. Seit Anna vor ihrer Tür gestanden hatte und nicht mehr dieselbe war. Seit diesem Moment hatte Eleanor das Gefühl, dass sich ihre Eltern vor allem und jedem fürchteten, dass sie sich in jeder wachen Sekunde um ihre beiden Töchter sorgten.
»Anna wir legen auf, Eleanor ist nach Hause gekommen«, sagte ihre Mom. »Wir sprechen nächste Woche wieder.«
Die Stimme ihrer Schwester war nicht mehr zu hören. War Eleanors Anwesenheit so unerträglich, dass Anna allein bei der Erwähnung ihres Namens sofort auflegte? Ein weiterer Stich in ihr geschundenes Herz.
»Len!«, rief ihr Dad hastig, er versuchte euphorisch zu klingen, doch es gelang ihm nicht. Aus seiner Stimme war das Unbehagen herauszuhören, gemischt mit Schuldgefühlen.
Warum hatte er Schuldgefühle? Anna war diejenige, die nicht mit ihr reden wollte und ihr nicht einmal einen Grund dafür nannte.
»Wie war das Training?«, versuchte ihr Dad ein Gespräch zu beginnen.
»Es war gut«, murmelte sie. Obwohl sie sich bemühte, ihre Enttäuschung zu verbergen, spürte sie die Kälte in ihren Worten, dieselbe Kälte, die sich in ihrem ganzen Körper ausgebreitet hatte, und mit der sie dem Titel der Eiskönigin alle Ehre machte. »Ich habe gehört ...«
»Das ist nicht wichtig«, unterbrach ihre Mom sie und stand auf. Ihr Blick war auf das Fenster gerichtet, als gäbe es dort etwas Interessantes zu sehen. Seit der Sache mit Anna hatte ihre Mom einen Teil ihrer Souveränität eingebüßt. »Annabelle geht es gut, und wir wollen nicht, dass du dir Sorgen machst.«
»Aber das tue ich, Mom«, sagte Eleanor leise. »Ich will doch nur wissen, wie es ihr geht. Ich will nur für eine Minute mit ihr reden.« Ihre Stimme klang wie ein Flehen, ein Betteln, und Eleanor würde noch viel weitergehen, wenn das bedeutete, mit Anna sprechen zu dürfen.
»Eleanor, bitte«, entgegnete ihre Mom sanft, aber nachdrücklich. »Die Situation ist kompliziert. Anna braucht Zeit für sich. Zeit, um gesund zu werden.«
Was in Wahrheit in den Worten ihrer Mutter mitschwang, war, dass Anna Eleanor nicht brauchte.
Die Splitter ihres geschundenen Herzens schnitten ihr ins Fleisch. Genauso fühlte sich dieses Gespräch für sie an.
»Ich will doch nur für sie da sein«, versuchte Eleanor es erneut. Ihre Stimme brach am Ende, und sie spürte, wie ihr die Tränen in den Augen brannten.
»Wir versuchen nur, das Beste für alle zu tun«, erklärte sich ihr Dad mit einem entschuldigenden Blick. »Annabelle hat mit ihrer Sucht zu kämpfen. Das ist nicht leicht für sie – für keinen von uns.«
»Anna ist dort gut aufgehoben. Wir können von hier aus nichts für sie tun, aber wir dürfen nicht in unseren Sorgen ertrinken«, fuhr ihre Mom fort. Sie atmete tief durch und wandte sich dann mit einem sanften Lächeln an Eleanor. »Heute gab es fantastische Nachrichten von der Gemeinde. Auf dich wartet ein unvergessliches Ereignis.«
Verständnislos sah sie ihre Mutter an. »Auf mich? Wieso?«
Die Augen ihrer Mom begannen zu leuchten, und sie kam auf Eleanor zu. »Die Gemeindevertretung und der Kulturverein haben entschieden, dass wir anlässlich der 350-Jahr-Feier unserer Stadt das Debütantinnenprogramm wieder aufnehmen. Alle jungen Frauen, die dieses Jahr volljährig werden oder geworden sind, dürfen daran teilnehmen. Ich habe dich angemeldet«, sagte sie voller Euphorie.
Eleanor hielt den Atem an. »Du hast was?« Mehr brachte sie nicht hervor.
»Du bist dieses Jahr Debütantin«, fasste ihre Mom es noch einmal zusammen. Ihr Lächeln strahlte nun so hell, als wären es die besten Neuigkeiten seit Langem.