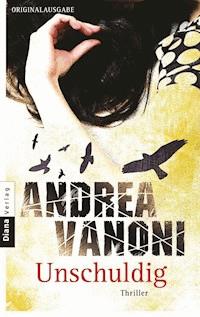Inhaltsverzeichnis
Die Autorin
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Copyright
Andrea Vanoni im Gespräch
In Ihrem neuen Thriller muss Paula Zeisberg, die Leiterin der neunten Mordkommision in Berlin, Mordfälle an jungen Frauen aufklären, die post mortem misshandelt wurden. Wie sind Sie beim Schreiben vorgegangen?
Obwohl es bei diesem Fall um Abgründe menschlicher Gewalt geht, war es mir wichtig, dem Leser immer wieder Ruhepausen zu gönnen. So wird die Perspektive des Täters hier nicht erzählt, sondern man erfährt nur durch Paulas Ermittlungen, was den Opfern widerfahren ist. Dass Paula selbst in höchste Gefahr gerät, kann ich dem Leser allerdings nicht ersparen.
Paula arbeitet sehr eng mit der neuen Rechtsmedizinerin Martina Weber zusammen, einer Expertin auf ihrem Gebiet, die die Toten mit Ehrfurcht und großem Respekt untersucht.
Ich wollte mit Dr. Martina Weber eine Figur schaffen, die sowohl rational und schnell handelt als auch gleichzeitig verletzlich und unsicher sein kann. Nur wenige wissen, was in der Rechtsmedizinerin vorgeht, auch Paula nicht, aber die beiden Frauen beobachten sich und halten viel voneinander.
Sie lassen Ihrer Heldin nicht viel Zeit für ein Privatleben - gibt es trotzdem Hoffnung für Paula und Jonas?
Wenn ich einen Liebesroman schreiben würde, dann auf jeden Fall. In diesem Krimi ist Paula allerdings sehr auf sich allein gestellt. Aber Jonas ist bei ihr, zumindest in Gedanken …
Die Autorin
Andrea Vanoni, geboren 1963, war nach ihrem Studium als Assistentin am Wiener Burgtheater und als Dramaturgin am Kieler Opernhaus tätig. Heute arbeitet sie als selbstständige Agentin für Drehbuchautoren, Regisseure und Kameraleute und pendelt zwischen Maastricht und Berlin-Wilmersdorf hin und her. Nach »Totensonntage« und »Im Herzen rein« ist »Seelenruhig« ihr dritter Roman.
Prolog
Stolz aufgerichtet, mit flatterndem Haar und im weißen langen Hemd steht sie auf dem Schinderkarren. Hoch zu Ross reitet ein Büttel mit blankem Schwert voraus. Raunend steckt das Publikum die Köpfe zusammen, gierig und atemlos gespannt, wie sich der Engel der Schmerzen verhalten wird.« Er wird mit seinen zwölf Jahren fast zum Poeten, wie er so vor sich hin wispert.
Es ist nicht die erste Hinrichtung, bei der er zuschaut, doch wieder spürt er Wildheit und Ehrfurcht zugleich. Ihre zarten Handgelenke stecken in Eisenfesseln, die mit Ketten an dem Karren befestigt sind. Ihre leuchtend blauen Augen sind zum Himmel gerichtet. Ob sie wohl Gott anruft?
Er imitiert eine aufgeregte Frauenstimme und presst hervor: »Zündet sie an!« Dabei bewegt er eine der Mädchenfiguren, die in vorderster Reihe stehen und dem Wagen ausweichen müssen.
»Nur Geduld, der Henker wird ihr mit seiner Fackel schon die Füße kitzeln!«, ruft er mit geröteten Wangen. Für einen kurzen Moment hält er die Hexe in die Flamme seines Feuerzeugs.
Dann schnappt er sich das Fischweib, das einen Korb unter dem Arm trägt, und raunzt: »Sie wird ins Feuer pieseln!« Er imitiert ein höhnisches Gelächter, eher ein Quaken. »Bei dem Fuder Holz ist ihr Angstwasser nur ein Tropfen in die heiße Hölle!«
Während er den Wagen weiter zum Hinrichtungsplatz schiebt, mit einem Bleistift vorsichtig die mittelalterliche Menge zurückdrängt und Pfaff und Henker in Position bringt, flüstert er erregt: »Mitleid? Nein! Eine Kirmes - da braucht man eine Hinrichtung.« Eine Trompete - tätätätät. Alle sehen zum Rathaus. Die feinen Herren auf dem Rundbalkon nicken träge dem Volke zu, dem sie heute eine Freude bereiten.
Aber den Gedanken hat er sofort wieder vergessen. Er springt im Geiste unter die mittelalterlichen Zuschauer ganz vorne in die erste Reihe. Ihm glüht das Gesicht, denn direkt vor ihm hält der Karren. Die Henkersknechte springen herbei und lösen die eisernen Fesseln der Jungfrau. Als ihr weißes Kleid verrutscht, kann er die Spuren der erlittenen Marter sehen - klaffende Wunden an den Beinen, braune, violette und rote Hautpartien. Das zerquetschte Gewebe und die geplatzten Adern zeugen von der Erbarmungslosigkeit der Inquisitoren. Doch auf ihren Lippen, die rot und geschwollen sind, liegt ein Lächeln. »Das Lächeln des Teufels«, murmelt er wie im Fieber. Er weiß, dass der Teufel die Tränen austrocknet, denn sie würden Gott erbarmen, und er würde der Qual ein Ende setzen. Daher befeuchten manche Hexen ihre Wangen mit Speichel, um ein Weinen vorzutäuschen.
Während er alles noch einmal in Ruhe betrachtet, greift seine Hand nach dem Wurstbrötchen auf dem Teller neben sich. Er beginnt langsam zu kauen und stellt ein paar Figuren vor den Scheiterhaufen - den Richter mit den Schöffen -, würdig und streng. In gebührender Distanz zu ihnen schiebt er die Figur des Scharfrichters vor die Leiter, über die die Verurteilte hinaufsteigen wird. Breitbeinig steht er da, mit verschränkten Armen, nackt und muskulös. »Die rote Kapuze und die blutbefleckte Lederschürze sind die Insignien aller Höllenschmerzen, die auf den weißen Menschenleib warten«, liest er sich laut aus der Beschreibung für die Figuren vor.
Ein Stück Wurst ist auf die Tischplatte gefallen. Er beugt sich herab und packt es wie ein Hund mit den Zähnen. Er schluckt und brüllt: »Hure! Metze! Du höllische Dirne! Teufelsbraten und Kinderverderberin!« Bei jedem Ausdruck wechselt er die Stimme, um die hasserfüllten Flüche eines aufgebrachten Volkes zu imitieren.
»Aber sie nimmt es kaum noch wahr. Am ganzen Leib zitternd, hängt sie mit gesenktem Haupt in den Armen ihrer Peiniger.« Er stellt die zum Tode Verurteilte auf den Scheiterhaufen und platziert einige Henkersknechte um sie herum. »Demut hat sich in ihr ausgebreitet. Aber jetzt hebt sie doch wieder ihr schönes Gesicht, das wie durch ein Wunder fast gänzlich unversehrt geblieben ist. Ihre Augen leuchten, und ein Lächeln voller Verachtung trifft die Umstehenden. Und dann geschieht es.« Er knipst ein paarmal die Stehlampe neben sich an und aus. »Ein Blitz zuckt herab vom Himmel, der Pöbel schreit auf, und in dem grell flammenden Licht sehe ich ihren Blick auf mich gerichtet. Heiß durchfährt es mich. Ich frage mich, ob der Blitz wirklich vom Himmel kommt oder ihren Augen entwichen ist, um mich zu bannen oder vielleicht sogar zu vernichten. Der Krüppel vor mir beginnt hysterisch zu zucken.« Mit zwei Fingern nimmt er die Figur eines Bettlers ohne Beine und schüttelt sie. Er packt auch noch andere und stößt kleine Schreie aus, die das Verbrennen der Hexe fordern.
Plötzlich springt er auf, rennt in die Küche und holt sich einen Schokokuss, den er gierig verschlingt. Er leckt seine Finger ab, reibt sie an einem Taschentuch sauber und packt das Mädchen im weißen Hemd, um sie zu quetschen, als käme sein Schluchzen aus ihrer Brust. Er beugt sich über die Szene und führt mit roten Ohren alles leise und angespannt zu Ende. Der Henker steigt die Leiter hinauf, nimmt einen Strick, den der Junge in einem kleinen Wassereimer mit echtem Wasser tränkt, und fesselt ihre Handgelenke. Er zieht fest zu und imitiert ihr schmerzvolles Aufstöhnen. Er reißt sie hoch und stellt sie mit dem Rücken an den Pfahl. Mit sicheren Griffen schlingt er den Strick um sie und zurrt ihn so fest es geht. Als der Henker vom Scheiterhaufen wieder herabgestiegen ist, nimmt er von einem seiner Knechte die Fackel. Er streckt sie siegessicher in den Himmel wie ein Feldherr vor der Schlacht sein Schwert.
Der Pöbel schreit auf, Rufe der schmutzigsten Art ertönen.
Ungerührt hält der Henker die Fackel an das Reisig. Das Feuer springt schnell auf die untere Lage Knüppelholz über. Gierig fressen sich die Flammen in das Innere des Haufens. Am Anfang sieht es aus, als ob sich das Feuer versteckt. Nur die schimmernde Glut und ein Flimmern in der Luft verraten es. Dennoch geben die winzigen, aus Birkenholz bestehenden Knüppel das Feuer an die Buchenscheite weiter. Er drückt auf die Stopptaste seines Rekorders, der vorfabrizierte Sound einer johlenden Menschenmenge verstummt. Es ist so still, dass er das Knistern des Feuers hören kann.
»Das Mädchen sieht mit dem Ausdruck eines zu Tode gehetzten Tieres auf die emporkletternden Flammen. Voller Entsetzen windet es seinen geschundenen Leib und wirft den Kopf von der einen zur anderen Seite. Die Haare schlagen über das Gesicht. Die aufsteigende Hitze bläst ihr unter das Hemd. Flatternd weht der bereits brennende Saum über ihre Schenkel. Sie trägt nichts weiter am Leibe, und die Flammen beleuchten ihren schönen schlanken Körper. Erste Flämmchen lecken an ihren Füßen. Sie verkrampft sich. Die Flammen steigen unaufhörlich, und schon steht sie bis zu den Knien im Feuer.« Er kann den Text auswendig, wenn er ihn auch jedes Mal ein wenig variiert.
Wegen der Hitze wirft die Farbe der Figur Blasen und beginnt abzublättern. Ihre bleiernen Unterschenkel schmelzen, und sie sackt zusammen.
Fasziniert betrachtet er das Herabtropfen des Bleis. »Vor Schmerzen hat sie ihre Zunge zerbissen und spuckt das Blut aus. Angeekelt kreischt die umstehende Menge auf und weicht zurück. Ich nicht, ich bleibe stehen.« Er taucht eine Fingerspitze in das flüssige Blei und schmiert es sich ins Gesicht. »Ich mache mir nicht einmal die Mühe, mir das Blut aus dem Gesicht zu wischen. Die Qualen der vor mir im Feuer stehenden Hexe stählen meine Muskeln. Ich spüre meine Kraft und heldenhafte Zuversicht. Nichts wird mich je verletzen können.« Mit einem Schraubenzieher schiebt er den Kopf und die Reste der Figur in das Feuer. »Wird sie noch lange durchhalten? Ihre verzweifelten Schreie überschlagen sich und gehen bereits in ein kraftloses Gurgeln über.« Er schreit und gurgelt. »Roter Schaum quillt ihr aus dem Mund. Doch ihr Leben kehrt zurück, und heftig schlägt sie mit dem Hinterkopf gegen den Pfahl, die gefesselten Hände ringend. Der inzwischen trockene Strick zieht sich fester. Lichterloh brennt das Hemd. Der Geruch von versengtem Fleisch steigt mir in die Nase.«
Knisternd bricht der kleine Scheiterhaufen in sich zusammen, und der Kopf fällt schmelzend hinein. Eine winzige Explosion schießt einen Schwall von Funken aus dem Pfahl, an den sie gefesselt war.
»Ein viehisches Brüllen tönt aus der Flamme. Es ist unfassbar, denn dort in der Feuersäule steht sie in der Hochzeit ihrer Schmerzen. Seht, der Satan holt sie!« Er imitiert den Schrei einer Hysterikerin. »Ja, wirklich, es sieht so aus, als würden sich zwei Gestalten in dem Feuer bewegen! Kämpfen sie? Mir wird unheimlich, obwohl ich mir sage, dass es nur eine Täuschung sein kann. Bewegung kommt unter die Leute, nicht wenige ergreifen die Flucht.« Mit einer schroffen Handbewegung schiebt er die Figuren fort, sodass sie weit über den Teppich purzeln.
Das Feuer auf dem großen Kupfertablett flammt noch einmal auf und fällt dann in sich zusammen.
»Jubel bricht aus, die Freude ist groß! Gott triumphiert, der Teufel ist vertrieben! Am Pfahl hängt ein verkohlter, zusammengekrümmter Leichnam. Der Mund ist wie im Schrei erstarrt, die Zähne stehen glänzend hervor, die Augen gleichen Bratäpfeln.« Er hebt den Kopf und schnuppert. »Unheilvoll schwebt eine dunkle Wolke über der Stadt. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die nächste der fünfunddreißig vom Teufel Besessenen den Holzstoß besteigen muss. Oder denket ihr Magas, dass ihr dem Urteil entrinnen werdet? - O nein, o nein, das wird euch nicht gelingen … denn Alles ist Eins, und Eins ist Alles.«
Er keucht, der brenzlige Rauch bringt ihn zum Husten, während er Rosenblätter auf die Zerschmolzene streut.
Plötzlich ertönt die Stimme seiner Mutter, streng und unerbittlich: »Komm her! Aber sofort!«, und auf ist er, rennt ins Bad, bürstet sich Hände und Nägel, fährt sich mit dem nassen Kamm glättend durchs Haar. O Gott, bitte, bitte, tu mir nicht weh!
1
Er besuchte sie viel zu selten, aber sein Job bei Ärzte der Welt erlaubte ihm kein normales Privatleben. Es war schon ein Wunder, dass er am Silvestermorgen gekommen war und sie die Tage seither vollkommen ungestört genießen konnten. Zwar hatte Paula Bereitschaftsdienst, und jedes Klingeln ihres Handys hätte das Ende ihrer Zweisamkeit bedeuten können, aber seit Weihnachten hatte es Gott sei Dank keinen Mord mehr gegeben. Jeder Tag, jede Stunde war ein Geschenk. Wenn man einmal vom Regen absah.
»Ich habe schlechtes Wetter mitgebracht«, hatte Jonas lachend gesagt, als sie ihn vom Flughafen abholte.
Und er hatte recht: Mit seiner Landung hatte der Regen eingesetzt und bis zu seiner Abreise nicht mehr aufgehört. Sie wollten eigentlich am Silvesterabend irgendwo schön essen gehen, aber man wäre schon allein von der Haustür bis zum Taxi klatschnass geworden. Jonas schlug vor, zu Hause in der Küche zusammen etwas zu improvisieren. Der Vorschlag gefiel ihr, denn sie hatte vorher noch eingekauft. Um Mitternacht begrüßten sie das neue Jahr mit Champagner im Bett. Es regnete die ganze Nacht hindurch und hörte auch die nächsten Tage nicht auf. Manchmal standen sie am Fenster und hielten Ausschau, ob es nicht endlich besser werden würde, aber die Wolken türmten sich wie düstere Kathedralen, und der finstere Himmel schien die Stadt zu erdrücken, die mit flimmernden und flackernden Lichtern unter ihm lag. Dann sackten die Wolkenberge plötzlich in sich zusammen und schütteten ihre Wassermassen auf Dächer und Balkone und in die Straßen.
Paula und Jonas verbrachten die meiste Zeit im Bett. Einmal versuchten sie, das Haus zu verlassen, sprangen aber zurück, als die erste Wasserfontäne eines viel zu schnell vorbeifahrenden Autos sie vollspritzte. Durchnässt standen sie im Fahrstuhl und küssten sich.
Paulas Wohnung lag nach hinten hinaus, und vor ihren Fenstern im sechsten Stock sah sie die Wipfel der Pappeln und Buchen aus dem Grüngürtel zur Fasanenstraße hin. Manchmal ließ der Regen ein wenig nach, und es wurde bis auf die rauschenden Dachrinnen und gurgelnden Abflüsse still. Es war wie ein Luftholen und eine Hoffnung, er würde nun endlich aufhören, aber dann frischte der Wind wieder auf, bewegte die Zweige der Bäume und kündigte die nächste Öffnung der Schleusen an. Schließlich kamen die ersten Nachrichten von Überschwemmungen am Rhein und an der Elbe.
Jonas war schlimmere Katastrophen gewöhnt und bestand mit bester Laune darauf, eine Stadtrundfahrt im Taxi zu machen. Auf den Straßen waren kaum Passanten zu sehen. Zwei Männer in Kapuzen tauchten schemenhaft auf, Bierdosen in der Hand, die sie wütend dem Wasser-Taxi hinterherwarfen.
»Das wär eine Farbe für dich«, sagte er gut gelaunt und deutete auf eine Frau im roten Regenmantel, die die Häuserwände entlanghastete.
»Du meinst, Rot steht mir?«
»Ja, unbedingt«, sagte er und küsste sie.
Der Regen klatschte auf die verdreckten Straßen und die grauen Häuser. Er fiel auf Parkhäuser und Bürogebäude, auf türkische Kebab-Buden und düstere Eckkneipen und tauchte das Kopfsteinpflaster in der Mommsenstraße in glänzendes Grau. Er fiel auf die neue Wohnanlage am Lietzensee, deren Fenster noch mit Plastikfolie geschützt waren. Die Fundamente in den tiefen Baugruben standen seit Tagen unter Wasser. Er prasselte auf den Engel auf der Siegessäule und die geschwungenen Dächer der Philharmonie. Er fiel auf die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße, die nun wie reines Gold glänzte, und auf die über 2 700 Stelen des Holocaust-Denkmals. Es regnete auf die Reichstagskuppel und das Rote Rathaus.
»Was ist das da?«, fragte er.
»Der Berliner Dom. Die Hauptkirche des norddeutschen Protestantismus.« Und als die Museumsinsel ins Blickfeld kam, sagte sie: »Und sieh mal dort, die Museumsinsel sieht jetzt tatsächlich wie eine Insel aus.«
»Wäre ein schöner Platz für uns«, sagte er und zog sie enger an sich.
Er wollte auch unbedingt die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz sehen und anschließend den Gendarmenmarkt, weil er gelesen hatte, dass das einer der schönsten Plätze Europas sei.
Also fuhren sie zunächst über die Straße des 17. Juni bis hin zum Brandenburger Tor.
»Das ist die Quadriga«, sagte der Taxifahrer.
Unter den Linden vor dem Hotel Adlon ließen sich zwei junge Männer mit Regenschirmen von einem livrierten Bellboy die teuren Lederkoffer aus ihrem schwarzen Mercedes tragen. In der Ferne erhaschte Paula ein paar Blicke auf die hohen Gebäude des Potsdamer Platzes, das Sony Center, den gläsernen Bahn-Tower, den Kollhoff-Tower mit dem schnellsten Aufzug Europas. An den Hackeschen Höfen zerrte eine alte Frau ihren Dackel bei Rot über die Ampel in Richtung S-Bahn-Treppen. Sie hatte ihm eine Plastiktüte mit Öffnungen für Kopf und Beine über den Körper gezogen.
Als sie an der zehn Meter hohen Uhr ankamen, stiegen sie doch nicht aus, denn sie konnten sie auch gut vom Taxi aus sehen. Obgleich es sonst ein beliebter Treffpunkt für die Berliner war, war kein Mensch dort. Die viele Tonnen schwere Uhr mit ihren vierundzwanzig Zeitzonen, durch die Jonas so oft um die Erde flog, ließ Paula schmerzlich an seinen Abschied denken. Er war die große Liebe ihrer Kindertage gewesen, aber erst im letzten Jahr hatten sie zueinandergefunden. Bloß eine Affäre, hatte sie anfangs gedacht, aber mittlerweile wünschte sie, dass vielleicht mehr daraus werden könnte. Doch leider erwartete man ihn in wenigen Tagen im Libanon.
Der Taxifahrer deutete auf die Spitze des Fernsehturms, die im Nebel fast verschwunden war. »Eine Million Touristen besuchen die Aussichtsetage jedes Jahr«, erklärte er. »Zweihundert Meter hoch. Da kann man bis vierzig Kilometer weit gucken.«
»Aber heute sind’s wohl keine hundert Meter«, erwiderte Jonas freundlich.
Paula erinnerte sich an den Besuch ihrer Schwester im letzten Jahr. Sie waren mit dem Aufzug in die Etage über die Aussichtsplattform gefahren, wo sich das Telecafé befindet. Während Manuel, Paulas Neffe, Pommes rot-weiß verputzte und sie sich von ihrer Schwester den neuesten Tratsch von zu Hause berichten ließ, hatte sich das Café in einer halben Stunde einmal um die eigene Achse gedreht.
Am Gendarmenmarkt stürzte der Regen in rasendem Tempo durch die Rinnsteine auf einen Abfluss zu, und immer wieder hörte Paula die Sirenen der Unfall- und Polizeieinsatzwagen. Ein Ehepaar - beide trugen grüne Kopfbedeckungen und die gleichen braunen Regenschirme - stand mit langen Gesichtern am geschlossenen Portal des Französischen Doms. Paula und Jonas bewunderten aus dem Wagen heraus die Kuppelbauten der beiden Zwillingskirchen. Im ehemaligen Schauspielhaus gab es am Abend ein Konzert mit Beethoven-Sinfonien, aber Paula war froh, dass Jonas die wenige Zeit, die sie zusammen hatten, nur mit ihr verbringen wollte.
Es freute sie, dass ihn diese originelle Sightseeingtour amüsierte. In Tiergarten wurden die vier- und fünfstöckigen Häuserzeilen von Villen und kleinen Parks abgelöst, und ein Stück weiter öffneten sich schöne Alleen. Sie fuhren durch das Botschaftsviertel - vorbei an den Repräsentanzen Österreichs, Italiens, Japans, Saudi-Arabiens, Süd-Koreas, den Nordischen Botschaften und Mexikos - und schließlich zurück in die Uhlandstraße.
Auch in den Nächten mit Jonas und selbst noch im Schlaf hörte sie den Regen. In ihrem Traum war er ein Vorhang aus bunten Perlen, die klackernd aneinanderschlugen. Etwas hinter diesem Vorhang winkte sie heran, aber sie konnte nicht erkennen, was es war.
Paula war glücklich. Der einzige Wermutstropfen war, dass sie es nicht geschafft hatte, vor Jonas’ Besuch die Wohnung noch renovieren zu lassen. Eigentlich hatte sie es selbst machen wollen, aber dann reichte einfach nie die Zeit dafür. Und so hatte sie es immer weiter vor sich her geschoben, und nichts war passiert. Im Flur und im Bad standen zahlreiche Umzugskartons herum, die sie auch noch nicht ausgepackt hatte.
Dann kam der Tag des Abschieds, und das Geräusch des Regens begleitete ihre Traurigkeit. Gegen Abend wurde es kalt, der graue Matsch bildete auf den nassen Straßen eine Eisschicht. Im Radio wurden die Autofahrer vor erhöhter Unfallgefahr gewarnt.
Paula hatte keine Lust, nach draußen zu gehen. Sie schmiegte sich an Jonas, als könnte sie damit die Zeit anhalten, doch es blieben ihnen nur noch wenige Minuten. Er hatte ihr angeboten, ein Taxi zum Flughafen nach Schönefeld zu nehmen, aber sie schüttelte den Kopf. Sie wollte mit ihm so lange zusammenbleiben, wie es nur ging.
Die Straßen waren zwar glatt, aber es hatte aufgehört zu regnen, und überall waren Streuwagen im Einsatz. Dennoch brauchte sie mit ihrem Wagen über zwei Stunden. Zusammen zogen sie seinen Koffer zum Check-in. Sie standen eng umschlungen, bis sein Flug zum letzten Mal aufgerufen wurde und sie sich voneinander lösen mussten. Traurig und mit einem Gefühl von Leere ging sie über den Parkplatz zurück zu ihrem Auto. Ein scharfer, eisiger Wind schlug ihr ins Gesicht.
Als sie nach Hause kam und die Tür aufschloss, fühlte sie sich noch elender. Im Schlafzimmer warf sie sich auf das zerwühlte Bett, und als ihr Jonas’ Duft aus den noch warmen Laken in die Nase stieg, brach sie in Tränen aus.
2
Den nächsten Tag verbrachte sie allein. Die meiste Zeit saß sie mit angezogenen Beinen auf dem Fensterbrett und schaute in den Innenhof hinaus in den Regen. Sie fröstelte trotz der aufgedrehten Heizkörper. Draußen wurde der Himmel schließlich dunkel, und dann war es auch schon Nacht. Müde wurde sie nicht. Sie vermisste Jonas und fühlte sich unbeschreiblich verlassen.
Es war schon nach elf, als ihr Handy klingelte. Für einen kurzen Augenblick hoffte sie, dass es Jonas war, der zu ihr zurückkommen wollte. Aber als sie die Stimme hörte, wusste sie sofort, dass ein Mord geschehen war. Ein Beamter informierte sie über einen Leichenfund auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof.
»Wer ist von der Staatsanwaltschaft dabei?«, fragte sie.
»Staatsanwältin Gregor.«
Sie hatte Chris Gregor in der letzten Zeit nicht oft gesehen und freute sich jetzt, sie zu treffen. Auch wenn der Anlass weniger erfreulich war.
In den vergangenen Monaten hatte Paula an einem langweiligen Fall gearbeitet, bei dem der ermittelnde Staatsanwalt Dr. Schmitteneiner war, ein dröger Typ, der seine Erfolge seinem Steckenpferd verdankte: der Strafprozessordnung. Alle nannten ihn »Schmitt-im-Eimer«, weil das eine seiner häufig verwendeten Redewendungen war. »Diese These ist doch jetzt im Eimer«, pflegte er zu sagen, wenn er eine von Paulas Überlegungen verwarf.
Chris! Wir sollten uns wirklich mal wieder einen gemütlichen Weiberabend machen, dachte Paula. Wein trinken und über die Kollegen lästern. Normalerweise gab es keine Freundschaften zwischen der Staatsanwaltschaft und der Kripo, aber mit Christiane Gregor war es etwas anderes. Ihr war sie bei einem der letzten Fälle sehr nahegekommen.
Während Paula sich anzog und das Nötigste zusammenpackte, überlegte sie, wo der Friedhof sein könnte. Sie kannte den Waldfriedhof in Zehlendorf, den Dahlemer St.-Annen-Friedhof, sie hatte auch schon einmal auf dem Südwestfriedhof in Stahnsdorf zu tun gehabt, aber da es etwa dreihundert Friedhöfe in Berlin gab, war es sicherer, auf der Karte nachzuschauen. Irgendwo in der Nähe vom Bahnhof Friedrichstraße musste er sein.
In der Küche hing ein großer Stadtplan an der Wand, daneben lag das Heft mit dem alphabetischen Straßenverzeichnis. Doch das brauchte sie nicht, sie sah ihre Route auf einen Blick: durch den Tiergarten, über den Hauptbahnhof und dann die Invalidenstraße entlang. Sie wollte schon losgehen, sah aber im letzten Moment, dass es noch einen zweiten Dorotheenstädtischen Friedhof gab. Das hatte ihr der Idiot vom Lagedienst nicht gesagt. Während sie noch eine Pudelmütze in die Tasche stopfte, drückte sie Marius’ Nummer.
»Paula?«
»Hallo, Marius. Welcher ist es denn nun? Chausseestraße oder Liesenstraße?«
»Chausseestraße.«
»Wie lange brauchst du noch?«
»Bin gleich da.«
Sie rannte die Treppe hinunter und ärgerte sich, dass sie ihren schönen Parkplatz aufgeben musste.
Ein neues Tief brachte wieder wärmere Luft und Regen mit. Um den Hauptbahnhof war gestreut worden, und es knirschte unter den Reifen, aber schon in der Invalidenstraße war durch die langen grauen Regennadeln, die auf den Asphalt niederprasselten, alles weggespült worden. Aus dem Schifffahrtskanal stieg eine Dunstglocke aus kondensierter Feuchtigkeit auf und legte sich über die Straße.
Auf Höhe der Chausseestraße 126 standen drei Streifenwagen quer auf dem Bürgersteig, und als sie vorsichtig bremsend näher kam, winkte sie einer der Polizisten mit der Kelle an den Rand. Sie nannte ihren Namen.
»Die Einfahrt zum Friedhof ist dort, Frau Hauptkommissarin«, sagte er und deutete auf ein Tor.
»Ist schon alles abgesperrt?«
»Sicher.«
Im Schritttempo fuhr sie durch das große Tor. Links begrenzten eine hohe Kalksteinmauer und rechts die Hofwände der Nachbargebäude den Friedhof. Vor ihr schwenkte jemand in der Dunkelheit eine Lampe durch den Regen. Sie fuhr langsam weiter gegen das Wasser an, das ihr auf dem leicht ansteigenden Kiesweg entgegenkam. Kurz vor einem Denkmal stoppte sie.
Wer auch immer mit der Lampe gewunken hatte, war wieder verschwunden. Sie stieg aus und ärgerte sich, dass es niemanden gab, der ihr sagen konnte, wohin sie sich wenden sollte. Es war völlig dunkel, selbst in den Gebäuden um den Friedhof herum brannten keine Lichter.
Sie holte die Stablampe aus dem Wagen und den noch verpackten Schutzanzug, zog ihre Kapuze tief ins Gesicht und richtete den Lichtstrahl auf die Umgebung. An der rechten Seite der Zufahrt sah sie einen grob verputzten Bau mit Satteldach, der wohl die Friedhofskapelle war. Zwei Säulen flankierten den Eingang, zu dem ein paar Stufen hinaufführten. Rechts daneben war ein weiteres Häuschen. Es schien unter dem Efeu ziemlich verwittert. Vielleicht wohnte da der Friedhofsverwalter. Sie ging ein paar Schritte darauf zu. Noch weiter rechts war eine hässliche weiße Eisentür mit einem Münzeinwurf und der Aufschrift »WC«. Dahin wollte sie sicher nicht, aber wohin sonst? Sie leuchtete weiter in die andere Richtung. Die hohen Grabdenkmäler wirkten wie düstere Gestalten in der Finsternis, aus der in Hunderten von kleinen Blitzen der Regen in den Schein ihrer Lampe fiel.
Von irgendwo hörte sie eine Stimme. Als sie sich umwandte, sah sie einen Uniformierten ihren Wagen mit einer Lampe durchsuchen.
Sie ging schnell zu ihm und sagte bissig: »Ich bin schon ausgestiegen.«
»Darf ich fragen, wer Sie sind?«
»Kriminalhauptkommissarin Zeisberg. Warum steht hier niemand, der einem sagt, wo man hin soll?«
Er grinste. »Jetzt erkenne ich Sie. Der Fall mit dem …«
Sie unterbrach ihn ungeduldig. »Sagen Sie mir einfach nur, wo ich hinmuss.«
»Ja klar, Entschuldigung, ich bringe Sie hin. Hier entlang.«
Der Polizist begleitete sie und zeigte ihr mit der Lampe die Pfützen, damit sie nicht hineintrat. Hinter einem riesigen schwarzen Baum bog er in einen Weg nach links ein. Ihre unwirsche Reaktion hatte bewirkt, dass er nicht mehr sprach, was ihr ganz recht war. Im Dunkeln konnte sie nicht sehen, wie groß der Friedhof war, aber die Grabstellen, an denen sie vorbeigingen, waren stattlich, zum Teil mit mächtigen Steinmalen geschmückt.
»Hier ist das Mausoleum«, sagte er, und sie standen vor einer kleinen Versammlung Vermummter. War Chris schon da? Sie erkannte ihren Vertreter Herbert Justus, der sich mit drei Uniformierten und zwei Zivilisten unterhielt. Sie hatten alle ihre Kapuzen oder Regenhüte tief ins Gesicht gezogen. Justus kam auf sie zu und gab ihr die Hand. »Hallo, Paula. Schönen Urlaub gehabt?«
Ihm war es immer recht, wenn sie Urlaub hatte. Dann spielte er den kleinen Napoleon. Sie konnte seine Gesichtszüge in der Dunkelheit nicht sehen, aber sie ahnte, dass er sein typisches unlustiges Lächeln aufgesetzt hatte. »Ich hatte Bereitschaftsdienst, Herbert, keinen Urlaub. Ist Frau Gregor schon da?«
»Nein.«
»Wäre es nicht besser, wenn ihr ein paar Lampen aufstellt, damit man den Weg findet?«
Justus wandte sich sofort an die Beamten. »Haben Sie ein paar Warnlichter dabei, um den Weg hierher zu kennzeichnen?«
»Und wer sind Sie?«, fragte Paula den Zivilisten, der ihr am nächsten stand.
»Ich bin Heinz Lankwitz. Ich bin hier in der Friedhofsverwaltung.«
»Ist Ihnen irgendwas aufgefallen?«
»Was soll mir denn aufgefallen sein?«
Paula hatte im Moment nicht den Nerv, sich mit begriffsstutzigen Zeugen abzugeben.
»Wo ist der Tatort?«
Justus zeigte auf das Mausoleum. »Da im Keller. Das Schloss der Eingangstür ist aufgebrochen worden.«
»Und?«
»Besser, wir warten auf den Bus. Dann haben wir auch Gummistiefel. Durch diesen Scheißregen ist Wasser in die Gruft gelaufen.«
»Ist noch gar keiner von uns da?«
»Nein. Auch die von der Spurensicherung noch nicht.«
Paula wandte sich dem Mausoleum zu, als die Scheinwerfer eines Wagens aufblitzten, der in den Friedhofsweg einbog. Langsam kam er näher, und sie drehte sich um. Geblendet hob sie die Hand.
Wer könnte das sein?, fragte sie sich verwundert.
Sie wartete, bis der Wagen hielt und die Lichter auf Standlicht geschaltet waren, und fragte Justus, ob das Marius oder einer vom Team sei.
»Ich glaube nicht. Die würden doch nicht mit ihren Autos auf den Friedhof fahren.«
Paula hielt es für unwahrscheinlich, dass sich der Kriminaldirektor persönlich oder ein noch höheres Tier hierher verirrt haben könnte. Außerdem war das Auto dafür ein bisschen zu klein.
Eine Gestalt im dunklen Mantel stieg aus. Sie hielt den Hut auf ihrem Kopf fest, weil eine Bö die Tropfen von den Ästen schüttelte. Dann öffnete sie die hintere Autotür und nahm etwas von der Rückbank, knallte die Tür ohne Rücksicht auf die Totenruhe zu und kam mit schweren, stapfenden Schritten herbei. »Ich bin Doktor Weber vom Institut für Rechtsmedizin.«
Justus hatte seine Lampe wieder angemacht und ergriff die ihm entgegengestreckte Hand. Die Person war fast einen Kopf größer als Justus und Paula.
»Guten Abend, Doktor Weber«, sagte sie. »Hoffentlich kommen Sie nachher mit Ihrem Wagen aus dem Schlamm hier auch wieder raus.«
Justus schaltete sich sofort ein. »Wenn Doktor Weber stecken bleibt, haben wir hier ein paar kräftige Männer, die ihn da rausschieben.«
Paula lächelte, weil er nicht bemerkt hatte, dass Dr. Weber eine Frau war. Sie war erst seit vier Wochen in Berlin, und Paula hatte noch nicht mit ihr zusammengearbeitet, aber sie hatte von Linus Giesecke erfahren, dass es eine neue Kollegin gab, die vom Institut für Rechtsmedizin in Hamburg kam.
»Ich darf mich vorstellen, ich bin Kriminalhauptkommissar Justus von der Neunten. Ich vertrete Frau Zeisberg, die die Neunte hier leitet.«
»Guten Abend. Ich dachte schon, ich sei zu spät, aber wohl doch nicht.«
»Die müssten alle jeden Moment eintreffen«, sagte Justus.
Dr. Weber reichte zuerst Paula und dann Justus die Hand. »Ich wohne in der Ravenéstraße, das ist nicht allzu weit von hier.«
»Wir können ja mal einen Blick reinwerfen.« Paula deutete auf das Mausoleum, das nahezu die Größe eines Ferienhäuschens hatte. Wann immer es errichtet worden war, die Familie Fabeau musste sehr wohlhabend gewesen sein. Die schmiedeeisernen Türen standen offen, und die Platten, die die Kellertreppe bedeckten, waren zur Seite gehoben worden.
Paula leuchtete mit ihrer Taschenlampe die Stufen ab. Im Licht glänzten sie feucht und glitschig. Acht Stufen, die neunte lag bereits unter einer schwarzen Wasseroberfläche. Sie reichte Justus ihre Hand. Er blieb stehen und suchte einen festen Stand. Sie rieb mit ihrem rechten Schuh die Stufen ab, bis sie mit dem Fuß Halt hatte, setzte dann den anderen Fuß nach und scheuerte die nächste Stufe frei. So gelangte sie Schritt für Schritt nach unten. Justus musste sich immer mehr hinabbeugen, um sie nicht loszulassen. In der anderen Hand hielt er seine Taschenlampe, deren breiter Schein die Gruft gut ausleuchtete, während das Licht von Paulas Lampe gebündelter war.
Bisher hatte sie alle Aufmerksamkeit darauf gerichtet, auf der glitschigen Treppe nicht auszurutschen, aber als sie nicht mehr weiterkonnte, machte sie sich von Justus frei.
Sie hob ihre Lampe, um die von Säulen durchsetzte Gruft auszuleuchten. Der Keller des Mausoleums stand unter Wasser. Eine mumifizierte Leiche in einem violetten Kleid schaukelte sanft in der Dunkelheit. Paula war ungewöhnliche Arbeitssituationen gewöhnt, doch dies gehörte auch für die kühl denkende Polizistin zu den Situationen, die sie sich gerne erspart hätte. Was sie aber wirklich aus der Fassung brachte, war ein weiterer Fund: Auf einem im Wasser treibenden Sargdeckel lag die noch frische Leiche einer nackten jungen Frau mit dunklem Haar. Ihre Augen starrten gleichgültig gegen die Decke ihres Verlieses.
Gehörte sie in einen Sarg, dessen Deckel sich gelöst hatte? Wären ihre Augen dann nicht geschlossen gewesen? Natürlich Verstorbenen werden die Augenlider doch zugedrückt.
Es sah ganz so aus, als hätte hier nicht nur die Kraft des Wassers gewirkt. Sollte sie auf diesem Friedhof ums Leben gekommen sein? Nackt? In dieser Eiseskälte? »Habt ihr irgendwelche Kleidungsstücke gefunden?«, fragte sie Justus.
»Nein.«
Paula rührte sich nicht. Es war totenstill. Doch plötzlich hörte sie ein Scharren hinter sich, und als sie sich umdrehte, stand Dr. Weber hinter ihr, schon fast auf derselben Stufe wie sie. Mein Gott, hoffentlich rutscht sie nicht aus, dachte sie und warf der Medizinerin einen besorgten Blick zu. Aber die Weber verstand es wohl als Aufforderung und machte einen letzten Schritt auf Paulas Stufe. Es war so eng, dass sie sie anstieß, und die Weber sich vor Schreck an ihr festhielt, was beide fast aus dem Gleichgewicht brachte, während sie sich aneinanderklammerten. Dennoch nahm die Ärztin ihren Blick keinen Moment von der Leiche auf dem Sargdeckel. »Da sind Einschnitte an Brust und Bauch«, flüsterte sie und drückte schon wieder gegen Paulas Rücken.
»Bitte stoßen Sie mich hier nicht rein«, sagte Paula schroff und versuchte, sich von ihr zu lösen. Es war kalt und eklig hier unten, aber der Gedanke, in das Leichenwasser zu fallen, ließ sie schaudern. Es gab auf dieser schmalen Treppe einfach nicht genug Platz für zwei. Und trotz der dicken Jacke war ihr kalt.
»Keine Sorge, ich nehme an, Sie haben heute schon gebadet«, antwortete die Weber trocken.
Paula hatte kurz die Vision von einem heißen, duftenden Vollbad, aber sie riss sich zusammen. Je konzentrierter sie hier bei der Sache blieb, desto schneller hätte sie die Chance, die Vision in die Tat umzusetzen. »Was sagten Sie da eben über die Tote?«
Die Weber zeigte auf die etwa zwei Meter von ihnen entfernte Leiche. »Wenn mich nicht alles täuscht, läuft da ein Schnitt um die Brüste herum bis zum Schambein. Es könnte aber auch nur eine Wunde sein. Vielleicht kann man sie etwas näher rankriegen.«
»Herbert, hol uns mal irgendwas, womit wir sie fischen können.«
»Okay, du hast ja Licht.« Als Justus mit seiner Lampe verschwand, wurde es schlagartig dunkler in dem Raum.
Bis auf das Geräusch des von der Decke tropfenden Wassers war es still. Von draußen drang kein Laut herein. Waren alle gegangen? Plötzlich klatschte etwas. Paula leuchtete herum, und mitten in ihrem Lichtkegel hechtete eine Ratte auf die Leiche zu. Paula stieß einen kleinen Schrei aus, worauf die Ratte kehrtmachte und in die äußerste Ecke schwamm, wo sie auf einen Mauerabsatz über dem Wasser kletterte. Dort blieb sie hocken und starrte aus schwarzen Knopfaugen zu den Eindringlingen herüber.
Paula rief, Justus möge endlich irgendwas bringen.
Es dauerte weitere Minuten, bis er vorsichtig die Stufen herunterkam, einen Stab in seiner Hand.
»Was ist das?«, fragte Paula.
»Eine Harke.«
»Wo hast du denn die her?«
»Hatte einer der Friedhofsarbeiter.«
Paula nahm ihre Taschenlampe zwischen die Zähne und fischte mit der Harke in dem brackigen Wasser herum.
»Du darfst die Harke nicht unter Wasser führen«, sagte Justus. »Du musst sie auf den Sargdeckel legen und dann heranziehen.«
»Weiß ich auch, du Schlaumeier.« Aber sie wollte nicht, dass der Deckel kippte und die nackte Leiche ins Wasser glitt.
»Bitte nicht in dem Ton«, erwiderte er spitz.
»Ich hab sie!«, rief Paula. »Hol mir mal Handschuhe.«
»Hier, nimm meine.« Er hielt ihr ein Paar dünne Latexhandschuhe hin, aber Dr. Weber war schneller, nahm sie und zog sie an.
Paula hielt die Harke so, dass die Leiche nicht wegtreiben konnte, die Weber bückte sich und berührte die schlüpfrige Haut. »Leuchten Sie mal.« Sie zeigte auf die Schnittränder. »Merkwürdig, dass es überhaupt nicht geblutet hat. Hier noch mal mehr Licht!«
Paula hielt die Lampe ganz dicht an den Körper heran.
»Der Wundrand sieht völlig avital aus.« Vorsichtig hob die Weber die Haut ein Stück an.
Die Haut schien lose auf dem Körper zu liegen, und als die Ärztin auch mit der anderen Hand zufasste und zog, löste sich die ganze Vorderseite. Sogar die Brüste verschoben sich. Sie beugte sich noch tiefer und forderte Paula auf, dichter an Brust, Bauch und Schambereich heranzuleuchten. »Dachte ich’s mir doch«, sagte sie und ließ die Hautfalte los.
Die Vorderseite der toten Frau war nun so verschoben, als wäre ihr das Kleid verrutscht.
»Sehen Sie? Das freiliegende Fettgewebe und die Muskulatur weisen keine Einblutungen auf.«
»Was bedeutet das?«
Die Weber richtete sich auf. »Dass sie die Schmerzen ihrer Häutung nicht mehr miterlebt hat.«
»Wann ist sie gestorben?«
»Um das feststellen zu können, brauche ich mehr Licht. Hier müssen ein paar Männer rein und den Sargdeckel mit der Leiche herausheben«, sagte sie. »Lassen Sie uns zurückgehen.«
Sie nahm Paulas Arm und deutete die Stufen hoch. Paula folgte ihr vorsichtig in die Vorhalle des Mausoleums, die inzwischen grell erleuchtet war. Irgendjemand hatte Scheinwerfer aufgestellt.
3
Inzwischen waren Paulas Kollegen eingetroffen und warteten in ihren Schutzanzügen in der Halle des Mausoleums. Der Bereich vor dem Grabmal war durch einen schnell errichteten Lichtmast hell erleuchtet, und dicke Tropfen fielen wie Glasperlen in die Helligkeit. Ein paar Schritte weiter tuckerte der Diesel der Feuerwehr.
Paula fühlte sich geblendet und blieb stehen. Offenbar hatte niemand Lust, sich in dieser Situation zu bewegen. Paula spürte ihre Anspannung. »Fangt an und pumpt den Keller aus!«, befahl sie laut, und mit einem Mal rannten alle geschäftig umher.
Sie holte einmal tief Luft und versuchte sich zu entspannen. Neben ihr erklang eine warme Stimme. »Hallo, Paula, alles okay?«
Es war Marius. Sie lächelte ihn an. »Schön, dass du fragst. Da kann ich dich gleich bitten, die junge Frau da unten im Keller an Land zu ziehen und mit ein paar unternehmungslustigen Jungs heraufzubefördern. Ihr müsst euch allerdings Gummizeugs überziehen. Vorsicht, wir wissen noch nicht, ob sie hier umgebracht worden ist oder als Leiche hergeschleppt wurde.«
Als Marius sich ein wenig enttäuscht wegen der kurzen Begrüßung abwandte, um die Bergung zu organisieren, erblickte Paula Chris mitten im Scheinwerferlicht. Unter dem durchsichtigen Plastikcape trug sie einen anthrazitfarbenen Wollmantel mit umgeschlagenen Samtmanschetten, der mit einem breiten schwarzen Gürtel zusammengehalten wurde. Die Knopfreihe ging von der Taille aus schräg nach oben. Den ebenfalls samtenen Mantelkragen hatte sie hochgeschlagen.
Sie lachte. »Dieser Killer wird nicht mein Freund werden.« Im Licht der Strahler blitzten ihre schönen weißen Zähne. Als Paula gerade erwidern wollte, das habe auch niemand erwartet, ließ sie sie nicht zu Wort kommen. »Ich war kurz davor, diesen bulgarischen Pianisten …«, dann unterbrach sie sich, weil Justus dazukam. Sie nickte ihm ein »Guten Abend« zu und nahm Paula zur Seite. »Es könnte wirklich eine neue Liebe werden«, zischte sie ihr zu, doch Justus folgte ihnen, und sie sagte laut, als wäre dies die offizielle Frage der Staatsanwaltschaft: »In welcher Form hat das Böse diesmal zugeschlagen?«
Justus lächelte verkrampft über den Witz und entfernte sich dann, um die gerade eingetroffenen Kollegen von der Spurensicherung einzuweisen. Der ganze Friedhof musste abgesucht werden.
Chris machte ein Zeichen hinter seinem Rücken, das wohl so viel bedeuten sollte wie Gut so!, und setzte ihren getuschelten Bericht über den netten Abend fort. Sie kam gerade vom Potsdamer Platz, wo sie mit einem »sehr lieben Freund«, wie sie ihn nannte, in einer Bar Cocktails getrunken hatte. Sie hatte ihn zuvor in der Berliner Philharmonie kennengelernt. Dort hatte eine Freundin im Kammermusiksaal eine Buchpräsentation mit musikalischer Untermalung veranstaltet. Paula verstand nicht ganz, was Bücher dort zu suchen hatten, und Chris erklärte ihr, die Freundin habe eine Agentur für Streichquartette und darüber in ihrer Freizeit ein Buch geschrieben, in dem es nur um Musik gehe. Eine Sammlung von Geschichten über die Streicher-Diven.
»Und? War es schön?«
»Zur Feier des Abends spielten drei verschiedene Streichquartette.«
»Und einen von den Stehgeigern hast du …?«
»Nein, nein, aber ich habe da den Pianisten Ivo Charankov kennengelernt.«
Der Name sagte Paula nichts, und Chris erklärte vergnügt, was für ein Stern mit Ivo Charankov am Pianisten-Firmament aufgegangen sei. Seine bulgarischen Eltern hatten den Zwölfjährigen ans Moskauer Konservatorium geschickt, und zehn Jahre später war seine internationale Karriere mit den Chopin-Mazurken gestartet. Chris schwärmte von der Interpretation der »Englischen Suiten« und der Scarlatti-Sonaten, als hätte sie nicht Jura, sondern Musikwissenschaft studiert.
»Ein Exzentriker?«
»Ach, Quatsch, er ist total normal.« Chris lachte auf. »Eigentlich.«
Das Eigentlich war dann in Paulas Augen das Eingeständnis, dass er wohl doch nicht so total normal war. Von solchen Männern hatte sie Chris dringend abgeraten; exzentrisch war sie nämlich selbst schon genug.
Paula nahm um Chris herum immer eine helle Energie wahr. Sogar jetzt an einem derart düsteren Ort. Sie war zwar eine Frau, die sich selbst regelmäßig in die unmöglichsten Situationen brachte, das aber mit einem solchen Schwung tat, dass sie stets auch wieder herauskam. Und manchmal waren es einfach nur Geschichten, die Paula vielleicht selbst gerne erlebt hätte.
Das Feuer, das Chris antrieb, war heute Abend zusätzlich noch durch ein wenig Alkohol entfacht, aber vielleicht war der Alkohol auch ein guter Schutz gegen das, was sie gleich zu sehen bekommen würde.
Paula rief nach Marius und bat ihn, der Staatsanwältin den Fundort zu zeigen, bevor dort die Hauptarbeiten beginnen würden.
»Kann ich auch machen«, sagte Justus, der jede Situation nutzte, um seine Person ins Spiel zu bringen.
Er trug inzwischen Gummistiefel, und Paula riet Chris, sich auch welche geben zu lassen. Ihre Stiefel im Sixties-Style aus schwarzem Leder mit acht Zentimeter hohem Blockabsatz eigneten sich nicht wirklich für den Abstieg in die Gruft.
Während Justus zum Mordbus, wie sie den Teambus untereinander nannten, ging, um die Gummistiefel zu holen, berichtete Chris weiter von ihrem Abend. Nach dem Streicher-Konzert war sie noch auf ein paar Caipirinhas mit dem Pianisten in die Marlene-Dietrich-Bar auf dem Potsdamer Platz gegangen. Ivo Charankov war nicht nur bei vielen Musikliebhabern bekannt, auch Chris kannte ihn seit einem vielbesprochenen Fernsehauftritt, in dem er Chopin - nicht nur musikalisch, sondern auch mit seinen Erläuterungen - als sensiblen und zerrissenen Künstler dargestellt hatte. Das hatte Chris fasziniert.
»Da sind deine Stiefel.« Paula deutete auf Justus, der die klobigen Teile in den Händen hielt.
»Hoffentlich passen sie«, sagte er.
Chris stützte sich bei Paula ab, während sie in die Gummistiefel schlüpfte und ein paarmal auftrat. »Passt«, sagte sie, obgleich sie nicht mehr so sicher stand. »Was erwartet mich denn nun?«
Eilfertig war Justus zur Stelle: »Dort unten wurde eine völlig entkleidete junge Frau gefunden.«
Er wollte noch mehr sagen, aber Chris ignorierte ihn und zog Paula zum Grufteingang: »Wer ist von der Gerichtsmedizin da?«
»Martina Weber. Du kennst sie wahrscheinlich noch nicht, sie ist erst seit vier Wochen in Berlin und für den kürzlich pensionierten Breitenbach gekommen.«
»Nett?«
»Wäre das falsche Wort, aber vielleicht hat sie ein paar nette Brüder.«
Als sie in die Gruft hinableuchtete, sah sie die Weber auf der untersten Stufe stehen. Inzwischen ebenfalls in Gummistiefel und Schutzanzug gekleidet, kam sie zu ihnen herauf, und Paula stellte die beiden einander vor.
»Guten Abend, Frau Gregor«, sagte die Rechtsmedizinerin und ließ Chris’ Doktortitel weg.
»Was haben Ihre ersten Untersuchungen ergeben, verehrte Kaltchirurgin?« Chris lächelte ironisch.
Die Weber hustete, als hätte sie sich dort unten im Keller schon erkältet. »Sieht aus wie das Werk eines Nekrophilen. Brust- und Bauchhaut sind ausgeschnitten. Zusammen mit dem Brustdrüsengewebe regelrecht abpräpariert. Fachmännische, saubere Arbeit. Man kann das Ganze abheben wie eine Schürze. An den Schnitträndern finden sich nur minimale Blutaustritte. Das ist eindeutig erst Stunden nach dem Tod passiert. Sie können sich’s unten anschauen.«
Paula ging vor und reichte Chris die Hand, um sie zu führen. Sie selbst trug ihre Walking-Schuhe, die ein stark geriffeltes Profil hatten und mit denen sie sich einigermaßen sicher fühlte, aber mit Gummistiefeln schien es nicht so einfach zu sein, die schlüpfrigen Stufen hinunterzukommen, wie sie an Chris’ zögernden Schritten merkte. Vorsichtig und seitlich ging sie mit dem rechten Fuß voran. Sie war so damit beschäftigt, nicht auszurutschen, dass sie keinen Blick für ihre Umgebung übrig hatte.
Die Ratte hockte inzwischen nicht mehr in ihrer Ecke. Sie war geflüchtet bei dem Lärm und Betrieb, den die Vorbereitungen zum Absaugen des Wassers verursachten. Auf dem Sargdeckel lag die Frauenleiche mit ihrer verrutschten Vorderseite. Der Deckel war vertäut. Leicht schaukelnd lag er einen Meter vor ihnen auf dem Wasser. Die Brühe war so schwarz, als wäre sie hundert Meter tief.
Als Chris endlich in der richtigen Position stand, um sich alles ansehen zu können, tauchte aus dem Wasser die verweste Vorderseite eines Totenkopfes auf.
Chris stieß einen gellenden Schrei aus und riss die Arme in die Höhe. Dabei verlor sie das Gleichgewicht. Um nicht der Länge nach ins Wasser zu kippen, machte sie einen Hüpfer und sprang mit beiden Füßen zugleich. Die schwarze Suppe reichte ihr bis zur Brust. Wieder schrie sie und schlang die Arme um ihren Körper. Paula beugte sich so weit wie möglich vor und hielt ihr die Hand hin: »Die Treppe geht noch weiter ins Wasser hinunter, geh dorthin und dann komm wieder rauf.«
»Hier bewegt sich was!«, kreischte Chris.
»Was?«
»An meinem Bein.« Ihre Stimme bebte hysterisch vor Ekel.
»Das bildest du dir ein. Los, komm hier zur Treppe!«
Oben erschien Tommi, ein Seil in der Hand, in das er zwei Knoten machte und Paula dann zuwarf.
Sie gab es der wimmernden Chris weiter.
»Nimm es!«, sagte Paula. »Halt es fest! Nicht loslassen!«
Chris packte das Seil und trippelte auf Zehenspitzen und mit hoch erhobenen Armen auf die Treppe zu.
»Weiter hier rüber, damit du auf die Stufen kommst!«
Paula zerrte sie nahe zu sich heran. »Zieh!«, brüllte sie Tommi zu.
Das Seil spannte sich, und Chris schleppte sich zittrig herauf, bis sie neben Paula stand, die sie stützte und ihr befahl, weiter nach oben zu gehen.
Wasser gluckste aus den Gummistiefeln und spritzte gegen Paulas Jeans.
Tommi zog, und Paula schob mit beiden Händen von hinten.
Als sie oben angekommen waren, bat sie Waldi, schnell Decken zu holen. »Du kannst dich im Mordbus umziehen«, sagte sie zur zähneklappernden Chris. »Waldi, fahr den Bus so weit ran, wie es geht.«
»Fahr hier direkt rein«, schnarrte Tommi. Er war der Witzbold im Team und nie um eine Antwort verlegen, während Waldi Wehland eher umsichtig und fürsorglich agierte.
Die Weber schien von alldem vollständig unberührt. Sie hatte nur Augen für die zwei Feuerwehrleute, die vorsichtig und langsam den Sargdeckel mit der Leiche herauftrugen. Das ganze Unternehmen war nicht einfach, weil der Körper bei der geringsten Schieflage hinunterzugleiten drohte. Schließlich setzten sie den Sargdeckel mit der Toten auf einer am Boden ausgebreiteten Plastikplane ab.
Die Rechtsmedizinerin untersuchte die Leichenflecke, prüfte, ob sie sie wegdrücken konnte und schaute, wie ausgeprägt die Totenstarre am Kiefer und in den Gelenken der Arme und Beine war. Sie kniete sich neben die Tote und führte ein Digitalthermometer in den After ein.
Paula warf einen Blick nach draußen, ob endlich Decken oder irgendetwas für Chris kämen. Sie hätte sie gern in den Arm genommen, aber sie sah so nass, bleich und zerbrechlich aus, als würde sie bei der kleinsten Berührung zerspringen.
»Immer noch 28 Grad«, sagte die Weber. »So lange ist sie noch gar nicht tot.«
Chris starrte auf die Medizinerin, die ein Gerät aus ihrem Tatortkoffer nahm, das aussah wie ein Mobiltelefon mit elektrischen Kabeln, an deren Enden sich zwei Reizelektroden befanden.
»Ich prüfe auch mal die elektrische Erregbarkeit«, sagte sie zu Paula. »Wenn sie noch zuckt, ist sie noch nicht lange hin.« Sie stach die Nadel der Toten knapp unterhalb der Braue in die Haut. Das Oberlid zog sich zusammen. »Hat gezuckt. Haben Sie gesehen?«
Sie wandte sich Chris zu: »Offensichtlich ist der Tod am Nachmittag oder am frühen Abend eingetreten. Woran sie gestorben sein könnte, ist mir noch schleierhaft. Jedenfalls nicht an den Schnitten. Die sind ihr erst post mortem beigebracht worden.« Sie packte ihre Sachen ein, erhob sich und blieb kurz vor Chris stehen. »Ich bin gespannt, was wir bei der Sektion herausfinden.« Sie nickte Paula zu und ging hinaus, in der Hand ihren Tatortkoffer.
Chris reagierte nicht.
Tommi kam mit einer Decke unter dem Arm angesaust und sagte, Waldi könne nicht näher heranfahren, weil der Wagen der Rechtsmedizinerin den Weg versperre.
Paula nahm die Decke, legte sie Chris um die Schultern und wollte sie zu ihrem Wagen bringen, um sie nach Hause zu fahren.
Doch plötzlich stand die Weber vor ihnen, griff Chris am Arm und sagte: »Kommen Sie, ich fahre Sie nach Hause.« Energisch führte sie sie zur Beifahrertür.
»Dann wird Ihr ganzes Auto nass und stinken«, wandte Chris schlotternd ein.
»Ist ja nur ein Auto«, sagte die Weber, riss die Tür auf und bugsierte sie hinein.
Als sie selbst einsteigen wollte, sagte Paula: »Sie kriegen die Leichen noch heute Nacht. Wann werden Sie morgen mit der jungen Frau beginnen?«
»Um zehn.«
»Gut. Also zehn. Ich möchte dabei sein.«
»Okay«, sagte die Weber und gab ihr die Hand. Sie drückte so stark zu, dass Paula die Zähne zusammenbeißen musste, um nicht aufzustöhnen, denn ihre Hände waren beinahe steif gefroren.
Ärgerlich betrachtete sie die Medizinerin. Jetzt, im hellen Scheinwerferlicht, konnte sie ihr Gesicht genau sehen. Ihr dunkelbraunes Haar hatte sie hinten zusammengebunden, was ihr ohnehin schon strenges Gesicht noch kühler machte. Der Schatten ihres Hutes, von dem das Wasser tropfte, verdeckte ihre Augen. Da sie inzwischen ihren Schutzanzug wieder ausgezogen hatte, sah Paula, dass auch ihre Kleidung recht konservativ war: eine dunkelbraune Steppjacke über einer hellbraunen Hose. Sie legte offensichtlich wenig Wert auf Kleidung und Aussehen, und es kümmerte sie offenbar auch nicht, dass der Regen alles durchweichte.
Paula wollte Chris noch zurufen, zu Hause gleich ein heißes Bad zu nehmen, aber die Weber ließ schon den Motor aufheulen. Mit aufgeblendeten Scheinwerfern versuchte sie zu wenden. Sie ließ die Scheibe herunter und rief mit rauer Stimme: »Frau Zeisberg, geben Sie mir mal Zeichen, damit ich keinen Grabstein umfahre!«
Paula winkte sie in die Spur, und mit durchdrehenden Rädern fuhr der Wagen davon.
Es würde wohl eine Weile dauern, bis der Leichenwagen da wäre. So lange wollte Paula nicht warten, und sie beauftragte Tommi, das Gelände weiträumig abzusperren und der Schutzpolizei die Überwachung zu übertragen.
Er musste sowieso dableiben, bis die Leichen in die Rechtsmedizin abtransportiert waren und der Fotograf alles abgelichtet hatte.
Sie schaute zur Uhr, es war zwanzig vor drei.
Bis auf Tommi entließ sie das Team, denn es war inzwischen unerträglich kalt. Auf den Pfützen hatten sich dünne Eisschichten gebildet.
Sie spürte immer noch den kräftigen Händedruck der Weber und bat Marius, sie zu begleiten. »Meine Hände sind so steif, ich glaube nicht, dass ich den Wagen aufkriege.«
»Kein Problem«, grinste er. »Ich öffne alles für dich.«
»Dein Portemonnaie auch?«
»Gute Idee. Wollen wir noch in einen Club?«
»Ich bin viel zu fertig.«
»Aber wir hatten doch den schönsten Bereitschaftsdienst seit Langem! Der reinste Urlaub. Da hättest du das Bett ja gar nicht zu verlassen brauchen.«
Verlagsgruppe Random House
Originalausgabe 02/2009
Copyright © 2009 by Diana Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion | Angelika Lieke Herstellung | Helga Schörnig Umschlagmotiv | Mauritius Images/Botanica München-Zürich, Teresa Mutzenbach 978-3-453-35220-9
www.diana-verlag.de
eISBN : 978-3-641-02469-7
Leseprobe
www.randomhouse.de