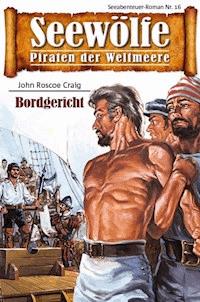Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Der Sturm beutelte die "Isabella von Kastilien". Doch diese Nacht hielt noch mehr Überraschungen für Philip Hasard Killigrew bereit. Capitan Romero Valdez, sein Gefangener, war trotz seiner Verwundung und trotz des Sturmes in deinem Dinghi geflohen. Und als Hasard sah, daß Valdez ein Geheimfach in der Kapitänskammer aufgebrochen und irgendetwas mitgenommen hatte, da wußte er, daß es für den spanischen Capitan etwas Wichtigeres gab als den Tod. Aber auch der Seewolf war zäh. Er wußte, daß die spanische Flotte ihn verfolgte. Trotzdem befahl er seiner Mannschaft: "Sucht den Bastard!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum© 1975/2012 Pabel-Moewig Verlag GmbH,Pabel ebook, Rastatt.ISBN: 978-3-95439-093-9Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
1.
Capitan Romero Valdez lauschte auf die vertrauten Geräusche, die ihn umgaben. Er hörte das Ächzen des Rumpfes, das Knarren der Blöcke und Taljen und über sich das Pfeifen der Wanten vom Besanmast, an denen der steife Ostwind herumsägte.
Unruhig ging er in der schmalen Kammer seines Ersten Offiziers auf und ab. Er spürte die Demütigung, auf seinem eigenen Schiff Gefangener zu sein, fast körperlich. Seit drei Jahren fuhr er die „Isabella von Kastilien“. Vier Fahrten in die Neue Welt hatte er mit diesem Schiff bereits hinter sich, und nie war es irgendeinem Feind gelungen, auch nur einen Fuß auf die Decksplanken der „Isabella“ zu setzen.
So sicher wie mit Romero Valdez – das gehörte jetzt der Vergangenheit an. Dieser Spruch würde so schnell vergessen sein, wie er vor einem Jahr aufgetaucht war, als er als einziges Schiff einer Flota den Freibeutern von Hispanola hatte entkommen können.
Er dachte an die wertvolle Ladung des Schiffes, die er nach Sevilla hatte bringen sollen. Dreißig Tonnen Silber. Ein Vermögen, das dieser schwarzhaarige Teufel von einem Engländer der spanischen Krone geraubt hatte und nach England brachte.
Am Zittern der Planken unter seinen Füßen merkte Valdez, daß die Galeone mit vollem Zeug segelte. Er trat an das kleine rechteckige Fenster, das zur Heckgalerie hinausführte, und warf einen Blick auf den nachtschwarzen Himmel. Nur ab und zu blitzte ein Stern am Firmament auf, dann wurde er von drohend geballten Wolkenfeldern wieder verschlungen.
Die See zeigte weiße Schaumköpfe. Es schien, als hole der Wettergott zum nächsten, härteren Schlag aus.
Capitan Romero Valdez ballte die Hände zu Fäusten und trommelte in stiller Verzweiflung gegen die Holzwand. Nicht so sehr das Schicksal, das ihn in England erwartete, setzte ihm zu – nein, diese Erniedrigung würde er durchstehen wie ein Mann. Die Schmach, die der Engländer der spanischen Flotte im Hafen von Cadiz angetan hatte, schmerzte ihn viel mehr.
Valdez hatte in den vierundzwanzig Stunden, die seit der Kaperung seines Schiffes vergangen waren, die Hoffnung aufgegeben, daß eines der in Cadiz vor Anker gegangenen Schiffe die Verfolgung der „Isabella“ aufgenommen hatte. Zu stark blies der günstige Ostwind. Und wie sollten die spanischen Schiffe herausfinden, welchen Kurs der Engländer genommen hatte? War er hinaus nach Osten in den Atlantik gesegelt, um später nach Norden zu drehen, und die englischen Häfen von Südwesten anzusteuern? Oder hielt er nordöstlich auf Kap Sao Vicente zu?
Romero Valdez wußte, daß es fast unmöglich war, bei diesem Wetter ein Schiff zu verfolgen und zu finden, auch wenn es schwerfällig war wie die „Isabella von Kastilien“, in deren Frachträumen dreißig Tonnen Silber verstaut waren.
Der Capitan dachte an seine Leute, die sich von den verfluchten Engländern hatten überrumpeln lassen. Beschämt gestand er sich ein, daß sein Verhalten nicht gerade dazu beigetragen hatte, seine Männer zum Widerstand zu treiben. Aber wer hatte schon damit gerechnet, daß es den Engländern gelingen könnte, ein Schiff der spanischen Krone aus einem spanischen Hafen zu entführen, der von schweren Kriegsschiffen abgeriegelt war?
Valdez preßte die Lippen aufeinander. Seine rechte Hand griff an die linke Hüfte, aber sein Degen war nicht da. Der Engländer hatte ihn ihm abgenommen. Er besaß keine Waffe mehr. Nicht einmal ein kleines Messer, mit dem er den Riegel der Tür hätte öffnen können.
Der Capitan schüttelte den Kopf. Der Weg durch die Tür war ihm sowieso versperrt. Er hatte den riesigen Neger gesehen, der vor der Tür wachte. Valdez wandte sich wieder zum Fenster. Seine Unruhe wuchs. Er mußte etwas unternehmen. Er durfte dieses Schiff nicht unbehelligt nach England segeln lassen, dehn es hatte etwas viel Wertvolleres an Bord als die dreißig Tonnen Silber. Und das durfte um keinen Preis der Welt in die Hände der Engländer fallen.
Romero Valdez hob die Hände und drückte gegen den Rahmen des kleinen Fensters, aber es gab nicht nach. Wütend stieß er nach dem Glas, das klirrend brach und nach draußen auf die Heckgalerie fiel.
Erschrocken hielt Valdez inne. Er lauschte zur Tür. Sein schwarzer Wächter hatte anscheinend etwas gehört. Schritte stampften über die Decksplanken, und die gutturale Stimme des Negers klang auf. Ein anderer Mann antwortete. Wahrscheinlich der Rudergänger, der am Kolderstock stand.
Valdez wartete, bis wieder Ruhe herrschte. Der kalte Seewind pfiff durch das Fenster. Der Capitan zog fröstelnd die Schultern hoch. Dann griff er abermals zum Fensterrahmen, und diesmal schaffte er es, ihn mit einem Ruck herauszureißen. Der Riegel, den einer der Engländer von draußen vor das Fenster genagelt hatte, polterte auf die Planken der Heckgalerie.
In diesem Augenblick brüllte jemand Befehle über das Mitteldeck. Valdez verstand nur Wortfetzen. Für ihn war nur wichtig, daß niemand etwas von seinem Ausbruch bemerkte.
Er stellte einen Stuhl unter das Fenster und stieg hinauf. Mühsam zwängte er seinen Oberkörper durch die kleine Öffnung. Er blickte nach oben. Der Engländer hatte tatsächlich alle Segel gesetzt, als wolle er dem Teufel ein Ohr absegeln. Der Wind nahm Sturmstärke an. Jaulend fuhr er durch die Takelage und füllte die Segel. Das Schiff pflügte mit Backstagswind und Steuerbordhalsen durch die schaumgekrönte See, die vor dem Bug herzulaufen schien.
Capitan Valdez schob sich ganz durch die schmale Fensteröffnung. Keuchend lehnte er sich gegen die Holzverkleidung des Achterkastells. Der Wind riß an seiner Kleidung. Die Kälte drang ihm bis auf die Haut, aber er bemerkte es nicht. Die Gedanken schossen durch seinen Kopf.
Wenn es ihm gelang, seine Leute aus dem Frachtraum zu befreien, konnten sie die paar Engländer, die das Schiff in ihre Gewalt gebracht hatten, mit Leichtigkeit ausschalten. Aber der Weg zum Quarterdeck war weit. Niemand wußte das besser als Captain Valdez.
Mit ein paar Schritten war der Spanier am Heck. Unter der Galerie gurgelte das Wasser. Ein Dinghi, das mit einer Schleppleine an Backbord der Heckgalerie festgemacht war, tanzte hinter dem Schiff auf den Wellen.
Valdez wunderte sich, daß der Engländer das Boot noch nicht an Bord geholt hatte, denn schließlich befand er sich auf der Flucht, und ein nachgeschlepptes Boot war so etwas wie eine Bremse, auch wenn es bei dieser Windstärke kaum ins Gewicht fiel.
Aus den Fenstern der Kapitänskammer fiel kein Licht. Entweder schlief der schwarzhaarige Engländer, oder er befand sich auf dem Achterdeck, um rechtzeitig Segel wegnehmen zu lassen, wenn der Sturm stärker wurde. Valdez preßte sein Gesicht gegen die buntbemalten Scheiben, aber er konnte im Innern der Kammer nichts erkennen.
Er schlich zurück und tastete nach dem vorstehenden Oberdecksbalken. Ächzend zog er sich in die Höhe. Er brauchte keine Angst zu haben, daß ihn jemand hörte, denn der Wind orgelte dröhnend durch die Takelage und sang ein Lied, das der Teufel selbst komponiert hatte.
Mit Mühe schaffte er es, sich über das Schanzkleid zu ziehen. Der Wind hatte das Band, mit dem seine Haare im Nacken zusammengehalten wurden, gelöst. Feuchte Strähnen hingen Valdez ins Gesicht, so daß er nichts sehen konnte. Er suchte mit den Fußspitzen Halt an der Wand des Achterkastells, und als er eine Ritze gefunden hatte, strich er sich schnell die Haare aus dem Gesicht.
Valdez wurde blaß, als er den großen schlanken Mann auf dem Achterdeck sah. Die braungebrannten, kräftigen Hände hatte der junge Engländer um das Balustradengeländer gekrallt. Sein von Wetter und Sonne gegerbtes Gesicht war auf den Großmast gerichtet, der sich unter dem Anprall des Windes nach Lee bog.
Valdez sah seinen Degen an der Hüfte des jungen Engländers, In dem breiten Gürtel steckte eine Pistole.
Der Kopf des Capitan ruckte herum, als er das Knattern der Fock hörte, die zu lose gefahren wurde.
Der Befehl des Engländers folgte auf der Stelle.
„Holt die verdammte Fock dicht!“ brüllte er, um den Sturmwind zu übertönen.
Valdez sah, wie ein paar Männer über das Deck liefen und den Befehl sofort ausführten. Die Fock stand gleich darauf wieder voll.
Der Capitan hatte genug gesehen. Er wollte sich langsam auf die Heckgalerie zurückgleiten lassen, aber seine Finger waren klamm geworden. Seine Fußspitze rutschte von der Plankenritze ab. Krachend landete Valdez auf der Heckgalerie, Sein Kopf schlug gegen die Reling. Bunte Sterne tanzten vor seinen Augen, und ein Gefühl der Übelkeit breitete sich in seinem Magen aus.
Er hörte eine Stimme und stampfende Schritte auf dem Achterkastell. Benommen rappelte er sich hoch, kroch auf allen vieren um die Ecke der Heckgalerie und preßte sich eng an die Außenwand der Kapitänskammer.
Sekundenlang wagte er nicht zu atmen. Er spürte förmlich, wie sich der Engländer über das Schanzkleid beugte und zur seitlichen Heckgalerie hinunterstarrte.
Ewigkeiten schienen zu vergehen, ehe wieder Schritte zu hören waren, Valdez atmete hastig. Er zitterte am ganzen Körper. Er horchte in sich hinein, aber es war keine Angst, die er spürte. Er wußte, daß ihm nicht viel passieren würde, wenn ihn der Engländer bei einem Befreiungsversuch ertappte. Er zitterte vor Kälte – und davor, daß dem Engländer die Kassette in die Hand fiel, die Spaniens Macht bedeutete.
Minutenlang hockte er bewegungslos da, bevor er sich zu einem Entschluß durchrang. Er schob sich langsam zum Fenster der Kapitänskammer hoch, zögerte nur kurz und schlug es mit der Faust ein.
Er preßte die Lippen aufeinander, als er den stechenden Schmerz im Handballen spürte. Etwas Warmes lief in den Ärmel seiner Jacke. Er achtete nicht darauf. Er steckte die Hand durch die Öffnung im Fenster und schob den Riegel hoch.
Der achterliche Wind riß ihm das Fenster aus der Hand. Mit lautem Knall flog es gegen die Innenwand.
Valdez fluchte unterdrückt. Er zögerte nicht länger, schwang sich hoch und schob sich durch das schmale Fenster. Als er in der Kammer war, schloß er das Fenster und schob den Riegel wieder vor.
Der Capitan brauchte kein Licht, um sich in seiner Kammer zurechtzufinden. Er umrundete den schweren Schreibtisch, auf dem Karten lagen, und ging auf seine Koje zu. Seine Hände tasteten die getäfelte Wand ab.
Er fand den geheimen Mechanismus sofort. Eine kleine Klappe sprang auf. Valdez wollte mit der rechten Hand hineingreifen, aber plötzlich wurde ihm schwindlig. Er stützte sich an der Wand ab. Er hielt seine rechte Hand vor die Augen und sah, daß die Wunde am Handballen fingerlang war. Unaufhörlich pulste das Blut heraus. Der Ärmel der Jacke hatte sich bereits damit vollgesogen.
Valdez taumelte zur anderen Seite der Kajüte. Er öffnete einen Schrank und riß die Sachen, die vor der Kiste mit Arzneien standen, einfach heraus und warf sie zu Boden. Hastig wickelte er sich einen Verband um die rechte Hand. Er wußte, daß ihm nicht mehr viel Zeit blieb. Jeden Augenblick konnten die Engländer entdecken, daß er aus der Offizierskammer geflohen war.
Mit den Zähnen zurrte er den Verband fest. Er lief zurück zu dem Geheimfach. Mit der Linken holte er die lederne Kassette hervor und preßte sie an seine Brust. Nein – sie durfte niemals in die Hände der Engländer gelangen.
Er hastete zur Tür, die zur Heckgalerie hinausführte. Als er sie aufriß, wirbelte ein Windstoß die Karten auf dem Schreibtisch hoch und verteilte sie in der ganzen Kammer.
Capitan Romero Valdez kümmerte sich nicht darum. Er hob die linke Hand, um die Lederkassette ins Meer zu werfen. Im letzten Moment zögerte er. Das Dinghi fiel ihm ein, das im Schlepp der Galeone auf den Wellen tanzte.
Ein verwegener Gedanke zuckte durch sein Hirn.
Wie weit waren sie von der Küste entfernt? Wenn der Wind sich nicht gedreht hatte, während er in der Kammer eingesperrt war, wehte er immer noch von Ost. Das Schiff lief auf nordwestlichem Kurs. Wahrscheinlich war der Engländer auf Kap Sao Vicente zugesteuert.
Also war die portugiesische Küste nicht allzu fern!
Capitan Valdez zog die Tür der Kapitänskammer entschlossen hinter sich zu. Er stopfte die kleine Lederkassette unter seine Jacke und lief zur Backbordseite der Heckgalerie, wo die Vorleine des Dinghis festgezurrt war.
Der Spanier überlegte nicht mehr lange. Er schwang sich über die Galeriereling und packte die Vorleine mit beiden Händen. Ein stechender Schmerz zuckte durch seinen rechten Arm. Aber es gab kein Zurück mehr für ihn. Seine Füße verloren den Halt, und dann hing er zwischen Himmel und Wasser.
Er ließ sich hinabgleiten, bis seine Beine ins eiskalte Wasser des Atlantiks tauchten. Seine Pumphosen sogen sich rasch voll Wasser und zogen ihn schwer nach unten.
Angst packte den Capitan. Und diese Angst verlieh ihm neue Kräfte. Obwohl die Wellen über ihm zusammenschlugen, ließ er die Vorleine nicht los. Stück für Stück hangelte er sich weiter, bis er mit der Linken nach dem Bootsrand greifen konnte. Eine Weile konnte er den Kopf über Wasser halten. Er sog gierig die Luft in seine Lungen. Er spürte den Druck der Lederkassette auf seiner Brust, und das gab ihm neue Kraft.
Er achtete nicht auf seine Wunde, in der das Salzwasser brannte. Noch einmal holte er tief Luft, dann packte er die Bordwand mit beiden Händen und zog sich hoch. Eine Welle unterlief das Boot am Heck und hob es hoch. Für einen Moment sah es so aus, als würde das Dinghi umschlagen, doch dann wurde es von einer weiteren Welle wieder aufgerichtet.
Capitan Valdez hing mit dem Oberkörper über der Bordwand und stürzte der Länge nach in die Plicht. Mit der Hüfte prallte er auf die vordere Ducht und schrie auf. Erschrocken preßte er die Lippen zusammen. Regungslos blieb er auf den Bodenbrettern des Dinghis liegen. Er konnte nur hoffen, daß der Wind den Schrei nicht bis zu den Engländern getragen hatte.
Es dauerte Minuten, bis er sich so weit gefangen hatte, daß er damit beginnen konnte, die Vorleine von dem Boot zu lösen. Er blickte nach vorn und versuchte die rabenschwarze Nacht mit seinen Augen zu durchdringen. Aber durch die Schleier der gischtenden Wellen konnte er nur die hellen Flecken der Segel erkennen.
Mit klammen Fingern löste der Spanier die Vorleine des Dinghis.
Endlich hatte er es geschafft. Innerhalb von Sekunden war die „Isabella von Kastilien“ von der Nacht und den hochgehenden Wellen verschlungen.
Capitan Romero Valdez war allein. Allein auf einer tanzenden Nußschale irgendwo im Atlantik vor der portugiesischen Küste.
Vielleicht würde er niemals wieder Land sehen. Vielleicht verschluckte ihn der Sturm, der noch an Stärke zuzunehmen schien.
Der Spanier hob trotzig das Kinn und spuckte gegen den scharfen Ostwind. Dies war nicht der erste Sturm, mit dem er fertig werden mußte. Er würde es schaffen – und wenn nicht, dann hatte er Spanien immer noch vor einem großen Schaden bewahrt.
Er preßte die lederne Kassette enger an sich und schloß sorgfältig die oberen Knöpfe seiner Jacke. Dann nahm er die Riemen von den Duchten, schob sie in die Runzeln und begann gegen den Wind zu pullen.
Schon nach kurzer Zeit hatte Capitan Valdez jegliches Gefühl für Zeit verloren. Mit stoischem Gleichmut zog er die Riemen durch das aufgepeitschte Wasser. Er merkte nicht, daß der Sturm langsam nachließ, und als die ersten grauen Streifen an der östlichen Kimm aufzogen, drehte er sich nicht einmal um.
Seine Augen waren vom Salzwasser entzündet. Seine Hände spürte er nicht mehr. Der Verband an der rechten Hand war durch und durch rot vom Blut, das er in den ersten Stunden noch verloren hatte.
2.
Philip Hasard Killigrew krallte die rechte Hand in die Steuerbordreling der Poop und stand breitbeinig auf den vibrierenden Planken des Achterkastells. Seine eisblauen Augen blitzten. Zwei weiße Zahnreihen leuchteten zwischen den leicht geöffneten Lippen.
Hasard war in seinem Element. Das Orgeln des steifen Ostwindes war für seine Ohren Musik. Er war froh, daß der Sturm so schnell nachgelassen hatte.
Er blickte aufs Hauptdeck hinunter, wo Ben Brighton und drei andere Männer die Fock wieder setzten. Nach seinen Berechnungen mußten sie Kap Sao Vicente bereits hinter sich gelassen haben, und niemand von den lausigen Spaniern, denen sie die „Isabella“ aus dem Hafen von Cadiz gekapert hatten, würde sie jemals wieder einholen.
Das Herz lachte Hasard im Leibe, als er an die dreißig Tonnen Silber im Laderaum des Schiffes dachte. Mit diesem Geld konnte man neue Schiffe bauen und den Spaniern noch mehr Verluste beibringen.
Hasard hob den Kopf. Der Wind hatte auf Südost gedreht. Er wollte gerade einen Befehl hinunter aufs Hauptdeck brüllen, da sah er, daß Ben Brighton schon von sich aus die Rahen so braßte, daß sie auf ihrem Nordwestkurs blieben. Die „Isabella“ lag jetzt platt vorm Wind. Der schwerfällige Rumpf tauchte seine Nase in tiefe Wellentäler, und Gischtschleier wehten über die Back und das Vorkastell.
Philip Hasard Killigrew beobachtete Ben Brighton. Der Bootsmann der „Marygold“ enttäuschte ihn nicht. Er war wirklich so gut, wie Hasard vermutet hatte. Hasard konnte sich auf Brightons seemännische Fähigkeiten voll verlassen. Das einzige, was ihn an dem Mann störte, war seine unerschütterliche Ruhe. Aber bisher hatte er auch reagiert, wenn es hart auf hart ging und eine blitzschnelle Entscheidung verlangt wurde.
Der Seewolf zog die Lippen von den Zähnen. Ben Brighton war schon in Ordnung. Alles in allem hatte er gute Seeleute an Bord. Vielleicht mit Ausnahme des Kutschers, der ebenfalls in Plymouth gepreßt worden war und behauptete, nichts mehr zu hassen als Schiffe und die See. Dabei hatte er sich dennoch bereits Seebeine wachsen lassen.
Hasard grinste. Der arme Kerl würde seinen Lord wohl nicht so schnell wiedersehen. Sicher war sein Job inzwischen schon von einem anderen Mann besetzt.
Neben Ben Brighton stand Donegal Daniel O’Flynn und schlug das Geitau der Fock um die Nagelbank. Die Augen des schlaksigen Jungen leuchteten. Für ihn war diese Prise das größte Abenteuer, das er bisher erlebt hatte. Die langen blonden Haare hingen ihm in nassen Strähnen ins Gesicht, und als Brighton etwas zu ihm sagte, brüllte er sein „Aye, aye, Sir“ so laut übers Deck, daß Hasard es gegen den Wind auf der Poop hörte.
Hasard trat noch ein paar Schritte nach vorn und blickte aufs Quarterdeck hinab.
„Ferris!“ rief er hinunter.
Der rothaarige Riese, der sich an der Lafette der kleinen Kanone an Steuerbord des Quarterdecks zu schaffen machte, drehte den Kopf.
„Ja?“
„Übernimm die Wache, Ferris“, sagte Hasard. „Ich werde mich ein paar Stunden aufs Ohr legen. Ich glaube, daß der Wind seine Stärke jetzt beibehält.“
„Aye, aye“, sagte Ferris Tucker. Er kletterte auf die Poop, während Hasard im Niedergang verschwand und auf die Kapitänskammer zusteuerte. Vor der Offizierskammer hockte Batuti auf der Erde. Der riesige Neger sprang auf die Beine.
„Alles in Ordnung, Batuti?“ fragte Hasard.
„Aye, aye, Sir!“
Der schwarze Herkules aus Gambia grinste über beide Ohren.
Hasard trat an die verriegelte Tür der Offizierskammer und schob den Balken aus der Halterung.
„Mal sehen, ob unser hoher Gast noch einen Wunsch hat“, sagte er. „Schließlich müssen wir ihm dankbar sein, daß er die wertvolle Ladung für uns von Westindien hierhergeholt hat.“
Philip Hasard Killigrew stieß die Tür auf.
In der Kammer war es dunkel. Mit der Linken griff Hasard nach hinten und Batuti reichte ihm die Öllampe.
Hasard sah das herausgebrochene Fenster und wußte sofort, was los war. Abrupt drehte er sich um. Er knallte dem Schwarzen die Laterne vor die Brust und rief im Laufen: „Hol alle Männer an Deck! Der Spanier ist aus seiner Kammer ausgebrochen!“
Wie der Blitz fegte Hasard auf das Oberdeck, raste über das Quarterdeck und nahm den Niedergang zum Hauptdeck mit zwei mächtigen Sätzen. Mittschiffs am Niedergang zum Frachtraum hockte ein Mann, der sofort aufsprang, als er Hasard erkannte.
„Alles in Ordnung?“ fragte Hasard keuchend.
Der Mann nickte erstaunt.
„Klar“, sagte er.
„Der Capitan ist ausgebrochen“, sagte Hasard schnell, damit der Mann seine Befürchtungen verstand.
Die Augen des Seemannes wurden groß. Hastig drehte er sich um und verschwand im Niedergang. Hasard folgte ihm. Zu zweit überzeugten sie sich, daß die gefangenen Spanier schliefen. Ein paar von ihnen richteten sich auf. Sie waren vom Lärm, der jetzt an Deck herrschte, geweckt worden.
Hasard hastete wieder auf Deck.
Ben Brighton und Dan O’Flynn standen am Niedergang und blickten ihm fragend entgegen. O’Flynn hielt einen Degen, den er einem Spanier abgenommen hatte, in der rechten Faust.
„Hast du den Capitan gefunden?“ fragte Ben Brighton in seiner ruhigen Art.
Hasard schüttelte den Kopf.
„Er hat nicht versucht, seine Männer zu befreien“, sagte er nachdenklich. „Noch nicht. Vielleicht tut er es noch. Laß die Wachen am Niedergang verstärken, Ben. Und dann geh mit allen Männern auf die Suche nach dem Gefangenen. Wer weiß, was er im Schilde führt. Zwei Männer bewachen die Pulverkammer, damit er nicht das ganze Schiff in die Luft jagt.“