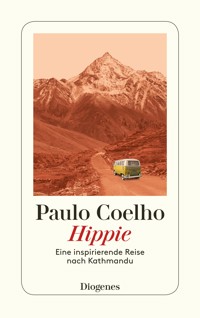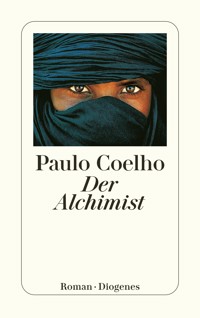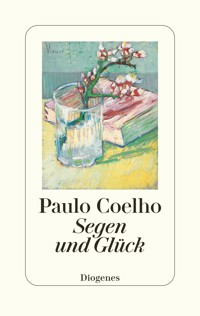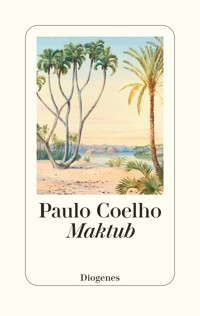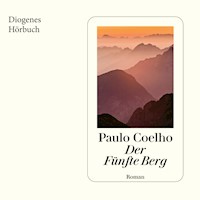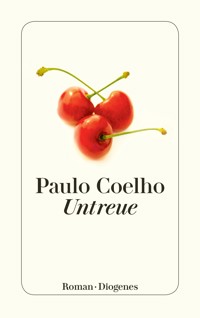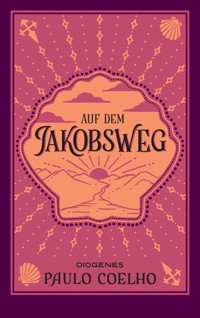8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein spiritueller Wegweiser für Leute, die unterwegs sind – unterwegs zu sich selbst, zur Verwirklichung ihrer Träume, zur Bezwingung ihrer inneren Berge. Ein Stundenbuch, das gewissermaßen ein Minutenbuch ist – für den Stau auf der Autobahn, beim Warten auf den Bus, im Zug, beim Spazierengehen, abends vor dem Einschlafen oder wenn man schlaflos daliegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Paulo Coelho
Sei wie ein Fluß,der still die Nachtdurchströmt
Geschichten und Gedanken
Aus dem Brasilianischen vonMaralde Meyer-Minnemann
Die hier versammelten Geschichten erschienen zuerst
2006 im Diogenes Verlag und sind eine von
Paulo Coelho vorgenommene Auswahl
und Zusammenstellung von
seit 1995 gesammelten und zum Teil
in Zeitungen oder auf seiner Homepage
www.paulocoelho.com
publizierten Kolumnen
Copyright © 2006 by Paulo Coelho
Mit freundlicher Genehmigung von
Sant Jordi Asociados, Barcelona, Spanien
Alle Rechte vorbehalten
Paulo Coelho: www.paulocoelho.com
Die Kolumne ›Der Klavierspieler im Einkaufszentrum‹
wurde von Barbara Mesquita übersetzt
Die Kolumne ›Der Australier und die Anzeige
in der Zeitung‹ ist unter dem Titel ›Gerechtigkeit‹,
die Kolumne ›Allein auf dem Weg‹ unter dem Titel
›Das Radrennen‹ im Sammelband Unterwegs/Der Wanderer
erschienen, und die Kolumne ›Ich darf nicht hinein‹ ist leicht
verändert im Kapitel »Paula, Ana und Maria« (S.216 f.)
in Bekenntnisse eines Suchenden. Juan Arias im Gespräch
mit Paulo Coelho enthalten
Alle anderen Kolumnen erscheinen hier erstmals in Buchform
Umschlagfoto (Ausschnitt):
Copyright © plainpicture/Cultura
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2016
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23782 5 (13.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60258 6
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Sein wie ein Fluß,
der still die Nacht durchströmt.
Die dunkle Nacht nicht fürchten.
Die Sterne widerspiegeln, wenn welche am Himmel sind,
und wenn Wolken den Himmel bedecken,
Wolken, die Wasser sind wie der Fluß,
auch diese widerspiegeln, ohne Schmerz,
in den ruhigen Tiefen.
Manoel Bandeira, Der Fluß
[7] Inhalt
1 Statt eines Vorworts: Schriftsteller sein [11]
2 Ein Tag in der Mühle [16]
3 Der Mann, der seinen Träumen folgte [20]
4 Das Böse will, daß das Gute getan wird [23]
5 Auf den Kampf vorbereitet, doch voller Zweifel [26]
6 Der Weg des Bogens und des Pfeils [29]
7 Die Geschichte vom Bleistift [33]
8 Handbuch für Bergsteiger [35]
9 Über die Wichtigkeit eines Diploms [40]
10 In einer Bar in Tokio [43]
11 Blickkontakt [47]
12 Dschingis-Khan und sein Falke [50]
13 Ein Blick in Nachbars Garten [53]
14 Die Büchse der Pandora [54]
15 Wie alles in einem Teil enthalten sein kann [58]
16 Die Musik in der Kapelle [59]
17 Das Schwimmbad des Teufels [62]
18 Der Tote im Pyjama [63]
19 Die einsame Glut [67]
20 Manuel ist ein wichtiger und unentbehrlicher Mann [69]
21 Manuel ist ein freier Mann [73]
22 Manuel kommt ins Paradies [77]
23 Eine Konfrontation ist besser [80]
24 Der Klavierspieler im Einkaufszentrum [82]
25 Unterwegs zur Buchmesse in Chicago [85]
26 Von Stöcken und Regeln [86]
27 Das Butterbrot, das auf die verkehrte Seite fiel [90]
28 Von Büchern und Bibliotheken [92]
29 Prag, 1981 [96]
30 Für eine Frau, die alle Frauen ist [98]
31 Jemand kommt aus Marokko [101]
32 Meine Beerdigung [102]
33 Das Netz flicken [105]
34 Das sind doch meine Freunde! [107]
35 Wie haben wir bloß überlebt? [108]
36 Rendezvous mit dem Tod [111]
37 Der Moment der Morgenröte [115]
38 Ein beliebiger Tag im Januar 2005 [116]
39 Der Mann, der auf dem Boden lag [119]
40 Der fehlende Baustein [122]
41 Raj erzählt mir eine Geschichte [123]
42 Jenseits von Babel [125]
43 Vor einem Vortrag [129]
44 Von der Anmut [130]
45 Nhá Chica aus Baependi [133]
46 Das Haus wieder aufbauen [137]
47 Das Gebet, das ich vergessen hatte [138]
48 Copacabana, Rio de Janeiro [141]
49 Todes- und Geburtsstatistiken [142]
50 Die Bedeutung von Katzen bei der Meditation [145]
51 Ich darf nicht hinein [148]
52 Statuten des neuen Jahrtausends [149]
53 Zerstören und aufbauen [152]
54 Der Krieger und der Glaube [153]
55 Im Hafen von Miami [157]
56 Aus einem Impuls heraus handeln [158]
57 Über den flüchtigen Ruhm [159]
58 Mißbrauchte Barmherzigkeit [162]
59 Hexenjagd gestern und heute [164]
60 Über das Tempo und den Weg [167]
61 Anders reisen [169]
62 Ein Märchen [172]
63 Dem Größten von allen [175]
64 Von einer Begegnung, die nicht stattgefunden hat [178]
65 Das Paar, das lächelte (London 1977) [180]
66 Die zweite Chance [182]
67 Der Australier und die Anzeige in der Zeitung [186]
68 Die Tränen der Wüste [187]
69 Isabelle kehrt aus Nepal zurück [190]
70 Die Kunst des Schwertkampfs [191]
71 In den blauen Bergen [194]
72 Vom Genuß des Gewinns [196]
73 Die Teezeremonie [199]
74 Die Wolke und die Düne [200]
75 Norma und die guten Dinge [203]
76 21. Juni 2003, Jordanien, Totes Meer [204]
77 Im Hafen von San Diego, Kalifornien [207]
78 Die Kunst des Rückzugs [208]
79 Mitten im Krieg [211]
80 Der Soldat im Wald [212]
81 In einer Stadt in Deutschland [215]
82 Eine Begegnung in der Dentsu-Galerie [216]
83 Gedanken zum 11. September 2001 [219]
84 Die Zeichen Gottes [222]
85 Allein auf dem Weg [224]
86 Was am Menschen witzig ist [227]
87 Eine Reise um die Welt nach dem Tod [228]
88 Wer will diesen Schein? [231]
89 Die zwei Schmuckstücke [232]
90 Selbstbetrug [235]
91 Die Kunst des Versuchs [237]
92 Die Fallstricke der Suche [240]
93 Mein Schwiegervater, Christiano Oiticica [244]
94 Danke, Mr. President [245]
95 Der kluge Angestellte [249]
96 Die dritte Leidenschaft [250]
97 Der Katholik und der Moslem [253]
98 Das Gesetz von Jante [254]
99 Die Alte von Copacabana [257]
100 Offen für die Liebe bleiben [258]
101 An das Unmögliche glauben [261]
102 Ein Gewitter zieht auf [264]
103 Beenden wir dieses Buch mit Gebeten [267]
[11] 1
Statt eines Vorworts:
Schriftsteller sein
Als ich fünfzehn war, sagte ich zu meiner Mutter:
»Ich weiß, was ich werden will, Mama. Ich will Schriftsteller werden.«
»Mein Sohn«, antwortete sie traurig, »dein Vater ist Ingenieur. Er ist ein logisch und vernünftig denkender Mann. Er sieht die Welt mit präzisem, sachlichem Blick. Weißt du eigentlich, was das ist, ein Schriftsteller?«
»Ein Schriftsteller ist jemand, der Bücher schreibt.«
»Dein Onkel Haroldo, der Arzt ist, schreibt auch Bücher und hat sogar schon einige veröffentlicht. Studier Bauingenieur, und schreib in deiner Freizeit.«
»Nein, Mutter. Ich will nur Schriftsteller sein. Kein Ingenieur, der Bücher schreibt.«
»Hast du schon mal einen Schriftsteller kennengelernt? Oder je einen gesehen?«
»Nie. Nur auf Fotos.«
»Wie willst du Schriftsteller werden, ohne genau zu wissen, was das ist?«
Um meiner Mutter eine Antwort geben zu können, beschloß ich, mich schlau zu machen. Hier folgt das Ergebnis meiner Erhebung dazu, was es Anfang der sechziger Jahre bedeutete, Schriftsteller zu sein:
[12] Erstens: Ein Schriftsteller trägt stets eine Brille und kämmt sich nicht ordentlich. Er ist die Hälfte der Zeit auf alles und jeden wütend und die andere deprimiert. Er lebt in Bars, diskutiert mit den anderen Brille tragenden, ungekämmten Schriftstellern. Er redet Schwerverständliches. Hat immer phantastische Ideen für seinen nächsten Roman und macht den herunter, den er gerade veröffentlicht hat.
Zweitens: Ein Schriftsteller darf auf gar keinen Fall von seiner eigenen Generation verstanden werden, sonst glaubt ihmkeiner, daß er ein Genie ist, und dabei ist er doch davon überzeugt, in eine Zeit hineingeboren zu sein, in der die Mittelmäßigkeit das Zepter schwingt. Ein Schriftsteller überarbeitet und verbessert jeden Satz, den er schreibt, mehrmals. Der Wortschatz eines gewöhnlichen Menschen umfaßt 3000 Wörter; die benutzt aber ein richtiger Schriftsteller nicht, schließlich gibt es weitere 189000 im Wörterbuch, und ein Schriftsteller ist kein gewöhnlicher Mensch.
Drittens: Nur andere Schriftsteller begreifen, was ein Schriftsteller sagen will. Trotzdem verachtet der Schriftsteller insgeheim die anderen Schriftsteller – denn sie sind alle Konkurrenten im Kampf um die wenigen Plätze, die die Literaturgeschichte im Laufe der Jahrhunderte Autoren zuweist. Daher streitet der Schriftsteller mit seinesgleichen um die Trophäe für das komplizierteste Buch: Sieger wird, wer am kompliziertesten schreibt.
[13] Viertens: Ein Schriftsteller ist auf Gebieten mit furchteinflößenden Namen bewandert: Semiotik, Epistemologie, Neokonkretismus. Um zu schockieren, sagt er Dinge wie: »Einstein ist ein Esel«, oder: »Tolstoi ist der Clown der Bourgeoisie.« Alle sind empört, wiederholen aber nichtsdestoweniger anderen gegenüber, daß die Relativitätstheorie falsch sei und Tolstoi die russische Aristokratie verteidigt habe.
Fünftens: Wenn ein Schriftsteller eine Frau rumkriegen will, sagt er einfach: »Ich bin Schriftsteller«, und schreibt ein Gedicht auf eine Serviette. Das klappt immer.
Sechstens: Da er gebildet ist, bekommt ein Schriftsteller jederzeit einen Job als Literaturkritiker. Und als solcher ist er großzügig, indem er die Bücher seiner Freunde bespricht. Die Hälfte der Kritik besteht aus Zitaten ausländischer Autoren, die andere aus Analysen, in denen ständig Sätze vorkommen mit Ausdrücken wie »der epistemologische Schnitt« oder »die integrierte Version einer entsprechenden Achse«. Wer die Kritik liest, sagt: »Was für ein gebildeter Mensch!« Und kauft das Buch nicht, weil er nicht weiß, wie er weiterlesen soll, wenn der epistemologische Schnitt erfolgt ist.
Siebtens: Wenn ein Schriftsteller gefragt wird, welches Buch er gerade liest, nennt er immer eines, von dem niemand je etwas gehört hat.
[14] Achtens: Es gibt nur ein Buch, das den Schriftsteller und alle seine Kollegen einhellig begeistert: Ulysses von James Joyce. Der Schriftsteller spricht nie schlecht über dieses Buch, aber wenn ihn jemand fragt, worum es darin geht, kann er es nicht recht erklären, was Zweifel darüber aufkommen läßt, ob er es überhaupt gelesen hat. Es ist erstaunlich, daß Ulysses so selten neu aufgelegt wird, wo doch alle Schriftsteller es als Meisterwerk anführen; vielleicht liegt es ja an der Dummheit der Verleger, die sich die Chance entgehen lassen, mit einem Buch Geld zu verdienen, das alle mit Vergnügen gelesen haben.
Anhand dieser Erhebung habe ich dann meiner Mutter erklärt, was ein Schriftsteller ist. Sie war ziemlich überrascht.
»Es ist einfacher, Ingenieur zu sein«, sagte sie. »Außerdem trägst du doch gar keine Brille.«
Aber ich war bereits ungekämmt, hatte mein Päckchen Gauloises in der Tasche und ein Theaterstück unter dem Arm (Grenzen des Widerstandes, das der Kritiker Yan Michalski zu meiner großen Freude als »das verrückteste Spektakel« bezeichnete, »das ich je gesehen habe«). Ich studierte Hegel und war wild entschlossen, Ulysses zu lesen. Bis eines Tages Raul Seixas erschien, mich von der Suche nach Unsterblichkeit ab- und auf den Weg der gewöhnlichen Menschen zurückbrachte.
Das hat dazu geführt, daß ich viele Orte besuchte und, wie Bertolt Brecht einmal gesagt hat, die Länder noch öfter wechselte als die Schuhe. Auf den folgenden Seiten halte ich Momente fest, die ich erlebt habe, Gedanken, die [15] mich auf bestimmten Etappen jenes Flusses bewegten, der mein Leben ist.
Die hier versammelten Geschichten und Gedanken sind in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften in aller Welt veröffentlicht worden und erscheinen hier größtenteils erstmals deutsch in Buchform.
[16] 2
Ein Tag in der Mühle
Mein Leben ist zur Zeit eine Symphonie in drei Sätzen mit den Angaben: »viele Menschen«, »einige Menschen« und »fast niemand«. Diese drei Sätze können im Laufe eines Jahres jeweils vier Monate andauern, manchmal aber wechseln sie sich auch innerhalb eines Monats ab. Allerdings ist jeder Satz ganz klar erkennbar.
Der Satz »viele Menschen« entspricht den Zeiten meiner Lesereisen, auf denen ich Verleger und Journalisten treffe. Der Satz »einige Menschen« ist dran, wenn ich in Brasilien bin, alte Freunde treffe, den Copacabana-Strand entlangwandere, zu diesem oder jenem gesellschaftlichen Ereignis gehe, meistens aber zu Hause bleibe.
Heute möchte ich jedoch meine Gedanken zu dem Satz mit der Bezeichnung »fast niemand« schweifen lassen. Draußen geht soeben die Sonne über dem 200-Seelen-Dorf in den Pyrenäen unter, in dem ich vor kurzem eine zu einem Haus umgebaute Mühle gekauft habe. Jeden Morgen wache ich mit dem ersten Hahnenschrei auf, trinke meinen Kaffee und mache mich dann zu einem Spaziergang auf, an Kühen und Schafen vorbei, durch Maisfelder und Wiesen. Ich betrachte die Berge und – anders als bei dem Satz mit der Bezeichnung »viele Menschen« – denke dabei nicht darüber nach, wer ich bin. Ich habe weder Fragen noch [17] Antworten, lebe ganz in der Gegenwart, begreife, daß das Jahr vier Jahreszeiten hat (das mag offensichtlich erscheinen, aber manchmal vergessen wir es) und daß ich mich verändere wie die Landschaft ringsum.
In solchen Augenblicken interessiert es mich wenig, was im Irak oder in Afghanistan geschieht: Wie für die meisten Leute, die auf dem Lande leben, sind die wichtigsten Nachrichten die Wetterberichte. Alle im Dorf wissen, ob es regnen, kalt oder windig wird, da ihr Leben, ihre Pläne, ihre Ernten unmittelbar davon betroffen sind. Ich komme an einem Bauern vorbei, der sein Feld bestellt, wir wünschen einander einen guten Tag, unterhalten uns über den Wetterbericht und gehen dann wieder unseren Beschäftigungen nach – er pflügt weiter, und ich setze meine Wanderung fort.
Beim Nachhausekommen schaue ich in den Briefkasten. Da liegt das Regionalblatt: Im Nachbardorf gibt es ein Tanzfest, in der nächsten größeren Stadt eine Lesung. Die Feuerwehr mußte ausrücken, weil in der Nacht eine Mülldeponie in Brand gesteckt wurde. Hauptgesprächsthema im Bezirk ist eine Gruppe, der vorgeworfen wird, die Platanen an einer Landstraße gefällt zu haben, weil sie die Bäume für den Tod eines Motorradfahrers verantwortlich machen. Diese Nachricht nimmt eine ganze Seite ein, und tagelang wird über das »Geheimkommando« berichtet, das den Tod des jungen Mannes rächen wollte, indem es die Bäume fällte.
Ich lege mich an den Bach, der an meiner Mühle vorbeifließt. Blicke in den wolkenlosen Himmel dieses mörderischen Sommers, der allein in Frankreich fünftausend [18] Todesopfer gefordert hat. Ich stehe wieder auf, übe Kyudo, die Meditation mit Pfeil und Bogen, die mehr als eine Stunde meines Tages ausfüllt. Dann ist Zeit fürs Mittagessen: Ich nehme ein leichtes Mahl ein, und dabei fällt mein Blick plötzlich auf einen merkwürdigen Gegenstand in einem der Nebengebäude des alten Hauses, mit einem Bildschirm, einer Tastatur und – Wunder aller Wunder – einer Hochgeschwindigkeitsverbindung, auch DSL genannt. Ich weiß, sobald ich den Einschaltknopf drücke, kommt die Welt zu mir.
Ich widerstehe, so lange ich kann, aber irgendwann berührt mein Finger dann doch den Einschaltknopf, und ich bin wieder mit der Welt verbunden, mit den Büchern, den Interviews, die ich geben muß, den Nachrichten aus dem Irak und aus Afghanistan, den Anfragen, der Ankündigung meines Flugtickets für morgen, den Entscheidungen, die sich aufschieben lassen, und den Entscheidungen, die sofort getroffen werden müssen.
Ich arbeite ein paar Stunden lang, denn das habe ich mir so ausgesucht, weil dies mein Lebenstraum ist, weil ein Krieger des Lichts weiß, daß er Pflichten hat und Verantwortung trägt. Während des »Fast-niemand-Satzes« der Symphonie rückt alles, was auf dem Bildschirm des Computers erscheint, in weite Ferne, so wie die Mühle wie ein Traum erscheint, wenn ich mich im Satz »viele Menschen« oder »einige Menschen« befinde.
Die Sonne geht unter, der Knopf zum Ausschalten wird gedrückt, die Welt ist erneut nur Feld, frisch gemähtes Gras, muhende Kühe, die Stimme des Hirten, der seine Schafe zurück in den Stall neben der Mühle treibt.
[19] Ich frage mich, wie ich einen Tag in zwei so unterschiedlichen Welten verbringen kann. Darauf weiß ich keine Antwort, nur, daß mir das viel Spaß bringt und ich zufrieden bin, während ich diese Zeilen schreibe.
[20] 3
Der Mann, der seinen Träumen folgte
Ich kam in der Klinik São José in Rio de Janeiro zur Welt. Da meine Geburt ziemlich kompliziert war, hat meine Mutter mich dem heiligen Joseph geweiht, ihn gebeten, mir zu helfen, am Leben zu bleiben. Der heilige Joseph ist seither ein Fixpunkt in meinem Leben, und seit 1987, dem Jahr nach meiner Wallfahrt nach Santiago de Compostela, gebe ich jährlich am 19.März zu seinen Ehren ein Fest. Wir laden Freunde ein, arbeitsame, ehrliche Leute, und vor dem Abendessen beten wir für alle, die versuchen, bei ihrer Arbeit nie ihre Würde zu verlieren. Wir beten auch für die, die keine Arbeit, keine Zukunftsperspektive haben.
Vor dem Gebet erinnere ich daran, daß das Wort »Traum« im Neuen Testament fünfmal auftaucht, viermal bezieht es sich auf Joseph, den Zimmermann, und jedesmal geht es darum, wie ein Engel ihn davon überzeugt, genau das Gegenteil von dem zu tun, was er ursprünglich vorhatte.
Der Engel bittet ihn, seine Frau nicht zu verlassen, obwohl sie von einem anderen ein Kind erwartet. Joseph hätte einwenden können, »Was sollen unsere Nachbarn denken«, aber er geht nach Hause und glaubt dem, was das Wort des Engels ihm enthüllt hat.
Der Engel schickt ihn nach Ägypten. Auch da hätte [21] Joseph antworten können: »Aber ich habe mich doch hier in Nazareth als Tischler niedergelassen, habe meine Kunden, ich kann doch nicht einfach alles aufgeben.« Dennoch packt er seine Sachen und bricht auf ins Unbekannte.
Joseph folgt dem Traum, den ihm der Engel eingegeben hat, anstatt zu tun, was der gesunde Menschenverstand verlangt. Er weiß: Wie unendlich viele andere Männer auf der Welt muß er für seine Familie dasein und sie ernähren. Aber von ihm wird noch mehr verlangt, denn er muß Dinge hinnehmen, die seine Vorstellungskraft übersteigen.
Von einem seiner Söhne ausgehend, wird das Christentum entstehen. Seine Frau wird von vielen Menschen tief verehrt werden. Aber seiner, des Handwerkers, der diesen Sohn aufgezogen hat, wird nur bei den Weihnachtskrippen gedacht. Oder aber jene gedenken seiner, die ihn in besonderer Weise verehren, wie ich oder Leonardo Boff, für dessen Buch über den Zimmermann ich ein Vorwort geschrieben habe.
Ich gebe im folgenden einen Text des Schriftstellers Carlos Heitor Cony wieder (ich hoffe, es ist wirklich sein Text, denn ich habe ihn im Internet gefunden):
»Immer wieder wundern sich die Leute darüber, daß ich, der ich mich als Agnostiker bezeichne und eine philosophische, moralische oder religiöse Gottesvorstellung ablehne, traditionelle Heilige verehre. Gott ist eine Vorstellung oder Wesenheit, die mein Vorstellungsvermögen übersteigt und von dem, was ich brauche, zu weit entfernt ist. Die Heiligen hingegen verdienen, weil sie irdisch waren, weil sie den gleichen Ursprung haben wie ich, nämlich den der aus Lehm [22] gemachten ersten Menschen, mehr als nur meine Bewunderung. Sie verdienen meine Verehrung.
Der heilige Joseph ist einer von ihnen. In den Evangelien ist kein einziges Wort von ihm überliefert, nur sein Handeln, und einmal heißt es, er sei ein ›vir iustus‹, ein gerechter Mensch. Da Joseph Zimmermann und nicht Richter war, kann man daraus folgern, daß Joseph vor allem ein guter Mensch war. Ein guter Zimmermann, ein guter Ehemann, ein guter Vater eines kleinen Jungen, der die Geschichte der Welt in ein Davor und ein Danach teilen würde.«
Schöne Worte hat Cony da gefunden. So anders als die verstiegenen Geschichten, die ich manchmal lese, wie zum Beispiel den Satz: »Jesus ist nach Indien gegangen, um dort von den Meistern des Himalaja zu lernen.« Ich denke, jeder Mensch kann die Aufgabe, die ihm das Leben gestellt hat, heiligen. Jesus hat etwas gelernt, als Joseph, der gerechte Mensch, ihm beibrachte, Tische, Stühle und Betten zu zimmern.
[23] 4
Das Böse will, daß das Gute getan wird
Der erste Kalif der Omayaden-Dynastie, Muawiya, schlief eines Tages in seinem Palast, als er von einem Fremden geweckt wurde.
»Wer bist du?« fragte er.
»Ich bin Luzifer«, antwortete der Fremde.
»Was willst du hier?«
»Die Stunde für dein Gebet ist gekommen, und du schläfst immer noch.«
Muawiya stutzte. Wieso erinnerte ihn der Fürst der Finsternis an seine Betstunde, wo er doch sonst immer darauf aus war, die Seelen der Kleingläubigen für sich zu gewinnen?
Luzifer erklärte es ihm:
»Vergiß nicht, daß ich als Engel des Lichts geboren wurde. Trotz allem, was mir widerfahren ist, kann ich meine Herkunft nicht vergessen. Ein Mensch kann bis nach Rom oder Jerusalem reisen, doch er wird immer die Werte seiner Heimat in seinem Herzen tragen: Genau das ist auch bei mir der Fall. Ich liebe noch immer meinen Schöpfer, der mich genährt hat, als ich jung war, und der mich gelehrt hat, Gutes zu tun. Ich habe mich nicht gegen ihn aufgelehnt, weil ich ihn nicht liebte, ganz im Gegenteil. Ich liebte ihn so sehr, daß ich auf Adam eifersüchtig war. [24] Damals wollte ich Gott herausfordern, und das hat mich ins Verderben gestürzt. Dennoch habe ich die Segnungen nicht vergessen, die ich einst von ihm erhalten habe, und vielleicht komme ich ja, wenn ich Gutes tue, wieder zurück ins Paradies.«
Muawiya antwortete:
»Ich höre wohl nicht recht? Du hast so viele Menschen auf dieser Erde ins Unglück gestürzt.«
»Du solltest mir aber glauben«, ließ Luzifer nicht locker. »Gott allein kann aufbauen und zerstören, denn er ist allmächtig. Er hat dem Menschen, als er ihn schuf, das Begehren, die Rache, das Mitgefühl und die Angst mitgegeben. Sie sind Teil seines Lebens. Darum darfst du nicht mir die Schuld an all dem Bösen um dich herum geben, denn ich bin nur der Spiegel des Bösen.«
Muawiya, dem das alles nicht geheuer war, wandte sich verzweifelt an Gott und betete um Erleuchtung. Er stritt und unterhielt sich die ganze Nacht mit Luzifer, ohne sich von dessen brillanten Argumenten beirren zu lassen.
Als der neue Tag anbrach, gab Luzifer schließlich auf und erklärte:
»Es stimmt, du hast recht. Als ich gestern nachmittag kam, um dich zu wecken, damit du die Gebetsstunde nicht versäumst, wollte ich dich nicht dem göttlichen Licht nahebringen.
Vielmehr wußte ich, daß du dich grämen würdest, wenn du deine Pflicht nicht erfüllst, und in den nächsten Tagen doppelt so gläubig beten und für deine Pflichtvergessenheit um Vergebung bitten würdest. In Gottes Augen würde ein jedes dieser Gebete, die du mit Hingabe und Reue [25] sprichst, soviel wert sein wie zweihundert aus Gewohnheit und ohne Nachdenken gesprochene Gebete. Du würdest am Ende geläuterter und beseelter sein, Gott würde dich noch mehr lieben, und ich wäre seiner Seele noch ferner.«
Luzifer, der Herr der Finsternis, verschwand, und ein Engel des Lichts trat gleich darauf ein:
»Vergiß niemals, was du heute gelernt hast«, sagte er zu Muawiya. »Manchmal verstellt sich das Böse als Sendbote des Guten, doch dahinter steckt immer die Absicht, noch mehr Zerstörung hervorzurufen.«
[26] 5
Auf den Kampf vorbereitet, doch voller Zweifel
Ich lege eine eigenartige, aus dickem Stoff gemachte, grüne »Rüstung« voller Reißverschlüsse an. Meine Hände stecken in Handschuhen, um Verletzungen zu vermeiden. Ich ergreife eine Art Lanze, die fast so groß wie ich und am Ende mit drei Zacken und einer Spitze versehen ist.
Vor mir liegt mein »Schlachtfeld«: mein Garten.
Mit meiner »Lanze« mache ich mich daran, dem Unkraut zu Leibe zu rücken, das sich im Rasen breitgemacht hat. Ich tue dies eine Zeitlang und weiß, daß jede aus dem Boden ausgerissene Pflanze sterben wird.
Dann halte ich plötzlich inne und frage mich: Tue ich das Richtige?
Was ich »Unkraut« nenne, sind Pflanzen, die in Jahrmillionen von der Natur geschaffen wurden und überlebt haben. Ihre Blüten wurden von unzähligen Insekten bestäubt, entwickelten Samen, die der Wind weiträumig auf den umliegenden Feldern verteilte, so daß sie an vielen Stellen gedeihen konnten und so größere Chancen hatten, den Winter zu überstehen und im nächsten Frühling wieder zu sprießen. Würde jede Pflanzenart nur an einem Fleck wachsen, wäre die Gefahr groß, daß sie ausstürbe, denn sie wäre Pflanzenfressern, Überschwemmungen, Bränden oder Trockenheit ausgesetzt.
[27] Doch das tapfere Unkraut bekommt es jetzt mit meiner Lanze zu tun, die ihm einen erbarmungslosen Kampf liefert.
Warum tue ich das?
Jemand – ich weiß nicht, wer – hat den Garten geschaffen. Als ich mein Haus kaufte, war er schon da, harmonisch eingepaßt in die Berglandschaft und die ihn begrenzenden Bäume. Doch mein Vorgänger muß ihn lange geplant, sorgfältig bepflanzt und ihn jahraus jahrein gehegt und gepflegt haben. (Da gibt es beispielsweise eine Allee, welche die Hütte verbirgt, in der wir unser Feuerholz aufbewahren.) Als ich die alte Mühle übernahm, in der ich jährlich mehrere Monate verbringe, war der Rasen makellos. Jetzt muß ich die Arbeit meines Vorgängers fortsetzen. Doch es bleibt die Frage: Ist das Geschaffene wichtiger oder die wildwachsende Natur?
Ich reiße weiter unerwünschte Pflanzen aus und werfe sie auf einen Haufen, um sie später zu verbrennen. Möglicherweise mache ich mir über das, was ich tue, zu viele Gedanken. Aber eine jede Geste des Menschen ist heilig und hat Folgen, und daher mache ich mir zu Recht Gedanken.
Einerseits haben diese Wildpflanzen das Recht, sich überall auszubreiten. Andererseits werden sie, wenn ich sie jetzt nicht ausreiße, den ganzen Rasen ersticken.
Im Neuen Testament spricht Jesus von der Notwendigkeit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber – mit oder ohne Unterstützung der Bibel – ich stehe vor einem konkreten Problem, mit dem sich die Menschheit von jeher auseinandersetzt: Inwieweit dürfen wir in die Natur [28] eingreifen? Ist dieses Eingreifen immer negativ, oder kann es auch positiv sein?
Ich lege meine »Lanze« ab – die nichts anderes ist als eine Hacke. Jeder meiner Hiebe bedeutet das Ende eines Lebens, die Nichtexistenz eines Wildkrauts, das sonst im nächsten Frühling blühen würde. Jeder meiner Hiebe ist Ausdruck der Arroganz des Menschen, der die Landschaft, die ihn umgibt, formen möchte.
Ich muß noch weiter nachdenken, bestimme ich doch in diesem Augenblick über Leben und Tod. Der Rasen scheint zu sagen: »Schütze mich, die Wildkräuter werden mich zerstören.« Und die Wildkräuter scheinen zu sagen: »Wir sind weit gereist, um in deinen Garten zu gelangen, warum willst du uns jetzt töten?«
Da erinnere ich mich an den Text des indischen Baghavadghita und an die Antwort, die Krishna dem Krieger Arjuna gab, als dieser sich vor einem entscheidenden Kampf mutlos zeigte, seine Waffen zu Boden warf und sagte, es sei nicht recht, einen Kampf zu beginnen, in dem er seinen Bruder töten werde. Krishna antwortete darauf mit mehr oder weniger diesen Worten: »Du glaubst, du könntest jemanden töten? Deine Hand ist meine Hand, und alles, was du tust, stand schon geschrieben. Niemand tötet, niemand stirbt.«
Von dieser plötzlichen Erinnerung beschwingt, packe ich erneut meine »Lanze« und rücke den Wildkräutern zu Leibe, die nicht eingeladen waren, in meinem Garten zu wachsen.
Dieser Morgen hat mir eine Lektion erteilt: Wenn etwas Ungewünschtes in meiner Seele wächst, bitte ich Gott, mir den Mut zu geben, es ohne Mitleid auszureißen.
[29] 6
Der Weg des Bogens und des Pfeils
Wichtig ist, immer dasselbe zu wiederholen
Eine Handlung ist ein sich manifestierender Gedanke.
Eine kleine Geste kann uns scheitern lassen, daher müssen wir alles vervollkommnen, an die Einzelheiten denken, die Technik so verinnerlichen, daß sie intuitiv wird. Intuition hat nichts mit Routine zu tun, sondern mit einer Geisteshaltung, die über die Technik hinausgeht.
Daher denken wir, wenn wir viele Jahre geübt haben, nicht mehr an jede einzelne notwendige Bewegung: Alle Bewegungen werden zu einem Teil unserer Existenz. Aber dazu muß geübt, wiederholt werden.
Und als wäre das nicht genug, muß wiederholt und geübt werden. Schaue einem guten Schmied zu, der Stahl bearbeitet. Für das ungeübte Auge wiederholt er die Hammerschläge.
Aber wem klar ist, was Wiederholung bedeutet, der weiß, daß die Intensität des Schlages jedesmal, wenn er den Hammer hebt und wieder senkt, anders ist. Die Hand wiederholt dieselbe Bewegung, aber während die Hand sich dem Eisen nähert, weiß sie, ob sie es härter oder sanfter treffen muß.
Schau der Mühle zu. Für denjenigen, der zum erstenmal [30] eine Mühle sieht, drehen sich die Flügel immer mit derselben Geschwindigkeit, wiederholen sie ständig dieselbe Bewegung.
Wer sich aber mit Windmühlen auskennt, weiß, daß die Bewegung der Flügel von der Stärke und der Richtung des Windes abhängt und daß die Mühle, wenn es sich als notwendig erweist, auch mit dem Wind die Richtung wechseln muß.
Die Hand des Schmiedes wird durch die tausendfache Wiederholung derselben Geste des Hämmerns geschult. Die Flügel der Mühle kreisen um so besser, je länger sie sich im Wind gedreht haben, weil die Zahnräder durch den Gebrauch keine Grate mehr haben.
Der Bogenschütze lernt erst, wie wichtig der Bogen, die Haltung, die Sehne und das Ziel sind, nachdem er seine Gesten tausendfach wiederholt hat, ohne zu fürchten, etwas falsch zu machen. So lange, bis er über das, was er gerade tut, nicht mehr nachdenken muß. Von diesem Augenblick an wird der Bogenschütze zu seinem Bogen, seinem Pfeil und zu seinem Ziel.
Wie man den Flug des Pfeils beobachten soll
Der Pfeil ist die in den Raum projizierte Absicht.
Sobald der Pfeil abgeschossen wurde, kann der Schütze nichts mehr tun und nur noch dessen Bahn zum Ziel verfolgen. Von diesem Augenblick an gibt es keinen Grund mehr, die für den Schuß notwendige Spannung aufrechtzuerhalten.
[31]