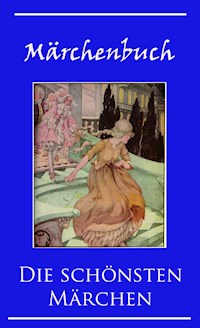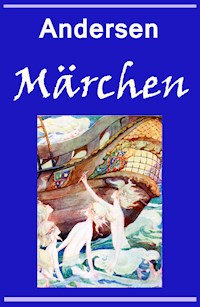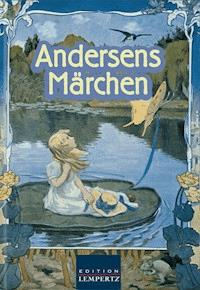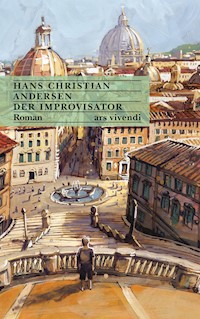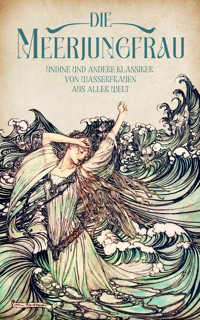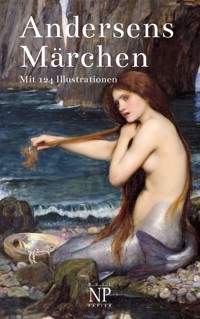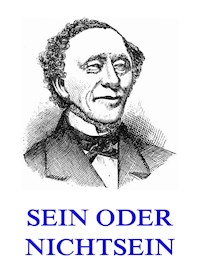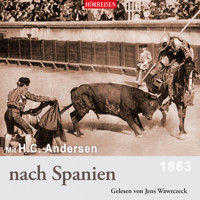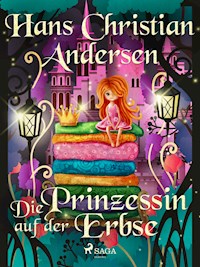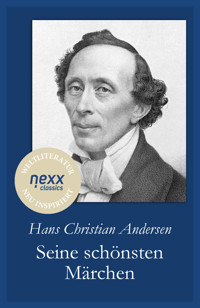
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NEXX Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: nexx classics – WELTLITERATUR NEU INSPIRIERT
- Sprache: Deutsch
Ein schimmerndes Märchen-Universum erwartet Sie!
Tauchen Sie ein in die zauberhafte Welt von Hans Christian Andersen, wo träumerische Abenteuer und tiefgründige Botschaften aufeinandertreffen. Dieses liebevoll überarbeitete Märchenbuch vereint zeitlose Klassiker wie »Die kleine Meerjungfrau«, »Des Kaisers neue Kleider« und »Das hässliche Entlein« – Geschichten, die Generationen inspiriert und berührt haben. Entdecken Sie mutige Helden, unvergängliche Freundschaften und die Magie des Lebens in einer neuen sprachlichen Frische, die den ursprünglichen Charme bewahrt.
Erleben Sie die Magie von Märchen, die Herzen verzaubern!
nexx classics – WELTLITERATUR NEU INSPIRIERT
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Hans Christian Andersen
Seine schönsten Märchen
Hans Christian Andersen
Seine schönsten Märchen
ISBN/EAN: 978-3-95870-735-1
1. Auflage
Rechtschreibung und Schreibweise des Originaltextes
wurden behutsam angepasst.
Cover: Zeichnung "Hans Christian Andersen", Künstler
unbekannt
Covergestaltung: nexx verlag, 2025
www.nexx-verlag.de
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
es ist mir eine Freude, Sie in die magische Welt der Märchen von Hans Christian Andersen einzuladen. Diese Sammlung, »Seine schönsten Märchen«, beinhaltet einige der berühmtesten und bezauberndsten Geschichten, die je geschrieben wurden. Andersens Erzählungen haben Generationen von Lesern erobert, inspiriert und berührt – ihre zeitlose Qualität spricht Kinder und Erwachsene gleichermaßen an.
Die Geschichten in dieser Sammlung sind sorgfältig neu erzählt und für die heutige Zeit angepasst. Sie behalten dennoch den unverwechselbaren Charme und die tiefgründige Weisheit, die Andersen in seinen Werken meisterhaft kommuniziert. Vom Mut des kleinen Zinnsoldaten über die Bescheidenheit des hässlichen Entleins bis zu den Träumen der kleinen Meerjungfrau – jede Geschichte bringt uns zum Lachen, Weinen und Nachdenken.
Während Sie sich durch diese Seiten bewegen, lade ich Sie ein, Ihre Fantasie zu entfesseln und die kraftvollen Botschaften, die in jeder Geschichte verborgen sind, zu entdecken. Lassen Sie sich von Andersens genialen Geschichten verzaubern und freuen Sie sich über die Wunder dieser literarischen Meisterwerke.
Viel Spaß beim Lesen!
Joachim FeserVerleger
Des Kaisers neue Kleider
Vor vielen Jahren lebte einmal ein Kaiser, der so viel auf schöne neue Kleider gab, dass er all sein Geld dafür ausgab, um immer recht auffallend einherzugehen. Er kümmerte sich nicht um seine Soldaten oder um das Theater oder Waldausritte, außer wenn er seine neuen Kleider dabei vorzeigen konnte. Für jede Tageszeit hatte er einen besonderen Mantel, und wie man sonst von den Königen sagt: Seine Majestät befindet sich im Ratszimmer, so sagte man hier: der Kaiser ist im Ankleidezimmer. In der Hauptstadt seines Landes ging es sehr lebhaft zu, und jeden Tag kamen dort viele Fremde an. So erschienen eines Tages auch zwei Betrüger, die sich für Weber ausgaben und behaupteten, sie seien imstande, den allerschönsten Stoff, den man sich nur denken könne, zu weben. Nicht nur seien die Farben und Muster außergewöhnlich schön, auch blieben die Kleider, die man aus diesem Stoff herstellte, für Menschen, die für ihren Beruf nicht taugten oder unerlaubt dumm seien, unsichtbar.
»Das wären ja ausgezeichnete Kleider!« dachte der Kaiser. »Wenn ich solche Anzüge hätte, könnte ich leicht dahinterkommen, welche Männer in meinem Reich für das Amt, das sie bekleiden, tauglich sind oder nicht, und ich könnte die Dummen von den Klugen unterscheiden. »Ja, solch ein Stoff muss gleich für mich gewebt werden!« Und er gab den beiden Betrügern einen großen Vorschuss, damit sie sofort mit ihrer Arbeit begännen.
Sie stellten auch zwei Webstühle auf und taten so, als ob sie daran arbeiteten, hatten aber nicht das geringste auf den Stühlen.
Trotzdem verlangten sie mit frecher Stirn die feinste Seide und das prächtigste Gold. Die steckten sie dann in ihre eigenen Taschen und arbeiteten bis tief in die Nacht hinein an den leeren Webstühlen.
»Nun möchte ich doch wissen, wie weit sie mit dem Stoff sind!« dachte der Kaiser, aber es war ihm doch ein wenig sonderbar zumute, wenn er daran dachte, dass derjenige, der dumm oder für sein Amt untauglich war, das Gewebte nicht sehen konnte. Er glaubte zwar, er brauche seinetwegen nicht ängstlich zu sein, zog es aber doch vor, erst einen anderen zu senden, um nachzusehen, wie sich die Sache verhielt. Jedermann in der ganzen Stadt wusste mittlerweile, welche wunderbare Kraft der Stoff haben sollte, und war daher sehr gespannt zu sehen, wie untauglich und dumm sein Nachbar sei.
»Ich will meinen guten, alten Minister zu den Webern schicken«, dachte der Kaiser, »er kann am besten beurteilen, wie der Stoff aussieht, denn er ist sehr klug, und niemand ist besser für sein Amt geeignet als er.«
Nun ging der alte, gutmütige Minister in den Saal, wo die beiden Betrüger an den leeren Stühlen saßen und arbeiteten. »Lieber Gott!« dachte der alte Minister und riss die Augen auf, »ich sehe ja rein gar nichts!«, sagte es aber er nicht laut.
Die beiden Betrüger baten ihn, näher zu treten, und fragten, ob das nicht ein sehr schönes Muster und prächtige Farben seien. Dabei deuteten sie auf den leeren Webstuhl, aber obwohl sich der arme Minister die größte Mühe gab, konnte er nichts sehen, denn es war nichts da. »Mein Gott!« dachte er, »sollte ich am Ende dumm sein? Das hätte ich doch nicht gedacht, und das darf kein Mensch erfahren. Sollte ich für mein Amt nicht taugen? Nein, nein! Ich darf nicht erzählen, dass ich den Stoff auf dem Webstuhl nicht sehe.«
»Nun, Sie sagen ja gar nichts!« bemerkte der eine der Weber.
»Oh, es ist prachtvoll! Ganz wunderschön!« antwortete der alte Minister und schaute durch seine Brille. »Dieses Muster und diese Farben! Ja, ich werde dem Kaiser berichten, dass es mir außerordentlich gut gefällt.«
»Nun, das freut uns!« sagten die Weber, und darauf nannten sie die Farben mit Namen und erklärten ihm das eigentümliche Muster. Der alte Minister hörte aufmerksam zu, damit er dem Kaiser nachher genauen Bericht darüber erstatten konnte. Aber nun verlangten die Betrüger noch mehr Geld, Seide und Gold, indem sie vorgaben, es zum Weben zu brauchen. Sie steckten alles in ihre eigenen Taschen, auf den Webstuhl kam nicht ein einziger Faden, und sie arbeiteten nach wie vor an den leeren Stühlen weiter.
Nach kurzer Zeit sandte der Kaiser einen anderen gutmütigen Beamten hin, um nachzusehen, wie es mit dem Stoff vorwärtsgehe und ob er bald fertig sei. Diesem Herrn ging es genau wie dem Minister; er sah sich fast die Augen aus, da aber außer dem leeren Webstuhl nichts da war, konnte er natürlich auch nichts sehen.
»Ist das nicht ein schöner Stoff?« fragten die beiden Betrüger und erklärten auch ihm das schöne Muster, das gar nicht da war. »Dumm bin ich doch eigentlich nicht«, dachte der Mann, »demnach tauge ich, wie es scheint, nicht zu meinem Amt. Das ist doch sonderbar, und ich darf es natürlich niemanden merken lassen.« Er rühmte also den Stoff, den er nicht sah, und sprach den Webern seine Freude über die schönen Farben und das herrliche Muster aus. »Es ist wirklich wunderschön!« sagte er zum Kaiser.
In der ganzen Stadt sprach man von dem prächtigen Stoff. Endlich wollte ihn der Kaiser selbst auch sehen, so lange er noch auf dem Webstuhl sei. Er begab sich also mit einer Schar auserwählter Männer, unter denen sich auch die beiden alten, treuen Beamten befanden, zu den beiden listigen Betrügern, die aus Leibeskräften webten.
»Ist es nicht prachtvoll?« sagten die beiden treuen Beamten. » Eure Majestät mögen geruhen den Stoff zu bewundern. Welch ein schönes Muster! Welch lebendige Farben!« Dabei deuteten sie auf den leeren Webstuhl, denn sie dachten, die andern könnten den Stoff sicher sehen.
»Was ist das?« dachte der Kaiser, »Ich sehe ja gar nichts! Wie entsetzlich! Bin ich dumm? Tauge ich am Ende nicht zum Kaiser? Das wäre das Schrecklichste, was mir passieren könnte.« – »Es ist recht hübsch!« sagte er darauf, »es hat meinen allerhöchsten Beifall!« Und er nickte zufrieden, während er immerfort den leeren Webstuhl betrachtete, denn er wollte nicht gestehen, dass er nichts sehen konnte.
Das ganze Gefolge gab sich die größte Mühe, guckte und guckte, konnte aber natürlich auch nicht mehr entdecken. Trotzdem sprachen sie alle dem Kaiser nach: »Ja, es ist recht hübsch!« Sie rieten ihm, die aus diesem herrlichen Stoff hergestellten Kleider bei einem feierlichen Umzug, der bald bevorstand, zum ersten Mal zu tragen. »Reizend! Entzückend! Wundervoll!« ging es von Mund zu Mund, und alle waren sehr erfreut darüber. Der Kaiser verlieh den beiden Betrügern einen Orden und gab ihnen den Titel »Hofweber«.
Die ganze Nacht vor dem Umzug verbrachten die beiden Betrüger beim Schein von mehr als sechzehn Kerzen an ihren Webstühlen, damit die Leute meinen sollten, sie arbeiteten so fleißig an den neuen Kleidern des Kaisers. Sie taten, als ob sie den Stoff von den Stühlen abnähmen, schnitten mit großen Scheren in der Luft herum, nähten mit Nähnadeln ohne Faden und sagten schließlich: »So, nun sind die Kleider fertig!«
Der Kaiser kam mit seinen vornehmsten Hofleuten selbst herbei, und die Betrüger erhoben die Arme, als ob sie etwas vorzeigten und sagten: »Seht, hier sind die Beinkleider, hier der Mantel. Leicht wie Spinnenweben sind sie! Man könnte meinen, man hätte gar nichts auf dem Leib, aber das ist gerade der Vorzug dabei.«
»Ja«, sagten alle Hofleute, sahen aber nichts. »Geruhen Eure Majestät nun allergnädigst Eure Kleider abzulegen!« sagten die Betrüger, »Dann werden wir Eurer Majestät hier vor dem großen Spiegel die neuen anlegen.«
Der Kaiser entkleidete sich, und die Betrüger taten nun, als ob sie ihm jedes Stück der neuen Kleidung, eins ums andere, anzögen. Dann fassten sie ihn um die Hüften, nestelten an ihm herum, als ob sie etwas festbänden, was die Schleppe darstellen sollte, und der Kaiser wandte und drehte sich vor dem Spiegel. »Wunderschön! Sie sitzen ausgezeichnet und kleiden Eure Majestät herrlich!« riefen alle Anwesenden. »Welches Muster! Welche Farben! Es ist ein unvergleichlicher Anzug!«
»Draußen steht schon der Thronhimmel bereit, der bei dem feierlichen Umzug über Eurer Majestät getragen werden soll!« meldete der Ober-Zeremonienmeister.
»Nun, ich bin ja fertig!« sagte der Kaiser, »Nicht wahr, es ist alles in Ordnung?« Dann wandte er sich noch einmal zum Spiegel, denn er wollte den Anschein geben, als ob er seinen Anzug genau betrachtete.
Die Kammerherren, die die Schleppe zu tragen hatten, langten nun mit den Händen auf den Fußboden, als ob sie die Schleppe aufhöben, und hielten dann die Hände steif vor sich in der Luft, denn sie wollten und durften es sich nicht anmerken lassen, dass auch sie nichts sahen.
So ging der Kaiser bei dem feierlichen Umzug unter dem Thronhimmel, und alle Leute auf den Straßen und in den Fenstern riefen: »Des Kaisers neue Kleider sind unvergleichlich! Welch eine herrliche Schleppe! Es sitzt alles wie angegossen!« Niemand wollte sich anmerken lassen, dass er nichts sah, denn das wäre ja Zeugnis dafür gewesen, dass er zu seinem Amt untauglich oder schrecklich dumm sei. Noch nie hatten die Kleider des Kaisers einen solchen Jubel hervorgerufen.
»Aber er hat ja gar nichts an!« rief plötzlich ein kleines Kind. »Lieber Gott! Hört die Stimme der Unschuld!« sagte der Vater des Kindes. Und einer flüsterte dem andern zu, was das Kind gesagt hatte. »Er hat gar nichts an – das kleine Kind dort hat behauptet, er habe gar nichts an!« erklang es.
»Er hat ja gar nichts an!« rief endlich das ganze Volk. Da erschrak der Kaiser, denn es kam ihm selbst so vor, als ob das Volk recht habe, aber er dachte: »Nun hilft alles nichts, ich muss es eben aushalten!« So nahm er eine noch stolzere Haltung an, und die Kammerherren trugen die Schleppe, die gar nicht da war, noch stolzer hinter ihm her.
Der standhafte Zinnsoldat
Es waren einmal fünfundzwanzig Zinnsoldaten, und es waren lauter Brüder, denn sie waren alle aus demselben alten Löffel gegossen worden. Sie schulterten das Gewehr, wandten das Gesicht geradeaus, dem Feind entgegen, und ihre Uniformen waren wunderschön rot und blau. Das allererste, was sie auf dieser Welt hörten, als der Deckel von der Schachtel, in der sie lagen, abgenommen wurde, war das Wort: »Zinnsoldaten!« Das rief ein kleiner Knabe und klatschte dabei vor Wonne in die Hände. Er hatte sie zu seinem Geburtstag geschenkt bekommen und stellte sie nun in Reih und Glied auf dem Tisch auf. Der eine Soldat glich dem andern aufs Haar. Nur ein einziger war etwas verschieden, er hatte nur ein Bein, denn er war zuletzt gegossen worden, und das Zinn hatte nicht ausgereicht. Doch stand er auf seinem einen Bein genauso fest wie die anderen auf ihren beiden, und gerade ihm wurde ein höchst merkwürdiges Schicksal zuteil.
Auf dem Tisch, auf dem sie aufgestellt waren, stand noch viel anderes Spielzeug, aber das schönste war ein prächtiges Schloss aus Papier. Durch die kleinen Fenster konnte man innen in die Säle hineinschauen, und vor dem Schloss waren ein Spiegelglas, das einen Teich darstellen sollte, und kleine Bäume. Schwäne aus Wachs schwammen auf dem Teich und spiegelten sich darin. Das war alles sehr hübsch, aber das hübscheste war ein kleines Mädchen, das in dem offenen Schlosstor stand. Es war ebenfalls aus Papier ausgeschnitten, hatte ein Röckchen aus feinstem Leinen und ein kleines, schmales blaues Band als Schärpe über den Schultern, auf dem ein funkelnder Flitterstern so groß wie ihr ganzes Gesicht saß. Das kleine Mädchen hob anmutig die beiden Arme in die Höhe, denn sie war eine Tänzerin, und hielt das eine Bein so hoch, dass der Zinnsoldat dachte, dass sie, wie er, nur ein Bein habe.
»Das wäre die richtige Frau für mich«, dachte er, »aber sie ist gewiss zu vornehm für mich, denn sie wohnt in einem Schloss und ich nur in einer Schachtel, die ich auch noch mit vierundzwanzig anderen Soldaten teilen muss. Nein, das ist keine Wohnung für sie. Ich will aber dennoch sehen, ob ich ihre Bekanntschaft machen kann.« Darauf legte er sich der Länge nach hinter eine Schnupftabaksdose, die auf dem Tisch stand. Von hier aus konnte er die kleine, feine Dame, die immerfort auf einem Bein stand, ohne das Gleichgewicht zu verlieren, nach Herzenslust betrachten.
Als es Abend wurde, legte man die anderen Zinnsoldaten wieder in ihre Schachtel, und die Menschen im Haus gingen zu Bett. Nun begannen die Spielsachen zu spielen: mal »Besuch«, mal »Räuber«, mal »Tanzvergnügen«. Die Zinnsoldaten rasselten in ihrer Schachtel, weil sie auch gerne dabei gewesen wären, sie konnten aber leider den Deckel nicht hochheben. Der Nussknacker schlug Purzelbäume, und der Schreibstift fuhr ausgelassen über die Tafel hin. Es entstand ein solcher Lärm, dass der Kanarienvogel davon aufwachte und nun auch mitredete, und zwar in Versform. Die beiden einzigen, die sich nicht von der Stelle bewegten, waren der Zinnsoldat und die kleine Tänzerin. Sie stand kerzengerade auf der Zehenspitze und hatte beide Arme erhoben, und er war auf seinem einen Bein ebenso standhaft und wandte seine Augen nicht von ihr ab.
Jetzt schlug es Mitternacht, und klatsch! sprang die Schnupftabaksdose auf, aber es war kein Schnupftabak darin, sondern ein kleiner, kunstvoll erstellter, schwarzer Kobold.
»Zinnsoldat!« sagte der Kobold, »schau doch nicht immer nach etwas, das dich nichts angeht!« Aber der Zinnsoldat tat, als ob er es gar nicht gehört hat.
»Ja, warte nur bis morgen!« sagte der Kobold.
Als es nun Morgen wurde und die Kinder aufstanden, wurde der Zinnsoldat aufs Fensterbrett gestellt, und – war es nun der Kobold oder der Zugwind – plötzlich flog das Fenster auf, und der Zinnsoldat fiel aus dem dritten Stockwerk kopfüber hinunter. Es war ein rasanter Sturz. Er streckte sein einziges Bein gerade in die Höhe und blieb schließlich mit dem Kopf und dem Bajonett zwischen den Pflastersteinen stecken.
Das Kindermädchen und der kleine Knabe liefen sogleich hinunter, um ihn zu suchen, aber obwohl sie beinahe auf ihn getreten wären, fanden sie ihn nicht. Hätte der Zinnsoldat gerufen: »Hier bin ich!«, hätten sie ihn wohl gefunden haben, da er jedoch ein Soldat war, hielt er es nicht für passend, so laut zu schreien.
Nun begann es zu regnen, zuerst leicht, dann immer stärker, bis zuletzt ein tüchtiger Platzregen daraus wurde. Als er schließlich vorüber war, kamen zwei Straßenjungen daher.
»Sieh mal«, sagte der eine, »da liegt ein Zinnsoldat. Holla, den lassen wir Bootfahren!«
Sie falteten aus Zeitungspapier ein Boot, setzten den Soldaten mitten hinein und ließen ihn den Rinnstein hinunterschwimmen. Beide liefen nebenher und klatschten begeistert in die Hände. Lieber Himmel! Welche Wellen durch den Rinnstein rauschten, das war ja ein richtiger Fluss! Es war ja ein tüchtiger Regenguss gewesen.
Das Boot schwankte auf und nieder und drehte sich bisweilen im Kreis, so dass den Zinnsoldaten ein kalter Schauer überlief. Trotzdem blieb er standhaft, sah nur immer geradeaus und hielt sein Gewehr stramm geschultert.
Plötzlich trieb das Boot in einen langen Rinnstein-Schacht. Hier war es stockdunkel, so wie in der Schachtel zu Hause.
»Wohin geht wohl jetzt die Reise?« dachte er. »Daran ist natürlich der Kobold schuld! Ach, säße doch das kleine Mädchen hier bei mir im Boot, dann könnte es gerne doppelt so finster sein!«
In diesem Augenblick erschien eine große Ratte, die in dem Rinnstein-Schacht wohnte.
»Hast du einen Pass?« fragte die Ratte. »Zeige ihn vor!«
Der Zinnsoldat schwieg und hielt sein Gewehr noch etwas fester. Das Boot fuhr weiter und die Ratte rannte hinterher. Hu! Wie sie mit den Zähnen knirschte und den daher schwimmenden Holzspänen und dem Stroh zurief: »Haltet ihn auf! Haltet ihn auf! Er hat keinen Zoll bezahlt und seinen Pass nicht vorgezeigt!«
Die Strömung wurde stärker und stärker, der Zinnsoldat konnte schon das Tageslicht am Ende des Schachtes sehen, gleichzeitig hörte er aber auch einen brausenden Ton, der wohl das Herz des tapfersten Mannes erschreckt hätte. Der Rinnstein fiel genau am Ende des Schachtes in einen großen Kanal hinab!
Er war schon so nahe, dass er nicht mehr anhalten konnte, das Boot fiel hinab. Der arme Zinnsoldat hielt sich, so gut es eben ging, aufrecht, niemand sollte ihm nachsagen können, dass er auch nur mit den Augen gezwinkert habe. Das Boot drehte sich drei- bis viermal im Kreis und füllte sich dabei bis zum Rand mit Wasser, es musste sinken. Schon ging dem Zinnsoldaten das Wasser bis zum Hals, und das Boot sank tiefer und tiefer. Das Papier löste sich mehr und mehr auf, jetzt ging dem armen Soldaten das Wasser schon über den Kopf – da dachte er an die kleine, niedliche Tänzerin, die er nie wiedersehen würde, und wehmütig klang es ihm in den Ohren:
Leb' wohl, du tapferer Krieger!Stirb oder kehr' als Siegerheim ins Vaterland ...
Nun riss das Papier, und der Zinnsoldat fiel hindurch und wurde im selben Augenblick von einem großen Fisch verschluckt.
Hu, wie finster war es da drin! Das war noch schlimmer als im Rinnstein-Schacht und außerdem so entsetzlich eng! Trotzdem blieb der Zinnsoldat standhaft und lag mit dem Gewehr im Arm da.
Der Fisch schwamm wild umher und machte die fürchterlichsten Bewegungen. Aber plötzlich bewegte er sich nicht mehr und kurz darauf durchfuhr ihn wie ein Blitz etwas Scharfes, dann drang ein heller Lichtschein hinein und jemand rief laut und verwundert aus: »Der Zinnsoldat!«
Der Fisch war gefangen, auf den Markt gebracht und dort verkauft worden. Dann war er in eine Küche gelangt, wo ihn die Köchin mit einem großen Messer aufschnitt. Diese fasste den Soldaten mit zwei Fingern und trug ihn in die Stube, wo sich alle Anwesenden herbeidrängten, um den merkwürdigen Mann zu sehen, der im Magen eines Fisches umhergereist war. Der Zinnsoldat war aber gar nicht stolz darauf. Man stellte ihn auf den Tisch und da – ja, wie merkwürdig es doch in der Welt zugehen kann – befand sich der Soldat in derselben Stube, in der er vorher gewesen war. Er sah dieselben Kinder, und dasselbe Spielzeug stand auf dem Tisch, nämlich das prächtige Schloss mit der niedlichen, kleinen Tänzerin. Noch immer stand sie auf einem Bein und hielt das andere hoch in der Luft – ja, sie war ebenfalls standhaft. Das rührte den Zinnsoldaten so, dass er beinahe zinnerne Tränen geweint hätte, aber das hätte sich doch nicht geschickt. Er sah sie an, und sie sah ihn an, aber sie sagten nichts zueinander.
Plötzlich ergriff der eine der kleinen Knaben den Zinnsoldaten und warf ihn in den Ofen, obwohl er gar keinen Grund dazu hatte. Sicherlich war der Kobold in der Dose schuld daran.
Der Zinnsoldat stand hell beleuchtet da und es wurde ihm glühend heiß. Ob das die Folge des Feuers oder seiner übergroßen Liebesglut war, konnte er nicht feststellen. Alle Farbe war von ihm gewichen, ob dies aber schon auf der Reise geschehen war, oder ob es von seinem großen Kummer herrührte, wusste niemand. Er sah das kleine Mädchen an, und dieses sah ihn an. Er fühlte, dass er zerschmolz, aber noch stand er standhaft mit dem Gewehr im Arm. Da ging eine Tür auf, der Luftzug ergriff die Tänzerin, und sie flog wie eine Fee direkt in den Ofen zum Zinnsoldaten hinein, loderte in den hellen Flammen kurz auf und – war verschwunden. Da schmolz der Zinnsoldat zu einem Klümpchen zusammen, und als die Magd am nächsten Morgen die Asche aus dem Ofen nahm, fand sie ihn als ein kleines zinnernes Herz. Von der Tänzerin war nur der Flitterstern übriggeblieben, und der war ganz verkohlt.
Der große und der kleine Klaus
In einem Dorf lebten einmal zwei Männer, die beide denselben Namen hatten: beide hießen Klaus. Aber der eine besaß vier Pferde und der andere nur ein einziges Pferd. Um sie nun voneinander unterscheiden zu können, nannte man den mit den vier Pferden den großen Klaus, und den, der nur ein Pferd besaß, den kleinen Klaus.
Die ganze Woche hindurch musste der kleine Klaus für den großen Klaus pflügen und ihm dazu sein einziges Pferd leihen. Dafür half ihm der große Klaus wieder mit seinen vier Pferden aus, allerdings nur einmal in der Woche, und das am Sonntag. Hussa! Wie knallte der kleine Klaus da die Peitsche über alle fünf Pferde hin, denn an diesem einen Tag waren sie ja so gut wie sein Eigentum. Die Sonne schien herrlich, die Glocken läuteten zur Kirche, und die Leute gingen in ihren Sonntagskleidern zum Gottesdienst. Da sahen sie den kleinen Klaus, wie er mit fünf Pferden pflügte, und er war so vergnügt darüber, dass er mit der Peitsche knallte und rief: »Hüa, alle meine Pferde!«
»Das darfst du nicht sagen«, befahl der große Klaus, »es gehört dir ja nur eins von den Pferden.«
Aber als wieder jemand zur der Kirche vorbeiging, vergaß der kleine Klaus, dass er es nicht sagen durfte, und rief wieder: »Hüa, alle meine Pferde!«
»Nun möchte ich aber doch recht bitten, das bleiben zu lassen«, sagte der große Klaus. »Wenn du es noch einmal sagst, schlage ich dein Pferd so auf den Kopf, dass es auf der Stelle tot ist!«
»Ich werde es gewiss nicht mehr sagen«, versprach der kleine Klaus. Als aber dann Leute vorbeikamen und ihm zunickten, freute er sich und dachte, es sehe doch recht schön aus, dass er fünf Pferde habe, um sein Feld zu pflügen, und er knallte mit der Peitsche und rief: »Hüa, alle meine Pferde!«
»Ja, hüa, alle meine Pferde! Ich werde dir helfen!« sagte der große Klaus, nahm einen Prügel und schlug das einzige Pferd des kleinen Klaus damit so auf die Stirn, dass es umfiel und maustot war.
»Ach, nun habe ich gar kein Pferd mehr!« jammerte der kleine Klaus und begann zu weinen. Darauf zog er dem toten Pferd die Haut ab, trocknete sie im Wind, steckte sie in einen Sack, den er auf den Rücken nahm, und machte sich auf den Weg in die Stadt, um seine Pferdehaut zu verkaufen.
Er hatte einen sehr weiten Weg vor sich und musste durch einen großen, dunklen Wald, und dann wurde das Wetter entsetzlich schlecht. Er verirrte sich völlig, und bis er wieder auf den rechten Weg kam, war es schon Abend und er war zu weit von der Stadt entfernt, um sie vor Einbruch der Nacht zu erreichen oder wieder nach Hause zu kommen.
Dicht am Weg lag ein alter Bauernhof, dessen Fenster von außen mit Läden verschlossen waren, durch die aber etwas Licht hervorschimmerte. »Hier werde ich wohl ein Obdach für die Nacht finden«, dachte der kleine Klaus, ging hin und klopfte an die Tür.
Die Bäuerin öffnete, als sie aber hörte, was er wollte, sagte sie, er solle weitergehen, ihr Mann sei nicht daheim und sie nehme keinen Fremden auf.
»Nun, dann muss ich eben hier draußen übernachten«, sagte der kleine Klaus, und die Bäuerin schlug ihm die Tür vor der Nase zu.
Ganz in der Nähe des Wohnhauses stand ein kleiner Heuschober, und zwischen diesem und dem Haus war ein kleiner Schuppen mit einem flachen Strohdach.
»Da oben werde ich übernachten«, sagte der kleine Klaus, als er das Dach sah. »Das ist ja eine ausgezeichnete Lagerstatt, und der Storch wird wohl nicht herunterfliegen und mich ins Bein zwicken.« Denn ein Storch stand oben auf dem Dach, wo er sein Nest hatte.
Nun kletterte der kleine Klaus auf den Schuppen hinauf, wo er sich niederlegte und sich hin und her drehte, um gut zu liegen. Die hölzernen Läden vor den Fenstern schlossen oben nicht ganz, und so konnte er in die Stube hineinsehen.
Da war ein großer Tisch gedeckt mit Wein und Braten und einem herrlichen Fisch. Die Bäuerin und der Küster saßen am Tisch. Sie schenkte ihm ein, und er machte sich über den Fisch her, denn das war sein Leibgericht.
»Wenn ich doch da auch mitessen dürfte!« dachte der kleine Klaus und streckte den Kopf weiter zum Fenster hin. Ei der Tausend! Dort drüben stand ja auch noch ein prachtvoller Kuchen, das war ein wahres Festmahl!
Plötzlich hörte er, wie jemand von der Landstraße her auf das Haus zugeritten kam, es war der Bauer, der nach Hause zurückkehrte.
Der Bauer war ein guter Mann, aber er hatte die merkwürdige Schwachheit, dass er den Anblick eines Küsters nicht ertragen konnte. Daher hatte auch der Küster die Frau an diesem Abend besucht, weil er wusste, dass ihr Mann nicht zu Hause war. Und die gute Frau hatte ihm das Beste, was sie hatte, vorgesetzt.
Als sie nun den Mann nach Hause kommen hörten, erschraken sie sehr, und die Frau bat den Küster, in eine große, leere Truhe, die in der Ecke stand, hineinzukriechen. Das tat er auch, denn er wusste ja, dass der Bauer den Anblick eines Küsters nicht ertragen konnte. Die Frau versteckte schnell all das herrliche Essen und den Wein in ihrem Backofen, denn wenn der Mann es zu sehen bekommen hätte, hätte er gewiss gefragt, was das zu bedeuten habe.
»Oh weh!« seufzte der kleine Klaus oben auf dem Schuppen, als er das schöne Essen verschwinden sah.
»Ist jemand da oben?« fragte da der Bauer und sah zu dem kleinen Klaus hinauf. »Weshalb liegst du da oben? Komm doch mit in die Stube hinein.«
Da erzählte der kleine Klaus, wie er sich verirrt habe, und bat dann um ein Obdach für die Nacht.
»Ja natürlich«, sagte der Bauer, »aber jetzt müssen wir zuerst etwas zwischen die Zähne bekommen.«
Die Bäuerin empfing beide sehr freundlich, deckte auch gleich den Tisch und gab ihnen eine große Schüssel Grütze. Der Bauer war hungrig und aß mit großem Appetit, der kleine Klaus aber musste unaufhörlich an den herrlichen Braten, den Fisch und den Kuchen denken, die, wie er wusste, im Backofen standen.
Unter den Tisch hatte er zu seinen Füßen den Sack mit der Pferdehaut hingelegt. Die Grütze wollte ihm gar nicht munden, da trat er gegen seinen Sack, so dass die Haut darin laut knarrte.
»Bst!« sagte der kleine Klaus zu seinem Sack, trat jedoch sofort noch einmal dagegen, so dass er noch lauter als zuvor knarrte.
»Ei, was hast du denn in deinem Sack?« fragte der Bauer.
»Oh, das ist ein Zauberer«, sagte der kleine Klaus. »Und er sagt, wir sollen doch keine Grütze essen, denn er hätte Braten, Fisch und Kuchen in den Backofen gezaubert.
»Ist das möglich?« rief der Bauer und öffnete schnell den Backofen. Da sah er all die herrlichen Speisen, die seine Frau darin versteckt hatte, die seiner Meinung nach der Zauberer hineingehext hatte. Die Frau durfte nichts sagen. Sie stellte die Speisen sofort auf den Tisch, und die beiden ließen sich den Fisch, Braten und Kuchen schmecken. Rasch trat der kleine Klaus wieder gegen den Sack, so dass die Haut darin knarrte.
»Was sagt er nun?« fragte der Bauer.
»Er sagt«, antwortete der kleine Klaus, »er habe auch drei Flaschen Wein für uns hergehext, und sie stünden ebenfalls im Ofen.« Nun musste die Frau den Wein, den sie versteckt hatte, ebenfalls hervorholen, und der Bauer trank und wurde ganz ausgelassen, einen solchen Zauberer, wie der kleine Klaus ihn im Sack hatte, hätte er gar zu gerne auch gehabt.
»Kann er denn auch den Teufel herbeihexen?« fragte der Bauer. »Ich möchte ihn gerne sehen, denn jetzt bin ich gerade dazu aufgelegt.«
»Ja«, sagte der kleine Klaus, »mein Zauberer kann alles, was ich verlange. Nicht wahr, du?« fragte er und trat dabei gegen den Sack, dass es knarrte. »Hörst du, er sagt ja! Aber der Teufel sieht hässlich aus, und wir wollen ihn lieber nicht sehen.«
»Oh, ich fürchte mich nicht! Wie mag er wohl aussehen?«
»Er sagt, er würde sich als leibhaftiger Küster zeigen!«
»Hu, das wäre freilich grässlich!« sagte der Bauer. »Ihr müsst nämlich wissen, dass ich den Anblick eines Küsters nicht ertragen kann. Aber das tut jetzt nichts zur Sache, ich weiß ja, dass es der Teufel ist, da werde ich mich am Ende damit abfinden. Nun, ich bin mutig, er darf mir nur nicht zu nahekommen.«
»Nun, ich will einmal meinen Zauberer fragen«, sagte der kleine Klaus, indem wieder gegen seinen Sack trat und das Ohr hinhielt.
»Was sagt er?«
»Er sagt, Ihr sollt die Truhe, die dort in der Ecke steht, aufmachen, dann werdet Ihr den Teufel darin hocken sehen, aber Ihr müsst den Deckel festhalten, damit er Euch nicht entwischt.«
»Wollt Ihr mir helfen?« fragte der Bauer und ging zur Truhe, in der die Bäuerin den Küster, der bebend und zähneklappernd darinsaß, versteckt hatte.
Der Bauer hob den Deckel ein wenig hoch und guckte hinein. »Hu!« schrie er und sprang zurück, »Ja, ich habe ihn gesehen! Er sah wirklich wie unser Küster aus! Es war schrecklich!«
Darauf mussten sie wieder trinken, und tranken bis tief in die Nacht hinein.
»Den Zauberer musst du mir verkaufen«, sagte der Bauer, »verlange dafür, was du willst! Ja, ich gebe dir einen ganzen Scheffel Geld dafür.«
»Nein, das kann ich nicht«, sagte der kleine Klaus, »bedenke, welch großen Nutzen ich von diesem Zauberer habe.«
»Aber ich möchte ihn gar zu gerne haben!« sagte der Bauer und hörte nicht auf, den kleinen Klaus darum zu bitten.
»Nun«, sagte dieser schließ, »da du so gut gewesen bist, mir heute Nacht Obdach zu gewähren, so mag es denn sein. Ich werde dir den Zauberer für einen Scheffel Geld überlassen, aber der Scheffel muss gehäuft voll sein!«
»Das sollst du bekommen«, sagte der Bauer, »aber die Truhe dort musst du auch mitnehmen. Ich will sie nicht eine Stunde länger im Haus haben, denn man kann nicht wissen, ob der Teufel nicht noch darinsitzt.«
Der kleine Klaus gab also dem Bauern seinen Sack mit der trockenen Haut und bekam einen gehäuften Scheffel Geld dafür. Der Bauer verehrte ihm sogar noch einen großen Schubkarren, um die Truhe und das Geld darauf fortfahren zu können.
»Lebe wohl!« sagte der kleine Klaus, und fuhr mit seinem Geld und der großen Truhe, worin noch immer der Küster saß, davon.
Auf der anderen Seite des Waldes war ein tiefer Bach. Das Wasser schoss so rauschend dahin, dass man kaum gegen den Strom schwimmen konnte. Über diesen Bach führte eine Brücke, und mitten darauf hielt der kleine Klaus an. Dann sagte er recht laut, damit es der Küster in der Truhe hören konnte:
»Was soll ich nur mit der dummen Truhe anfangen? Sie ist so schwer, als ob Steine darin wären! Ich werde nur müde, wenn ich sie noch weiterfahre. Ich will sie lieber in den Bach werfen. Schwimmt sie zu mir nach Hause, dann ist es gut, wenn nicht, nun, dann ist nicht viel verloren.«
Er fasste die Truhe mit der einen Hand und hob sie ein wenig hoch, so, als ob er sie ins Wasser stürzen wollte.
»Nein! Nein!« rief der Küster in der Truhe. »Lass mich zuerst hinaus!«
»Hu!« machte der kleine Klaus und tat, als ob er erschrocken wäre. »Er sitzt noch immer drin! Schnell in den Bach mit ihm, damit er ertrinkt!«
»Oh nein! Oh nein!« rief der Küster, »Wenn du mich gehen lässt, will ich dir einen ganzen Scheffel Geld geben!«
»Ja, das ist etwas anderes!« sagte der kleine Klaus und öffnete die Truhe. Der Küster kroch schnell heraus, stieß die Truhe ins Wasser und ging dann nach Hause, wo der kleine Klaus einen ganzen Scheffel Geld erhielt. Einen hatte er ja schon von dem Bauern bekommen, nun hatte er den ganzen Schubkarren voller Geld.
»Sieh an, das Pferd hat sich ja recht gut bezahlt!« sagte er zu sich selbst, als er zu Hause angekommen war und alles Geld auf einen Haufen mitten in der Stube aufschüttete. »Das wird den großen Klaus ärgern, wenn er erfährt, wie reich ich durch mein einziges Pferd geworden bin. Aber ich will es ihm nicht direkt sagen.«
Darauf schickte er einen Jungen zum großen Klaus und ließ ihn um ein Scheffelmaß bitten.
»Was er wohl damit will?« dachte der große Klaus und bestrich den Boden des Maßes unten mit Teer, damit von dem, was gemessen wurde, etwas daran hängen bleiben solle. Und so geschah es auch: als er den Scheffel zurückerhielt, klebten drei große Silbermünzen daran.
»Was ist denn das?« sagte der große Klaus und lief sofort zu dem kleinen Klaus hinüber.
»Oh, das bekam ich für meine Pferdehaut, die ich gestern verkauft habe.«
»Ei der Tausend, das ist gut bezahlt!« sagte der große Klaus, nahm seine Axt und schlug seine vier Pferde tot. Darauf zog er ihnen die Haut ab und fuhr mit ihnen in die Stadt.
»Häute! Häute! Wer kauft Häute?« rief er durch die Straßen.
Alle Schuhmacher und Gerber liefen herbei und fragten, was die Häute kosteten.
»Einen Scheffel Geld für jede!« sagte der große Klaus.
»Bist du verrückt?« sagten alle, »Meinst du denn, wir hätten das Geld scheffelweise?«
»Häute! Häute!« rief er wieder, aber allen, die nach dem Preis fragten, gab er zur Antwort: »Einen Scheffel Geld!«
»Er will uns zu Narren halten!« riefen die Handwerker, und die Schuhmacher ergriffen ihre Spannriemen und die Gerber ihre Schurzfelle und begannen auf den großen Klaus einzuhauen.
»Häute! Häute!« spotteten sie, »Ja, wir werden dir die Haut gerben und die Schuhe versohlen! Hinaus aus der Stadt mit dir!« schrien sie, und der große Klaus musste so schnell er konnte davonlaufen, so gründlich war er noch nie verprügelt worden.
»Na, warte!« sagte er, als er nach Hause kam, »Das sollst du mir büßen, kleiner Klaus ich schlage dich tot!«
Aber zu Hause beim kleinen Klaus war indessen die alte Großmutter gestorben. Sie war zwar stets böse und heftig zu ihm gewesen, aber er war doch recht betrübt, nahm die tote Frau und legte sie in sein warmes Bett, um zu sehen, ob sie nicht vielleicht wieder erwache. Da sollte sie die ganze Nacht liegen, und er selbst wollte sich an den Ofen setzen und auf einem Stuhl schlafen, was er schon öfter getan hatte.
Als er nun nachts so dasaß, ging die Tür auf, und der große Klaus trat mit seiner Axt herein. Er wusste, wo das Bett des kleinen Klaus stand, ging direkt darauf zu und schlug die tote Großmutter auf den Kopf, weil er glaubte, dass es der kleine Klaus sei.
»So, nun wirst du mich nicht mehr zum Narren halten!« sagte er und ging wieder nach Hause.
»Das ist doch ein recht böser Mann«, sagte der kleine Klaus, »er wollte mich totschlagen. Es war nur gut, dass die alte Mutter schon tot war, sonst hätte er ihr das Leben genommen.«
Nun zog er der alten Großmutter ihre Sonntagskleider an, entlehnte von seinem Nachbarn ein Pferd, spannte es vor den Wagen und setzte die Großmutter auf den hintersten Sitz, so dass sie beim Fahren nicht herausfallen konnte. Und so fuhren die Beiden durch den Wald davon. Als die Sonne aufging, befanden sie sich vor einer großen Schenke; hier hielt der kleine Klaus an, um zu frühstücken.
Der Wirt hatte viel Geld und war so jähzornig, dass man bei ihm seines Lebens nicht sicher war.
»Guten Morgen!« sagte er zum kleinen Klaus, »du hast dich ja schon sehr früh in den Sonntagsstaat geworfen!«