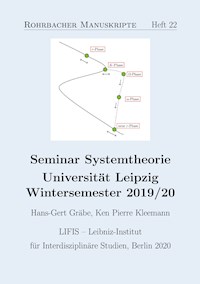
Seminar Systemtheorie E-Book
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Rohrbacher Manuskripte
- Sprache: Deutsch
Der Systembegriff spielt in vielen Wissenschaftsbereichen eine zentrale Rolle. Er ist grundlegend für alle Ingenieurwissenschaften und mit der ISO/IEC/IEEE-15288 Norm "Systems and Software Engineering" auch Gegenstand internationaler Normierungs- und Standardisierungsprozesse. Er spielt auch bei der Beschreibung komplexer natürlicher und kultureller Prozesse - etwa im Begriff des "Ökosystems" - eine zentrale Rolle. Mit dem "Semantic Web" rückt die Bedeutungsanalyse digitaler Artefakte in den Mittelpunkt, die in letzter Instanz Sprachartefakte sind und damit ebenfalls in direktem Zusammenhang zu einem sinnvoll zu entfaltenden Systembegriff stehen als Grundlage jeden Verständnisses konkreter Systeme. Mit dem Schlagwort "Nachhaltigkeit" werden schließlich komplexe gesellschaftliche Abstimmungsprozesse angesprochen, mit denen vielfältige Informations- und Bewertungsprobleme einhergehen. Hierbei ist die Fähigkeit der beschreibenden Abgrenzung, Entwicklung und Steuerung von sogenannten Systemen auf bzw. über verschiedene Governance-, Raum- und Zeitebenen hinweg von großer Bedeutung. Ziel des Seminars war es, in einem interdisziplinären Kontext (Informatiker, Inegnieure, Philosophen) ein besseres Verständnis für diese Vielfalt von Systembegriffen zu gewinnen und dabei die Zugänge verschiedener Systemtheorien als Gegenstand einer "Systemwissenschaft" zu analysieren. Die Diskussionsergebnisse des Seminars werden im vorliegenden Band in systematischer Weise präsentiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Ziel und Methodik des Seminars
Systembegriff in der Theorie dynamischer Systeme (Gräbe)
Einführung in Systemwissenschaft, Nachhaltigkeit und Allgemeine Systemtheorie (Lautenschläger)
Zum Verhältnis von Systembegriff und Wirklichkeit (Kleemann)
Systembegriffe in der Praxis (Gräbe)
Organisation in lebenden Systemen (Laforet)
Resilienz (Laforet, Lautenschläger)
Organisation in komplexen adaptiven Systemen (IIRM)
Institutionelle Analyse von sozio-ökologischen Systemen (IIRM)
Sozio-technische Systeme und Transformationsprozesse (IIRM)
Systembegriff in der TRIZ-Methodik (Gräbe)
TRIZ und Systematische Innovationen in komplexen Umgebungen (Gräbe)
Gesetze und Trends der Entwicklung technischer Systeme (Gräbe)
Wie entwickeln sich technische Systeme?
Literatur
1 Ziel und Methodik des Seminars
1.1 Zielstellung
Der Systembegriff spielt in der Informatik eine herausragende Rolle, wenn es um Datenbanksysteme, Softwaresysteme, Hardwaresysteme, Abrechnungssysteme, Zugangssysteme usw. geht. Überhaupt wird die Informatik von einer Merhheit als die „Wissenschaft von der systematischen Darstellung, Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Informationen, besonders der automatischen Verarbeitung mithilfe von Digitalrechnern“ (Wikipedia) verstanden. Auch gewisse einschlägige Professionen wie etwa der Systemarchitekt genießen unter IT-Anwendern hohe Wertschätzung.
Die Bedeutung des Systembegriffs reicht allerdings weit über den Bereich der Informatik hinaus – er ist grundlegend für alle Ingenieurwissenschaften und mit der ISO/IEC/IEEE-15288 Norm „Systems and Software Engineering“ als Systems Engineering auch Gegenstand internationaler Normierungs- und Standardisierungsprozesse. Mehr noch spielt der Systembegriff auch bei der Beschreibung komplexer natürlicher und kultureller Prozesse – etwa im Begriff des Ökosystems – eine zentrale Rolle.
Mit dem Semantic Web rückt die Bedeutungsanalyse digitaler Artefakte in den Mittelpunkt, die in letzter Instanz Sprachartefakte sind und damit ebenfalls in direktem Zusammenhang zu einem sinnvoll zu entfaltenden Systembegriff stehen als Grundlage jeden Verständnisses konkreter Systeme.
Mit dem Schlagwort Nachhaltigkeit werden schließlich komplexe gesellschaftliche Abstimmungsprozesse angesprochen, mit denen vielfältige Informations- und Bewertungsprobleme einhergehen. Hierbei ist die Fähigkeit der beschreibenden Abgrenzung, Entwicklung und Steuerung von sogenannten Systemen auf bzw. über verschiedene Governance-, Raum- und Zeitebenen hinweg von großer Bedeutung.
Ziel des Seminars ist es, ein besseres Verständnis für diese Vielfalt von Systembegriffen zu gewinnen und dabei die Zugänge verschiedener Systemtheorien als Gegenstand einer Systemwissenschaft zu analysieren.
1.2 Inhaltliche Abgrenzung
Das Seminar ist ein Einführungskurs in die Systemwissenschaft auf Master-Ebene und thematisiert deren Entwicklung im Laufe der Zeit, Verzweigung von Ansätzen, Schlüsselbegriffen und Konzepten. Systemwissenschaft wird hier als übergeordneter Ausdruck für ein Feld verwendet, zu dem zahlreiche Gelehrte aus den verschiedensten Disziplinen wie Anthropologie, Biologie, Chemie, Ökologie, Ökonomie, Mathematik, Physik, Psychologie, Soziologie und andere beigetragen haben. Entwicklungen wie Kybernetik, Chaostheorie oder Netzwerkanalyse und -Wissenschaft können als Teil von Systemwissenschaft oder zumindest stark verwandt mit ihr angesehen werden. Einige Zweige der Systemwissenschaft gelten in Deutschland sogar als neue Wissenschaftsbereiche mit eigenen Rechten wie Synergetik oder Komplexitätswissenschaft.
Diese Entwicklungen haben neue Möglichkeiten für eine verbesserte Analyse und Entscheidungsfindung in wissenschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bereichen eröffnet. Wir stellen jedoch täglich fest, dass in komplizierten Situationen, insbesondere in der Politik und in der Wirtschaft, einfache und direkte Entscheidungsfindungsprozesse nach wie vor überwiegen, was zu einer Zunahme negativer Entwicklungen führt, wenn die ursprünglich beabsichtigten Wirkungen nicht eintreten. Jede unerwartete Nebenwirkung oder Gegenreaktion, die die Maßnahmen unbrauchbar machen, sind ein klares Indiz dafür, dass die grundlegenden mentalen Modelle der Akteure unvollständig waren und breitere systemische Korrelationen vernachlässigt wurden. Das Systemdenken ist daher von besonderer Bedeutung für den Übergang zu einer nachhaltigeren Gesellschaft.
1.3 Methodik
In diesem Seminar sollen die historische Entwicklung der Systemwissenschaft (in Teilen) verfolgt sowie relevante Grundbegriffe studiert werden. Wir halten uns dabei an kein spezifisches Modell (wie z.B. Systemdynamik), sondern entwickeln ein tieferes Verständnis für die Systemwissenschaft und für eine spezifische Art des „Systemdenkens“, mit der Nachhaltigkeitsprobleme erfolgreicher angegangen werden können. Dies erreichen wir durch das Lesen und Diskutieren von wissenschaftlichen Arbeiten und Buchkapiteln.
Von den Studierenden wird erwartet, dass sie sich aktiv am Seminar beteiligen durch Seminardiskussionen, Präsentationen, schriftliche Ausarbeitungen und nicht zuletzt durch Lesen. Die Kursteilnehmer werden angeregt und aufgefordert, einen eigenen Zugang zum Thema Nachhaltigkeit zu entwickeln.
1.4 Curriculare Einordnung
Das Seminar ist Teil des Vertiefungsmoduls Semantic Web, zu dem weiter eine Vorlesung Nachhaltigkeit und Digitale Skills sowie ein Online-Praktikum mit dem Minsker TRIZ-Trainer gehören. Im Seminar wollen wir uns dem für die TRIZ-Methodik zentralen Begriff des Systems nähern und dazu verschiedene Quellen auswerten.
1.5 Plan des Kurses
Das Semantic Web erweitert das Web, um Daten zwischen Rechnern einfacher austauschbar und verwertbar zu machen; so kann beispielsweise der Begriff „Bremen“ in einem Webdokument um die Information ergänzt werden, ob hier ein Schiffs-, Familien- oder der Stadtname gemeint ist. Diese zusätzlichen Informationen explizieren die unstrukturierten Daten. Zur Realisierung dienen Standards zur Veröffentlichung und Nutzung maschinenlesbarer Daten (insbesondere RDF).
Das ist eine sehr technizistische Sichtweise, der nicht berücksichtigt, warum diese Unterscheidungen überhaupt relevant sind. In diesem allgemeineren Sinne befassen sich Semantic Web Technologien mit der werkzeuggestützten Schärfung der Bedeutung von Begriffen in konkreten Kontexten.
In diesem Kurs stehen die Voraussetzungen und Bedingtheiten im Vordergrund, die mit der Schärfung der Bedeutung von Begriffen in konkreten Kontexten verbunden sind. Wir werden dies auf dem Kontext der Nachhaltigkeitsdebatte genauer studieren. Mit technischen Fragen des Semantic Web werden wir uns allenfalls am Rande beschäftigen.
Der Kurs ist als interdisziplinäres akademisches Lehrangebot konzipiert, an dem Kolleginnen und Kollegen aus drei Bereichen beteiligt sind – Lydie Laforet und Sabine Lautenschläger vom IIRM, Ken Pierre Kleemann (Philosohpie) und Hans-Gert Gräbe (Informatik).
Akademisch bedeutet, dass wir miteinander – besonders im Seminar – auf Augenhöhe verhandeln wollen und werden. Es geht um rationale Argumentationen auf einem wissenschaftlichen Niveau, also um Argumente und nicht um apodiktische Wahrheiten.
Der Kurs besteht aus drei Teilen:
Die
Vorlesung
(do 11-13 Uhr). Dort werden grundlegende Begriffe wie Technik, Nachhaltigkeit im Kontext der bürgerlichen Gesellschaft, digitales Universum, RDF Basics, Ontologien (im Sinne der Informatik), Storytelling, Daten, Information, Wissen sowie kooperatives Handeln im digitalen Zeitalter genauer entwickelt.
Das Seminar „Systemwissenschaft“ (di 15-17 Uhr). Hier werden auf dem Hintergrund des vielfach überladenen Systembegriffs Begriffsbildungsprozesse in ihrer theoretischen wie praktischen Dimension studiert. Die Herangehensweise der interdisziplinären Partner wird sich dabei unterscheiden, wie bereits in der Vorbereitung des Seminars deutlich wurde. Während für die Kolleginnen am HRM die
eigenen Praxen der Einbindung
in konkrete sozio-politische Prozesse um die Sicherung von Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen, geht es dem Informatiker stärker um die
sozio-technischen Bedingtheiten
von Begriffsbildungsprozessen als Kern von Semantic Web Technologien und dem Philosophen um die
Dynamik von Begriffsbildungsprozessen
als solchen auf der Basis praktisch-performativer Erfahrungen, wie sie die Kolleginnen vom HRM und auch die Studierenden mitbringen.
Dabei werden wir immer wieder auf widersprüchliche Situationen stoßen, die genauer sprachlich zu analysieren sind, um sinnvolle Lösungen zu finden. TRIZ als (nicht nur) Erfindungsmethodik bietet hierfür ein umfassendes Instrumentarium an. Im
Praktikum
steht die Vermittlung grundlegender Fertigkeiten im Umgang mit dieser Methodik im Mittelpunkt, wobei der Minsker TRIZ-Trainer als Online-Kurs zum Einsatz kommt.
2 Systembegriff in der Theorie dynamischer Systeme (Gräbe)
Literatur: [38], Zusatzliteratur: [25], [26]
2.1 Fragestellungen der Theorie dynamischer Systeme
Ein dynamisches System ist eine abgegrenzte zeitabhängige Funktionseinheit, die durch ihre Signaleingänge und Signalausgänge in einer Wechselwirkung mit der Umwelt steht.
Das System hat mindestens einen Signaleingang und einen Signalausgang und reagiert zu einem bestimmten Zeitpunkt auf ein beliebiges Eingangssignal mit einer bestimmten zeitlichen Reaktion als Ausgangssignal. (Wikipedia)
Das System kann in der Regel Informationen über vorherige Ereignisse durch interne Strukturtransformation speichern und entwickelt so ein „Gedächtnis“.
Das Verhalten dieser Systeme kann linear, kontinuierlich nichtlinear, diskontinuierlich nichtlinear, zeitinvariant, zeitvariant und totzeitbehaftet sein. Dies gilt für Eingrößen- und Mehrgrößensysteme. (Wikipedia)
2.2 Erste Beispiele
Beispiele im homogenen Gravitationsfeld (aus der Wikipedia)
Pendel. Einfacher mathematischer Zusammenhang mit festem Bezugspunkt führt zu „einfachem“ Verhalten.
Gekoppelte Pendel. Kopplung von zwei Zusammenhängen nach (1) führt zu einer Reihe qualitativ verschiedener Kopplungsphänomene (Mitschwingen, Gegenschwingen, Schwebung).
Doppelpendel. Kopplung mit bewegtem Endpunkt als zweiter Anfangspunkt führt bereits zu chaotischen Trajektorien, da über die Kopplung in das zweite System Energie aus dem ersten eingetragen wird (bei kleinen Ausschlägen synchronisieren sich die Pendel nach einere Weile).
Magnetisches Pendel. Pendel mit drei punktförmigen Attraktoren, Energieeintrag hängt von den Entfernungen des Pendelendes von den drei Magneten ab. Im Ergebnis pendelt das Ende längere Zeit um jeweils einen der Magneten, bis es chaotisch zu einem anderen Magneten wechselt.
Beispiele mit gravitativer Wechselwirkung (auch Wikipedia)
Das Zweikörperproblem
Das Dreikörperproblem und das Kolmogorow-Arnold-Moser-Theorem. Dieses besagt, dass fast alle Trajektorien quasiperiodisch sind, dazwischen aber immer wieder kompliziertere Trajektorien liegen. Beispiel: Saturnringe.
Das sind bereits – notwendigerweise reduktionistische – Beschreibungsformen der Wirklichkeit wie etwa Beschreibungen des Pendels mit und ohne Dämpfungsglied.
Aber: Sinnvolle Reduktionen von Beschreibungsformen verbessern unsere Einsicht in die Zusammenhänge der Welt. Hätte Galileo Galilei diese Denkmethodik nicht angewendet, wäre ihm niemals aufgefallen, dass Eisen und Feder gleich schnell fallen, weil dies der praktischen Erfahrung widerspricht und erst nach einem Abstraktionsprozess deutlich wird. Dann kann es, unter Herstellung entsprechender idealer Bedingungen, aber auch im Experiment überprüft werden.
Nicht alles, was wie Chaos aussieht, muss auch Chaos sein:https://i.redd.it/zr7tet9mdf101.gif
2.3 Grenzzyklen und Attraktoren
Grenzzyklen
Attraktor als stabile zeitinvariante Lösung des entsprechenden Differentialgieichungs-Systems
Beispiel: Die Attraktoren des Magnetpendels sind die drei stabilen Endlagen, also drei Punkte im Phasenraum.
Weitere Phänomene:
Hysterese. Beispiel: Temperaturregelung einer Heizungsanlage
Räuber-Beute-Zyklen (Wikipedia), Lotka-Volterra-Gleichungen, Lotka-Volterra-Regeln
Zur Bedeutung „stabiler“ zyklischer Prozesse in der Natur.
Wir sind in der Lage, solche sich näherungsweise wiederholenden Muster in natürlichen Prozessen (d.h. Attraktoren) wahrzunehmen, also auch unabhängig von der Mathematik eine solche Reduktionsleistung zu vollbringen.
Wie kompliziert können solche Attraktoren werden?
Beispiel: Der Lorenzattraktor.
Achtung, im Gegensatz zum Magnetpendel entsteht das Bild nicht durch Bahnverfolgung, sondern stellt wirklich den Attraktor als globales Artefakt dar, als invariante Lösung des (recht einfachen, allerdings nichtlinearen) Systems aus drei Differenzialgleichungen.
Es geht noch komplizierter: Seltsame Attraktoren als „Endzustand eines dynamischen Prozesses, dessen fraktale Dimension nicht ganzzahlig und dessen Kolmogorov-Entropie echt positiv ist. Es handelt sich damit um ein Fraktal, das nicht in geschlossener Form geometrisch beschrieben werden kann“. (Wikipedia)
Damit ist der Trajektorienbegriff der klassischen Physik für derartige Phänomene nicht mehr anwendbar. Damit greift zugleich die klassische Interpretation des „Schmetterlingseffekts“ zu kurz, denn sie geht von der Existenz einer Trajektorie aus, längs derer (Mono)-Kausalität vermittelt wird.
2.4 Systeme auf multiplen Zeitskalen
Ein wichtiger Ansatz ergibt sich für Systeme, deren Dynamiken auf verschiedenen Zeitskalen ablaufen. Man kann dann methodisch als weiteren Abstraktionsschritt zunächst die Dynamiken auf den einzelnen Zeitskalen untersuchen und später in einem erweiterten Modell die Wechselwirkungen zwischen den Zeitskalen hinzunehmen. Massiv neue Phänomene ergeben sich bereits bei der Betrachtung von zwei Zeitskalen, was als Mikro- und Makroevolution bezeichnet wird. Hier wird es in der Wikipedia bereits dünn.
Beispiel: Doppelpendel als Pendel, aber der Pendelkörper hat selbst noch eine innere Dynamik. Das Obersystem prägt dem Untersystem durch Energieeintrag eine gemeinsame Dynamik auf. Obwohl das Doppelpendel eigentlich chaotisch ist, ist das System damit (final)
nicht
chaotisch, sondern verhält sich (bei kleinen Ausschlägen) wie ein einfaches Pendel mit Masse im Schwerpunkt.
In der Literatur als „Versklavungseffekt“ bekannt und besonders in methodisch schlecht fundierten soziologischen Betrachtungen als Verbalargument verbreitet.
Eine genauere Argumentation zu dem Thema unter
https://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerkforschung
Welche Probleme treten beim Zusammensetzen von (verstandenen) Mikroevolutionen von Teilsystemen zu einem Verständnis der Dynamik auf der Makroebene auf?
2.5 Immersiver und submersiver Systembegriff
Komplexere Relationen von Systemen S1 und S2 innerhalb eines Obersystems S kann man als Einbettung der beiden Teilsysteme in das Obersystem beschreiben.
Mathematische Formulierung der Fragestellung:
Gegeben sind die beiden Systeme S1 und S2 (als Instanzen einer mathematischen Kategorie, zum Beispiel Mengen oder Vektorräume).
Gesucht sind für jedes denkbare Obersystem S geeignete Abbildungen f1 : S1S, f2 : S1 → S2 S, die diese „Einbettung“ realisieren.
Einbettung steht hier für beliebige Morphismen in der gegebenen Kategorie.
Frage: Gibt es für diese Konstellation ein universelles kategorielles Objekt, d.h. ein in dieser Kategorie allein aus S1 und S2 konstruierbares universelles U samt universellen Abbildungen p1: S1→ U, p2 : S2 → U, so dass sich für jedes Tripel (f1, f2, S) die obige Konstellation als
für ein geeignetes schreiben lässt?
U heißt in dem Fall direkte Summe und man schreibt
Mathematische Kategorien.





























