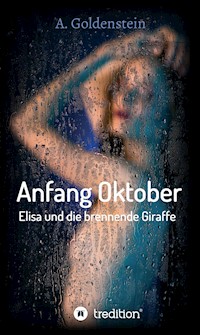8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Eine gleichermaßen spannende und betörende wie erotische Geschichte zwischen Wahrheit und Wirklichkeit um Emotionen, Sex, Tod und Sehnsucht nach Geborgenheit. Lebendige, federleichte Sprache und entwaffnender Humor lassen seufzende Bilder im Kopf entstehen. Sexy und ruchlos zugleich.« (SELECTED ARTISTS, BERLIN) Thijs Fisher ist smart, Anfang 40, Lebemann. In einer bekannten Radioshow gibt er Hilfesuchenden psychologische Ratschläge - disziplinlos und barsch. Nachdem sich ihm ein Jugendlicher live auf Sendung anvertraut, wird es brenzlig für Thijs. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Doch statt um die eigene Existenz besorgt zu sein, dreht sich sein Dasein nur um Frauen. Geradezu besessen versucht er, die geheimnisvolle Elisa zu erobern. Wäre da nicht Exfreundin Katja, die plötzlich zurück in das Leben von Thijs tritt... Verstrickt in ein Netz aus Eifersucht und Lügen gerät seine emotionale Welt aus den Fugen. Thijs' anmutige ostfriesische Heimat bildet die Kulisse für einen aufwühlenden Showdown – stets ungehörig, listig, boshaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Achim Goldenstein
SENDESCHLUSS
Die Sache mit der Wahrheit
Achim Goldenstein
SENDESCHLUSS
Die Sache mit der Wahrheit
Roman
© 2022 Achim Goldenstein
Cover-Design: Selected Artists, Berlin (Painting: "The Speech" by Radu Belcin) (selected-artists.com)
ISBN Softcover: 978-3-347-77037-9
ISBN E-Book: 978-3-347-77038-6
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Für meine Familie.
Prolog
Im Leben gibt es zwei Arten folgenschwerer Begegnungen. Eine, die einem bewusst ist, gegen die man sich aber nicht stemmt. Eben jene, die mit Wucht ins Dasein tritt und direkt versucht, aus der Bahn zu werfen - Resultate zuerst, Bedenken später. Unversehens zeigt sie auf, dass die Risiken elementar und schwer kalkulierbar sind, wenn man sich nur auf sie einlässt.
Fataler ist die andere Art. Es ist jene, die schleichend und verstohlen ins Leben tritt. Unbemerkt nistet sie sich ins Hirn ein und beginnt, die Sinne zu vernebeln. Sie lässt die Welt aus den Fugen geraten. Zwar spürt man, dass etwas anders ist. Eine gewisse Unruhe macht sich breit. Doch man unternimmt nichts dagegen, und es gibt auch rein gar nichts, was man dagegen tun könnte. Diese Art der Begegnung ist wie ein Unfall, der nur darauf wartet zu geschehen.
Manche Menschen machen weder mit der einen noch mit der anderen Art Bekanntschaft. Und so leben sie ihr Leben nicht, weil sie nicht merken, dass es gerade stattfindet.
In mein Leben traten beide. Und zwar ruchlos, verführerisch und auf heikle Weise gleichzeitig. Von ihnen handelt meine Geschichte.
Kapitel 1 – Gemütlich
Alles begann, als sich nicht nur meine Einstellung, sondern auch mein Lächeln änderte. Es war sowas wie der Anfang vom Ende. Das hört sich komisch an, irgendwie versnobt und oberlehrerhaft, keine Frage. Aber es ist die Wahrheit.
Ich saß in einem Lokal, trank Wein und hatte ein wirklich gutes Essen. Ich dachte, hier ist es auszuhalten, ja verdammt gemütlich ist es hier sogar. Es kommt nur sehr selten vor, dass ich es irgendwo gemütlich finde. Aber in dem Restaurant war‘s gemütlich. Es gab gemütliches Licht, gemütliche Stühle, gemütliche Atmosphäre. Und selbst die Musik, sowas irrsinnig Klassisches, die sacht im Hintergrund lief, war irgendwie gemütlich. Wenn Musik das überhaupt sein kann, also gemütlich.
Ich befand mich in einem italienischen Restaurant und in keiner schnöden Pizzeria mit allenfalls ordinären Pizzen und Pasta im Angebot, die allesamt in Unmengen von Käse und Olivenöl schwimmen. Nein, in jenem Restaurant gab es italienische Gerichte, feinste Küche von Apulien bis Venezien, mit frischem Gemüse und Kräutern und allem, was dazugehört. Das Essen wurde aufwendig zubereitet und hübsch angerichtet. Das Speisenangebot war auf eine große Tafel geschrieben. Vermutlich tat man das mit Kreide oder speziellen Filzstiften, die sich wieder abwischen lassen. Es waren nicht viele Gerichte, nur zehn, vielleicht auch zwölf und allesamt hörten sie sich wahnsinnig klangvoll an. Ich mag aufwendig zubereitetes Essen. Mit Tiefkühlpizza oder Fertiggerichten für die Mikrowelle muss mir niemand kommen. Da wird mir übel.
An so einer furchtbaren Tiefkühlpizza wäre ich beinah einmal erstickt. In der Kindheit kaufte Mutter meinem Bruder und mir nie Tiefkühlpizza. Niemals tat sie das. Sie kaufte zwar regelmäßig ein und schleppte alles Mögliche ins Haus. Unser Kühlschrank und die Tiefkühltruhe waren immer voll, und zwar bis zum Rand. Darin befanden sich auch jede Menge Erbsen, Möhren, Bohnen und andere Sachen, die Mutter im eigenen Garten erntete und in akkurat beschrifteten Beuteln und Dosen einfror. Und natürlich waren übriggebliebene Mahlzeiten, Fleisch, Eintöpfe und Mutters einzigartige Hühnersuppe in dieser Truhe. Sogar Brot fror Mutter ein, besonders das Schwarzbrot von Battermann. Das war in meinem ostfriesischen Heimatdorf so eine kleine Bäckerei mit angeschlossenem Tante-Emma-Laden. Dort wurde das beste Schwarzbrot gebacken hat, das ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Nie wieder habe ich besseres Schwarzbrot gegessen. Es war das beste Schwarzbrot aller Zeiten.
Die Tiefkühltruhe stand im Vorratsraum und nahm dermaßen viel Platz ein, dass man sich zwischen dieser containergroßen Truhe und dem gegenüberstehenden Regal nicht mal mehr umdrehen konnte. Man musste vorwärts rein in den Vorratsraum und rückwärts wieder raus. Doch wann immer mein Bruder oder ich da vorwärts hineingegangen sind und rückwärts wieder raus, fanden wir in der gigantischen Truhe, deren Inhalt niemals weniger werden wollte, keine Tiefkühlpizzen. Die mussten wir uns schon selbst kaufen. Und das taten wir, ich sogar häufiger als mein Bruder. Und als ich eines Tages mit so einer tiefgefrorenen Salami-Pizza heimkam, habe ich die verdammte Folie nicht richtig abgemacht, zumindest nicht vollständig. Die Folie ist mit dem Pizzaboden, der Tomatenpampe, dem Käse und der Salami im Ofen richtig schön verschmolzen. Und zwar so, dass man das nicht sehen konnte in dem schummrigen Licht in Mutters Küche. Einerseits gab es jede Menge Licht in unserer Küche, eine große Deckenleuchte, Spots, Unterbaulicht und sogar eine Stehlampe. Doch andererseits schaltete ich die Beleuchtung nicht ein, denn ich mochte nicht essen, wenn es so hell und grell um einen herum leuchtete und schien, dass man die Augen regelrecht zukneifen musste. Im Halbdunkeln aß ich also diese scheiß Pizza, und, wie es kommen musste, blieb mir die versengte Folie im Halse stecken und ich röchelte und hustete wie verrückt, bis ich blau angelaufen war. Ich habe es überlebt, aber nur knapp, wenn ihr’s genau wissen wollt.
Doch, weshalb saß ich überhaupt in dem gemütlichen italienischen Restaurant? Natürlich deshalb, weil ich einen Bärenhunger hatte und weil ich zufällig darauf gestoßen war. Ich hatte in Berlin nämlich etwas zu erledigen. Etwas, das mit meiner Arbeit zu tun hatte. Im weitesten Sinne hielt ich mich also beruflich in Berlin auf. Um ehrlich zu sein, hatte es nur deshalb mit meiner Arbeit zu tun, weil ich keine mehr hatte. Von meinem Job als Radio-Moderator war ich freigestellt worden. Angeblich hatte ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, das berühmte Fass zum Überlaufen gebracht und lauter so einen Blödsinn musste ich mir von der Senderleitung anhören. Ein paar sensationsgeile Journalisten machten aus einer Mücke den berühmten Elefanten. Es war abzusehen, dass die Medien daraus einen Eklat konstruierten.
Allerdings bringt so eine Freistellung vom Job bei einem Giganten der öffentlich-rechtlichen Sender eine Menge Vorteile mit sich. Man hat viel Zeit, Sachen zu erledigen, die man auf die lange Bank geschoben hat, oder einfach Dinge zu tun, die man noch nie getan hat. Gleichzeitig fließt die Kohle weiter aufs Konto und sorgt für ein gutes Auskommen. Mein Brötchengeber begründete meine Dispensierung damit, mich eine Zeit lang aus der Schusslinie nehmen zu wollen. Ich allerdings hätte mich anfangs gern dem allgemeinen Tohuwabohu gestellt und betrachtete die Entscheidung des Senders als Heuchelei. Schließlich war ich der Überzeugung, einen guten Job gemacht zu haben und hatte mir nicht das Geringste vorzuwerfen.
In der Hauptstadt war ich wegen eines Termins, der dazu dienen sollte, auszuloten, ob ein Engagement bei einem weniger mimosenhaften Arbeitgeber nicht unabhängiger und sogar lukrativer war. Doch das Treffen bei einem Privatsender ließ ich kurzfristig platzen. Die ständige Werbung und vor allem die Selbstbeweihräucherung bei den Privaten gingen mir gegen den Strich. Mein Intendant würde schon noch zur Besinnung kommen, war ich der Meinung.
In zwiespältigen Situationen, besonders dann, wenn Leute, die nicht meiner Meinung sind, aber ungünstigerweise am längeren Hebel sitzen, halte ich es meist mit den Worten, die der Kleine Prinz tatsächlich niemals gesagt hat, denen aber eine gewisse Logik innewohnt: Was vergangen ist, ist vergangen, und du weißt nicht, was die Zukunft dir bringen mag. Aber das Hier und Jetzt, das gehört dir.
Und mein Hier und Jetzt war Charlottenburg, denn dort hatte ich ein Hotel gebucht. Eine Attraktion in dem Stadtteil ist der berühmten Ku’damm, den ich gleich mehrmals täglich auf und ab latschte. Ich lief von der Gedächtnis-Kirche runter am Hardrock Café und an einer Million Boutiquen und Läden vorbei, die lauter edle und teure Sachen verkaufen. Ich ging bis zum Agathe-Lasch-Platz. Eigentlich war ich nie ganz bis zum Agathe-Lasch-Platz gekommen, sondern blieb jedes Mal einige Meter vorher stehen, am Rudi-Dutschke-Tatort. Dort befindet sich eine große Platte aus Marmor, die ins Straßenpflaster eingelassen ist sowie eine Informationstafel. Beides erinnert an Dutschke und wie man ihn dort 1968 abgeknallt hat. Gestorben ist der Dutschke übrigens gar nicht sofort, sondern erst Jahre später an den schlimmen Folgen. Rudi Dutschke tat mir irgendwie leid. Ich malte mir aus, wie er eine gefühlte Ewigkeit mit dem Tod gerungen hatte, ganze elf Jahre lang, und dann den verdammten Kampf verlor. Eine grausliche Vorstellung.
Mindestens hundert Mal bin ich also die eine Ku’damm-Seite heruntergelatscht und auf der anderen wieder hinaufgelaufen. Auf dieser Flaniermeile gibt es zwischen all den teuren Gucci-, Boss, Porsche- und Prada-Läden kaum etwas anderes als Luxusgüter. Jedenfalls fand ich kein Restaurant und schon überhaupt kein gemütliches. Es gibt auf dem Ku’damm zudem noch jede Menge Juweliere, Kosmetikgeschäfte und tatsächlich einen 24-Stunden Botox-Shop. Als ich den entdeckte, dachte ich, ich werde verrückt. Botox to go flackerte in riesigen LED-Buchstaben in einer Schaufensterscheibe. Davor blieb ich eine Weile fassungslos stehen und setzte mich schließlich in unmittelbarer Nähe auf eine Bank, mein Beobachtungsposten. Männer wie Frauen jeden Alters gingen in den Botox-Shop ein und aus. Manche trugen teure Mäntel, einige davon sogar aus Pelz, und allerlei andere Edelklamotten. Ich versuchte, in die Gesichter dieser Menschen zu blicken, was gar nicht einfach war, denn viele versteckten sich unter komischen Mützen und Kapuzen, die sie sich weit ins Gesicht gezogen hatten. Von denen, die ich erkennen konnte, wirkten nicht wenige komischerweise ganz normal. Andere wiederum sahen tatsächlich zum Fürchten aus. So schlimm, dass ich es gar nicht beschreiben kann. Es waren Leute ohne jede lebhafte Mimik. In den versteiften Visagen bewegte sich nichts mehr. Stillgelegte Gesichter, die noch am ehesten an erfrorene Nagetiere erinnerten.
Wenn ich in fremden Städten Hunger bekomme und auf der Suche nach einem Restaurant bin, ist mir oft nichts gut genug. Nachdem ich Ewigkeiten gegoogelt und Bewertungen im Netz gelesen habe, laufe ich die weitesten Wege, um zu einem Lokal zu gelangen, das gutes Essen und gemütliche Atmosphäre verspricht. Wenn ich es erreiche, werfe ich zuerst einen Blick durch die Fensterscheiben und dann, wenn es drinnen nichts auszusetzen gibt, auf die Speisekarten, die in so kleinen beleuchteten Kästen an der Außenwand angebracht sind. Das Licht in diesen blöden Kästen ist übrigens immer zu schwach und die Schrift auf den darin befindlichen Karten immer zu klein. Ich presse meine Nase geradezu an die Scheibe, um überhaupt was von dem Angebot lesen zu können oder hole mein Handy hervor, um die dämlichen Kästen auszuleuchten. Weshalb machen Gastwirte sowas? Haben die was zu verbergen oder wollen die Leute wie mich ärgern?
Wenn nach meiner ausgiebigen Recherche mehrere Restaurants in Frage kommen, bin ich überdies immer wahnsinnig unentschlossen, welches davon ich ansteuern soll. Das macht mich selbst verrückt, doch kann ich es nicht ändern und muss mich mit dieser Macke abfinden. Und in Charlottenburg gibt es mindestens einhunderttausend Restaurants.
Von der ganzen Lauferei taten mir die Füße weh. Mit jedem Meter, den ich in Charlottenburg herumirrte, wurden meine teuren Sneakers mehr und mehr zur Qual. Zu den Sneakers trug ich meine schwarze Lederjacke - meine Midlife-Crisis scheiß Lederjacke, wie Nadine, eine Freundin, das gute Stück beschrieb. Dem Grunde nach ist sie nicht nur eine Freundin. Nadine ist meine beste Freundin, und sie ist immer so verdammt ehrlich, wenn man sie nach ihrer Meinung fragt. Sie hat nur einen verdammten Fehler, so wie alle Frauen auf dieser Welt ihre Fehler haben oder wenigstens eine absolute Marotte. Nadine mag kein italienisches Essen. Wenn jemand allen Ernstes kein italienisches Essen mag, bringt mich das um den Verstand. Wie um alles in der Welt kann man die italienische Küche nicht mögen? Aber sowas scheint vorzukommen. Es gibt ja auch Menschen, die aus der verteufelten Nazi-Zeit bis heute nichts gelernt haben, die auf kleine Kinder stehen oder die Bayern-Fan sind oder was weiß ich.
Zu meiner Lederjacke trug ich einen Schal. Der Schal stammte aus Spanien, genauer gesagt aus Málaga, gekauft in einem teuren Designer-Laden. Der Shop war vielleicht nicht so exklusiv wie die Läden am Ku’damm, aber immer noch ein verdammt teurer. Zwei Jahre lag es bereits zurück, dass ich den Schal am südlichsten Ende Spaniens gekauft hatte. Anschließend lagerte das teure Stück im Schrank. Ich hatte den Schal beinah vollkommen vergessen, und er fiel mir eher beiläufig wieder in die Hände. So ergeht es mir nicht nur mit Sachen, die ich irgendwo kaufte. Auch das Leben bescherte mir immer wieder zufällige Funde auf der Suche nach was anderem.
Den Urlaub in Andalusien habe ich in guter Erinnerung, denn ich war damals schon Single. Außerdem trieb ich mich auf Reisen nicht gern am Pool oder am Strand herum. Ich sah mir lieber die Gegend an, erkundete Städte und besonders beobachtete ich Menschen, die langweiligen genauso wie die interessanten.
Jedenfalls dachte ich, dass ich den Schal mal ins verrückte und schöne Berlin mitnehmen könne. Die ersten Frühlingsboten kamen zwar schon pünktlich im März, sie hatten sich aber in jenen Tagen Ende April bereits wieder verabschiedet. Nicht einmal zehn Grad zeigte das Thermometer an. Da war es gut, wenn man einen Schal dabeihatte. An dem Schal haftete sogar noch das Verkaufsetikett, denn ich hatte ihn nicht ein einziges Mal getragen. Ich fand, ich sah ganz passabel aus. Der Schal und die Jacke hatten etwas. Gekleidet war ich ganz in Schwarz. Nur der Schal nicht und die Sneakers, die meine Füße quälten, auch nicht. Okay, dachte ich, du kannst dich sehen lassen. Lediglich die Haare gefielen mir nicht. Sie waren zu kurz und ich beschloss, sie länger wachsen zu lassen. Wenigstens oben, die Seiten waren ok.
Frauen wenden ihren Blick manchmal zu mir. Das bilde ich mir jedenfalls ein, dass das so ist. Natürlich nicht alle Frauen, aber immerhin die ein oder andere, das fällt mir schon auf. Sie tun es nicht, weil sie mich auf der Straße, in der Schlange an der Supermarktkasse, in einem Lokal oder einfach im Vorbeigehen erkennen. Ich bin nicht berühmt wie der Papst oder der amerikanische Präsident, die man alle halbe Stunde in den Medien sieht. Ok, ich war sogar schon einmal Gast in einer Talk-Show, doch deswegen erkennt man mich nicht sofort. Trotzdem haftet mir ein wenig Bekanntheit an. Doch eben nicht, weil man mein Gesicht erkennt. Vielmehr ist es meine Stimme, die manch einem geläufig vorkommt und einen Wiedererkennungswert besitzt.
Im Gegensatz zu meiner Stimme fühle ich mich optisch oft nicht wahrgenommen. Man übersieht mich wie ein grausliches Tischtuch oder wie ein nicht weggeräumtes leeres Glas. Wenn Leute mich ansehen, bleiben die Blicke an mir nicht haften. Ich fühle mich oft ignoriert. Es kam schon vor, dass man mir von einer witzigen Begebenheit erzählte, ohne sich daran zu erinnern, dass ich dabei war, als es geschah.
Sehen mich also hin und wieder Frauen an, meine ich diesen Blick, wenn man sich nicht nur einfach so flüchtig ansieht, sondern diese eine Sekunde zu lange. Das fällt mir immer sofort auf, und ich setze dann meist ein angedeutetes Lächeln auf, so gut ich kann jedenfalls.
Besonders tat ich das in dem gemütlichen Charlottenburger Restaurant für die Brünette am Nebentisch, der keinen halben Meter von meinem entfernt stand.
Das, was in diesem italienischen Lokal allerdings nicht wirklich angenehm und gemütlich war, war die Tatsache, dass die Tische so eng nebeneinanderstanden. Ich dachte, man muss sich mit dem Hintern zwischen dem Mobiliar hindurchzwängen und stößt dabei womöglich noch ein Glas oder eine Flasche um, so dass man von allen Seiten angeglotzt wird. In dem gemütlichen Restaurant war es so eng, dass ich, als ich von der Toilette zurückkam, fast auf meinen Platz klettern musste. Solche Situationen hasse ich wie die Pest.
Die Brünette hatte schon mindestens dreimal zu mir herübergeschaut. Vielleicht hatte sie es sogar noch öfter getan, doch dann hatte ich es nicht mitgekriegt. Ihre Lippen waren streng, doch Augen hatte die Brünette so schwarz wie die Nacht und so funkelnd wie die Sterne. In ihnen lagen nicht nur Glut, sondern auch Seele. Sie war mit ihrer Mutter dort oder mit ihrer Tante oder sonst jemandem. Jedenfalls war die Ältere, die der Schönheit gegenübersaß, nicht attraktiv. Überhaupt nicht war sie das, nicht die Spur attraktiv. Das war sie vermutlich auch nie gewesen. Die Alte wirkte altbacken, fast schon omahaft. Sie war wenigstens sechzig Jahre alt und hatte sich vergeblich bemüht, ein paar Jahre davon wegzuschminken. Vielleicht war sie sogar tatsächlich die Großmutter. Die Brünette war höchstens dreißig, vielleicht einunddreißig oder zweiunddreißig aber auch keine zweiundzwanzig mehr. Dafür trug sie ein wahnsinnig elegantes Kleid. Es war aus dünnem, samtartigem graugrünem Stoff, und es saß eng an ihrem Luxuskörper, besonders da, wo so elegante Kleider eng sein müssen. Ich habe schon viele Frauen in Kleidern gesehen, und nicht wenige davon sollten wirklich keine engen Kleider tragen. Aber die Brünette gehörte nicht zu denen, weiß Gott nicht. Ich dachte, sie kann wahrscheinlich drei oder vier Kleider übereinander anziehen und sieht immer noch hinreißend aus. Und wie ich so mit meiner Serviette, die der Kellner beim Abräumen liegengelassen hatte, spielte, stellte ich mir ihre Dinger vor, also ihre Brüste oder Möpse oder Titten oder wie auch immer man dazu sagen will. Es gibt vermutlich eine Million Bezeichnungen.
Die Frauen, bildete ich mir ein, guckten nicht nur im Restaurant. Auch während meines Gelatsches am Ku’damm war es mir aufgefallen. Nun bin ich nicht übermäßig eitel oder gar gefallsüchtig. Doch ich bin ein Mann, und welcher Kerl steht nicht auf die Gunst der Frauen? Als mir das an meinem kleinen Tisch in dem gemütlichen Restaurant bewusstwurde, beschloss ich, dass ich zu meinem Blick und meinem angedeuteten Lächeln eine andere Einstellung an den Tag legen sollte. Ich dachte, ich bin weit mehr als ein unschönes Tischtuch oder ein stehengelassenes Glas. Man hatte mich nicht einfach zu übersehen. Außerdem mussten mein Blick und mein Lächeln ganz passabel sein, andernfalls hätte die Brünette nicht schon so häufig zu mir herübergeschaut. Und jedes Mal schaute sie diese eine Sekunde zu lang. Das bildete ich mir jedenfalls ein. Vielleicht täuschte ich mich auch, und sie sah einfach durch mich hindurch. Ich nahm mir also vor, Blickkontakt mit attraktiven Frauen und das angedeutete Lächeln zu intensivieren. Ich wollte fortan weniger blöd gucken, wenn mich eine Frau ansieht, sondern selbstbewusster, autark und vor allem sichtbar und präsent.
Vom Kellner fühlte ich mich inzwischen vernachlässigt. Er kam mit dem Wein nicht mehr nach und erweckte den Anschein, als wolle er mich schikanieren oder gar verdursten lassen. Generell legte der Typ, der für meinen Tisch und die Tische um meinen herum eingeteilt war, ein arrogantes Verhalten, an den Tag, ein geradezu Gigolo-mäßiges Benehmen. Ein Möchtegernitaliener war das, der mehr ausschaute wie jemand aus dem hintersten Winkel Osteuropas, begann ich mich aufzuregen. Zwar hatte der Kellner so typisch schwarze italienische Haare, doch die trug er auf einem viel zu großen Kopf, einem richtigen Quadratschädel. Er besaß auch keinen Hals, jedenfalls entdeckte ich keinen. Der wulstige Nacken quoll über den Hemdkragen und der kartoffelähnlichen Knollnase trug er eine Brille aus der Zeit vor den Weltkriegen. Ach, lass die Frauen, Gigolos, Betonköpfe und alle Idioten dieser Welt, dachte ich vom Wein arg benebelt, es langweilt mich, wenn ich mich darüber echauffiere.
Am Nachbartisch zur anderen Seite hatte zwischenzeitlich ein Paar Platz genommen, das in etwa in meinem Alter war. Der Typ trug ein peinliches rosafarbenes Hemd, hatte nur noch einen armseligen Haarkranz vorzuweisen und zu allem Überfluss einen silbrig blitzenden Stecker im Ohr. Sie war auch nicht gerade ansehnlich, hatte sich aber bemüht, mit Schminke und aufwendig frisiertem Haar das Beste aus sich herauszuholen. Er, das beobachtete ich schon länger, wenn ich meinen Blick mal von der Brünetten lassen konnte, befummelte seine Schnecke unterm Tisch und tätschelte ihre Beine, ihre Strumpfhose und was er da unten noch so fand. Die ganze Zeit hatte er die Flossen dort. Und sie nahm es gar nicht richtig wahr oder wollte es zumindest nicht wahrnehmen. Vielleicht dachte sie auch, der Idiot soll das verdammt nochmal lassen, traute sich aber nicht, den Mund aufzumachen. Was mich am meisten nervte, war, dass der Typ den allerletzten Mist erzählte. Er sprach von einem Arbeitskollegen, der an irgendwelchen Tabletten beinah gestorben wäre, weil er davon zu viele auf einmal geschluckt hatte. Und der Haarkranzaffe sagte, dass er davon überzeugt sei, dass dieser Kollege die Pillen absichtlich geschluckt hatte. Herrgott, das geht doch gar nicht, dachte ich. Der Typ befummelt seine Madam unentwegt unterm Tisch, um sie scharf zu machen und erzählt gleichzeitig von einem Typen, der vom Leben die Schnauze voll hatte und fast verreckt wäre. Ihre Reaktion war nicht besser, weil sie immer wieder sagte, dass das ja wohl nicht wahr sein darf, mein Schatz und so einen Müll. Das ganze Dilemma spielte sich weniger als einen Meter von meinem Tisch entfernt ab. Ich hätte kotzen können.
Doch das wäre zum einen nicht gut und zum anderen schade um das Essen gewesen. Denn mein Essen war gut, wirklich gut. Der Wein war es übrigens auch. Der Pinot Grigio kam fast ohne Säure aus und schmeckte angenehm und süffig. Ich bin kein Experte oder gar Sommelier, trotzdem habe ich in meinem Leben genug getrunken, um guten Wein von billiger Plörre unterscheiden zu können.
Bei Signore Quadratkopf bestellte ich noch eine weitere Karaffe, in der Hoffnung, der Typ würde seine Beine diesmal zu etwas mehr Eile antreiben und mich nicht wieder so lange warten lassen. Für so arrogante Typen hatte ich mein ganzes Leben lang noch keine Geduld. Und schon mal gar nicht, wenn ich, so wie ich es in dem gemütlichen Restaurant war, ziemlich angetrunken bin.
Die Sneakers, die ich an jenem Abend trug, waren übrigens weiß und der Schal nicht. Der war gestreift.
Kapitel 2 – Elfenbein
Der Weißwein in dem gemütlichen Restaurant mit den verflixt engen Tischen war wirklich fabelhaft. Vor allem war er exzellent temperiert. Mir schmeckt Weißwein am besten, wenn er genau elf Grad hat. Wenn er wärmer ist, werde ich verrückt oder verlange unverzüglich Eiswürfel. Der gute Tropfen beim Italiener war allerdings nicht ganz so gut wie der, den ich ein paar Wochen zuvor mit Katja getrunken hatte. Das mochte weniger am Wein als an den besonderen Umständen gelegen haben, unter denen ich ihn genießen durfte.
Katja war meine Ex, und sie ist es immer noch. Bereits seit zweieinhalb Jahren ist sie das. Während ich nach der Trennung wegzog, ist Katja in Wismar geblieben. Sie hat sich dort eine neue Wohnung gesucht. Unsere gemeinsame Bude war zwar ganz wohnlich, nur mir war sie immer zu klein. Für Katja allein hätte sie Platz genug gehabt, doch sie behielt die Wohnung trotzdem nicht, weil angeblich zu viele Erinnerungen daran hafteten. Katja und ich hatten uns niemals so ganz aus den Augen verloren, was vermutlich daran lag, dass ich immer wieder in Wismar zu tun hatte und sie mir alle paar Monate mehr oder weniger über den Weg lief.
Nur zu gerne saß ich meinen Espresso schlürfend in Wismar am Alten Hafen. Den besten Espresso und die beste Aussicht gab es immer im Café Da Ricardo. Stundenlang konnte ich dort sitzen und aufs Wasser starren, lesen oder mich mit meinem iPhone langweilen, wenn ich diesen aromaexplosiven Espresso mit der nussbraunen Crema trank. Das Café besitzt im Außenbereich Mobiliar aus verwittertem Holz und keine Plastikmöbel. Möbel aus billigem Kunststoff verabscheue ich. Nur hin und wieder nervten mich am Alten Hafen die Touristen. Wenige Wochen vor meiner Reise nach Berlin traf ich sie, meine Exfreundin Katja.
Es war ein wolkenarmer Tag im März, und sie begegnete mir am späten Nachmittag zufällig vor dem kleinen Tabakladen unterhalb der Wohnung, die sie seit anderthalb Jahren ihr Zuhause nannte. Zuhause ist für mich ja etwas Heiliges, etwas Unantastbares. So eine schnöde Oberwohnung würde ich niemals als mein Zuhause bezeichnen. Ich hielt es aber für nicht besonders klug, Katja meine Anschauung augenblicklich um die Ohren zu hauen und ließ es. Wir begrüßten uns eher herzlich, mit einer Umarmung und einem kurzen gegenseitigen Drücken. Wir quatschten, lachten und rauchten gemeinsam. Sowohl Katja als auch ich hatten Langeweile und nichts weiter zu tun, als Zigaretten zu kaufen, vor dem quirligen Laden zu stehen und belangloses Zeug zu reden. Sie fragte, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr auf ein Glas Wein oder eine Tasse Tee in ihre Wohnung zu kommen. Dabei sah sie mich diese eine verdammte Sekunde zu lange an. Ob ich ein Lächeln andeutete, weiß ich nicht mehr. Ich habe es einfach vergessen. Was ich aber noch weiß, ist, was ich dann zu ihr sagte:
»Ja, klar, das können wir machen. Ich bin ganz neugierig, wie du dich eingerichtet hast.«
Manchmal wundere ich mich selbst über den Mist, der mir über die Lippen kommt. Und sie sagte praktisch nichts, und ihr schöner Mund lächelte. Ich hatte fast vergessen, was für einen unsagbar sinnlichen Mund sie hatte.
Aber Katja war wahnsinnig. Das war sie schon immer. Deshalb ist es mit ihr auch auseinander gegangen. Mit Wahnsinnigen kann man keine Beziehung führen, jedenfalls nicht, wenn man nicht zufällig selbst wahnsinnig ist. Trotzdem war es an dem Tag mit Katja kurzweilig und amüsant und Jesus was noch alles. Es war so, wie es nicht immer ist, wenn man in der Wohnung seiner Ex-Freundin landet. Und weil man das so ja auch gar nicht immer will, oder wie auch immer man das beschreiben soll.
Katjas Wohnung war sehr hell eingerichtet und die Wände alle in derselben Farbe gestrichen.
»Du magst Weiß noch immer am liebsten, nicht wahr?«, fragte ich und sah mich zu allen Seiten um. Katja lächelte ihr hübsches Lächeln und antwortete:
»Das ist kein Weiß, Thijs. Das ist elfenbeinfarben.«
»Dunkelweiß also…?!«, sagte ich und dachte, nun reimt sie auch noch, und wahnsinnig ist sie noch immer.
»Nein, mein Lieber, das nennt sich tatsächlich elfenbeinfarbig «, erklärte Katja. Und ohne nur eine Sekunde lang zu pausieren, fügte sie nahtlos hinzu:
»Ich habe noch zwei Flaschen Chardonnay, was hältst du davon?«
»Fürs Erste reicht eine Flasche«, sagte ich.
Doch Katja dachte gar nicht daran, über den kleinen Witz zu lachen, sondern blieb wortlos und verzog ausnahmsweise mal keine Miene. Sie nahm mir meine Jacke ab und legte sie über eine Stuhllehne. Auch nach achtzehn Monaten in dieser Bude hatte sie offenbar noch keine Zeit gefunden, eine Garderobe oder wenigstens ein paar Haken an die Wand zu dübeln.
Die Wohnung war auf den ersten Blick nicht besonders groß. Und auch nicht auf den zweiten. Küche und Wohnzimmer bildeten sozusagen einen Raum, abgetrennt waren die beiden Bereiche nur durch ein Regal. Es war ein wirklich schönes, wenngleich elfenbeinfarbenes Regal. Mir gefiel es auf Anhieb. Nicht unbedingt die Farbe aber das Regal selbst. Die Regalfächer waren quadratisch und vollgestellt mit hunderten von Schallplatten. Schallplatten, wer hat heute noch richtige Schallplatten, fragte ich mich. Katja hatte schon während unserer Beziehung ein Faible für sowas. Dass es sich um so viele Platten handelte, hatte ich damals nicht geahnt. Die Dinger mussten aus Platzgründen in den Umzugskartons bleiben und waren in einer Nische im Keller verstaut, genauso wie ein Großteil meiner Bücher. Unsere damalige Wohnung war viel zu klein. Es gab ein winziges Schlafzimmer und ein noch winzigeres Wohnzimmer, eine Mini-Küche und ein Bad. Das war’s, mehr nicht. Es gab keine Rückzugsmöglichkeit. Wir lebten auf nicht einmal sechzig Quadratmetern beinah zwei Jahre zusammen. Vielleicht ist Katja auch davon wahnsinnig geworden. Ich weiß es bis heute nicht.
Die Fächer des Regals waren so, als wäre das gute Stück eigens für Schallplatten hergestellt worden. Ein Schallplattencover misst pro Seite genau 315 Millimeter. Das weiß ich so genau, weil ich das in einer dieser langweiligen Quizsendungen gesehen habe und das auf sonderbare Weise hängengeblieben ist. Die Regalfächer waren eine Spur größer, so dass noch genügend Platz war, die Sammlung zu durchblättern, wenn man wollte. Ich wollte nicht, sondern bestaunte, wie akkurat die Schallplatten aufgereiht waren. Praktisch keine einzige Hülle ragte hervor, nichts war schief oder ungeordnet. Ganz oben stand zuvorderst die LP August and everything after von den Counting Crows. Es ist eine meiner Lieblingsplatten. Das Album kann man von Anfang bis Ende durchhören und muss keine einzelnen Lieder herauspicken, weil der größte Teil nur lückenfüllender Mist ist. Es handelt sich um ein echtes Gesamtkunstwerk. Ich nahm die Platte und fläzte mich auf einen der beiden Sessel, während Katja an der Küchenzeile stand und etwas mühevoll den Wein entkorkte. Verflucht, dachte ich, die wahnsinnige Katja hat noch immer verdammt heiße Beine, was ich sah, als sie sich streckte, um ganz oben aus dem Hängeschrank zwei Gläser zu nehmen. Sie trug einen knielangen Rock und darunter eine Nylonstrumpfhose. Ich bin mir fast sicher, dass ich in dem Moment, als ich Katja auf die Beine glotzte, ein Lächeln andeutete.
*
In dem gemütlichen Restaurant brachte mir der Möchtegernitaliener nach einer Ewigkeit endlich den ersehnten Wein und grinste mich dabei auch noch an, der Trottel.
Erneut begegnete ich dem Blick der Brünetten. In ihren Augen lag etwas Geheimnisvolles. Vielleicht war es ein Versprechen, die Aussicht auf etwas Intimes, auf ein Abenteuer. Möglicherweise gab sie mir ihr Versprechen nur, weil sie mir ansah, dass sie es nicht würde halten müssen. Gleich darauf machte sie nämlich Anstalten zu gehen. Sie nahm den Schlüsselbund, das Handy und was sie da sonst noch auf dem Tisch deponiert hatte, und stopfte alles in ihre Handtasche. Sie trank den letzten Schluck des Rotweins, das Wasser ließ sie stehen, ebenso wie den Kaffee, den sie nach dem Essen serviert bekam und nicht mal zur Hälfte ausgetrunken hatte. Schließlich erhob sie sich und sagte etwas Unverständliches zu der Omahaften, die glücklicherweise auch aufgestanden war. Das wäre was gewesen, wenn die Alte allein an dem Tisch direkt neben mir zurückgeblieben wäre. Wahrscheinlich hätte ich einen Haufen Geld auf den Tisch gelegt und wäre Hals über Kopf aus dem Laden gestürmt. Denn vermutlich, so erging es mir schon des Öfteren, hätte mich die Alte angesprochen und versucht, mich in ein langweiliges Gespräch zu verwickeln. Schließlich saß ich ja alleine am Tisch, und auch die Alte hätte dort verlassen und verloren gesessen. Solche Situationen hasse ich. Ich rede dann den allerletzten Stuss. Da kommt kein gescheites Wort aus mir heraus, wenn mich Leute anquatschen, die ich zuvor beobachtet habe und die ich sowieso oder gerade deshalb gar nicht kennenlernen will.
Die Brünette zog ihre Jacke über und zwängte sich an meinem Tisch vorbei. Sie war so verdammt schlank und gelenkig, dass sie nicht die Spur klettern musste. Was für ein klasse Hintern, dachte ich, schlag mich einer tot! Er war nicht zu klein und nicht zu wuchtig. Unter dem enganliegenden eleganten Kleid zeichnete er sich apfelförmig ab. Mir hätte es die Sprache verschlagen, hätte ich etwas sagen wollen. Als die Brünette dicht an mir vorbei huschte, weil die Tische ja so verflixt eng aufgereiht standen, wehte ein Hauch ihres edlen Parfums zu mir heran, und eigentlich verbot ich es mir, ihr nachzublicken. Und dann, scheiß drauf! Selbst der Betonkopfkellner ohne Hals glotzte ihr drauf, der Idiot.
Ich war mir sicher, die hübsche Brünette verschwindet im nächtlichen Trubel Berlins, und ich würde sie nie mehr wiedersehen. Das dachte ich damals übrigens auch von Katja.
*
Wenn ich früher, als ich noch mit Katja zusammen war, Frauen hinterhergeblickt habe, missbilligte Katja das aufs Schärfste. In solch Situationen sagte sie grundsätzlich kaum etwas, höchstens mal ein Wort. Aber das hatte es dann auch in sich, also das Wort. Wie Pfeile konnte sie Wörter benutzen. Und wenn man sie daraufhin auch noch ansah, versprühten ihre wachen Augen Blitze. Für mich hatte das immer etwas Furchteinflößendes.
Katja kam mit zwei befüllten Gläsern zurück von der Küchenzeile und reichte mir eines. Ich legte das Plattencover auf den Fußboden, der übrigens nicht elfenbeinfarben war. Auch nicht grün oder gelb oder schwarz. Nein, der Fußboden bestand aus schnödem Kunststoff und war in bräunlicher Holzoptik auf alt getrimmt. Zwischen den Sesseln lag ein Hochflorteppich auf dem Boden. Natürlich war der elfenbeinfarben. Katja stieß ihr Glas an meins und trank ohne ein Prost, ein Zum-Wohle oder einen anderen Trinkspruch zu bemühen. Sie blickte mich lediglich an. Mindestens eine Sekunde zu lang.
Ich sage euch, der Wein war klasse, blumig und irgendwie spritzig und doch hatte er keine Säure oder sonst etwas Unwohlschmeckendes. Der Geschmack haute mich mindestens genau so um, wie es Katjas Beine taten. Ehrlich gesagt, haute mich das alleroberste Ende ihrer Beine, also ihr entzückender Arsch, am meisten um. Mit dem setzte Katja sich nämlich keineswegs auf den gegenüberstehenden Sessel, sondern auf die Lehne des Sessels, in den ich mich gelümmelt hatte. Ich dachte, warum setzt sich die Wahnsinnige nicht gleich auf deinen Schoß. Mir fiel nichts Besseres ein, als zu sagen:
»Was wird denn das?«, und ich muss dabei ziemlich bescheuert aus der Wäsche geguckt haben, als ich das sagte. Jedenfalls fragte Katja:
»Was soll es denn werden?«
Die Art, wie sie so lasziv und beinah flüsternd was soll es denn werden fragte, war eigentlich gar keine Frage. Es war eine Antwort. Und zwar eine Antwort, die sie sich längst selbst auf ihre Frage gegeben hatte. Vermutlich tat sie das, als sie den Wein öffnete, oder sie tat es schon draußen auf dem Gehsteig vor dem Tabakladen. Ich dachte, dass ich eigentlich gar nicht so recht weiß, wie ich darüber nun denken und was ich daraufhin antworten soll. Katjas was soll es denn werden gab mir dermaßen viel Spielraum für alle möglichen Vorstellungen, dass sich meine Synapsen überschlugen. Ich stotterte mehr, als dass ich sprach:
»Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn du erstmal diese Platte auflegst und ich dir im Anschluss vielleicht antworte.«
Ich war nervös, wollte mir aber nichts anmerken lassen und hob die Platte vom Boden auf. Mit den Nerven war ich nicht direkt am Ende, doch konnte ich nicht wirklich abschätzen, auf was ich mich einließ.
»Kein Problem. Nur auflegen musst du sie schon selbst. Und wie ich sehe, ist dein Musikgeschmack immer noch fabelhaft.«
Als Katja das sagte, deutete sie mit dem Kinn auf das Cover in meinen Händen. Dann schwang sie sich von der Sessellehne und meinte:
»Ich zieh mir mal etwas Bequemeres an, wenn Du nichts dagegen hast«, und verschwand in ihr Schlafzimmer.
Ich dachte, dass sie eigentlich schon recht bequeme Kleidung trägt, nämlich ein Shirt-ähnliches Oberteil mit weiten Ärmeln und dazu den Rock. Ihr Rock war bestimmt bequemer als meine Hose. Und was sollte ich dagegen haben, wenn Katja sich umzieht, fragte ich mich. Schließlich ist es ihre Wohnung und da kann sie anziehen und tun oder machen, was immer sie will.
Katjas Wohnung war noch winziger, als es damals unsere gemeinsame war. Den Mittelpunkt stellte der Wohnraum dar, wo ich mich an der HiFi-Anlage zu schaffen machte, um die Scheibe der Counting Crows aufzulegen. Katja besaß noch einen der Plattenspieler aus den Achtzigern mit analoger Technik, bei dem man mit einem kleinen Hebel den Tonarm mit der Nadel manuell auf die Rille setzen muss.
Vor der Küchenzeile standen ein kleiner Tisch und zwei Stühle, hinter dem Plattenregal die beiden Sessel und eine Couch. An der gegenüberliegenden Wand hing ein Flachbildfernseher. Durch den kleinen Flur, der genau so winzig und schmal war, wie der Vorratsraum meines Elternhauses, in dem die riesige Truhe stand, erreichte man das Bad und das Schlafzimmer. Ich dachte, mir wäre das entschieden zu wenig Platz. Ich muss mich ausbreiten und in den eigenen vier Wänden wenigstens ein paar Schritte gehen können.
Nachdem Katja und ich uns getrennt hatten, zog ich in ein freistehendes Einfamilienhaus. Ich hatte damals die Schnauze voll von langweiligen Leuten in Nachbarwohnungen, von Treppenhäusern und vom ganzen irrsinnigen Leben in der Stadt. Das Haus, in dem ich wohne, kaufte ich nach der Trennung. Es liegt in einem Kaff am Salzhaff, eine gute halbe Autostunde von Wismar entfernt. Genau wie die alte Hansestadt liegt auch das kleine Dorf direkt an der Ostsee. Mecklenburg-Vorpommern ist zwar nicht New York, Kalifornien oder Florida, keine Frage. Trotzdem hatten weder Katja noch ich es schlecht getroffen, denn beide mochten wir das Meer mit all seiner verführerischen Endlosigkeit.
Zu Fuß ist man in weniger als zehn Minuten am Wasser. Mein Haus stellt kein riesiges Anwesen dar. Ich bin auch kein Millionär oder ein adeliger Vonundzu und wohne in einem stinknormalen Haus mit Unter- und Obergeschoß. Rundherum ist es mit roten Klinkersteinen verblendet. Es hat ein Reetdach, weil diese Dächer in der Gegend bei vielen Häusern üblich sind. Das, was ich an meinem Haus am meisten mag, ist, dass es, im Gegensatz zu Katjas Oberwohnung, einen Garten hat. Katja und ich wohnten also nach der Trennung nicht weit voneinander entfernt. Und doch trennten uns Welten.
*
In Berlin war es spät geworden, und das gemütliche Restaurant leerte sich zunehmend. Der Tisch, an dem eben noch die Brünette in ihrem wahnsinnig eleganten Kleid auf ihrem Apfelhintern gesessen hatte, wurde nicht nachbesetzt. Dem Gigolo-Kellner signalisierte ich, er möge die Rechnung bringen. Und er kam damit hundert Mal schneller angetrabt, als er es mit dem Wein zu werke brachte. Der Kellner spendierte noch einen Grappa.
Wirklich lecker war der nicht, und ich ließ mir Zeit, das Teufelszeug auszutrinken.
Eigentlich, wenn ich mal nicht zu dem Befummler und seiner Schnecke herüberguckte und mich wegen des Grappas nicht beinah hätte übergeben müssen, hatte ich große Lust auf Sex. Den kann man in Berlin fast überall kaufen, was kein wirkliches Geheimnis ist. Aber ich dachte, es sei nicht passend, für Sex zu bezahlen, wo ich doch klassische Musik in einem gemütlichen Restaurant gehört und wirklich vornehme Speisen gegessen hatte. Außerdem hatte ich den Abend neben dieser eleganten Wahnsinns-Brünetten verbringen dürfen. Sie ging mir nicht aus dem Kopf.
Ich überlegte, ob sie vielleicht eine Professionelle war. Doch ich verwarf den Gedanken, denn keine Hure auf dieser Welt hat so verflucht funkelnde Augen. Und als ich das dachte, war ich um weit mehr als hundert Euro ärmer, schon wieder raus aus dem Restaurant und stand rauchend auf dem Gehsteig.