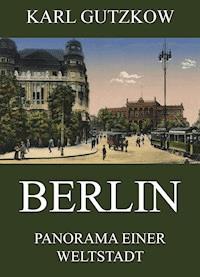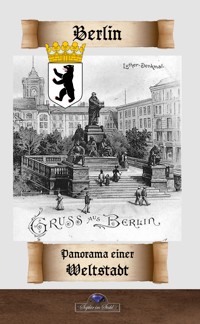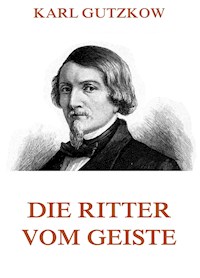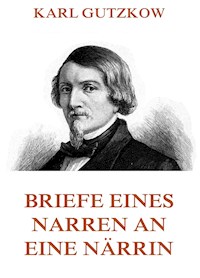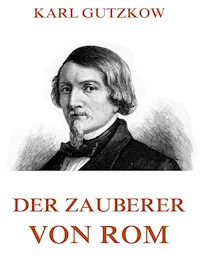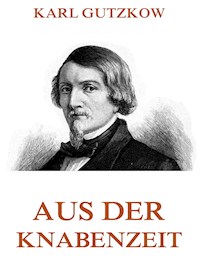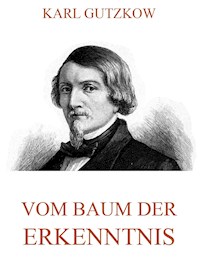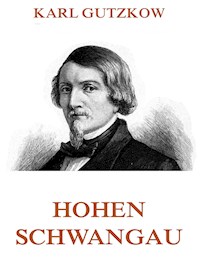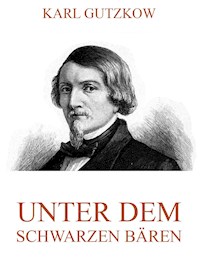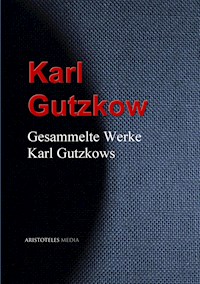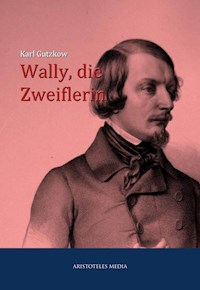Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Arthur, wie kalt ist diese Nacht und Sie haben keinen Druck für meine Hand. Julie, ich bin in diesem Augenblick nur der Umriß eines Mannes. Eifersucht quält mich nicht, Arthur. Sie vergeben mir meine Vergangenheit; drum darf ich auch keine Rechenschaft von der Ihrigen fordern. Wie es regnet draußen! Das Wetter klatscht an die klappernden Wagenfenster. So heimlich dieser enge Raum, Arthur! Mögen Sie Seraphinen geliebt haben oder noch lieben: gehören Sie doch wenigstens jetzt mir! Sie sind still, so wehmütig. Wenn Sie keine Umarmungen für mich haben, so schlagen Sie Ihre Biographie auf! Wer ist diese Seraphine? Sie müssen sich beide kennen. Sie antworten nicht? Kein Stern am Himmel. Die Laterne des Wagens zeigt nur die abdorrenden Kleider der Bäume, und noch ist die Traube nicht einmal vom Stock gelesen. Ach, diese nächtliche Philosophie, Arthur, ist kein Ersatz für Ihre Zärtlichkeit! Es wäre doch entsetzlich, wenn ich einschlafen müßte. Erzählen Sie von Seraphinen? Wer ist sie?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl Gutzkow
Seraphine
Roman
1837
idb
Widmung.
– – – beiläufig: Weil Du zu denen nicht gehörst, welche vom Dichter verlangen, daß er ihnen die Motive und Contraste gleich wie Sporen in die Weichen ritzt, und Du weder Hinko noch Notre Dame de Paris liebst; so empfehl' ich Dir Seraphinen! Du weißt, wie lange sie in C–s Pulte lag, und wie viel sie in den Paßbüreaux der Censur zu leiden hatte. Sie ist zwei Jahre alt! Ich hatte sie längst aufgegeben und erschrak fast, als ich sie wiedersah. – Da ich durch die Freiheit, die ich mir in der Wally nahm, um meine eigne kam und bei dem Geräusch, was die Unglückliche machte, wie aus einem Traume auffuhr; wußt' ich kaum, was mich so eilig trieb, Seraphine zu schreiben. Sie war zum größeren Teile vor der M–r Episode fertig. Ich hebe dies so dringend hervor, weil ich weiß, wie schüchtern diese Arbeit ist, wie farblos sogar, jedenfalls nach heutigem Geschmack wie allzuidyllisch, und weil ich doch nicht möchte, daß man sagte, es wäre die Not gewesen, die mich beten gelehrt hätte. Ließe man doch nur Jeden seinen eigenen Weg gehen! Ist er auf einem Felsenvorsprung angekommen, wo er nicht mehr weiter kann als durch einen Sprung auf Leben und Tod; er wird schon wieder zurückkehren und auf andrem Wege zur grünen Matte zu gelangen suchen, nach welcher sich sein Auge sehnt! Ich habe Seraphinen aus eigenem Bedürfnis geschrieben, um wieder zu mir selbst zu kommen; nicht der äußern Gewalt der Umstände, sondern der innern Gewalt des Herzens weichend. Ich wollte beweisen, daß der in mir waltenden Gedankenzeugung nicht in dem Grade, als ich dafür verrufen bin, die weibliche Seite fehlt. Objektiv etwas geleistet zu haben, darauf verzicht' ich; ich zweifle, ob Andre, die nicht so nachsichtig sind, wie Du, den Roman mit so vielem Vergnügen lesen werden, als ich beim Schreiben empfand. Ich wünsche auch – aber man hat gut wünschen! –
*
Erstes Buch.
Eine Staubwolke ließ auf der Höhe der Landstraße die Ankunft eines Reisewagens signalisieren. Dies war für die kleine, öffne Stadt keine Neuigkeit mehr, seitdem Madame Lardy die ländliche Abgeschiedenheit derselben zur Anlage einer weiblichen Erziehungsanstalt benutzt hatte. Madame Lardy war eine Deutsche von Geburt; aber sie behauptete, eine französische Schweizerin zu sein. Als Gouvernante hatte sie ihre Laufbahn in verschiedenen adligen Häusern begonnen, wo ihre mittelmäßige Kenntnis der französischen Sprache schon für hinreichend genommen wurde, die weibliche Jugend mit den notwendigsten Reisepässen für das öffentliche Leben zu versehen. Dann hatte Madame Lardy eine Periode in ihrem Leben, welche etwa fünf Jahre dauerte und niemals recht aufgeklärt worden ist. Wenn sie im Winter beim Schimmer der Sinumbralampe ihren Zöglingen die Schicksale ihres früheren Lebens erzählte, richtete sie an dieser Stelle immer eine Verwirrung von der Art an, wie sie an den Strickstrümpfen ihrer Pensionärinnen so oft von ihr getadelt wurde. Sie ließ hier nämlich gleichsam einige Maschen fallen, und verprudelte, wie sie zu sagen pflegte, ihre eigene Lebensgeschichte. Endlich hatte sie wieder den rechten Faden gefunden, sprach von großen Geldsummen, Protektionen und zeigte dann rings herum die Vollmacht der Behörde, welche ihr gestattete, in der kleinen Landstadt eine Erziehungsanstalt für Töchter gebildeter Stände zu errichten. Madame Lardy erzählte dies immer im schlechtesten Französisch; denn es wär' ihr dabei, sagte sie, weniger um ihre Biographie als um die Conversation zu tun.
An dem Tage, wo sich die große Staubwolke auf der Landstraße sehen ließ, feierte Madame Lardy gerade, wie sie behauptete, ihren ein- und vierzigsten Geburtstag. Auf allen Tischen des Zimmers prangten Geschenke, welche ihr die Dankbarkeit der Zöglinge verehrt hatte. Wo man nur hinsahe, da hatten ihr die kleinen zarten Hände etwas genäht, gestickt oder gehäkelt. An Tassen, Silbergeschirr, kupferne Theekessel, an alles knüpften sich die Erinnerungen von herrlichen lieben Geschöpfen, die jetzt nach allen Enden der Windrose hin verheiratet waren. Man denke nur nicht, daß Madame Lardy eigennützig war! Freilich nahm sie Alles, was sie bekommen konnte, aber nur aus pädagogischer Rücksicht. »Ich habe« sagte sie; »nur die Entwickelung der moralischen Eigenschaften meiner Zöglinge im Auge. Solche Geschenke der Liebe soll man nicht zurückweisen, weil sie ein edles und tugendhaftes Gemüt verraten. Das kleinste Kind würde ohne Philosophie behandelt werden, wenn man das Brot verschmähte, welches es in unsern Mund steckt. Wir sollen anbeißen und uns nicht sträuben. Ein solches Kind wird nie begreifen, wie es möglich ist, daß man zu ihm sagt: »behalte nur!« Man sieht, Madame Lardy hatte Maximen, die nahe an die Ideen Rousseaus streiften.
Jetzt rasselte der große Wagen schon in der Stadt. Die jungen Mädchen sprangen von ihren Arbeiten im Nebenzimmer auf und drängten sich an die Fenster. Madame Lardy blieb auf dem Sopha. »Es ist vielleicht Deine Mutter, Auguste; oder Deine Tante, Jenny; oder Dein Großonkel, Minna!« Im Stillen aber dachte sie: »vielleicht bekomme ich eine neue Schülerin!« Henriette, ein etwas altkluges Mädchen von fünfzehn Jahren bemerkte: »Sehen Sie nur, Madame Lardy, wie neugierig Alle sind!« Aber Madame Lardy, weit entfernt in diesen Pedantismus einzustimmen, versetzte: »Ich liebe diese natürliche Empfindung der Neugier, die andere Erziehungen zu unterdrücken pflegen. Ich bin gewohnt, in den Seelen der Jugend die Rückhalte zu zerstören, jene Reste gehemmter Eigenwilligkeiten, die nur die Veranlassungen zu versteckten Charakteren sind.« Während Madame Lardy dies sprach, rechnete sie im Stillen nach, wohin sie das Bett des neuen Ankömmlings stellen solle, ob er ein silbernes oder goldenes Besteck mitbringen würde, wieviel sie gewinnen könnte, falls der neue Zögling die Englische Stunde mitnähme, diese Englische Stunde, für welche sich bis jetzt erst zwei ihrer Schülerinnen entschlossen hatten, und die ihr so viel Honorar kostete! Dabei saß Madame Lardy auf dem Sopha, ein Bild der Resignation, frei von allem Eigennutz, lächelnd über die Neugier der kleinen Demoiselles, die ihr alles verrieten. Jetzt lenkt der Wagen ein, hieß es; er sucht die Hausnummer: ein Herr sitzt drin, und zwei Damen, zwei Schwestern vielleicht oder zwei Cousinen; jetzt hält er still. Ne faites pas de sottises! rief Madame Lardy, vom Sopha aufspringend, und ihre Philosophie vergessend. Prenez-vos places! Travaillez, travaillez! Silence, silence! Mon Dieu, mon Dieu!On frappe, n'est-ce-pas? Herein!
Die Besuchenden waren eine Dame, so blühend und jung, daß man in ihrer kleinen Begleiterin schwerlich eine Tochter geahnt hätte. Der junge Herr, welcher Beide führte, konnte weder ihr Sohn, noch wie es schien ihr Bruder sein. Sie kamen aus der Stadt, sie hatten entschiedene, abgeglättete Manieren, und sahen auf das, was sich ihnen hier darbot, mit vornehm lächelnder Teilnahme herab. Die Kleinsten unter den jungen Mädchen blieben stehen und blickten munter und ohne Scheu in das Auge des jungen Mannes; die Älteren aber flohen in das Nebenzimmer und wurden rot über eine Verlegenheit, für welche sie selbst noch keinen Namen hatten. Dem jungen Manne schienen diese Szenen neu und merkwürdig. Er machte Miene, nach der ersten Begrüßung sich in das Nebenzimmer zu verfügen, aber ein ernster Blick der Dame, die er geführt hatte, zwang ihn an ihrer Seite zu bleiben und an dem ceremoniösen Gespräche Teil zu nehmen, welches sich schon zwischen Madame Lardy und der Gemahlin des Ministers von Magnus entsponnen hatte.
»O ich ahn' es«, rief Madame Lardy aus, indem sie das kaum dreizehnjährige Kind einer schöneren Mutter umarmte, »Excellenz wollen diese engelreine Unschuld meiner Obhut anvertrauen?«
»Sie verzeihen«, sagte Frau von Magnus; »daß ich für meine Antonie ein Herz in Anspruch nehme, welches, wenn ich mich entschließen soll, die Erziehung meiner Tochter in fremde Hand zu geben, so empfinden müßte, wie ich selbst.«
»Ich hoffe, gnädige Frau;« erwiderte Madame Lardy, indem sie mit feinem Lächeln die Augen niederschlug; »daß Sie nicht der Zufall in mein Haus führt. Fromme Töchter, treue Gattinnen hab' ich erzogen. Was Sie hier um mich sehen, ist meine Welt. Ich bin eine alte, aber schattenreiche Ulme, an welche sich die zarten Schlingpflanzen meines Hauses aufranken. Zuletzt kenn' ich die Convenienz nicht, ich kenne nur die Tugend.«
»Erziehen Sie nach einem Systeme?« fragte der junge Mann.
»Nein, mein Herr«, sagte Madame Lardy, »ich habe eine Methode, aber kein System.«
»Sie lesen Pestalozzi, wohl auch Rousseau?« fuhr der junge Mann fort, indem sich Frau von Magnus mit schönem, aber boshaftem Lächeln auf die Lippen biß.
»Ich las Alles«, erwiderte Madame Lardy keck; »was von ausgezeichneten Denkern über die wichtigste Angelegenheit der Menschen geschrieben ist. Aber glauben Sie mir, ich bin bald von jenen abstrakten Vorschriften zurückgekommen, für welche es oft eben so sehr an den Lehrern wie an den Zöglingen selbst fehlt. Die ächte Pädagogik ist eine Naturgabe, die wie ein geheimer Aether dem Charakter des Lehrers entströmen muß. Für die Erziehung muß man geboren sein. Glauben Sie mir, daß viel gute Menschen durch die Principien, die besten aber durch den bloßen Umgang erzogen sind.«
Im Nebenzimmer lachte man. Augenscheinlich waren diese Phrasen dem Ohre der Pensionärinnen schon so bekannt, daß sie von ihnen immer den Eindruck einer Comödie hatten. Frau von Magnus hatte darauf im Geheimen mit Madame Lardy die Bedingungen der Aufnahme zu stipuliren. Man hörte sehr deutlich, daß von der Englischen Stunde die Rede war. Antonie und der junge Mann ergriffen diese Gelegenheit, sich in das Nebenzimmer zu begeben, wo die Einen in Kreide zeichneten, die Andern auf Stramin arbeiteten, aber nach malerischen Mustern.
»Sie haben Zeichenstunde?« fragte der junge Mann. Keine wollte eigentlich antworten; doch sagten zehn Stimmen auf Einmal ein ganz einfaches, kindisches Ja! Dann wurden sie Alle rot und fuhren still in ihrer Arbeit fort.
»Wo ist aber der Lehrer, der Ihnen den Unterricht gibt?«
Jetzt schwiegen Alle; da sie sich aber schämten, daß sie es taten, so sagte die Eine: »Herr Meyer ist von der Treppe gefallen.« Kaum hatte sie dies gesagt, als die Übrigen mit lautem Lachen einfielen, einmal deshalb, weil Auguste den Mut gehabt hatte, sieben Worte vor einem Fremden zu sprechen, sodann aber, weil – wahrscheinlich Herr Meyer eine komische Figur war. Jetzt folgten die satyrischen Bemerkungen Schlag auf Schlag: »Herr Meyer hat sich den Arm verstaucht.« »Herr Meyer springt immer wie ein Wiedehopf.« »Herr Meyer ist über seinen Zopf gestolpert.« Weiter brachten sie es aber nicht. Sie lachten nur noch. Ihr gutes Herz machte, daß sich ihre Satyre schon erschöpft hatte.
Der junge Mann war im besten Zuge, diese Unterhaltungen fortzusetzen; aber Frau von Magnus nahm seinen Arm und ließ sich durch die verschiedenen Zimmer führen, welche zu Madame Lardys Lokalitäten gehörten. Sie stiegen zwei Treppen höher, wo die Betten der Rosenknospen standen und auch Antoniens Zelle sein sollte. Als sie auf dieser Wanderung eine Tür nach der andern aufklinkten, stießen sie auf ein kleines Erkerzimmer, das Madame Lardy ebenfalls öffnete, ohne zu wissen, wer darin war. Sie hatte kaum den Kopf hinein gesteckt, als sie sich zurückbog und mit den Worten: »Ach, Sie sind hier, Fräulein Seraphine!« die Tür wieder schloß. Frau von Magnus bemerkte, daß sich die Gesichtsfarbe ihres Begleiters bei diesem Namen plötzlich veränderte. Sie wurde aufmerksam, als sie überhaupt den heftigen Eindruck und das Stillschweigen gewahrte, in welches der junge Mann verfiel. »Wer ist Fräulein Seraphine?« fragte sie Madame Lardy. »Eine meiner Lehrerinnen«, antwortete diese; »ein tiefes Wesen vom lieblichsten Gemüte, ganz geschaffen, auf die Jugend einzuwirken. Sie werden sie heut Abend sehen, wenn Sie uns die Freude gönnen und unserm kleinen Balle beiwohnen. Sie bleiben doch bis zum nächsten Morgen in meinem Hause?«
Frau von Magnus besann sich und sagte: »Das wohl nicht; wir werden die Nacht hindurch fahren; aber den Ball müssen wir sehen.« Ihr Begleiter wollte Einwendungen machen. Sie fixirte ihn aber scharf. Sein ganzes Benehmen schien vom tiefsten Nachdenken und sogar von Furcht beherrscht.
Gegen Abend zündete man unten einen kleinen Kronenleuchter an, welcher an der Decke des großen Arbeitszimmers der Pension hing. Der Tanzmeister erschien, die Violine unterm Arm. Es war eine kurze, wohlbeleibte Figur, Krauskopf mit grellen Augen. Alle seine Bewegungen schienen von einem inwendigen Orchester geleitet. Apoll und Merkur zu gleicher Zeit, schwebte er in den Saal hinein. Dem Balle gingen erst einige theoretische Übungen voraus, Wiederholungen schwieriger Pas, um die kleinen Füße erst in die richtige Bewegung zu bringen. »Denn« sagte Madame Lardy; »es ist in der Erziehung nichts schwerer, als jenen Übergang zu vermitteln von den Vorschriften der Schule zur Freiheit seiner eigenen originellen Bewegung. Ich wüßte nicht, was die entsetzliche Schüchternheit und Angst, welche man vor dem ersten Tanze auf dem ersten Balle, den man in seinem Leben besucht, empfindet, besser vertriebe, als dieser Ernst, mit dem wir beginnen, und diese Heiterkeit, mit der wir schließen werden.«
Über wie Vieles hätte sich Frau von Magnus jetzt nicht gern moquirt; aber ihr Begleiter saß zerstreut vor einem Spiegel und betrachtete darin die Tür, welche sich öffnen sollte, um ihm über Seraphinen Aufklärung zu geben. Seine Leichtfertigkeit hatte ihn verlassen. Die kleinen naiven Mädchen mit ihren graziösen Bewegungen zu einer alten gekratzten Geige, regten seine Empfindungen nicht mehr auf. Frau von Magnus, die Seraphinen fast vergessen hatte, war erschrocken über eine Indolenz, die sich hier vor einen Spiegel setzen konnte und keinen ihrer Blicke mehr zu verstehen schien.
In demselben Augenblicke, als dasjenige, was hier Ball genannt wurde, beginnen sollte, öffnete sich die Tür und eine weißgekleidete Dame trat herein, mit schönen, aber blassen Zügen. Sie glich einer Göttin, die in der Fabel erscheint und mildernd und versöhnend die aufgeregten Leidenschaften beschwichtigt. Ein sanfter Ernst lag auf der hohen glänzenden Stirn. Den Mund verzog ein innerer Schmerz in eine etwas krampfhafte Lage, welche aber nur der Vorbote irgend eines Entschlusses zu sein schien und hiedurch gemildert wurde Das dunkelbraune Haar war einfach gescheitelt und verlor sich auf das Anspruchloseste in zwei Ringellocken hinter dem Ohre. Alles schwieg, als diese Gestalt eintrat. Madame Lardy flüsterte ihrem Gaste zu, daß dies Demoiselle Seraphine wäre.
Frau von Magnus erwiderte nur halb den ihr von der jungen Lehrerin dargebrachten Gruß. Sie hatte ihren Begleiter im Auge, der bei Seraphinen's Eintritt aufgesprungen war und sich mit dem Rücken an das Fenster lehnte. Sie sahe, was zwischen Beiden vorging. Seine Blässe, seine Unruhe, sein Verstummen und auf Seraphinen's Antlitz die leise Röthe, ihre wogende Brust, ihr verlegenes Lächeln, der ganze Schmelz einer durch Freude und Schmerz hervorgebrachten Verklärung – sie mußten sich kennen.
Seraphine hatte eher Gelegenheit, von ihrer Überraschung befreit zu werden; denn die Zöglinge drängten sich an sie, umschlangen ihren Leib, bogen ihren Kopf herunter und liebkosten sie. Sie wies lächelnd diese Gunstbezeugungen zurück, erwehrte sich ihrer aber erst, als der Tanzmeister seine Geige strich und die Paare zusammentreten sollten. Da brachten die jungen Mädchen einen Myrtenkranz herbei, mit dem man sie schmücken wollte. Sie hatten ihn heute Madame Lardy geschenkt, die, obschon sie als Frau bezeichnet wurde, doch niemals verheiratet war und den Kranz mit einem Erröthen empfangen hatte, das keine der jungen Damen verstand. Seraphine gab den Kranz Antonien und sank dann, wie von einem innern Schmerz überwältigt, auf einen Sessel zurück, wo sie vor den tanzenden Paaren sicher war.
Einer so feinen Beobachterin, wie Frau von Magnus war, entging von diesen Gemütszuständen Nichts. Eifersucht oder Neugier ergriff sie. Sie schreckte ihren in Träume versunkenen Begleiter auf, umarmte ihr Kind, umarmte Madame Lardy, und schied mit einer Phrase, die ungefähr so viel sagen sollte, als: »Madame, ich lasse Ihnen hier mein Theuerstes. Von Ihnen fordr' ich es wieder zurück. Es ist ein Engel, machen Sie ein menschliches Wesen daraus! Sie lerne Französisch! Sie lerne Englisch! Sie lese den ganzen Schiller, Göthe mit Auswahl, aber Nichts von Jean Paul, weil mir das sentimentale Genre fatal ist. Seyen Sie nicht zu verschwenderisch in der Kost, sehen Sie auf gute Haltung und geben Sie nicht zu, daß sie beim Tanze ohne Erregung bleibt. Denn will man beim Tanze die Gesundheit erhalten, so müssen die Lungen freien Lauf haben. Man muß tiefen Atem holen dürfen und Sie müssen das Heben der Brust eher begünstigen als hemmen. Und Du, Antonie, mein Kind, mein einziges Kind, lebe wohl!«
Antonie blieb kalt, wie ihre Mutter. Aber Madame Lardy weinte, und geleitete den Besuch bis an den Wagen. Eine männliche Gestalt sprang vom Hause zurück in die dunkle Nacht, als sie unten waren. Der junge Mann flüsterte: »Ich glaube gar, das war Philipp.« Die Übrigen sahen nichts und schieden. Noch hörte man den Wagen rasseln, als Madame Lardy schon ihr Büreau aufgeschlossen und sich an ihre Bücher gesetzt hatte, um viel, sehr viel zu rechnen mit benannten und unbenannten Zahlen.
*
Arthur, wie kalt ist diese Nacht und Sie haben keinen Druck für meine Hand.
Julie, ich bin in diesem Augenblick nur der Umriß eines Mannes.
Eifersucht quält mich nicht, Arthur. Sie vergeben mir meine Vergangenheit; drum darf ich auch keine Rechenschaft von der Ihrigen fordern.
Wie es regnet draußen! Das Wetter klatscht an die klappernden Wagenfenster.
So heimlich dieser enge Raum, Arthur! Mögen Sie Seraphinen geliebt haben oder noch lieben: gehören Sie doch wenigstens jetzt mir! Sie sind still, so wehmütig. Wenn Sie keine Umarmungen für mich haben, so schlagen Sie Ihre Biographie auf! Wer ist diese Seraphine? Sie müssen sich beide kennen. Sie antworten nicht?
Kein Stern am Himmel. Die Laterne des Wagens zeigt nur die abdorrenden Kleider der Bäume, und noch ist die Traube nicht einmal vom Stock gelesen.
Ach, diese nächtliche Philosophie, Arthur, ist kein Ersatz für Ihre Zärtlichkeit! Es wäre doch entsetzlich, wenn ich einschlafen müßte. Erzählen Sie von Seraphinen? Wer ist sie?
Sie verdienen diese Biographie nicht.
Warum?
Sie sind kalt, Julie, Sie haben kein Herz. Sie haben nur Eitelkeit. Sie lieben, weil Sie nur Andere, nicht sich besiegen können. Sie würden lachen, wenn Sie zu dem Triumphe, den Sie über meine Gegenwart feiern, noch den über eine Vergangenheit fügen könnten, welche Sie niemals verstehen werden.
Arthur, ich will ganz still sein. Ist es eine Idylle aus den Schuljahren, so werd' ich wahrscheinlich über Ihre Tränen lachen müssen, aber ich will Sie's nicht hören lassen. Erzählen Sie nur; schon Ihre Worte sind Musik für mich.
Nun denn, meine arme, gute Seraphine: ich will von Dir erzählen, nicht daß ich eine egoistische Seele um die Nacht betrüge, sondern ich will laut an Dich denken. Ich will alte vernarbte Wunden wieder aufstechen und das Gras faserweise ausrupfen, was über mein grausames Gedächtnis gewachsen ist.
Also?
Ich verließ die Schule, und fiel mit einer wahren Hast über alles her, was meinen Geist und mein Herz bereichern konnte. Ich war noch rein und fromm in meinen Gefühlen, ich war ehrgeizig, aber nicht anders, als in der Absicht, mich dem Allgemeinen zu opfern, mein Ehrgeiz zerfloß in das blaue Licht meiner Ideale. Aber der Zwiespalt zwischen Herz und Welt nagte schon früh an meinem Leben. Ich wollte für jenes Eroberungen machen, und konnt' es doch nur, wenn ich diese aufgab. Ich wollte mich in das Verständnis der Begebenheiten, lernend und teilnehmend, werfen, und konnt' es wieder nur, wenn ich meinem Herzen keine Fesseln anlegte. Das Opfer dieses Zwiespaltes sah' ich heute nach langer Trennung wieder.
Im achtzehnten Jahre bezog ich die Universität. Meine Studien waren unglücklicherweise von der Art, daß ich hätte voraussehen sollen, wie ich sie allmählig aufgeben, wie ich aus einer Region in die andere hinüberschweifen würde. Ich muß diese ewige Metamorphose meines Ichs, diese unaufhörliche Erweiterung meiner Ideenkreise festhalten, um mich in den folgenden Begebenheiten von einer Seite wenigstens rechtfertigen zu können. Da traf ich in einem Cirkel, den ich zu besuchen pflegte, in einem Vereine von jungen Leuten, die sich im Gesange übten, ein Mädchen, dessen frische, blühende Erscheinung mich bezauberte. Augustens rosige Wange, ihr dunkles Haar, ein tiefblaues Auge, quellende und mit dem Netz einer durchsichtigen Haut umsponnene Formen riefen meine Neigung wach. Das war keine krankhafte Stimmung, sondern ein gesundes Verhältnis, dessen glücklicher Fortschritt mich wahrscheinlich in eine ganz veränderte Lebensrichtung geworfen hätte. Auguste sang schlecht; das machte sie mir nur um so lieber, weil natürlicher. Auguste hatte keine besonders originellen Ideen, einen Reiz, den die erste Liebe, die nur Liebe will, nie vermißt. Ich näherte mich ihr, so weit es ging. Sie war spröde, gleichgültig, sie trug, wie ich später hörte, um dieselbe Zeit eine flüchtige Neigung in sich, der sie schon treu war, und die sie sich doch kaum gestanden hatte. Meine Bewerbungen gingen an ihrem Herzen spurlos vorüber, und wurden selbst von einer Eitelkeit, die sie demnach kaum zu haben schien, nicht bemerkt. Ich hörte einstweilen wieder auf, nach ihrem Beifall zu geizen.
Es war Charfreitag. Ich hatte ein erstes Baßsolo übernommen, das in einer Kirche gesungen werden sollte. Die ganze Gesellschaft, von der ich eben sprach, führte eine geistliche Musik auf. Am grünen Donnerstage hatten wir die erste und letzte Probe. Ich weiß es nicht, war es schon hier, oder erst am folgenden Tage, wo ich Seraphinen kennen lernte. Die Gesellschaft wandelte auf dem Kirchhofe, der das Gotteshaus umschloß. Die jungen Mädchen, alle in festlichen Kleidern, lasen die Inschriften auf den Leichensteinen, und setzten sich dann auf sie, ohne indes besondere Todesgedanken zu nähren. Nur ein Wesen schien von dem stillen Frieden, der über diesen, teils verfallenen, teils frischen Gräbern wehte, mächtig ergriffen zu sein. Mich zog dies an, aber ich weiß nicht, ich glaubte dennoch darin eine Art Koketterie zu erblicken; denn schon damals regte sich vielleicht in mir jener Gefühlsterrorismus, mit dem ich mich selbst und meine Umgebungen allmählig zu tyrannisiren begann. Mein ganzes Leben wurde damals Polemik gegen den Schmerz, von dem ich glaubte, daß er sich immer mit dem Egoismus verbände und eine in offenbare Wollust der Gefühle ausarten könnte. Ich hatte die Erfahrung gemacht, daß sich diejenigen Menschen, welche leiden, besser vorzukommen pflegen, als die Fröhlichen, und haßte darum die Schwelgerei im Schmerze mit dem ganzen Rigorismus, den junge Männer besitzen, wenn sie zum ersten Male nach ihren eigenen Prinzipien zu leben anfangen.
Seraphine war blaß, ihre Stirn frei, ihr Antlitz oval. Dem Teint mangelte Reinheit, selbst das Schönste was sie besaß, das Profil einer griechischen Nase hatte die launische Natur gestört, indem sie nach einem Falle, eine etwas unregelmäßige Neigung bekam. Keines der übrigen Mädchen war bei Allem, was sie taten, mit soviel Seele zugegen. Aber es schien mir, als spränge Seraphine immer in die Extreme über. Bei ihr wurde die tiefsinnigste Trauer vom ausgelassensten Scherze abgelöst, so daß ich jedenfalls anfing, diese Originalität zu beobachten.
Wir sprachen vom Tode, aber steinerne Schmetterlinge auf den Gräbern trösteten unsern Schmerz, weil wir an Unsterblichkeit glaubten. Ach, hier knickte der Sturm des Lebens ein junges Frühlingsreis, ein Kind, das kaum hinaufreichte, seinen Vater zu küssen: dort lag eine Mutter mit ihrem Säuglinge. Unter einer Trauerweide barg sich das schmerzliche Drama einer einzigen Woche, das ich selbst erlebt hatte und sich in diesem Verse aussprach:
Weil es sich sanfter, schläft, vom Arme der Liebe gekettet. Ging dem sterbenden Kind sterbend die Mutter voran.
Dies Epitaph ergriff um so mehr, da es von mir war, und Seraphinen's Tränen, die ich sonst verdammt hätte, störten mich diesmal nicht. Sie blickte mich mit ihrem großen blauen Auge an, als schien sie in meiner Seele lesen zu wollen, vielleicht ob ich eine Reminiscenz oder etwas aus mir selbst Gebornes in jenem Verse gegeben hätte. Denn nichts bindet die Seelen so fest, als wenn ein Weib vom Manne ahnt, daß er Tränen zu vergießen fähig ist.
»Dies sind die einzigen Verse, die von mir auf die Nachwelt kommen werden«, sagte ich und sie entgegnete, »ob ich auch sonst Dichter wäre?« Diese im Grunde witzige Frage ärgerte mich; denn ich sah darin schon wieder Egoismus und glaubte, ein ganzer Federbusch von Koketterie winke und nicke mir aus ihrem Benehmen zu. Deshalb brach ich schnell ab und lief in die Kirche, um mein Solo: »Weinet nicht, es hat überwunden der Löwe«, aus dem Tod Jesu zu singen.
Ich hatte Seraphinen vergessen. Meine Studien absorbirten mich, auch meine Freundschaften, welche sogar in untersagte Verbindungen ausarteten. Am nächsten Himmelfahrtstage jedoch war es, wo ich sie wieder sprach. Die Gesellschaft hatte in zwei großen Wagen eine Partie auf's Land gemacht, einige Meilen weit: ich konnte mich nicht zurückziehen.
Auf Seraphinen besann ich mich nur dunkel. Sowohl ihre äußeren Formen, wie ihre Manieren hatten sich meinem Gedächtnisse nur obenhin eingeprägt. Auch war sie heute nur Scherz, potenzirte, fast aufgeschraubte Lustigkeit, die den Humor der Übrigen weit hinter sich ließ. Auguste war es wieder, die mich eifrigst beschäftigte. Alle meine Gedanken und im Spiele meine listigen Pläne gingen darauf aus, mich ihr wie eine Blüthenflocke dem Haare einzunesteln, so daß ich ihr, wenn sie sich des Nachts ihr Haar absteckte, gleichsam als der ganze Rest eines durchlachten und durchscherzten Tages in den Schooß fiel. Aber Auguste war kalt, fast mißtrauisch gegen mich. Denn mein ganzer Anteil an dem Feste war doch nie recht im Mittelpunkte desselben, ich durchkreuzte es nur und daraus nahm sie vielleicht ab, daß ich exzentrisch war.
So saß ich auch abgesondert von den Übrigen, still und betrübt in mich versunken, unter einem Fliederbaum, der das von uns besuchte Bauernhäuschen beschattete. Vom Kaffee waren Milch und Zuckerreste übriggeblieben, an denen auf dem Tische sich die Fliegen sättigten. Ich war erschöpft. Das Reifwerfen, Ballschlagen und Schwarzermannspielen, dacht' ich, ist eine Torheit für einen Helden wie du, der sich einbildet, das Jahrhundert erwarte ihn! Was würden die Stoiker, meine altdeutschen Freunde, sagen, wenn sie mich hier mit Weibern Versteckens spielen sähen? In diesem Augenblicke stand Seraphine vor mir. Sie hatte den Mut, einen Mann anzureden, der sie vernachlässigte. Ich sehe sie noch, wie sie sich an den Fliederbaum lehnte, die Hände zurückgeschlagen, ganz nachlässig, siegreich sogar auf mich herabblickend, fein lächelnd, plötzlich doch eine Erscheinung geworden, die mir auffiel. Wir sprachen allerdings nur von Halsweh, (sie klagte darüber) von isländischem Moos, wollenen Strümpfen; aber ihre soliden Bemerkungen zogen mich an, mehr noch, als einige Stellen aus Tiedges Urania, die sie neulich auf dem Kirchhofe citirt hatte. Ihr ungezwungenes Benehmen umstrickte mich, und ich hatte sie im Arme, als wir alle aufbrachen und die Wagen uns nachkommen ließen, um durch einen Wald ein nahegelegenes Dörfchen aufzusuchen. In einer Herberge angelangt, setzten wir uns zu Tisch, da es dunkelte. Ich blieb an Seraphinen's Seite. Sie war inzwischen weich und klagend geworden, ihre Stimme zitterte, sie vergoß Tränen. Ich verstand sie nicht. Mir wurd' es ungewiß im Kopfe; denn die Situation war so widersprechend. Vor uns auf dem Tische eine Stück Landkäse, und neben mir ein poetisches Wesen, das mit seinem Schmerze rang. Seraphine blieb mir die Antworten auf meine dringenden Fragen schuldig. Doch hört' ich wohl, daß eine Stiefmutter und unwürdige Behandlung Quell der Leiden war.
Als wir nach Hause fuhren, hatte Seraphine ihren Sitz durch Zufall vor mir. Das Wetter war schön, die Gesellschaft heiter, sie aber sprach nicht. In der Stadt mußte irgendwo Feuer ausgebrochen sein; denn ein lichterloher Schein glänzte am dunkeln Himmel. Nun fuhr alles wild durcheinander, man berechnete, wo das Feuer sein könnte. Daran, daß auch hier Seraphine ruhig blieb, sah ich ihren Schmerz, ihre üble Lage, der ich mit ritterlichem Edelmuthe abhelfen wollte. Als wir nach Hause kamen und ich mich im Bette wälzte, zogen höchst chevalereske Gedanken durch meinen brennenden Kopf. Am frühen Morgen saß ich schön am Schreibtisch und entwarf an Seraphine ein glühendes Gemälde des Interesses, welches ihr Schicksal mir eingeflößt hätte. Ich beschwor sie, aufrichtig gegen mich in Schilderung ihrer Leiden zu sein. Von Liebe sprach ich nicht, desto mehr aber von einem unerhörten Kreuzzuge für ihr Leben, für ihr kleines Haupt, das so fromm und duldsam wäre und unmöglich Jemanden kränken könne!
Noch seh' ich mich, wie ich an die Tür des Musikdirektors klopfte, der unsere Stimmen und unsere Spazierfahrten leitete. Besorgt gab ich dem Manne das Billet für Seraphine. Mit verdächtigem Blicke wurde ich gemessen, und ich Achtzehnjähriger hielt den Blick nicht aus, sondern erröthete. Doch gewann ich zuletzt etwas über den strengen Mann und ging mit bester Hoffnung.
Am nächsten Tage frag' ich nach einer Antwort. Keine da. Es vergehen drei, vier Tage, ich höre nichts. Man lacht dich aus, schloß ich, über deinen Ritterdienst, du hast dir eine Blöße gegeben, God dam! Doch ermutigte ich mich, in den nächsten Verein zu gehen, wo ich Seraphinen sahe. Sie hatte sich festlich gekleidet. Ihr Auge war verklärt, sie sang mit unbeschreiblichem Ausdruck das Solo in Rossinis Schweizer-Pastorale aus Wilhelm Tell. In Calls Quartett: Liebe wohnt in niedern Hütten, hörte man sie vor allen, so daß sie ganz allein den Sopran zu halten schien. Ich glaube, sie sang schon im Vertrauen auf meinen Schutz oder auf meine Liebe, wie sich denn auch schon bei mir beides verwechselt hatte.
Nach der Stunde trat ich in ihre Nähe. Sie sprach einige verwirrte Worte, und drückte mir einen Zettel in die Hand, den ich beim Schimmer der ersten Laterne draußen aufriß. Sie vertröstete mich auf morgen, wo sie in einem öffentlichen Garten, dem gewöhnlichen Rendezvous der Liebe, ungestört mit mir sprechen wollte. Wie dies nun alles kam, weiß ich kaum noch. Wir umarmten uns in jenem Garten, beschützt von Hollunderhecken. Wir schwuren uns Treue, wir wechselten Ringe, wir hatten keine Geheimnisse mehr. Als wir schieden, sagte sie: »Arthur, morgen um sechs Uhr treffen wir uns auf dem *** Platze; dann führ' ich Dich zu meinem Vater!«
Diese letzten Worte waren ein Donnerschlag für mich. Wie? dacht' ich, sie will mich wie eine gemachte Beute in ihr väterliches Haus schleppen? Diese Schwärmerei, welche mein Herz erquickt, soll mit einem bürgerlichen Acte und mit einer väterlichen Prüfung meiner Zeugnisse endigen? Herr Jesus, wohin hast du dich verirrt! Vormund wolltest du sein, und bist Geliebter geworden!
Dabei fiel mir die Szene in den Hollunderhecken ein. Ich sahe, wie klug Seraphine auf eine Entscheidung gedrängt hatte, und erinnerte mich, daß sie bei meinen Versicherungen, ihr beistehen zu wollen, einmal nach dem andern fragte: »Wie wollen Sie das aber anfangen, ohne mich zu compromittiren?«