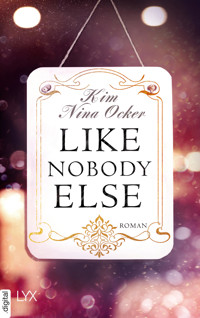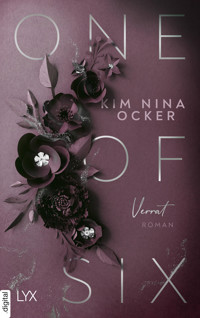11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kingsbay Secrets
- Sprache: Deutsch
ICH SPIELE MIT DEM FEUER UND BIN MIR SICHER, DASS ICH MICH FRÜHER ODER SPÄTER DARAN VERBRENNEN WERDE. ABER ICH BETE, DASS ES DEN SCHMERZ WERT SEIN WIRD
In der glamourösen Welt der High Society lauern dunkle Abgründe - das musste die junge Personenschützerin Charlie Blossom am eigenen Leib erfahren. Nachdem sie nur knapp einem Anschlag auf ihr Leben entkommen ist, will sie herausfinden, wer hinter der Bedrohung steckt. Dabei stößt sie auf eine alte Familienfehde zwischen ihren Arbeitgebern, den Newtons, und den Favreaus, der einflussreichsten Familie der kriminellen Unterwelt. Und nun bleibt ihr nichts anderes übrig, als Roméo Favreau um Hilfe zu bitten, denn nicht nur Charlie scheint in Gefahr zu schweben, sondern auch Gideon Newton, für den sie alles andere als professionelle Gefühle hat ...
»Kim Nina Ocker erschafft mit der gelungenen Mischung aus Mafia Romance und Enemies-to-Lovers-Dynamik einen packenden Pageturner, der ganz nach meinem Geschmack war.« book_lovely29 über Tainted Dreams
Band 2 der neuen New-Adult-Suspense-Trilogie der SPIEGEL-Bestseller-Autorin Kim Nina Ocker
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Leser:innenhinweis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
Die Autorin
Die Bücher von Kim Nina Ocker bei LYX
Impressum
KIM NINA OCKER
Shattered Palace
KINGSBAY SECRETS
Roman
ZU DIESEM BUCH
Als die junge Personenschützerin Charlie Blossom nur knapp einem Anschlag auf ihr Leben entkommt, muss sie am eigenen Leib erfahren, dass auch in der glamourösen Welt der High Society dunkle Abgründe lauern. Wenn sie sich jemals wieder sicher fühlen möchte, muss sie unbedingt heraus-finden, wer hinter der Bedrohung steckt. Allerdings macht ihr Arbeitgeber, die reiche Familie Newton, ihr die Ermittlungen nicht leicht, und dann tritt auch noch eine Person aus ihrer Vergangenheit in ihr Leben, die Charlie nie wiedersehen wollte. So bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich an den Mann zu wenden, von dem sie sich geschworen hatte, dass sie ihn niemals um Hilfe bitten würde – Roméo Favreau. Doch ohne die Unterstützung des mysteriösen Mitglieds der Familie Favreau und seinen Verbindungen in die kriminelle Unterwelt Miamis kommt Charlie nicht weiter. Außerdem ist nicht nur sie selbst in Gefahr, sondern auch Gideon Newton, für den sie alles andere als professionelle Gefühle hegt. Aber plötzlich stößt sie auf eine alte Familienfehde zwischen den Newtons und den Favreaus und muss fest-stellen, dass ausgerechnet Gideon etwas vor ihr verborgen hat …
Für Mona
&
Für diejenigen, die ihre Fortschritte im Stillen feiern,
weil sie zuvor niemandem gezeigt haben, dass sie am Tiefpunkt waren.
Seid stolz auf euch.
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier einen Contenthinweis.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle
das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Kim und euer LYX-Verlag
1. KAPITEL
Roméo
In der verzweifelten Hoffnung, meine Wut unter Kontrolle zu bringen, atme ich tief durch. Am liebsten würde ich aufstehen und irgendjemanden anbrüllen. Aber das hier ist nicht meine Show, und ich weiß, dass ich wie ein ungezogener Hund auf meinen Platz geschickt würde, sollte ich den Mund aufmachen. Also lehne ich mich in meinen Sessel zurück und kralle die Finger in die Lehnen, um meinen Aggressionen wenigstens ein kleines Ventil zu bieten. Ist leider wenig hilfreich.
»Du hast also nichts gesehen?«, fragt Dad zum gefühlt hundertsten Mal. Seine Stimme ist ruhig und beherrscht, doch ich kenne ihn gut genug, um zu erkennen, dass es unter der Oberfläche brodelt.
Elijah schüttelt den Kopf … oder macht eine Bewegung, die einem Kopfschütteln ansatzweise ähnelt. Bei seinem Hechtsprung aus dem Wagen ist er ziemlich hart mit dem Kopf auf den Asphalt geknallt, bevor ein ausweichendes Auto ihm den Oberschenkelknochen gebrochen hat. Um seinen Kopf ist ein beeindruckend dicker Verband gewickelt, sein Bein hängt in einer Schlinge an einer Art Minikran ein paar Zentimeter über der Matratze, und sein gesamter Körper ist übersät mit Prellungen und Schürfwunden.
»Ich kann dir den Van beschreiben«, antwortet Eli und klingt allmählich wie eine gesprungene Schallplatte. »Dunkelgrüner Chevy, schätzungsweise ein G20 aus den Sechzigern. Kein Nummernschild, verdunkelte Scheiben.«
»Das hilft uns nicht weiter.«
Er verengt die Augen. »Was hätte ich deiner Meinung nach tun sollen?«
»Irgendetwas«, erwidert mein Vater mit einem leichten Knurren in der Stimme. »Wie kann es sein, dass dich ein Wagen abdrängt, den SUV samt der Frau im beschissenen Ozean versenkt und du mir nichts weiter berichten kannst, als dass es ein beschissener grüner Van war?«
»Ich war ausgeknockt!« Eli versucht, sich ein Stück aufzurichten, gibt aber schnell wieder auf. »Die Wichser waren weg, als ich zu mir gekommen bin, und die ganze beschissene Kavallerie war da! Erwartest du, dass ich mit ’nem offenen Bruch am Bein die Verfolgung aufnehme?«
Ich lege den Kopf schief. Eindeutig ein Punkt für Elijah. Er ist ein harter Hund, und vermutlich würden Kleinigkeiten wie eine Schusswunde oder ein fehlendes Ohr ihn nicht aufhalten. Aber wenn ich die Ärzte richtig verstanden habe, hat sein Knochen aus seinem Oberschenkel herausgeguckt, als der Notarzt eingetroffen ist.
»Das ist doch alles gequirlte Scheiße!«, faucht mein Vater, während er sich reflexartig an seine Krawatte greift. Das tut er immer, wenn er nervös ist. Auguste Favreau trägt grundsätzlich einen dunklen Anzug mit Krawatte, völlig egal, wie seine Tagesplanung aussieht. Manchmal habe ich den Verdacht, dass er einfach stets auf eine Beerdigung vorbereitet sein will. Was in Elijahs Fall zum Glück nicht nötig war. »Wie soll ich Gabriel eurer Meinung nach erklären, was passiert ist?«, fragt er, während er sich schließlich zu mir umdreht.
Bislang habe ich schweigend und möglichst unauffällig in dem Besuchersessel im Krankenhaus ausgeharrt, doch irgendwie war mir klar, dass ich mich nicht lange der Aufmerksamkeit meines Vaters würde entziehen können.
Abwehrend hebe ich die Hände. »Guck mich nicht so an. Ich habe sie in ein Auto gesetzt und Elijah übergeben. Du kannst mir echt nicht vorwerfen, dass ich das«, mit beiden Händen deute ich demonstrativ auf Elijah in seinem Krankenhausbett, »nicht habe kommen sehen.«
»Das hättest du aber kommen sehen müssen!«
Mit hochgezogenen Augenbrauen starre ich meinen Vater an. »Okay, ich spiele mit: Wie genau hätte dieses Treffen deiner Meinung nach laufen sollen? Ich tauche wieder bei ihr zu Hause auf, am helllichten Tag, und das nach der Scheiße, die du und Pavel mit dem Newton-Gör abgezogen habt? Ich verwette meinen Schwanz darauf, dass die inzwischen mindestens zwanzig zusätzliche Sicherheitsleute angeheuert haben! Ich war ehrlich überrascht, dass Elijah es mit dem Jetski rein und wieder raus geschafft hat, ohne abgeknallt zu werden.«
Elijah sieht mich an und verengt die Augen. »Danke, Mann.«
Ich werfe ihm eine Kusshand zu. »Hör auf zu heulen, du lebst doch.«
»Gerade so.«
»Schluss jetzt!«, donnert mein Vater. Mit seiner vermeintlichen inneren Ruhe ist es offensichtlich vorbei.
Stöhnend stehe ich auf und greife nach dem Pudding, der auf Elijahs Nachtschrank steht. »Solange niemand weiß, wer für den ganzen Scheiß hier verantwortlich ist, kommen wir nicht weiter. Gabriel ist das Auto scheißegal. Kollateralschäden. Und die Frau interessiert ihn sicher auch nicht mehr. Keiner von uns kann etwas dafür, dass Elijah verletzt wurde.«
Er sieht mich an und verzieht den Mund zu einem Lächeln, das mehr einer Fratze gleicht. »Oh, so einfach ist das? Dann nehme ich an, dass du das Gabriel erklärst?«
»Klar«, erwidere ich achselzuckend, allerdings nur, weil ich weiß, dass mein Vater mir diese Aufgabe sicher nicht überlassen wird.
Gabriel Favreau ist das Oberhaupt meiner netten kleinen Familie und mein Onkel, zumindest bezeichnen wir ihn als solchen. In Wahrheit ist er der Cousin meines Vaters und dementsprechend mein … Onkel zweiten Grades? Oder so ähnlich. Ich habe keine Beziehung zu ihm und kenne ihn nicht einmal gut genug, um eine persönliche Meinung über diesen Mann zu haben. Aber ich kenne die Geschichten über ihn. Und weiß gut genug über unsere Familie Bescheid, um diesem Mann aus dem Weg zu gehen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Denn das Problem mit Persönlichkeiten wie Gabriel Favreau ist, dass man ihnen entweder sehr nahestehen und zu ihren Vertrauten gehören oder vollkommen unter ihrem Radar fliegen sollte. Nichts dazwischen.
Aktuell mache ich mir, anders als mein Vater, keine Gedanken über ihn. Diese ganze Scheiße mit dem grünen Van, Elijah und Charlotte Blossom war nicht meine Schuld. Ich habe sie nicht einfach aus den Augen verloren oder durch mein Verschulden den Zugang zu einer wertvollen Quelle gekappt. Eine dritte Partei hat sich eingemischt, und ich bin zuversichtlich, dass Gabriel sich in erster Linie auf diese unbekannten Männer konzentrieren und keinen Gedanken an mich verschwenden wird. Vorerst.
Das Einzige, was mich wirklich, wirklich ärgert, ist der zerschlagene Deal. Die Erpressung war mein Baby, und irgendjemand hat dafür gesorgt, dass ich die Informationen, denen ich so beschissen nahe war, nicht erhalte. Ich hätte mir die Liste einfach geben lassen sollen, als Blossom mir noch einigermaßen wohlbehalten gegenübersaß. Dann wäre die Kacke jetzt nicht derart am Dampfen und meine Eier nicht in einem Schraubstock, den mein Vater mit jeder Sekunde fester zieht.
»Ich habe keine Zeit hierfür«, macht Dad weiter und wendet sich ab. Dann dreht er sich noch einmal um und sieht Elijah an. Mich würdigt er keines einzigen Blickes. »Du rufst an, sobald die Ärzte deine Entlassungspapiere unterschrieben haben. Klar?«
Wieder macht Elijah eine Bewegung, die entfernt an ein Nicken erinnert. »Natürlich, Sir.«
Damit macht mein Vater einen Abgang, der von dem Knall der sich hinter ihm schließenden Tür untermalt wird.
Ich pfeife durch die Zähne und öffne den Pudding. »Dem geht der Arsch auf Grundeis.«
»Du solltest diese Sache ernst nehmen.«
»Tue ich«, versichere ich ihm. Weil auf dem Nachttisch kein Löffel liegt, kippe ich den Becher und lasse mir eine Portion Pudding in den Mund laufen. Elijah verzieht das Gesicht. »Glaub mir, ich nehme das ernst. Aber für meine Interessen ist es sinnvoller, wenn mein Vater denkt, ich wäre zu nichts zu gebrauchen.«
»Du bist zu nichts zu gebrauchen«, sagt Elijah nachdrücklich. »Du gibst Gabriels Geld aus und holst dir wahrscheinlich jedes Mal einen runter, wenn du deinen Kontostand checkst. Das wird nicht lange gut gehen, dann schicken sie dich zurück nach Kanada oder wo auch immer du hergekommen bist.«
Seine Sticheleien gehen mir am Arsch vorbei, daher gehe ich gar nicht auf sie ein. »Ich verdiene mir dieses Geld, Ellie. Nur weil du meinen Plan nicht durchschaust, heißt das nicht, dass ich keinen habe.«
Es scheint, als würde er skeptisch die Augenbrauen hochziehen, sicher bin ich mir aber nicht. Durch den Verband, der seine halbe Stirn bedeckt, ist das wirklich schwer zu sagen.
»Du hast einen Plan?«
»Ja, Elijah, ich habe einen Plan.«
»Die Gesamtsituation betreffend oder nur den Vorfall mit dem Van?«
»Beides.« Ich stelle den Pudding zurück, weil das ziemlich sicher ’ne zuckerfreie Version ist, so eklig, wie er schmeckt. »Ich will wissen, wer dahintersteckt und ob das ’ne Aktion gegen meinen Vater und Gabriel war oder ob mir da jemand persönlich an den Karren pissen wollte.«
Als er den Arm hebt, um die Decke ein wenig zur Seite zu schieben, stöhnt er leise. Anscheinend versucht er, irgendeine bequemere Position zu finden, aber ich bin nicht überzeugt, dass er erfolgreich ist. »Ich glaube nicht, dass diese Blossom dir wirklich Informationen aushändigen wollte. Ich denke, dass sie dich gelinkt hat.«
Ich schnaube. »Natürlich wollte sie mich linken. Sie wäre eine beschissene Assistentin, wenn sie direkt beim ersten Einschüchterungsversuch singen würde. Aber ich hätte sie weichgekocht … früher oder später.«
»Und dann?«, fragt er herausfordernd. »Was hätte dir das gebracht? Wärst du mit Gabriels Geld abgehauen? Dann hättest du dir ein paar wirklich schöne Tage damit machen können, bevor dein Dad deine Überreste in einer beschissenen Papiertüte hätte beisetzen lassen können.«
»Überanstreng dein angeschlagenes Gehirn nicht mit meinen Sorgen, Ellie. Soweit ich weiß, wirst du für deinen Bizeps bezahlt, nicht für deinen Verstand.«
Trotz der geschwollenen Unterlippe erkenne ich die Schadenfreude, als er grinst. »Hast du ja auch nötig, wenn ich das richtig gehört habe, oder? Wie oft hat das Mädchen dich geschlagen? Zweimal, drei?«
Unwillkürlich zucken meine Mundwinkel. Bei seinen Worten spüre ich wieder die blauen Flecken, die Blossom mir verpasst hat – in der Seitengasse in Kingsbay, während der Benefizveranstaltung. Ich muss zugeben, dass sie mich kalt erwischt und sich mit dieser Nummer ein klitzekleines bisschen Respekt verdient hat. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass sie dem Arschloch Newton an diesem Abend die Meinung gesagt hätte, nachdem er sie so galant gefeuert hat. Aber ich bekomme die Auswirkungen der Gehirnwäsche durch diese Familie nicht zum ersten Mal zu Gesicht, und ehrlich gesagt überrascht mich überhaupt nichts mehr.
»Hast du schon mit Pavel gesprochen?«, fragt Elijah, als ich nicht auf seinen Kommentar eingehe.
Ich zucke mit den Schultern. »Warum sollte ich?«
»Weil du seinen Auftrag verloren hast. Die Kleine war ursprünglich sein Ding, oder nicht?«, fragt er vollkommen sachlich, als hätte er nicht in demselben Auto gesessen wie die Kleine und eine beschissene Nahtoderfahrung mit ihr geteilt.
»Er hat sich damit abgefunden«, antworte ich nur. Das entspricht durchaus der Wahrheit. Nachdem mein großer Bruder seinen ersten Kontaktversuch mit Blossom verkackt hat, hat mein Vater mich auf sie angesetzt, und ich war nun mal besser in diesem Job als Pavel. Das ist nicht meine Schuld. Er leckt vermutlich noch immer seine Wunden. Nicht mein Problem.
Vor zwei Tagen hat dieser kackgrüne Van unseren SUV von der Brücke gedrängt und damit auch meine Eintrittskarte in den Favreau-VIP-Bereich in den Atlantischen Ozean geschubst. Seit ich vor rund einem Jahr in das Familienbusiness eingestiegen bin, war ich eine verfickte Aushilfskraft. Habe einzelne Handlangeraufgaben erledigt, für die ich Taschengeld bekommen habe, als wäre ich ein unerwünschtes Stiefkind, das man irgendwie zum Schweigen zu bringen versucht. Diese Sache mit Blossom wäre mein Beweis dafür gewesen, dass ich bei den großen Jungs mitspielen kann. Nicht, dass ich ernsthaft eine Karriere im Familienunternehmen anstrebe, hier geht es ums Prinzip. Darum, ernst genommen zu werden und eigene Entscheidung treffen zu können. Leider wage ich zu bezweifeln, dass ich diese Feuerprobe bestanden habe.
Was mir unfassbar auf den Sack geht. Ich hasse die Abhängigkeit von meinem Vater und damit auch von meinem Onkel. Dass sie mir laufend das Gefühl geben, ihnen zu Dank verpflichtet zu sein, weil sie meine Miete zahlen.
Stöhnend stehe ich auf und strecke die Arme über den Kopf, aber es hilft nicht, die Verspannungen aus meinem Nacken und meinen Schultern zu vertreiben. Gefühlt habe ich seit zwei Tagen nicht mehr geschlafen, und das macht sich allmählich bemerkbar.
»War schön, dich zu sehen«, sage ich zu Elijah, der die Augen verdreht. »Entspann dich ruhig noch ein bisschen, während wir anderen die Scheiße schaufeln müssen.«
Demonstrativ deutet er auf sein gegipstes Bein. »Ist nicht so, dass ich die Wahl habe, Arschloch.«
»Ich glaube nicht, dass du so mit mir reden solltest«, erinnere ich ihn, ohne es wirklich ernst zu meinen. Auf Förmlichkeiten habe ich noch nie sonderlich Wert gelegt. »Dir ist schon klar, dass ich dich ersetzen muss, oder?«
Er zuckt mit den Schultern. »Mach ruhig. Bis du einsiehst, dass es keinen Besseren gibt als mich.«
»Klar«, sage ich, während ich mich umdrehe und ihm winke. »Viel Spaß, wenn das Pflegepersonal kommt, um dich zu waschen.«
Falls er antwortet, höre ich seine Erwiderung nicht, da ich die Tür bereits hinter mir schließe. Sein Zimmer wird von meinem Onkel bezahlt, was bedeutet, dass es mehr einem Hotel als einem Krankenhaus gleicht. Aber das gilt leider nicht für den Flur. Hier riecht alles nach Krankheit und Tod. Zwar habe ich keine traumatischen Erfahrungen mit Krankenhäusern gemacht, trotzdem hasse ich diese Atmosphäre. Als würde über den Räumen ein Fluch liegen, der jedem Patienten ein One-Way-Ticket in die Hölle zusichert. Egal, ob sie mit einer Erkältung oder einem Schlaganfall eingeliefert werden.
Ich biege nach rechts ab und steuere das kleine Pflegezimmer an. An der Tür bleibe ich stehen und lehne mich dagegen.
»Hi«, sage ich und grinse, als Paige aufschaut. Sie ist eine entfernte Cousine oder etwas in der Art. Gut möglich, dass wir nicht einmal richtig verwandt sind, aber in dieser Familie sind wir alle Cousinen und Cousins. »Du siehst beschissen aus.«
»Nur weil du keine Ahnung hast, wie echte Arbeit aussieht.« Sie verzieht das Gesicht. »Ich hatte eigentlich nichts dagegen, dass wir uns so lange nicht gesehen haben.«
»Ja, war schön.« Ich mache einen Schritt in den Raum hinein und lehne mich gegen die Tischplatte. Außer uns ist niemand hier, was gut ist. »Hör mal, ich brauche ein paar Informationen.«
»Du bekommst überhaupt nichts von mir.«
Ich lache. Man könnte meinen, dass Paige mich nicht mag, aber ich weiß es besser. Ich bin definitiv einer ihrer Lieblingscousins.
»Ich will wissen, wer Elijah besucht«, sage ich, ohne auf ihre letzte Bemerkung einzugehen.
Mit schief gelegtem Kopf sieht sie mich an. »Warum?«
»Weil ich das will. Hat mein Vater oder einer der anderen danach gefragt?«
Sie zögert einen Moment, dann lehnt sie sich seufzend in ihrem Stuhl zurück. »Nein. Aus Gründen wahrscheinlich. Ich habe keinen Bock, da zwischen die Fronten zu geraten.«
»Tust du auch nicht.« Ich verenge die Augen und mustere sie einen Moment. »Wir haben einen Maulwurf, Paige, das weißt du auch. Ich will nur auf Nummer sicher gehen.«
»Weißt du, wie lange Elijah schon für Gabriel arbeitet?«, fragt sie ungläubig, greift nach einem Kugelschreiber und beginnt, sich damit aufs Bein zu tippen. »Mindestens seit zehn Jahren. Du solltest seine Loyalität nicht anzweifeln, wenn Gabriel es nicht tut.«
»Ich zweifle niemanden an«, stelle ich unbeirrt lächelnd klar. »Wenn er nichts zu verbergen hat, dann wird es ihn auch nicht stören, dass ich weiß, wer ihn besucht. Mag sein, dass wir ihm vertrauen, aber wer sagt, dass niemand herkommt, um seine Lage auszunutzen? Vielleicht will ich ihn auch nur beschützen.«
»Klar«, schnaubt sie und steckt den Kugelschreiber in ihre Brusttasche. Sie arbeitet seit ein paar Jahren in diesem Krankenhaus, und insgeheim bin ich mir sicher, dass sie von Gabriel strategisch platziert wurde. Wie eine Schachfigur in einer noch nicht entschiedenen Partie. »Ich hab ein Auge drauf, okay?«
»Du bist so toll«, sage ich, strecke die Hand aus und wuschle ihr durchs Haar. »Ich liebe dich so sehr.«
»Verpiss dich«, faucht sie und weicht meiner Hand aus, bevor sie sich wieder ihrem Computer widmet. »Sehen wir uns am Sonntag?«
»Voll ungern«, antworte ich, dann mache ich einen Abgang. Sonntags finden unsere allwöchentlichen Familienessen statt, aber ich drücke mich davor, so oft ich kann. Seit meiner Rückkehr nach Miami war ich vielleicht zwei-, dreimal dabei, und das auch nur, wenn es irgendwelche wichtigen Geburtstage als Anlass gab. Meine Familie ist speziell, und meistens habe ich keine große Lust, mehr Zeit als nötig mit ihr zu verbringen.
Aber dieses Mal werde ich vermutlich hingehen. Um die Wogen zu glätten und auszuloten, wie groß die Schwierigkeiten eigentlich sind, in die ich mich manövriert habe.
2. KAPITEL
Roméo
Zwei Tage später lasse ich mich in die gleiche Sitznische fallen, in der ich mit Blossom zusammengesessen habe, bevor sie von der Rickenbacker Bridge in den Ozean abgedrängt wurde. Das ist keine Woche her, trotzdem erscheint es mir wie eine Ewigkeit. Aus irgendeinem Grund hatte ich Spaß mit Charlotte Blossom, auch wenn sie mich die meiste Zeit über beleidigt oder bedroht hat. Oder geschlagen. Als ich diese kleine Mission für meine Familie übernommen habe, habe ich angenommen, dass die Erpressung nach Schema F ablaufen und alle Beteiligten sich an ihre vorgegebenen Rollen halten würden: Ich bin das – selbstverständlich charmante und charismatische – Arschloch, Elijah der beängstigende Schläger und Blossom die artig eingeschüchterte Zielperson, die kaum ein Wort herausbringt und brav tut, was ihr gesagt wird.
Da lag ich falsch.
Die Einzigen, die sich an ihre Rolle gehalten haben, waren Elijah und ich. Blossom hingegen … Sie hat einen Widerstand an den Tag gelegt, den ich nicht erwartet habe. Ich bin mir sicher, dass ihre Kontaktliste, falls diese überhaupt existiert hat, falsch gewesen wäre. Das ist keine Überraschung, damit habe ich gerechnet. So wenig Rückgrat erwarte ich von keiner Assistentin der Newtons. Doch Charlie hat sich nicht damit begnügt, mir falsche Informationen zu liefern. Sie hat mir die Stirn geboten, mehr als einmal. Sie hat mich geschlagen, verdammte Scheiße. Ich gebe es nur ungern zu, aber sie hat mich beeindruckt. Und vor allem hat sie mich neugierig gemacht.
Was ich überhaupt nicht gebrauchen kann, also sollte ich vielleicht dankbar dafür sein, dass sich die Angelegenheit mit ihr erledigt hat.
Gedankenverloren lasse ich den Blick aus dem Fenster schweifen. Es regnet schon wieder, weshalb der Betreiber des Lokals die Glaswand dieses Mal geschlossen hat. Was ein Jammer – die Aussicht ist eigentlich ziemlich krass, wenn man so nahe an der Klippe sitzt. Ein paar Minuten lang beobachte ich die Wellen, die sich, begleitet von einem tosenden Krachen, an den Steinfelsen brechen. Eigentlich wollte ich heute mit dem Boot raus, aber das hat wenig Sinn, wenn ich lediglich unter Deck sitzen und mir die Inneneinrichtung ansehen kann.
Ich schaue auf, als ein Schatten über den Tisch fällt.
»Du bist viereinhalb Minuten zu spät«, sage ich, grinse jedoch. »Hi.«
Lydia hebt die Hand und atmet geräuschvoll aus. Ihre Haare und auch ihre Klamotten sind an den Schultern und Oberschenkeln klatschnass. »Halt die Klappe, ich habe mich echt beeilt.«
Stirnrunzelnd mustere ich sie. »Bist du hergelaufen?«
»Hab das Rad genommen«, berichtigt sie, während sie sich mir gegenüber auf die Bank fallen lässt. Genau auf den Platz, an dem Blossom vor ein paar Tagen gesessen und mich wütend angestarrt hat. Lydia greift nach einer Stoffserviette und wischt sich damit das Wasser aus dem Gesicht. »Dieser Club ist am Arsch der Welt, hier fährt kein Bus hin.«
»Dann nimm dir ein Uber«, antworte ich verwirrt und reiche ihr wortlos meine Serviette, weil ihre bereits durchweicht ist.
Sie hebt den Blick und sieht mich genervt an. »Ich habe eine Millionenklage am Hals, Roméo. Ich kann mir kein Uber leisten.«
Wütend beiße ich die Zähne zusammen. »Ich hätte einen Fahrer schicken können.«
Ungeduldig winkt sie ab. »Passt schon, ist nur Wasser. Hast du schon bestellt?«
Ich starre sie an. Ist mir scheißegal, ob ich unhöflich bin oder sie in Verlegenheit bringe. Lydias Stolz hat ihr schon immer im Weg gestanden, auch in der Zeit, in der wir etwas miteinander hatten. Das waren nur ein paar Wochen, trotzdem hat sie auch damals kaum etwas annehmen können.
»Das nächste Mal rufst du mich an, dann holt dich jemand ab.«
Sie zuckt mit den Schultern und weicht meinem Blick aus. »Lass uns das Thema wechseln, okay? Hast du nun bestellt oder nicht?«
Einen Moment überlege ich, nachzuhaken, aber dann lasse ich es bleiben und winke eine Kellnerin heran, um unsere Bestellung aufzugeben. Anders als während meines Treffens mit Blossom ist der Gastraum aufgrund des Wetters ziemlich überfüllt, aber dieses Mal muss ich immerhin keine Show abziehen. Lydia kennt mich und muss nicht eingeschüchtert werden.
Nachdem wir bestellt haben, faltet Lydia die Hände vor sich auf der weißen Tischdecke und mustert mich ein paar Sekunden lang. »Geht es dir gut?«
»Mir geht es immer gut«, antworte ich und lache, als sie die Augen verdreht. »Ich war nicht mal in der Nähe dieses Autos, Lulu. Kein Grund zur Besorgnis.«
Sie schnaubt. »Ist mir egal, ob du zu der Zeit auf der Brücke, in Miami oder in Europa warst. Das fällt auf dich zurück, oder nicht?«
»Der Unfall?«, hake ich irritiert nach. Als sie ernst nickt, hebe ich die Augenbrauen. »Denkst du, dass ich das war? Dass ich das in Auftrag gegeben habe?«
»Ich denke überhaupt nichts«, präzisiert sie. »Aber ich weiß, dass du einen irrationalen Hass auf Gideon hast und Charlotte Blossom erpressen wolltest.«
»Und deswegen ramme ich sie mit einem Van von der Rickenbacker?«, frage ich fassungslos. »Wow, Lydia. Ich fühle mich echt geschmeichelt.«
»Hör auf, den Beleidigten zu spielen«, faucht sie und schaut sich kurz um, doch die beiden Sitznischen neben uns sind leer. »Sag mir, dass dein Onkel dazu nicht in der Lage wäre, wenn er Charlotte hätte loswerden wollen.«
»Dazu wäre er nicht in der Lage«, lüge ich glatt, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Nur weil wir ein paar Wochen Sex miteinander hatten, heißt das noch lange nicht, dass ich ihr vertraue. Vertrauen ist ein gefährliches Spiel, bei dem man meiner Erfahrung nach öfter verliert, als dass man gewinnt.
»Du lügst«, sagt Lydia und lehnt sich auf ihrer Bank zurück. »Aber, gut, lüg mich ruhig an. Ist vielleicht besser so.«
»Wahrscheinlich sogar.«
Sie mustert mich, als würde sie versuchen, die Gedanken hinter meiner Stirn zu lesen. »Ich will aussteigen.«
Geräuschvoll atme ich aus. Mit so etwas habe ich gerechnet, aber gehofft habe ich das Gegenteil. »Lydia, komm schon …«
»Nein«, unterbricht sie mich, während sie langsam den Kopf schüttelt. »Das wird mir zu heiß. Ich brauche das Geld. Scheiße, Roméo, du weißt, ich brauche das Geld. Aber wenn eine Frau, die für dich Informationen gesammelt hat, in die Biscayne Bay fällt, ist für mich Schluss. Ich habe echt keine Lust, die Nächste zu sein und als Wasserleiche zu enden.«
»Wirst du nicht«, sage ich eindringlich und beuge mich vor. Aber in diesem Moment taucht die Kellnerin wieder auf und stellt zwei Limos vor uns ab. Ich halte inne und lächle sie an, schaue ihr hinterher, bis sie außer Hörweite ist. »Dafür sind wir nicht verantwortlich, Lydia.«
»Das ist mir egal«, antwortet sie ungerührt. »Wer sie loswerden oder euch einen Denkzettel verpassen wollte, von wem ich schlussendlich umgebracht werde, spielt keine Rolle. Ich bin ganz gerne am Leben.«
»Du überdramatisierst das.«
»Ach ja?«, fragt sie spöttisch. »Meinst du, Charlotte sieht das genauso?«
Ich öffne den Mund, schließe ihn aber wieder, weil ich nicht weiß, was ich darauf antworten soll. Und das passiert selten. Lydia hat keine Ahnung, dass Charlie auf ihrem Platz gesessen hat, bevor sie von dem Wagen gerammt wurde. Meinem Dad gegenüber habe ich sie als Kollateralschaden bezeichnet, aber wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir bin, ist sie mehr als das. Diese Sache ist eine verfickte Tragödie, weil ein Teil von mir sich durchaus auf die kommenden Dates mit ihr gefreut hat. Doch nach alledem ist sie als Informantin wohl nicht mehr zu gebrauchen.
»Eben«, schlussfolgert Lydia, als ich nicht antworte.
»Nein.« Ich seufze und fahre mir mit der Hand durch die Haare. »Interpretier da nicht einfach irgendwas hinein, klar? Dir wird nichts passieren, du tust ja nicht mal etwas Spannendes. Du sollst nur beobachten, ob Newton misstrauisch wird.«
»Wie denn, Roméo?«, fragt sie und lacht trocken. »Der Plan war von vornherein scheiße, und das weißt du auch. Während dieser Promotour hätte das vielleicht funktioniert, weil ich an der Organisation beteiligt war. Aber jetzt? Ich habe einen Arsch voll Klagen. Denkst du wirklich, dass sich mir die Gelegenheit bieten wird, Gideon im Auge zu behalten?«
Ich beiße mir auf die Lippe und schaue zur Seite. Sie hat recht. Fuck! Sie und ihre Verbindung zu den Events dieser bescheuerten Promotour waren die perfekte Gelegenheit für mich, Newton und seine neue Assistentin im Auge zu behalten. Nur ist die Tour abgesagt worden.
»Zehntausend«, sage ich, ohne sie aus den Augen zu lassen. »In bar.«
Sie schnaubt. »Wofür?«
»Dafür, dass du jemanden suchst, der vertrauenswürdig ist. Jemanden für einen Inside-Job.«
Ich erkenne das widerwillige Interesse in ihren Augen, auch wenn sie sich alle Mühe gibt, es zu verbergen. Allein die Tatsache, dass sie nicht direkt aufsteht und sich verpisst, verrät sie.
»Geld bedeutet bei euch doch nichts«, sagt sie schließlich, wenn auch zögernd. »Wer versichert mir, dass ihr mich nicht mit schmutzigem Geld oder Blüten bezahlt?«
»Ich«, sage ich schlicht.
Lydia mustert mich, dann wendet sie den Blick ab und lässt ihn durch den Raum schweifen. Mir ist klar, dass sie darüber nachdenkt, und mir ist ebenfalls klar, dass das hier eine moralische Schlammgrube ist. Ich weiß, wie dringend Lydia Geld braucht. Niemand kann genau sagen, wie lange sich dieser Rechtsstreit mit den Newtons noch hinziehen wird. Das hier ist ein verdammt unmoralisches Angebot, aber ich bin zuversichtlich, dass sie annimmt und ihr nichts passieren wird. Ein Restrisiko besteht immer, daran kann ich nichts ändern, und das ist Lydia selbst klar.
»Okay, angenommen, ich mache mit«, sagt sie schließlich und sieht mich wieder an. Ich unterdrücke ein Grinsen. »Aber nur, weil ich keine Ahnung habe, wie ich meine Miete bezahlen soll. Was wären die Bedingungen?«
»Dass es jemand ist, der den Newtons nahesteht und uns nicht verpfeift. Der letzte Punkt ist keine Vertrauensfrage. Ich will eine Sicherheit.«
»Wie soll ich das machen?«
»Keine Ahnung«, gebe ich zu. »Erpressung, Drohung, vielleicht gibt es auch einfach jemanden, der die Newtons genug hasst, um die Seiten zu wechseln. Das sollte nicht allzu schwer sein. Für zehntausend kann ich schon ein bisschen Kreativität verlangen, findest du nicht?«
Sie beugt sich erneut vor, und auf einmal liegt ein flehender Ausdruck in ihren Augen. »Du wirfst mich den Wölfen zum Fraß vor.«
»Nein, Lulu, das tue ich nicht.« Ich bin mir beinahe sicher, dass sie mir nicht glaubt, aber ich sage die Wahrheit. Lydia ist mir nicht egal, und tatsächlich würde ich nichts wissentlich tun, was sie in Gefahr bringt. Andererseits kann ich ihr in dieser Welt einfach nicht versichern, dass ihr nichts passiert. Das kann niemand, vermutlich nicht einmal Gott. »Dein Name taucht nirgendwo auf, das schwöre ich dir. Wenn du Glück hast, ist das eine Sache von ein paar Tagen, und dann bist du raus. Es ist deine Entscheidung.«
»Als hätte ich eine Wahl. Wenn es so weitergeht, laufe ich bald mit einer Niere weniger rum.« Sie lacht hart. »Gut, ich mach mit. Zehn jetzt, zehn bei Lieferung.«
Ich grinse. »Wir hatten zehn insgesamt gesagt.«
Sie antwortet nicht sofort, weil in diesem Moment unsere Sandwiches gebracht werden. Als ich mit Charlie hier gesessen habe, habe ich Austern bestellt, obwohl ich sie eigentlich hasse. Die machen allerdings deutlich mehr Eindruck als Club-Sandwiches.
»Ich brauche zwanzig«, fährt Lydia fort, sobald wir wieder allein sind. Sie verschränkt die Arme vor der Brust und hält meinem Blick stand. »Sonst mache ich es nicht.«
»Du bist ’ne kleine Zecke«, sage ich, während ich nach meinem Sandwich greife. »Fünfzehn.«
»Siebzehn.«
»Sechzehn.«
»Deal.«
Ich verdrehe die Augen. »Wenn du jetzt sagst, dass du es auch für zehn gemacht hättest, kotze ich dir auf den Teller.«
»Zum Glück haben wir beide zu viel Stil, um dieses Klischee zu bedienen«, erwidert sie und zwinkert mir zu, bevor sie einen Bissen nimmt und einen übertriebenen Seufzer ausstößt. »Ich wünschte, ich müsste die Zwanzigtausend nicht direkt wieder den Newtons in den Rachen schieben.«
»Sechzehntausend«, erinnere ich sie, spare mir aber sonstige Kommentare. Wenn es einen Weg gäbe, Lydia vor diesen Klagen zu schützen, würde ich es tun. Schon alleine, um die Newtons zu ärgern. Aber in dem Fall sind mir die Hände gebunden, weil ich den Namen Favreau nicht unnötig in den Fokus irgendwelcher gut bezahlten Anwälte rücken kann. Abgesehen davon ist Lydia selbst schuld, so leid mir das auch tut. Sie hat eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben und dann in einem beschissenen Blog ausgepackt, sobald Newton ihr das Herz gebrochen hat. Nachvollziehbar, aber auch unfassbar dämlich.
Wir lassen das Thema fallen und reden den Rest des Essens über Belanglosigkeiten. Lydia und ich haben ein paar Wochen lang miteinander geschlafen, bevor sie beschlossen hat, eine echte Beziehung zu wollen. Die konnte ich ihr nicht geben, und wenn ich ehrlich sein soll, wollte ich das auch gar nicht. Trotzdem sind wir etwas Ähnliches wie Freunde geblieben. Dass sie jetzt so eine Scheiße durchmachen muss, tut mir wirklich leid und befeuert meinen Hass auf die Newtons noch ein bisschen mehr.
Als Lydia mir irgendein Drama über ihre Mitbewohner erzählt, das mich wenig bis gar nicht interessiert, wandern meine Gedanken wie von selbst zu Charlotte Blossom. Vielleicht, weil mich das hier an unser Treffen erinnert. Mit der Ausnahme, dass sie nicht so viel geredet und nichts gegessen hat. Ein sehr kleiner Teil von mir will einfach nicht akzeptieren, dass sich unsere Zusammenarbeit erledigt hat. Nicht nur, dass sie als Quelle nicht mehr zur Verfügung steht, sondern auch, dass … Ach, Scheiße, keine Ahnung. Vielleicht, dass ich nicht herausfinden werde, ob ich sie geknackt hätte. Ob sie tatsächlich zu einer hirnlosen, ferngesteuerten Soldatin der Newton-Armee geworden wäre. Weil ich wirklich gerne gesehen hätte, wie sie dieser Sippe einen gewaltigen Arschtritt verpasst.
Wie sie erkennt, was für ein Arschloch Newton ist, und diesen Glaspalast von innen heraus zum Einsturz bringt.
3. KAPITEL
Roméo
Gähnend werfe ich meine Brieftasche und meinen Schlüssel auf die Kommode im Flur, kicke die Tür hinter mir zu und trete aus meinen Schuhen. Es ist nicht mal zehn, trotzdem bin ich absolut bereit fürs Bett. Die vergangenen Tage habe ich kaum geschlafen, und allmählich bekomme ich in jedem Zentimeter meines Körpers die Quittung zu spüren.
Mein Apartment liegt im dreiundvierzigsten Stock in einem der unzähligen Wolkenkratzer in Brickell und hätte mich mit seinen knapp zweihundert Quadratmetern über zwei Etagen unter normalen Umständen vermutlich um die zwei bis drei Millionen Dollar gekostet. Glücklicherweise sind die Umstände alles andere als normal, und dieses Gebäude gehört irgendjemandem aus meiner Familie – genau wie die halbe Stadt. Diese Bude ist deutlich zu groß für mich, aber ich will mich nicht über zu viel Platz beschweren.
Wie immer wandert mein Blick sofort zu der Fensterfront, die an klaren Tagen einen wirklich beeindruckenden Blick auf die Strandpromenade und Virginia Key bietet. Doch heute ist es regnerisch, sodass ich mehr oder weniger auf eine graue Wand hinausblicke. Immerhin ist es nicht so stürmisch, dass das Gebäude spürbar hin- und herschwankt. Eine Tatsache, an die ich mich nach meinem Einzug erst mal gewöhnen musste, weil ich immer das Gefühl hatte, der beschissene Wolkenkratzer würde jeden Moment umkippen wie ein Jenga-Turm.
Ich gehe zur Küche, die zusammen mit dem Wohn- und Esszimmer die gesamte untere Etage einnimmt und sich zur ersten Etage hin in eine Galerie öffnet, in der das Schlafzimmer liegt. Ich bemerke, dass sich ein paar Dinge verändert haben. Jeden Tag kommt eine Reinigungskraft vorbei, die mir offensichtlich durch die Blume zu sagen versucht, dass mein Einrichtungsstil scheiße ist. Oder der Geschmack der Interior Designerin, denn ich persönlich habe hier gar nichts ausgesucht. Jedes Mal, nachdem die Reinigungskraft da war, sind Dekoartikel vertauscht oder neu angeordnet, Decken kunstvoll drapiert, oder es wurden frische Blumen aufgestellt. Heute steht ein komplettes Blumenarrangement aus weißen Blüten auf dem gläsernen Couchtisch, die einen starken Kontrast zu der schwarzen Couch darstellen. Ich muss meinen Vater dringend mal fragen, ob das Reinigungspersonal eine Art Deko-Budget hat oder ob die mir das extra in Rechnung stellen.
Beladen mit zwei Stücken kalter Pizza und einem Bier lasse ich mich auf die Couch fallen und schalte den Fernseher ein. Dann entsperre ich mein Handy und öffne die Mail, die Lydia mir geschickt hat. Seit ein paar Wochen übernimmt sie die Medienanalyse und das Reputationsmanagement für mich und das Hotel meines Vaters. Keine Stelle, die wir normalerweise besetzt hätten, aber es ist leicht verdientes Geld, und das ist etwas, das Lydia im Moment wirklich gebrauchen kann. Und meinen Dad schert es nicht, für wen und welche Aufgaben er Gehaltsschecks ausstellt, also ist das keine große Sache. Seit dem Unfall auf der Rickenbacker soll Lydia die Berichterstattung im Auge behalten, weshalb sie mir jeden Tag einen Überblick der Meldungen zusammenstellt.
Ich nehme einen Schluck von meinem Bier und tippe auf den ersten Link. Ein Artikel aus dem Herald, dem offensichtlich gerade die Meldungen ausgehen. Es ist das dritte Mal innerhalb einer Woche, dass sie über den Vorfall berichten, was mir ein bisschen übertrieben vorkommt. Die Headline ist lächerlich reißerisch, und in dem Artikel versucht der unfassbar bescheuerte Autor, sich selbst die Frage zu beantworten, ob die ganze Sache eine Folge von Bandenkriegen ist oder mit irgendwelchen Kartellen zusammenhängt. Ich verdrehe die Augen. Im ersten Artikel sind alle von einem zusammenhanglosen Unfall ausgegangen, in dem zweiten von einem verkappten Suizidversuch – meiner bescheidenen Meinung nach bislang die dämlichste Theorie –, und jetzt sind wir anscheinend bei Bandenkriminalität angelangt. Was vielleicht sogar schlüssig wäre, wenn Charlotte Blossom kein Landei wäre, das zu dem Zeitpunkt erst seit einer Woche in Miami gelebt und gearbeitet hat. Hätte sie sich in der kurzen Zeit nicht nur einer Gang angeschlossen, sondern auch so weit hochgearbeitet, dass sie wichtig genug für einen Mordanschlag gewesen wäre, hätte man mit ihr eine wirklich talentierte Kriminelle verloren.
Routiniert suche ich den Artikel nach einer Erwähnung von Elijah ab. Meine Familie ist bis hoch zum beschissenen Bürgermeister gegangen, um Elijahs Namen aus den Medien rauszuhalten. Die offizielle Geschichte lautet, er habe für einen externen Fahrdienst gearbeitet, der mit der ganzen Sache nichts zu tun habe, sei nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen und habe es rechtzeitig aus dem Wagen herausgeschafft. Auch Charlies Name war lange unter Verschluss, was schätzungsweise den Newtons zu verdanken ist. Ich gebe es echt nicht gerne zu, aber diese Familie hat in Miami fast genauso viel Einfluss wie meine. Und ihnen ist sicher auch eine ganze Menge daran gelegen, den Namen ihrer Mitarbeiterin aus der Presse herauszuhalten. Aber natürlich wurden irgendwann beide Namen geleakt – Charlottes und Elijahs.
Ein paar Tage lang war es das Topthema, was vermutlich auch daran lag, dass die Rickenbacker Bridge eine Weile gesperrt war und ein ganzer Haufen Touris mit Fähren von Key Biscayne und Virginia Key gerettet werden musste. Inzwischen ist Gras über die Sache gewachsen, und in Miami passiert ständig etwas Spannenderes, worüber die Leute sich das Maul zerreißen können.
Ich gehe auch noch die anderen Berichte durch, doch im Grunde sind sie alle gleich. Der letzte Link ist eine Sammlung von Instagram-Bildern und TikToks. Ich kneife die Augen zusammen und versuche, auf jedes Detail zu achten, während ich mir die Fotos und Videos ansehe. Es macht mich verfickt noch mal wahnsinnig, dass ich nicht weiß, wer in diesem bescheuerten Van gesessen hat. Inzwischen wissen wir, dass das Auto geliehen war und sich die Spur der Insassen bei der Leihwagenfirma verläuft – es wurde bar bezahlt, und es wurden falsche Ausweispapiere hinterlegt. Immerhin sagt uns das ziemlich deutlich, dass es kein Unfall gewesen sein kann. Dafür wurde sich zu viel Mühe gegeben, unerkannt zu bleiben.
Die Tatsache, dass irgendjemand einen Anschlag auf meine Familie verübt, haut mich nicht aus den Latschen. Unter normalen Umständen würde ich keinen einzigen Gedanken daran verschwenden, sondern die Aufarbeitung den Handlangern von Gabriel überlassen, so wie sonst auch. Aber hier ging es nicht um mich oder ein anderes Familienmitglied. In diesem Auto saßen ein verhältnismäßig unwichtiger Bodyguard und eine Assistentin der Newtons. Entweder die Täter wussten nicht, wer sich in dem Wagen befand, oder sie hatten ein bestimmtes Ziel. Aber warum, verdammte Scheiße?
Am ehesten verdächtige ich die Newtons selbst. Diesen Menschen traue ich so ziemlich alles zu, und alles schließt versuchten Mord nun mal nicht aus. Vielleicht haben sie spitzgekriegt, dass Charlotte sich mit mir trifft oder gar für mich arbeitet, und sie wollten sie aus dem Weg schaffen. Schockieren würde es mich nicht. Ich wäre nicht einmal überrascht, wenn der Herald morgen darüber berichten würde, dass die Newtons auf ihren Gartenpartys Koalababys am Kebabspieß servieren.
Leider hat die Theorie einen Haken: Nach der Sache mit Lydia weiß ich, dass die Newtons erbarmungslos sind, wenn es um illoyale Mitarbeitende geht. Sollten sie Charlotte wirklich verdächtigen, würden sie sie nicht töten, sondern sie und ihre Familie aussaugen, bis nichts mehr von ihnen übrig ist. Sie und ihre Existenzgrundlage zerstören und dann noch mal ordentlich nachtreten. Das ist grausamer und bringt ihnen mehr Geld, als extra einen Hitman zu engagieren, um eine Assistentin aus dem Weg zu schaffen.
Oder nicht?
Stöhnend lasse ich den Kopf auf die Lehne des Sofas sinken und schließe die Augen. Die Fragezeichen in meinem Kopf fahren Achterbahn, und ich habe keine Ahnung, wie ich sie davon abhalten soll. Charlotte Blossom ist ein unbedeutender Niemand, und trotzdem nimmt sie einen verfickt großen Teil meiner Gedanken ein. Ich habe kein schlechtes Gewissen – immerhin war nicht ich derjenige, der sie von dieser Brücke gedrängt hat. Und trotzdem denke ich immer wieder darüber nach, ob ich einen Fehler gemacht habe. Was mir überhaupt nicht passt.
Das Problem ist, dass mein Onkel Antworten fordern wird, genau wie mein Vater. Es mag vielleicht nicht auf Platz eins seiner Prioritätenliste stehen – dafür sind sowohl ich als auch Elijah und Charlie zu unbedeutend –, aber irgendwann wird er wissen wollen, was passiert ist. Wer wo wann verkackt hat. Und es wird ihm überhaupt nicht gefallen, wenn ich keine Antwort auf diese Frage habe. Im schlimmsten Fall verliere ich meinen Job, meine Wohnung, meine finanziellen … Zuwendungen. Dann stehe ich vor dem Nichts, kann mir vermutlich nicht mal ein WG-Zimmer in Miami leisten und, je nach dem, wie sehr ich Gabriel verärgere, niemals wieder Fuß in dieser Stadt fassen. Wenn ich das hier in den Sand setze, wird er mich verstoßen, und dann wird es auch keine Rolle spielen, dass wir irgendwie miteinander verwandt sind.
Ich tippe auf einen der TikTok-Links und halte das Handy näher vor mein Gesicht, weil die Qualität dermaßen mies ist, als hätte der Kerl mit einem Toaster gefilmt. Das Video beginnt mit einem Knall, dann sieht man den SUV über die Kante der Brücke rutschen. Im Hintergrund hört man den Typen fluchen, der gefilmt hat. Er muss auf der Brücke gewesen sein, vielleicht in einem der Autos hinter Elijahs SUV gesessen haben und ausgestiegen sein, als die Kacke am Dampfen war. Offensichtlich steht er einfach da und schaut zu. Als wäre das, was sich vor ihm abspielt, ein beschissener Actionfilm.
Das Video beginnt von vorne, und ich zoome an das hintere Fenster auf der Fahrerseite heran. Der graue Himmel spiegelt sich in der Scheibe, das Video ist verwackelt, und die Auflösung ist auch nicht gerade hilfreich. Trotzdem erkenne ich den blassen Umriss von Charlottes Gesicht, dann den ihrer Hand, als sie gegen die Scheibe schlägt.
Mein Magen zieht sich zusammen. Obwohl ich ihr Gesicht kaum erkennen kann, wabert ihre Panik beinahe durch das Telefon zu mir ins Zimmer. Zwischen dem Aufprall des Vans, dem Brechen der Brüstung und dem Fall gibt es einen winzigen Moment, in dem die Welt ihren Atem angehalten hat. In dem das Auto stillsteht und Blossom gegen das Fenster schlägt. Dann rutscht der Wagen zurück, und die Schnauze richtet sich auf, während das Heck sich Richtung Ozean neigt, bevor es schließlich abrutscht.
»Verdammte Scheiße«, fluche ich, lege das Handy neben mich auf das Polster und reibe mir über die Augen.
Ich habe den Polizeibericht gelesen und mir den Unfall aus allen möglichen Perspektiven angesehen. Ich weiß, was passiert ist. Bei einem der Zusammenstöße mit dem Van hat der Rahmen des SUV sich verzogen. Was keine große Überraschung ist, weil der vordere Teil des Autos aussah, als wäre er wie eine beschissene Coladose zerdrückt worden. Das hat dazu geführt, dass die hinteren Türen sich nicht mehr so einfach öffnen ließen. Blossom war wie in einer Rattenfalle gefangen und –
Als ich den letzten Schluck Bier trinke, vibriert neben mir auf der Couch mein Handy und reißt mich aus den Gedanken. Einen Moment lang spiele ich mit dem Gedanken, es einfach zu ignorieren. Ich hasse Menschen, und mir fällt keine einzige Person ein, mit der ich gerade telefonieren oder texten wollen würde.
Aber dann greife ich doch danach, entsperre den Bildschirm und öffne den Chat.
Ein, zwei Sekunden lang starre ich mit hochgezogenen Brauen auf die drei Wörter.
Wir müssen reden!
Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Die Nachricht stammt von niemand Geringerem als Charlotte fucking Blossom.
4. KAPITEL
Charlotte
Ich bin so unglaublich frustriert. Egal, was ich tue, unter dem verdammten Gips hört mein Arm einfach nicht auf zu jucken. Kratzen kann ich mich nicht, und ich habe sämtliche Coping-Methoden ausprobiert, die Google mir geliefert hat: die Handfläche kratzen, den anderen Arm kratzen, leicht auf den Gips klopfen. Es wird nicht besser. Und ich bin ganz kurz davor, entweder einen Kochlöffel unter den Gips zu schieben oder mir das ganze Ding einfach vom Arm zu schneiden!
Als das Handy auf meinem Knie einen kurzen Ton von sich gibt, greife ich danach, um mir Favreaus Antwort anzusehen. Dabei rastet mein Herz in meiner Brust aus. Dem rationalen Teil meines Verstandes ist absolut klar, dass es dämlich ist, Roméo Favreau zu kontaktieren. Es war von vornherein dämlich, überhaupt mit ihm zu sprechen. Aber dass ich auf dem Rückweg von einem Treffen mit ihm von einer Brücke gedrängt wurde, ist wohl mehr als nur ein unauffälliger Wink des Schicksals.
Trotzdem öffne ich unseren Chat. Den Sturz habe ich offensichtlich überlebt, und außer einem Haarriss in einem Mittelhandknochen und ein paar blauen Flecken ist mir nichts passiert. Aber das war pures Glück. Hätte die Tür nicht in dem Moment nachgegeben, in dem ich über den Rand der Brücke gerutscht bin, wäre ich vermutlich ertrunken. Und ich will wissen, warum. Warum ich zusätzlich zu den körperlichen Verletzungen eine ausgewachsene Nahtoderfahrung kassiert habe.
Die Newtons reden kaum mit mir darüber – im Krankenhaus hat mich nur Gideon besucht, und der hat ausschließlich davon geredet, dass ich gesund werden und mir keine Gedanken machen soll. Nachdem ich gestern aus der Klinik entlassen wurde, habe ich lediglich Saeedi zu Gesicht bekommen, der ebenfalls kaum ein Wort mit mir gesprochen hat.
Sicher wollen sie mich nur schonen und mir Zeit geben, mich zu erholen.
Aber ich brauche verdammt noch mal Antworten. Und für die muss ich mich wohl an den Teufel höchstpersönlich wenden.
Seine Reaktion auf meine Nachricht ist wie erwartet dramatisch und übertrieben:
Du lebst, wie wundervoll! Und du kannst es offensichtlich nicht lange ohne mich aushalten. Ich fühle mich geschmeichelt. <3 xoxo und so
Wütend beiße ich die Zähne zusammen. Vielleicht war das eine noch dämlichere Idee als bereits befürchtet. Direkt nach dem Unfall habe ich mir im Krankenhaus geschworen, den Kontakt zu Roméo und dem gesamten Favreau-Clan zu beenden. Nicht nur wegen meiner Loyalität gegenüber den Newtons, sondern auch, weil ich an meinem Leben hänge. Diese ganze Sache auf der Rickenbacker Bridge hat einen Haufen Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und ich war einigermaßen optimistisch, dass die Favreaus sich zurückziehen und mich in Ruhe lassen würden, um Gras über die Sache wachsen zu lassen. Den Newtons habe ich erzählt, dass Elijah ein Uberfahrer war, und allem Anschein nach haben sie mir geglaubt.
Gegenüber der Polizei musste ich die Wahrheit sagen, was mir verdammt schwergefallen ist. Ich weiß, wie mächtig die Newtons sind, und ich habe noch immer panische Angst davor, dass sie ihre Beziehungen nutzen und die Wahrheit herausfinden, auch wenn der Cop mir versichert hat, dass dieses Detail vertraulich bleibt. Ihm habe ich gesagt, dass ich einer Einladung von Roméo gefolgt bin, der mich abwerben wollte, und abgelehnt habe. Das entspricht mehr oder weniger der Wahrheit, ist aber hoffentlich unspektakulär genug, um das MPD nicht weiter zu beschäftigen.
Denn aus irgendeinem Grund bin ich mir sicher, dass die Insassen des Vans, der uns von der Brücke geschoben hat, nicht zu den Favreaus gehörten. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, die ganze Sache von sämtlichen Seiten beleuchtet. Die Favreaus hätten keinerlei Nutzen davon, mich und möglicherweise auch Elijah umzubringen. Keinen. Roméo hat die Informationen, wegen derer er mich erpresst hat, nie bekommen. Dafür hätte er warten müssen, bis ich zu Hause bin. Und selbst wenn er oder jemand aus seiner Familie herausgefunden hat, dass ich ihn verarschen wollte, wäre diese Art der … Beseitigung absolut dämlich. Mich dermaßen öffentlich und medienwirksam aus dem Weg zu schaffen, würde null Sinn ergeben. Hätten sie mich tatsächlich umbringen wollen, dann hätten sie es still und heimlich tun können. Im Wagen oder in dem Beach Club, in dem ich mich mit Roméo getroffen habe. Sie hätten unzählige Möglichkeiten dazu gehabt, ohne Tausende Zuschauer, die sofort ihre Handys zücken.
Nein, ich glaube wirklich nicht, dass die Favreaus ihre Finger im Spiel hatten. Was entweder bedeutet, dass es aus heiterem Himmel irgendwelche Dritten auf mich abgesehen haben, oder dass ich zur falschen Zeit am falschen Ort war und das Ziel eigentlich jemand anderes war. Elijah vielleicht, oder Roméo und die Arschlöcher sind davon ausgegangen, dass er auf der Rückbank sitzt, nicht ich.
All das sind reine Spekulationen, und die letzten Tage haben mir bewiesen, dass ich ohne Hilfe nicht weiterkomme. Gideon verhält sich schon wieder reserviert und geht mir eindeutig aus dem Weg. Mit ihm kann ich aus so vielen unterschiedlichen Gründen nicht reden, das Gleiche gilt für Saeedi.
Bleibt nur noch Roméo, auch wenn jeder einigermaßen vernünftige Teil von mir mich anschreit, mich so weit wie möglich von ihm fernzuhalten.
Ich lege das Handy wieder auf meinem Oberschenkel ab und tippe eine Antwort, was mit einer Hand unerträglich lange dauert. Glücklicherweise habe ich mir nicht die rechte Hand gebrochen … Falls man in dieser ganzen Angelegenheit überhaupt von so etwas wie Glück sprechen kann.
Triff mich morgen in der Stadt. Vier Uhr. Ich schicke dir meinen Standort, wenn ich da bin. Ich fahre selbst hin und auch wieder zurück, klar?
Die ganze Situation ist überhaupt nicht lustig, trotzdem muss ich grinsen, als ich die letzten Worte tippe. Vielleicht hat mein Verstand bei dem Sturz ins Wasser Schaden genommen. Anders kann ich mir nicht erklären, warum ich nicht mich vor und zurück wiegend in einer Ecke sitze.
Jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, kehren die Bilder jenes Abends zurück. Ich fühle noch immer, wie ich vom Sitz abgehoben und gegen die Lehne vor mir geknallt bin, als das Auto gefallen ist. Sehe die spiegelnde Wasseroberfläche unter mir, die immer schneller auf mich zurast. Wenn ich daran denke, wie kalt das Wasser war und wie dunkel, als es über mir zusammengeschlagen ist, erinnert nichts mehr an die malerische Schönheit, die ich vorher mit der Biscayne Bay verbunden habe. An diesem Tag war das nicht das überraschend blaue, saubere Wasser, in dem ich mit Gideon geschwommen bin. Es fühlte sich eher so an, als wäre ich in die stürmischen Wellen der Nordsee gefallen. Ich erinnere mich an das Brennen in meinen Lungen, weil ich nicht rechtzeitig Luft geholt habe, und daran, wie der Sog des sinkenden Wagens mich runtergezogen hat. An die wachsende Panik, je knapper der Sauerstoff wurde. Den Schmerz in meiner Hand habe ich überhaupt nicht registriert, und mir wurde erst im Krankenhaus gesagt, dass sie gebrochen ist.
Unwillkürlich schüttle ich den Kopf, um die Erinnerungen zu vertreiben. Ich bin nahezu unverletzt und habe überlebt. Darauf muss ich mich konzentrieren. Ich habe es aus dem Wagen geschafft, bin nicht ertrunken und wurde auch nicht von irgendwelchen Trümmern getroffen.
Ich habe überlebt.
Als Roméo dieses Mal antwortet, ist die Nachricht überraschend knapp. Ein einfacher Daumen hoch, was mich ein bisschen verwirrt. So, wie ich Favreau bislang kennengelernt habe, redet er grundsätzlich eher zu viel als zu wenig.
Ein Klopfen an der Tür reißt mich aus meinen Gedanken. Ich zucke so heftig zusammen, dass ich mir den Gipsarm an der Sofalehne anstoße und zischend ausatme, dann drehe ich mich um und schaue zur Tür. Durch die Mosaikglasfenster erkenne ich einen Schatten, mehr nicht. Draußen dämmert es bereits.
»Wer ist da?«, rufe ich, während ich aufstehe. Meine Paranoia ist inzwischen unendlich groß, und halb rechne ich damit, erneut Bekanntschaft mit einer dieser widerlichen weißen Masken zu machen.
Ich will gerade die Ringkamera checken, als Gideons Stimme gedämpft antwortet: »Ich bin’s. Lass mich rein.«
Der Anflug von Erleichterung, der sich kurzzeitig in meinem Inneren breit gemacht hat, wird von Nervosität abgelöst. Seit seinem Besuch im Krankenhaus hat Gideon nicht mehr mit mir gesprochen, mir nicht mal geschrieben, geschweige denn mich in Coach House besucht. Dass er jetzt hier auftaucht, könnte durchaus bedeuten, dass die Newtons etwas herausgefunden haben. Und ihn schicken, um mit mir zu sprechen.
Trotz des unguten Gefühls in meiner Magengegend öffne ich die Tür, ich kann ihn schließlich nicht einfach wegschicken.
Gideon hat die Hände in den Taschen seiner Anzughose vergraben. Er trägt ein Hemd, das an den Armen hochgekrempelt ist, und ein paar der Knöpfe stehen offen. Anscheinend kommt er aus dem Büro.
Bei seinem Anblick passieren viele seltsame Dinge in meinem Inneren, die ich lieber nicht so genau analysieren will. Trotz meiner Nervosität und meinem Misstrauen merke ich, dass ich ihn vermisst habe. Am liebsten würde ich ihn umarmen, meine Augen schließen und einen Moment lang die Dramen meines Lebens aussperren.
Aber das tue ich nicht. Dafür ist die Situation zu verrückt und meine Angst davor, dass er etwas herausgefunden hat, zu groß.
»Komm rein«, sage ich und räuspere mich, als ich höre, wie kratzig meine Stimme klingt. Ich trete beiseite, um Gideon Platz zu machen.
Wortlos geht er an mir vorbei zur Kücheninsel, dreht sich wieder zu mir um und lehnt sich dagegen. Einen Augenblick lang mustert er mich von oben bis unten. Sein unergründlicher Blick tastet meinen Körper ab, als würde er nach versteckten Waffen oder Verletzungen suchen. Als er mir wieder in die Augen schaut, spiegeln sich plötzlich so viele Gefühle in seinem Gesicht, dass ich unwillkürlich einen Schritt auf ihn zumache.
»Ist was?«, frage ich, sofort angespannt.
Er schüttelt den Kopf und hebt einen Mundwinkel, was mich ein bisschen beruhigt. »Alles gut. Wie geht es dir?«
Ich zucke mit den Schultern. »Gut. Die Hand tut kaum weh, und sonst ist ja nichts passiert.«
Gideon schnaubt. »Das sehe ich anders. Es hat mich fast umgebracht, dich nicht zu sehen.«
Die Verwirrung in meinem Inneren wächst. Ohne ihn aus den Augen zu lassen, setze ich mich auf die Couch und ziehe die Beine zu mir auf das Polster. Er sieht müde aus. Seine Augen scheinen ein wenig tiefer in den Höhlen zu liegen, und der übliche Bartschatten ist nun ein ausgewachsener Dreitagebart.
»Warum bist du dann nicht einfach zu mir gekommen?«, frage ich. Auch wenn ich mir Mühe gebe, kann ich den leicht vorwurfsvollen Ton in meiner Stimme nicht unterdrücken. Bevor ich von einer Brücke in die Biscayne Bay gedrängt wurde, stand es komisch zwischen mir und Gideon. Erst der Sex, dann der Anruf seiner Mom und das ganze Chaos der Beinahe-Entführung seiner Schwester …
Gideon und ich haben weder über unsere gemeinsame Nacht auf der Eliza noch über unsere Gefühle zueinander gesprochen, trotzdem hat es mich verletzt, dass er nach dem Unfall so abweisend war. Jetzt erlaube ich es mir, das zuzugeben.
»Es ist …«, beginnt er, bricht aber ab, weil er offensichtlich nicht weiß, was er sagen soll. Dann zuckt er ein wenig hilflos mit den Schultern. »Kompliziert.«
Schnaubend umfasse ich meine Knie mit den Armen, dann fällt mir der Gips wieder ein, und ich lasse los. »Das klingt wie der Beziehungsstatus einer Dreizehnjährigen auf Facebook«, sage ich. Gideon verzieht das Gesicht, und ich seufze. »Gideon, hör zu. Ich habe Kopfschmerzen und bin wirklich frustriert über die ganze Situation. Können wir uns einfach darauf einigen, nicht um den heißen Brei herumzureden? Du bist zu mir gekommen, also lass dir nicht alles aus der Nase ziehen … Bitte.«
Er antwortet nicht sofort. Die Unruhe in meinem Inneren wird immer schlimmer, also stehe ich auf und gehe hinüber zur Küche, um meinen Händen und meinem Verstand etwas zu tun zu geben. Meine Mahlzeiten der letzten Tage bestanden hauptsächlich aus Resten, die Saeedi oder die Hauswirtschafterin Melanie mir vorbeigebracht haben, also ist die Spülmaschine immerhin schön voll. Ich ziehe das untere Gitter heraus und beginne, die Teller wegzuräumen, während Gideon mich beobachtet.
»Ich will dich etwas fragen«, sagt er schließlich, nachdem er anscheinend seine Gedanken geordnet hat. Er hat sich zu mir umgedreht und die Arme vor der Brust verschränkt, als würde er eine Barriere zwischen uns errichten wollen.
Ich mache eine auffordernde Handbewegung. »Schieß los.«
Wieder zögert er. Ich wollte gerade nach einer Tasse greifen und sie in einen der Hängeschränke räumen, halte jetzt aber inne und schaue Gideon unsicher an. Irgendwie verhält er sich komisch, auch wenn ich nicht genau festmachen kann, woran es liegt.
»Der Unfall«, beginnt er schließlich. Mir wird schlecht, doch ich versuche, es mir nicht anmerken zu lassen. »Was genau war an dem Tag los?«
Mir rutscht das Herz in die Hose. »Das habe ich schon alles Saeedi erzählt.«
Er legt den Kopf schief. »Ich weiß, und ich habe seinen Bericht gelesen. Aber da sind immer noch ein, zwei Sachen, die für mich keinen Sinn ergeben.«
Scheiße. Am liebsten würde ich einfach weglaufen, doch das würde alles noch schlimmer machen.
Ich schließe die Spülmaschine und lehne mich gegen die Arbeitsplatte. »Okay, was willst du wissen?«
»Wo warst du? Auf dem Festland, meine ich.«
»Tampons kaufen«, antworte ich schnell. Vielleicht ein wenig zu schnell. »Das habe ich dir doch gesagt.«
»Hast du«, antwortet er langsam. »Aber es gibt auch Geschäfte auf Key Biscayne. Oder Virginia Key. Warum bist du nach Miami gefahren?«
Ich öffne den Mund, schließe ihn dann aber wieder, weil ich nicht weiß, was ich darauf antworten soll. Diese Frage hat Saeedi mir nicht gestellt, und ehrlich gesagt ist mir diese Lücke in meiner Geschichte in der ganzen Aufregung nach dem Unfall nie so richtig aufgefallen.
»Ich brauchte ein paar Sachen«, antworte ich so selbstsicher wie möglich. »Und hier kenne ich mich nicht aus, also bin ich einfach dahin gefahren, wo ich schon mal war. Ich hatte Pause, also habe ich nicht gedacht, dass das ein Problem ist.«
Ich könnte mich täuschen, doch ich meine, dass Gideons Augen sich ein kleines bisschen verengen. »Du hast ein Uber genommen?«
»Ja.«
»Du hättest Arthur fragen oder einen unserer Wagen nehmen können.«
»Hier war so viel los, also wollte ich Arthur nicht behelligen«, antworte ich müde. »Und es macht mich nervös, eure teuren Autos zu fahren. In der normalen Welt ruft man sich ständig ein Uber, Gideon.«
»Das war ein schickes Auto für ein Uber.«
Hoffentlich unbeeindruckt zucke ich mit den Schultern. Ich würde gerne genau wie er meine Arme vor der Brust verschränken, nur würde mein Gipsarm da vermutlich nicht mitmachen. »Was weiß ich, Gideon. Ich habe eine Fahrt gebucht, und der Kerl ist aufgetaucht. Was soll ich dazu sagen?«
Er mustert mich ein paar Sekunden, die mir wie Minuten vorkommen. »Weißt du, meine Eltern gehen davon aus, dass diejenigen, die für deinen Unfall verantwortlich sind, die Gleichen sind, die versucht haben, Daphne zu entführen.«
»Ach ja?«, frage ich tonlos.
Gideon nickt. »Zwei zusammenhanglose Anschläge auf ein Mitglied der Familie und eine Mitarbeitende an einem Tag halten sie für einen zu großen Zufall.«
Ich unterdrücke den Drang, mir auf die Lippe zu beißen. Saeedi hat eine ähnliche Theorie geäußert, und ehrlich gesagt war ich einfach nur erleichtert darüber, dass die Newtons sich irgendeine Erklärung zusammenspinnen, die nichts mit meiner Verbindung zu Roméo Favreau zu tun hat und damit auch nicht unter Vertragsbruch fällt.
Dem Misstrauen in seinen Augen und seinem leicht fragenden Unterton zufolge scheint Gideon alles andere als überzeugt von dieser Theorie.
5. KAPITEL
Charlotte
Die Unruhe in meinem Inneren wächst mit jeder Sekunde. Ich halte Gideons Blick stand, doch es fällt mir verdammt schwer. Ein Teil von mir ist wütend und enttäuscht, weil er mir offensichtlich misstraut. Allerdings bin ich nicht scheinheilig genug, um die Doppelmoral darin zu verkennen. Immerhin hat Gideon jeden Grund, meine Geschichte anzuzweifeln. Ich war nicht los, um Tampons zu kaufen. Ich habe nicht mal meine Periode. Stattdessen habe ich mich mit seinem Erzfeind getroffen.
Aber ich wurde dazu gezwungen. Und Gideons Stimme klingt nicht, als würde er mich retten oder beschützen, sondern als würde er mich vor das nächste Schiedsgericht stellen wollen.
»Was willst du wissen, Gideon?«, frage ich beinahe herausfordernd. »Ich kann dir nicht mehr sagen, als ich bereits Saeedi und der Polizei gesagt habe. Ich weiß nicht, wer uns von der Brücke gedrängt hat, und ich kenne auch den Fahrer nicht. Ich kann dir da nicht weiterhelfen.«
Ein paar Sekunden lang starrt er mich noch an, dann atmet er geräuschvoll aus. »Bitte entschuldige«, sagt er und reibt sich mit einer Hand über das Gesicht. »Ich will dich nicht anmachen, das alles ist nur so dermaßen … verwirrend.«
»Wem sagst du das«, antworte ich vorsichtig. Ich kann nicht ganz glauben, dass ich so einfach aus der Nummer herauskomme. Ein Teil von mir hat die ganzen letzten Tage damit gerechnet, von den Newtons gefeuert und in Grund und Boden verklagt zu werden.
Seine Schultern sacken herab. »Du hättest sterben können.«
Mit einem halbherzigen Grinsen lege ich den Kopf schief. »Meine Überlebenschancen standen ganz gut. Der Feuerwehrmann meinte, selbst wenn ich die Tür nicht aufbekommen hätte, wäre ich wahrscheinlich durch die zerstörten Fenster entkommen. Schwierig wäre es gewesen, wenn das Auto auf mich draufgefallen wäre.«
Gideon verzieht das Gesicht, als wolle er sich dieses Szenario lieber nicht so genau vorstellen. »Wie geht es deiner Hand?«
»Tut nur ein bisschen weh. Es ist lediglich ein Haarriss.«
»Ich weiß, ich habe mir deine Krankenhausakte angesehen.«
Langsam hebe ich eine Augenbraue. »Das sind vertrauliche Unterlagen, Gideon.«
»Jeder Mensch hat seinen Preis, Blossom«, bemerkt er grinsend. »Vor allem kriminell unterbezahltes Pflegepersonal.«