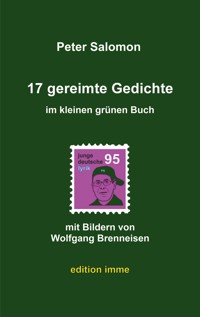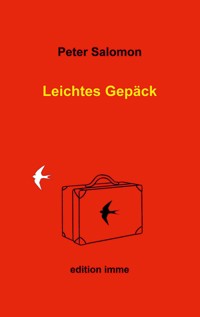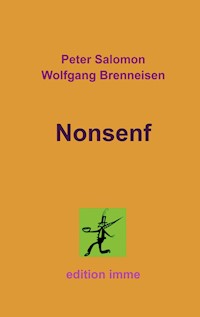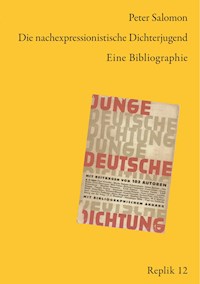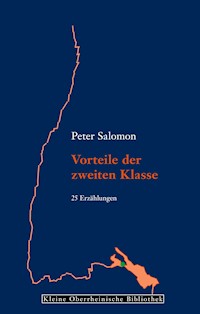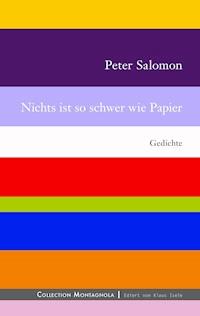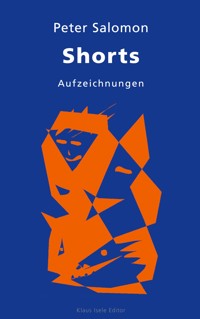
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese von Peter Salomon SHORTS genannten Aufzeichnungen sind die Fortschreibung seines 2020 erschienenen Buches HOT PANTS. Der Autor notiert, was ihm wichtig erscheint: in der Gegenwart, aber auch weit in die Vergangenheit zurückschweifend. Dadurch wird dieser Band zu einer Autobiographie des Originals Peter Salomon über sein Leben in Berlin und Konstanz der letzten 75 Jahre. Mit schrägem Humor, Ironie, Narzissmus und subtilen Provokationen (insbesondere wenn es um Sex-Themen geht) lässt er die Leser teilhaben an seinem Lebenskosmos, in dem es bunt, gelehrt, skurril, aber nur selten langweilig zugeht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Redaktionelle Notiz
Diese Textsammlung hat zahlreiche Urbilder in der Realität, von denen das eine oder andere Detail übernommen wurde. Die Personen, die Eigenschaften, die Handlungen und die Ereignisse und Situationen, die sich dabei ergeben, sind jedoch fiktiv. Die Namen lebender Personen wurden verändert, bei Personen des öffentlichen Lebens aber nicht.
Autor und Verleger danken Hans Dieter Schäfer, Regensburg, für seine Ideen zur Optimierung einzelner Notate und seine Hilfe bei der Schlussredaktion des Buchmanuskriptes.
Inhaltsverzeichnis
Textbeginn
Über den Autor
Das literarische Werk von Peter Salomon
Als Rechtsanwalt unterlag ich der Schweigepflicht und hatte sie so verinnerlicht, dass ich auch im privaten Bereich die personifizierte Diskretion war. Mit einundfünfzig Jahren gab ich den Rechtsanwaltsberuf auf. Zwanzig Jahre später erinnere ich mich an meine vielen Geheimnisse und möchte manche offenbaren. Ich googele dauernd, ob die betroffenen Personen und Familien noch leben oder inzwischen tot sind, damit ich endlich auspacken kann
Es war einmal: Er hieß Klaus Liefke. Er wohnte in dem großen Mietshaus genau gegenüber von unserem in der Landhausstraße. Aber unseres war viel gepflegter. Und wir hatten eine Fünf-Zimmer Wohnung. Das Haus gegenüber hatte noch Bombenschäden. Es war nur zur Hälfte bewohnt. Klaus Liefke hatte ein kleines spitziges Gesicht. Er war sehr blass und schmächtig. Wir gingen in die gleiche Klasse der Schule am Nikolsburger Platz und hin und zurück gingen wir immer gemeinsam. Wir müssen ein netter Anblick gewesen sein. Einmal fotografierte uns ein Journalist. Er ließ uns durch das feuchte Herbstlaub stapfen. Das Foto, das am nächsten Tag im Tagesspiegel gedruckt war, zeigt uns am Bordstein sitzend über unsere Schulhefte gebeugt. Die Bildunterschrift hieß: Einmal wurden noch zünftig Schularbeiten gemacht – dann wehte der Herbstwind alle Sorgen beiseite und die Ferien waren gekommen.
Die Eltern schimpften, der Zeitungsfotograf sei bestimmt Päderast und sein Job nur eine Methode, um hübsche Jungens fotografieren zu können. Der Zeitungsausschnitt ist das einzige Bild, das ich von Klaus Liefke habe. In den Ferien kletterten wir zusammen in den Ruinen. In einem Keller fanden wir Gasmasken und eine achteckige Stabbrandbombe. Mit der drosch ich auf einen morschen Baumstumpf ein, dass die Holzsplitter flogen. Klaus meinte, wir sollten besser weglaufen, und ich rannte hinter ihm her. Einmal war ich bei ihm zu Hause. Der Vater machte uns jedem ein Margarinebrot, dick bestreut mit Zucker. Das kannte ich nicht, es schmeckte gut. Bei uns bot uns die Mutter Pralinen von Hamacher an, der exklusiven Berliner Schokoladen-Manufaktur. Als ich sagte, bei Klaus habe es aber leckere Zuckerbrote gegeben, sagte die Mutter:
»Das sind auch ganz arme Leute.«
Mein Zeugnis war nicht so gut, wie es die Mutter von mir erwartet hatte. Sie bat um einen Besprechungstermin bei unserer Klassenlehrerin Frau Zilias. Frau Zilias sagte zur Mutter:
»Sie sollten darauf achten, dass Peter nicht immer mit dem Klaus Liefke zusammen ist, das ist kein Umgang für Peter.«
Ich habe keine weiteren Erinnerungen an Klaus.
Kurz darauf sind wir in unser Haus im Grunewald gezogen
Bei Blech denkt man an was ganz Billiges. Aber Blech kann auch aus Gold sein. Der österreichische Vierfach-Dukaten ist sehr groß und nur aus 0,7 mm dickem Gold – dünnes Blech, das man ohne viel Kraft verbiegen kann. Es gibt den Begriff Blech reden, rede nicht so ein Blech. Das ist dann sicher aus Zink. Reden sei Silber, Schweigen Gold – man kommt ganz durcheinander
Bundeswehr-Soldaten heißen jetzt Bundeswehr-Mitarbeiter. Das klingt zivil und ist es wohl auch. Im Kriegsfall könnten Betriebsrat und Gewerkschaft zum Streik aufrufen. Oder, wenn sie gerade für eine Lohnerhöhung streiken, wäre das eine gute Gelegenheit für einen Überraschungs-Angriff des Feindes. Nachtrag: Der Beruf eines Mannes, der im Fernsehen auftritt, wird als »Fachmann für Abfallwirtschaft« angegeben. Ist das der klassische Müllmann?
Der letzte Mensch – manchmal ist davon die Rede. Eher kann ich mir den letzten Baum vorstellen. Ich erinnere mich an einem Witz: Der letzte Mensch springt von einem Hochhaus; als er am dritten Stockwerk vorbeikommt, klingelt das Telefon. Der letzte Mensch – das ist eine Fiktion
Es gibt viele Könige, die niemand kennt; zum Beispiel Manuel I. von Portugal, genannt »Manuel der Glückliche«
Das Phantom des Freien Schriftstellers: Als Schriftsteller habe ich mich in meinem Tun immer ziemlich frei gefühlt, unabhängig. Nach dem Abitur begann der völlig Unbekannte damit, seine ersten Texte an Zeitschriften zu schicken, und immer öfter wurde etwas gedruckt.
Ich studierte dann Rechtswissenschaften, was mir nicht besonders schwerfiel. Deshalb konnte ich daneben Vorlesungen der Literaturwissenschaft hören, allerdings ohne dort Prüfungen abzulegen (immerhin erhielt ich einen Schein von Peter Szondi). Außerdem baute ich das Publizieren verstreuter Texte aus. Eines Tages erschien eine Rezension über eine Literaturzeitschrift, und als der Kritiker einige der darin gedruckten Autoren aufzählte, hieß es: »Und natürlich fehlt auch der unvermeidliche Peter Salomon nicht.« Ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich schon so oft gedruckt worden war.
Nach den juristischen Staatsexamina entschied ich mich, als Rechtsanwalt mein Brot zu verdienen und gleichzeitig als Autor zu arbeiten. Um dafür die nötige Freiheit zu behalten, begann ich als angestellter Rechtsanwalt mit dreieinhalb Bürotagen die Woche, die anderen dreieinhalb Tage hatte ich für die Schriftstellerei. Allerdings wagte ich als Angestellter in der Kleinstadt nicht, über meine Homosexualität zu schreiben und eine Anthologie mit homosexuellen Texten herauszugeben, die ich zusammengestellt hatte. Ich war unfrei aus Furcht vor Abmahnung oder gar Kündigung.
Nach vier Jahren machte ich mich selbstständig und behielt die Arbeitsverteilung von dreieinhalb zu dreieinhalb Tagen bei. Von Dienstag bis Freitag-Mittag war ich im Büro. Freitag-Nachmittag bis einschließlich Montag arbeitete ich zuhause. Wenn ein Mandant für Montag einen Termin wollte, war die offizielle Ansage: »Herr Salomon hat Montag ganztags einen auswärtigen Termin.« Wenn mal ein Gerichtstermin kollidierte, ließ sich die Regel nicht immer konsequent durchhalten – dann improvisierte ich eben und nahm einen anderen Tag frei für die Literatur.
Während der zwanzig Jahre meiner Anwaltstätigkeit fiel mir auf, dass ich von Institutionen der Literatur und Kollegen, die Funktionsträger waren, bei manchen Dingen ausgeschlossen wurde. Zum Beispiel bekam ich lange keine Literaturpreise und nur wenige Stipendien, auch gut bezahlte Lesungen gingen an mir vorbei. Ich hörte wiederholt: Als gutverdienender Anwalt hast du das ja nicht so nötig wie die Freien Schriftsteller, die davon leben müssen. Bei dieser Art Schriftstellerförderung steht mehr die soziale Komponente im Vordergrund; dass Preise auch Wertschätzung verkörpern und das öffentliche Ansehen eines Autors befördern, ist ein Aspekt, der bei der Preisvergabe meistens zu kurz kommt. Einen Preis bekommt bevorzugt der bedürftige »Freie Schriftsteller« – die Qualität des Werkes hat nicht die erste Priorität.
Und irgendwie leuchtete mir das sogar ein bisschen ein. Denn die sogenannten Freien Schriftsteller, die ich kenne, leben ja ein Sklavendasein und stehen finanziell alle schlecht da. Sie sind bis auf das Dutzend Bestsellerautoren alles arme Hunde.
Es fiel mir aber auch auf, dass sie den Begriff »Freier Schriftsteller« wie ein Qualitätssiegel benutzen. Als sei der Schriftsteller, der außer der Schriftstellerei keinen Beruf hat, der bessere Schriftsteller. Suggeriert wird, dass er seine ganze Arbeitszeit auf die Literatur verwenden und deshalb gründlicher arbeiten kann als der Autor mit Brotberuf.
Perfide fand ich, dass ich immer wieder einmal von diesen sog. »Freien« in Zeitungsberichten oder Rezensionen als »dichtender Rechtsanwalt« bezeichnet wurde, so als sei ich ein Amateur oder, schlimmer, ein Dilettant. Ein Maler, der auch Richter ist, ist »der malende Richter« und »dichtende Ärzte« – naja, Gottfried Benn war da wohl die Ausnahme von der Regel?
Viele sog. »Freie Schriftsteller« brauchen wohl diese Lebenslüge, um ihr Dasein zu ertragen: Sie sind zwar abhängig, sie sind zwar arm, aber sie sind frei und keine Dilettanten. Das ist die Mär.
Aber sie sind durch und durch abhängig, die sog Freien, weil sie einen großen Teil ihrer Zeit in Antichambrieren investieren müssen: Bei Zeitungen, Verlagen, Rundfunkanstalten usw. Sie müssen Bücher herausgeben, obwohl ihnen das Thema nicht am Herzen liegt. Sie müssen übersetzen und lektorieren, bzw. sie dürfen das für wenig Honorar, wenn ihr Antichambrieren gefruchtet hat. Viele erringen ein Funktionärsamt in einem Schriftstellerverband und sind dann für eine gewisse Zeit näher an den Futterstellen. Und die Spesen nicht vergessen! Dafür müssen sie ständig Vereinsmeierei betreiben und in Sitzungen ihre Zeit vertrödeln. Und dann müssen sie Aufenthaltsstipendien annehmen. Es gibt 1500 Euro im Monat, dafür darfst du ein halbes Jahr irgendwo in der Provinz in einer Schriftstellerwohnung leben, du musst Schullesungen machen und öffentliche Termine absolvieren. Deine Arbeitsbibliothek, deine literarischen Halbfabrikate sind zuhause. Aber natürlich solltest du und willst du etwas Neues schreiben, einfach so aus dem hohlen Bauch in einer fremden Wohnung. Ob das funktioniert?
Am freiesten ist man als Schriftsteller, wenn man von Haus aus vermögend ist und keiner Erwerbstätigkeit nachgehen muss. Der Reiche ist der wirklich freie Schriftsteller. Wenn er reich genug ist, hat er auch die Möglichkeit, für die Zufuhr an Lebensstoff zu sorgen, ohne den gute Literatur nicht entstehen kann.
Wenn man aber seinen Lebensunterhalt selbst durch Arbeit verdienen muß, ist man »Freier Autor« am besten als selbstständiger Rechtsanwalt oder in anderen sog. »freien« Berufen. Man kann in Grenzen frei über seine Zeit verfügen, man bekommt was mit vom Leben, hat also immer genügend Stoffzufuhr fürs Schreiben, und man hat genug Geld zum Leben.
Die Mär vom Freien Autor, der nur fürs Schreiben und vom Schreiben lebt, ist eine Lebenslüge. Der Autor mit Brotberuf ist freier und hat mehr Lebenszufuhr von außen. Eine Handvoll Ausnahmen bestätigen die Regel
Ein ausgezeichneter Schriftsteller: 1998 erhielt Philip Roth für Amerikanisches Idyll den Pulitzerpreis. Im selben Jahr wurde ihm im Weißen Haus die National Medal of Arts verliehen, und 2001 erhielt er die höchste Auszeichnung der American Academy of Arts and Letters, die Gold Medal, mit der unter anderem John Dos Passos, William Faulkner und Saul Bellow ausgezeichnet wurden. Er hat zweimal den National Book Award, den National Book Critics Circle Award und dreimal den PEN / Faulkner Award erhalten. 2005 zeichnete die Society of American Historians Verschwörung gegen Amerika als den bedeutendsten historischen Roman zu einer amerikanischen Thematik im Jahr 2003-2004 aus. Philip Roth gewann den Man Booker International Prize 2011. Vor kurzem hat er die beiden prestigereichsten Preise des PEN erhalten: 2006 wurde er mit dem PEN / Nabokov Award für ein Gesamtkunstwerk von andauernder Originalität und vollendeter Kunstfertigkeit und 2007 mit dem PEN / Saul Bellow Award für Archievement in American Fiction ausgezeichnet, der einem Schriftsteller verliehen wird, der dank seiner Leistungen während einer langen Laufbahn den höchsten Rang innerhalb der amerikanischen Literatur einnimmt. Philip Roth ist der einzige lebende amerikanische Autor, dessen Werk in einer umfassenden, maßgeblichen Gesamtausgabe von der Library of America herausgegeben wird. Der letzte der acht Bände ist 2013 erschienen. Anmerkung: Dieser Text ist ein Fundstück aus dem rororo-Taschenbuch 25565, Philip Roth, Portnoys Beschwerden, 2016, Seite 2. Dort, wo üblicherweise eine Vorschau auf das Buch steht und eine kleine autobiografische Notiz zum Autor, findet sich dieses hübsche Prosastück. Nur die Überschrift wurde von mir hinzugefügt. Was sagt uns diese gigantische Beweihräucherung? Sie sagt uns, dass noch der Nobelpreis fehlt. Philip Roth ist 2018 gestorben, ohne ihn bekommen zu haben
Ich habe in meiner Bibliothek eine Abteilung Zeitgenössische Literatur. Viele der Autoren habe ich persönlich kennengelernt. Nehme ich jetzt ein Buch heraus, ist der Autor meistens schon tot. Aus der zeitgenössischen Bibliothek ist eine Art Friedhof geworden
Jetzt geht die Sonne auf: Einmal fand das Treffen der jungen Autoren vom Bodensee in Haltnau bei Meersburg statt – oder in Hagnau. Es war schätzungsweise im Jahre 1980. Hans Georg Bulla und ich fuhren zusammen hin. Mit dem Bus der Linie 1 bis zum Fährehafen, dann mit der Fähre nach Meersburg – und dann ein schöner Fußweg am Seeufer entlang. Hans Georg kannte die Weinstube und machte den Führer. Ein paar Kollegen waren schon da, als wir ankamen. Ich setzte mich an die Kopfseite des langen Tisches mit Blick zur Tür, ein guter Platz, den die anderen freigelassen hatten, vermutlich für IHN. Es hieß: Angeblich will auch der Walser heute kommen, Peter Renz will ihn mitbringen. Peter Renz gehörte zu unserer Generation der Jungen, aber er war mit Martin Walser befreundet, hieß es. Die Tür ging auf, Peter Renz kam rein, hinterher Martin Walser. Wir sahen alle still zur Tür. Martin Walser trat an den Tisch, machte eine große ausholende Armbewegung und sagte mit lauter Stimme: »Jetzt geht die Sonne auf.« Peter Renz sagte: »Na, dann setz dich mal, Martin!«
Hans Dieter Schäfer schickte mir die neueste Nummer der Literaturzeitschrift »Sinn und Form« mit zwei seiner neuen Gedichte. Darin auch ein Nachlasstext von Günter Kunert mit Erinnerungen an Bertolt Brecht. Brecht hat noch mit dem Dichter Edgar Lee Masters korrespondiert, dem Autor der Spoon River Anthologie. Gerne würde ich die Briefe lesen. Sodann erfährt man, dass Brecht seine pornografischen Sonette, »höchst scharfe Sachen«, wie Kunert schreibt, im Manuskript alle sorgfältig mit dem Namen »Thomas Mann« signiert habe. Diese Sonette sind erst 1982 aus dem Nachlass veröffentlicht worden, und zwar in dem Sammelband »Gedichte über die Liebe«. Ich habe das Buch damals sofort gekauft. In einer Nacht am Wochenende traf ich im Roxy am Bodanplatz einen am See lebenden bekannten Dichter. Zu später Stunde zogen wir mit einem jungen Mädchen und einer Prostituierten zu mir nach Hause und machten die Nacht durch. Was hauptsächlich darin bestand, dass der Kollege aus dem Brecht-Buch stundenlang die pornografischen Gedichte rezitierte. Wirklicher Sex fand nicht statt. Als es hell wurde, ließ er sich mit dem Taxi zu seiner Wohnung am Obersee fahren. Plötzlich war ich mit den beiden Frauen alleine. Jeder suchte sich eine Ecke zum Schlafen (ich natürlich in meinem Bett), und gegen Mittag war der Brecht-Abend beendet. Das große Auto des Dichters stand noch tagelang vor dem Haus, dann war es weg. In Brechts Gedicht-Band fand ich später zwei hundert Mark-Scheine – ich vermute, die hatte der Dichter-Kollege für die Frauen hinterlassen
Es sei völlig unmöglich, sich den eigenen Tod vorzustellen, sagt Canetti. Ich habe aber eine exakte Vorstellung. Es ist wie vor der Geburt – nichts, nicht einmal schwarz. Auch das eigene Sterben kann ich mir vorstellen, sogar in verschiedenen Varianten. Es ist alles ganz einfach. Mir scheint, Canetti hatte überzogene Erwartungen
Reset: Schön wäre es, wenn öfter mal ein Anfang möglich wäre, ein Neustart. Aber jeder neue Anfang ist nur eine Fortsetzung, wenn man klug genug ist
Gibt es »falsche Erinnerungen«? Nein, Erinnerungen sind immer richtig. Falsch ist nur, sich nicht zu erinnern. Natürlich weiß ich, dass dieses Notat falsch ist, es hält nicht der Wissenschaft stand. Ich habe einmal im Radio ein Interview mit einer Wissenschaftlerin gehört, die über falsche Erinnerungen geforscht hatte. Sie hatte Testreihen mit jüngeren Menschen durchgeführt. Die Eltern hatten ihr ohne Wissen der Probanden Begebenheiten aus deren Kindheit erzählt; einige dieser Begebenheiten wurden in Absprache mit den Eltern verändert, also unwahr gemacht, verfälscht. Dann wurden Gespräche mit den Probanden über die mit den Eltern abgestimmten Themen geführt. Die Probanden sollten sich zu den Themen noch genauer erinnern. Fast alle haben zu den gefälschten Themen weiter assoziiert, als hätten sie das früher wirklich so erlebt. Also mein Notat am Anfang ist falsch. Aber ich nehme es nicht zurück
»Humor ist, wenn man trotzdem lacht« – eine blödsinnige Floskel. Fast hätte ich sie vorhin benutzt, habe aber im letzten Moment doch lieber geschwiegen. Mir wurde ganz mulmig, als mir bewusst wurde, dass ich sie früher schon öfter ausgesprochen habe. Niemand hat sich daran gestört. Die meisten Menschen sind nicht sehr sprachempfindlich
»Das ist doch nur Kino«, sagte die Mutter, wenn ich von einem Film aufgewühlt war. Ja, für einen Moment war es nur Kino – aber ich wusste, dass es einmal real sein würde. Dann war es nicht Kino, sondern das Leben
»Wenn du dich nicht zusammennimmst, stecke ich dich in ein Internat – da bringen sie dir Benehmen bei«, sagte die Mutter. Die Drohung hieß »Salem«. In den Illustrierten hatten wir über Prinz Charles gelesen, der in Salem auf dem Internat war. Weil er etwas dicklich war und unbeholfen wirkte, hatte er den Spitznamen Plumpudding weg. Da hätte ich auch gerne gelebt; Charles ist nur wenig jünger als ich. Wir hätten uns angefreundet und zusammen allen Widrigkeiten getrotzt. In den Ferien hätte er mich auf Schloss Windsor eingeladen. Aber die Mutter machte ihre Drohung nie wahr. Erst später wurde mir klar, dass die Eltern gar nicht das Geld gehabt hatten, um mich in Salem unterzubringenJeder Mensch ist ehrlos, der nicht irgendwann in seinem Leben sich zu den Tieren zählt (zählt, nicht: sich hingezogen fühlt!)
Das richtige Sehen: Der Maler verfügt darüber, und der Dichter hat es auch. Zum richtigen Sehen gehört immer auch ein Gefühl von Erinnerung – erst dann wird es wahr
Begegne ich einem fremden Menschen aus einem fremden Kontinent – wir können uns wahrscheinlich mit Englisch verständigen oder »mit Händen und Füßen«. Begegne ich im Wald einem einheimischen Tier – flüchtet es
Eugène Delacroix’ Gemälde »Tiger und Schlange« (1858) ist nicht lebensecht. Der Maler hatte die von ihm oft gemalten Raubkatzen nie in freier Natur gesehen, sondern nur im Pariser Zoo, was nicht viel bewirkt hat. Das Tier auf dem Bild hat etwas Fabelhaftes. Hans Schäuferlein malte 1505 einen Löwen als Attribut des Heiligen Hieronymus. Er kannte das Tier nur aus Schriften, das wirkliche Aussehen war zu seiner Zeit unbekannt, und so ähnelt das Gesicht seines Löwen eher einem geduckten Menschen. Beide Bilder sind ansprechend und lehrreich, auch rührend in ihrer Einfalt. So will auch ich mich bemühen, gelegentlich über Sachen zu schreiben, die ich nicht kenne. Vielleicht setzt das eine erfrischende Unbefangenheit frei
»Es ist mir völlig gleichgiltig geworden,
ob die lebende Generation Lyrik für
etwas leicht Komisches, für einen
barocken Schnörkel, eine kindische
Nebensächlichkeit hält oder nicht: Ich
weiß, dass sie wesentlich und in sich
selbst berechtigt, in sich selbst legitimiert
ist.
Max Barth, 1939
Das Alter spricht: Ich mag Claudio Abbado sehr – wenn das der ist, den ich meine
Wie lange sollte das Leben der Menschen dauern? Ich habe eine genaue Vorstellung: 200 Jahre sollte ein Menschenleben währen, 200 Jahre plus/minus. Und davon müsste das Alter 130 Jahre dauern, also fast doppelt so lange wie Jugend und Midlife. Das wäre dann ein maßvolles Leben
Riccardo Gagarin (1920-1980), ein russischer Dichter, damals lebend in Brasilien, schickte mir 1975 ein Gedicht und bat um Veröffentlichung in unserer Konstanzer Literatur-Zeitschrift UNIVERS. Mit einem Dreizeiler lehnte ich ab. Vergessen habe ich das nie Geburtstagspost, Weihnachtspost in Form von Grußkarten, analog, also keine E-Cards, das gibt es noch. Manche Versender wollen, dass sie punktgenau zu dem jeweiligen Festtag ankommt – und dann kommt sie leicht zu spät. Und die Überpünktlichen schreiben schon zehn Tage vorher. Deren Post liegt dann gesammelt auf einem Beistelltisch. Die Gruppen der Pünktlichen und der Späten mischen sich nicht – es sind immer die gleichen – abgesehen von denen, die zwischen den Festen gestorben sind
Angst vor dem Tod ist die Unlust vor der Veränderung der Lebensverhältnisse. Stünde dieser Satz in einem Buch, wäre er zum Unterstreichen. Aber nicht, weil er stimmt. Ich erinnere mich, wie ich als Vierjähriger mit den Eltern von Schöneberg nach Wilmersdorf umgezogen bin. Ich saß im LKW, der die letzte Möbel-Fuhre machte, vorne zwischen Fahrer und der Mutter, und weinte untröstlich. Wir saßen erhöht, die Sicht war gut, aber die Veränderung der Lebensverhältnisse machte mir Angst; die Sicht war tränentrüb. So war es mit vier Jahren, mit fünfundsiebzig ist das Ziel des Umzugs ein anderes. Die Sicht ist klarer
Die kalten Nachkriegswinter. Die Tinte gefror in den Füllern. Ich war gerade geboren. Schriftsteller wurde ich, als die kommende Klimakatastrophe noch nicht Thema war. Die warmen Wohlstandswinter. Im Sommer läuft aus dem Ball Pentel die flüssig gewordene Schreibpaste aus
Einmal war ich in einer Kneipe, sie hieß: »Zur unterirdischen Tante«. Es war die Hölle, höllisch geil
Man kann nicht sagen, dass Genies immer schön sind. Das Genie reicht nicht aus, die Hülle aufzuhübschen. Viele Genies waren hässlich. Aber schön wäre es
In der Schlange bei Rogacki vor Weihnachten, vor Sylvester, vor dem Geburtstag: Der Vater und ich stehen an. Vor uns eine lange Reihe aus grauem und weißem Haar. Wir wollen teuren Fisch kaufen, Hummer, Langusten, Krebse. Wir warten geduldig. Rogacki ist in. In den Auslagen liegen sie, alle hübsch arrangiert auf gestoßenem Eis. Hier war der Fisch schöner als im Meer
Der Weg nach unten heißt die Autobiografie des Schriftstellers Franz Jung – es ist die skeptisch-resignative Abrechnung seines wechselvollen Lebens. Einmal las ich im Deutschen Literaturarchiv den Briefwechsel zwischen den Schriftstellern Rudolf Adrian Dietrich und A. Rudolf Leinert aus den 1960er Jahren. Dietrich nimmt Bezug auf das soeben gelesene Buch von Jung und bestätigt: »Ja, das Leben ist ein Weg nach unten und er wird immer steiler.« Dietrich war gerade 70 geworden (1964) und hatte einige chronische Krankheiten, die ihm das Leben schwer machten. Und Leinert, nur unwesentlich jünger, gab ihm recht. Heute Nacht hörte ich im Radio das Lied »Von nun an gings bergab« – gesungen von Hildegard Knef mit einem autobiografischen Text. Jede Strophe deutet eine erfolgreiche Etappe ihres Lebens an, um dann mit dem resignativen Refrain zu schließen. Der Weg nach unten wird in der Literatur negativ besetzt. Ich habe viele Jahrzehnte im Schwarzwald Ferien gemacht. Bei den täglichen Spaziergängen war ich jedes Mal froh, wenn es endlich wieder bergab ging. Es läuft sich viel leichter, als wenn es bergauf geht
Viele bekannte Schauspieler werden auch Sänger. Wie das kommt? Es ist das kapitalistische Prinzip, aus einer guten Ware das Maximale herauszuholen
Als ich noch zu Hause bei den Eltern lebte, sprach der Vater oft vom »Weltstaat« und von der »Welt-Regierung«, die hoffentlich bald kommen würden. Ich fand das immer absurd angesichts der Verschiedenartigkeit der Welt. Wohl eine Überkompensation nach den inzwischen abgelegten völkischen Ideen der Nazis, dachte ich. Wie sollte man all das Verschiedene zusammenbringen? Ich wollte nicht, dass Deutschland verschwindet und die verbliebenen Menschen von einem Präsidenten aus Washington regiert werden. Jetzt las ich in Christopher Isherwoods Jugenderinnerungen, dass 1922 der Lehrer Holmes in Cambridge erklärte, die Tage der nationalen Wettkämpfe seien nun vorbei – man müsse auf den zukünftigen Weltstaat hinarbeiten. 1922 war mein Vater 13 Jahre alt – es war also wohl eine alte kollektive Idee, die er in den 1950er Jahren noch teilte. Aber wurde sie dadurch richtiger?
Me too: Mir fällt auf, dass das Öffentlich-Machen von sexualisierten Übergriffen, die früher stattgefunden haben, sich im Milieu des Jet Set abspielt. Schauspielerinnen klagen an, Beschuldigte sind Männer aus der Medien-Branche, die gewichtig sind. Da kann Aufmerksamkeit erzielt und Schmerzensgeld kassiert werden. Im Kleinbürgertum gibt es das nicht. Angrapschen zählt nicht. Oft habe ich in meiner Jugend in Bars fremde Boys befummelt, auch »unsittliche Angebote« gemacht. Wir grüßen uns noch heute freundlich in der Stadt, wenn die Wege sich kreuzen. Sex ist ja auch nicht so wichtig – hinterher! Wer von einer Anmache einen Dauerschaden davonträgt, war schon vorher krank
Irrsinn, sobald er sich zeigt, gebiert oft eine Religion
So wie der Kapitän