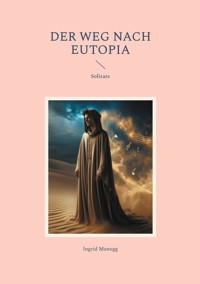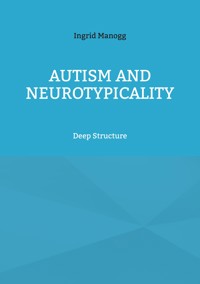Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine ängstliche Prinzessin versteckt sich vor der Welt. Bis ein unheimlicher Besucher auftaucht und sie auf eine fantastische Traumreise schickt... Tapfer wehrt sie sich gegen das betrügerische Spiel von Feen und Dschinn, selbst in der Verbannung gibt sie ihre Vorstellung vom wahren Wünschen nicht auf. Als sie erwacht, öffnet sich ihr ein neuer Weg. Ein poetisches Märchen, voll Esprit und feinem Humor
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
IM SCHLOSS
Die Prinzessin
Der Freund
DIE TRAUMREISE
Seelenfarbe
Verwandlung
Die Anwärterin
Die Seerose
Ausgestoßen
Verbannung
Das Wildpferd
Auf der Rennbahn
Schwarz oder Gold
Sturz
Komm ins Dunkel
Das Wasserwesen
Pfeil und Bogen
Die Rede
Der Traum wechselt
DER WUNDERSCHÖNE PRINZ
Erschaffung
Überleben
Des Prinzen erste Erfahrungen
Verhärtung
Die erwählte Prinzessin
Der Troubadour
Die Raucherin
Die Königsfamilie
Die verliebten Meister
Die Besucherinnen
DAS ERWACHEN
Erhebe dich
Der wahre Flug braucht
Keine Flügel.
Erkenne das Bild,
Das webt in den Träumen.
Es öffnet die Räume,
Die Zeiten und Welt.
Erden versinken,
Ewigkeit hält.
Ein Spruch der ‚Drimas‘
IM SCHLOSS
Die Prinzessin
In einer weiten, von Feldern und Wiesen geprägten Landschaft stand ein Schloss. Ein großer Park umgab es, darin plätscherten Springbrunnen, Lauben luden zum Verweilen ein, Statuen lugten zwischen Hecken hervor. Es war Herbst, letzte Rosen dufteten betörend in der Mittagssonne. Zahlreiche verschlungene Wege luden zum Flanieren ein, eine Allee, gesäumt von mächtigen Bäumen, führte von einem kunstvoll geschmiedeten Tor zum Haupteingang des Gebäudes. Vor diesem parkte seit Stunden eine schwarze, mit sechs Rappen bespannte Kutsche. Die edlen, mit Federbüschen geschmückten Pferde schnaubten und scharrten ungeduldig mit den Hufen.
Das Schloss war dreistöckig und hatte vier Türme. In einem davon kauerte die Prinzessin, im hintersten Winkel einer kleinen Kammer. Ein dicker Teppich schützte sie vor der Kälte, die vom steinernen Boden ausging. Unter einem wollenen Umhang trug sie dünne, abgetragene Kleider, aus denen sie längst herausgewachsen war. Ihre Haare und Augen wirkten glanzlos, den Prinzessinnenreif hatte sie abgelegt.
Seit Jahren hatte sie den Turm nicht mehr verlassen. Hier fühlte sie sich sicher vor der ihr fremden Welt, hier konnten ihre Ängste sie nicht unvermittelt anspringen und überwältigen. Hier waren sie einfach immer da, wie ruhige, dunkle Vertraute, die diskret warteten, bis sie sie einlud, oder sie sich auf ihren geistigen Pfaden unvorsichtig bewegte. Geriet sie doch einmal in Verbindung zu ihnen, zog sie sich innerlich und äußerlich zusammen, bis sie wieder von ihr abrückten.
Doch seit heute früh war ihre fragile Balance zerstört, alle ihre Schutzwälle waren eingebrochen. Ihr schien, als bebten und zitterten nicht nur ihre Hände und ihr Leib, sondern auch die Mauern ihres Verstecks.
Ein Mann hatte sie aufgesucht. Er hatte sich vor ihr postiert und Bewegungen gemacht, die aussahen, als würde er auf sie einstechen. Sie wusste nicht, wer er war, aber sie war sich gewiss, dass er wiederkommen und sie umbringen würde. Sie wäre nicht imstande zu fliehen, und keiner käme ihr zu Hilfe. Die Dienstboten nicht, die anderen Gäste nicht, und der König, ihr Vater, sowieso nicht. Immerhin gab es noch die Herrin, der sie seit frühester Kindheit vertraute. Aber wäre sie rechtzeitig zur Stelle, und wäre sie stark genug, sie zu beschützen?
Die Herrin war die Einzige, deren Nähe die Prinzessin ertrug. Jeden Morgen leerte sie den Nachttopf, brachte Speisen und Getränke, die kaum angerührt wurden, und sprach beruhigend auf ihren Schützling ein. Abends erzählte sie Märchen und Geschichten.
Sie war eine extravagant gekleidete Frau mittleren Alters. Als ehemalige Vertraute und Kammerzofe der früh verstorbenen Königin hatte sie fast uneingeschränkte Befugnisse. Sie wusste über alles Bescheid und informierte den König, wenn etwas für diesen von Belang war. Auf die Herrin konnte er sich stets verlassen.
Der König besaß neben seinem Stammschloss noch weitere Residenzen, in denen er die älteren Geschwister der Prinzessin und seine Mätressen untergebracht hatte, sowie ausgedehnte Ländereien. Er hatte alles geerbt, nie hatte er Krieg führen oder um etwas kämpfen müssen. Die meisten seiner Bekannten beschrieben ihn als großzügig, verantwortungsbewusst und vom Wesen her gutmütig.
Niemand wusste, welch tiefe Sehnsucht ihn umtrieb. Sie bestand nicht darin, einen Ersatz für seine geliebte Frau zu finden, sondern einen guten Freund und Vertrauten, wie er ihn einst in seiner Jugend gehabt hatte.
Mit seiner jüngsten Tochter mochte er sich schon lange nicht mehr abgeben. Gerne hätte er sie schnellstmöglich verheiratet. Doch an wen könnte er sie schon vermitteln …
Selbst die besten Ärzte und Heiler wussten nicht, was der Prinzessin fehlte, denn sie sprach nicht mit ihnen, sie blickte sie nicht einmal an. Irrationale Ängste, lauteten die vagen Diagnosen, Zwänge, Blutarmut oder eine unheilbare geistige Störung.
Offenbar wurde es schlimmer mit ihr. Eben hatte die Herrin ihm zugetragen, die Prinzessin fühle sich von dem Mann, der seit heute Morgen zu Gast weilte, bedroht, und eindringlich geraten, ihn des Hauses zu verweisen.
Der König hatte entrüstet abgewunken. Warum sollte er auf irgendwelche kranken Fantasien Rücksicht nehmen? Schließlich war Duweißtschonwer, wie der Besucher sich nannte, ein welterfahrener, wohlhabender Mann von sichtlich hohem Status. Darüber hinaus hatte er freundliche Augen, eine angenehme Stimme und wirkte äußerst zugewandt. Fast vermeinte der König, er würde ihn schon ewig kennen. Nein, Duweißtschonwer musste bleiben, wie Balsam wirkte er auf seine Seele.
Es ist das erste Mal, dass der König mich so harsch abweist, dachte die Herrin besorgt. Dieser Duweißtschonwer scheint ein Drima zu sein – mächtig in seiner Zauberkraft, Herrscher über Feen und Dschinn. Soweit ich weiß, hat niemand ihn eingeladen, doch spaziert er überall herum, als wäre er der Besitzer, und er betritt selbst die intimsten Räumlichkeiten. Unbedingt muss ich ihn davon abhalten, die Prinzessin ein zweites Mal zu ängstigen.
Sie eilte die Treppen hinauf und stellte sich vor die Tür, die in den oberen Teil des Turms führte. Dort befielen sie Zweifel. Wie lange konnte sie hier wachen? Dienstboten warteten auf ihre Anweisungen, Rechnungen mussten überprüft werden, tausend Dinge waren zu erledigen. Sie wollte lieber noch einmal mit dem König sprechen. Oder den Schlüssel holen, um den Zugang zur Kammer zu verschließen …
Plötzlich wischte etwas wie eine unsichtbare Hand über ihr Gesicht. Sie konnte es spüren und wehrte sich, doch es war zu spät. Sie begann bereits zu erstarren, weit blickten ihre offenen Augen ins Leere.
Der Freund
Noch nie hatte der König sein Bedürfnis nach einem Freund so stark empfunden wie heute. Seine Sehnsucht nach jemandem, der ihn vorbehaltlos mochte und verstand, steigerte sich ins Unerträgliche. Bald lief er dem Gast wie ein bettelndes Hündchen hinterher.
Beim Nachmittagstee war es soweit. Sein Herz quoll über, seine Zunge löste sich. Bebend und leicht stotternd fragte er: »Du- Duweißtschonwer, willst du mein, äh, Freund sein?«
Duweißtschonwer neigte sich ihm zu, etwas wie Melancholie schimmerte in seinen Augen auf. Leise erwiderte er: »Auch mein Herz fühlt, dass wir zusammengehören. Aber es ist gebrochen, denn einst verlor ich meinen besten Freund.« Nach einer kleinen Pause fügte er hinzu: »Ich brauche einen Vertrauensbeweis. Überlass mir dein Töchterchen.«
Der König zögerte. Sollte echte Freundschaft nicht bedingungslos sein?
»Die Verantwortung für die Kleine lastet schwer auf dir«, setzte Duweißtschonwer nach. »Befreie dich. Gib sie mir, ich verlange auch keinerlei Mitgift.«
Nun erklärte der König sich einverstanden. »So soll es sein, jetzt ist sie dein«, meinte er. »Bring sie aus dem Schloss. Je früher, je besser.«
»Abgemacht!«, rief Duweißtschonwer und hielt dem König die Hand hin, die dieser sogleich ergriff. »Dein Wort gilt.«
»Und jetzt«, atmete der König erleichtert auf, »da ich dir die Prinzessin übergeben habe, trinken wir ein Bier auf unsere Freundschaft. – Dienstbote, schnell, mach ein Fass auf!«
Der König trank viel, Duweißtschonwer tat nur so. Allmählich wurden die Augen des Königs glasig. Er schwelgte in Kindheits- und Jugenderinnerungen und tätschelte immer wieder Duweißtschonwers Arm. Noch bevor das Fass geleert war, hatte er alle möglichen Dokumente unterzeichnet und mit seinem Siegel versehen.
»Die sind für mein Poesie-Album, zur Erinnerung an diesen wundervollen Tag«, erklärte Duweißtschonwer mit sanfter Stimme.
Schließlich schlummerte der König ein und schnarchte zufrieden. Duweißtschonwer erhob sich. »Du König der Dummheit«, sagte er kopfschüttelnd.
Die Urkunden sorgsam in seine Manteltasche gepackt, machte er sich auf zur Prinzessin.
Auf dem Rückweg schnippte er kurz vor dem Gesicht der Herrin. In zwei Stunden würde die Starre von ihr abfallen. Dann spazierte er vor sich hin pfeifend aus dem Schloss und bestieg seine Kutsche. Die sechs Rappen warfen sich ins Geschirr und sprengten los, die Mähnen flatterten wie schwarze Fahnen.
Als der König erwachte, plagten ihn heftige Kopfschmerzen. Sein neuer Freund war verschwunden. Wo er gesessen hatte, lag nur noch ein Stapel Dokumente. Es waren Zweitschriften von Verträgen, unterschrieben und besiegelt. Mit wachsendem Unglauben sah der König sie durch. »Verrat!«, brüllte er. »Duweißtschonwer, du falscher Hund! Du verlogener Bastard!«
Jegliche Gutmütigkeit hatte den König verlassen. Bereit, zu töten, stürmte er in die Waffenkammer. Duweißtschonwer, der inzwischen seinen Stammsitz erreicht hatte, musste all seine geistigen Kräfte aktivieren, um den Rasenden zu beruhigen. Endlich hielt der König inne, fügte sich in sein Schicksal und rief nach der Herrin.
Die Prinzessin wusste nicht, wie ihr geschehen war. Der unheimliche Besucher hatte regungslos vor ihr gestanden. Sie hatte die Hände vors Gesicht geschlagen, wie eine Stichflamme waren all ihre Ängste aufgelodert. Dann hatten sie sich auf wundersame Weise beruhigt und aufgelöst. Als sie schließlich wagte, zwischen ihren Fingern hindurchzublinzeln, war der Mann verschwunden. Und jetzt gierte sie plötzlich danach, das Schloss zu verlassen, um die Welt und das Leben kennenzulernen.
Doch als sie sich erhob, zogen unsichtbare Hände sie wieder herunter. Eine Stimme erklang wie aus der Ferne und gleichzeitig ganz nah: »Warte und wähle dein Kleid.«
Ein Kleid wählen? Was ging jemanden ihr Aussehen an? Sie hatte nicht das mindeste Interesse an schönen Kleidern oder an ihrem Prinzessinnenstatus. Sie wollte sein, wie sie war.
Noch zweimal bemühte sie sich, sich zu erheben, aber jedes Mal geschah dasselbe. Etwas zerrte an ihr und drückte sie hinab.
DIE TRAUMREISE
Seelenfarbe
In der Nacht träumte die Prinzessin, unterwegs zu sein in der weiten Welt. Sie war nicht allein, der Mann, der sie am Morgen noch bedroht hatte, begleitete und leitete sie. Er ritt prächtig gekleidet auf einem großen schwarzen Pferd, sie trug ihre alten, ausgeblichenen Kleider und ritt auf einem kleinen weißen Pferd neben ihm her.
Verstohlen musterte sie ihn von der Seite. Er wirkte keineswegs furchteinflößend, sondern wie ein ganz normaler Edelmann. Seine Gesichtszüge blieben jedoch unscharf, sie konnte sie sich einfach nicht einprägen. Nicht einmal seine Haar- oder Augenfarbe blieben ihr in Erinnerung.
Als sie sich von ihren Pferden lösten und abhoben, ohne Flügel und ohne jegliches Bemühen, erschien dies ganz und gar leicht und selbstverständlich. Für Menschen unsichtbar zogen sie in niedriger Höhe über die verschiedensten Städte, Wiesen und Wälder. Alles leuchtete, alles wirkte schön, wie aus flüssigem Glas. Sie lugten in Paläste, schummrige Herbergen und Spielcasinos; schwebten über bunten Märkten, Schiffen und Lastkähnen, die auf Flüssen dahinschipperten …
Die Prinzessin war wie bezaubert. Sie staunte und wunderte sich in einem fort, schließlich kannte sie wenig außer Geschichten und Fantasien. Doch wenn sie ihren Führer etwas fragte, antwortete er nur einsilbig. Er schien irgendwie unzufrieden mit ihr. Manchmal verhandelte er mit Gestalten, die sie nicht erfassen konnte, oder erteilte ihnen Anweisungen, dann langweilte sie sich. Überhaupt erschien ihr diese Art des Reisens allmählich schal. Immer nur schweben und schauen, schweben und schauen … Nie durfte sie irgendwo verweilen. Oder alleine fliegen, die Flugbahn selbst bestimmen, das Auf und Ab genießen, frei schwimmen in der Luft …
Am Nachmittag des dritten Tages forderte der Mann sie unvermittelt auf: »Zeig mir deine Energie.«
»Was meinst du damit?«, fragte die Prinzessin verwundert.
»Jeder hat seine eigene, spezifische Energie«, erläuterte er. »Etwas, das ihn antreibt. Ein tiefstes Bedürfnis, eine innerste Kraft, einen Drang zu etwas hin. Eine Art Seelenfarbe. Lass sie aufscheinen, sicht- und spürbar werden.«
»Wozu?«
»Nun mach schon«, drängte er. »Oder nenn mir wenigstens deine äußere Lieblingsfarbe.«
Die Prinzessin zuckte die Achseln.
Der Mann seufzte. »Zwar hat der Schleier deiner Ängste sich von dir gehoben«, sagte er. »Doch ich kann nichts in dir erkennen. Jemand anderes wird sich um dich kümmern.«
Es dauerte nur einen Wimpernschlag und sie befanden sich wieder am Ausgangspunkt ihrer Reise, auf Pferden sitzend, das eine groß und schwarz, das andere klein und weiß. Ohne ein weiteres Wort gab der Mann seinem Rappen die Sporen und galoppierte mit wehendem Umhang davon.
Die Prinzessin starrte ihm ungläubig hinterher. Dann versuchte sie aufzuschweben, doch es gelang ihr nicht.
Mit der Dämmerung senkten Schatten sich herab und verwischten alle Konturen. Die Landschaft begann sich zu verändern, immer schneller. Mal wuchsen Berge auf, mal flachten sie zu Hügeln ab; ein See schimmerte auf und verschwand wieder. Selbst die Jahreszeiten schienen zu wechseln.
»Bring mich nach Hause«, beschwor die Prinzessin ihren Schimmel. Aber das Pferd bewegte sich nicht, als wäre es eingefroren. Da stieg sie ab und lief einen schmalen Pfad entlang, durch Felder führte er und durch Wälder, in die Nacht hinein.
Allmählich verstummten die letzten Vögel. Rehe und Eichhörnchen zogen sich in ihre Verstecke zurück, andere Tiere wurden aktiv. In der Ferne heulte ein Wolf, eine Rotte Wildschweine trappelte vorbei, Waldkäuzchen riefen.
An einen Baum gelehnt, kauerte die Prinzessin sich ganz klein zusammen, als säße sie in ihrer Kammer im Turm. Mehr und mehr zog sie sich in ihr Inneres zurück, in den sichersten dunklen Punkt. Eine hellblaugraue, fast transparente Schutzschicht diffundierte aus ihren Poren und hüllte sie vollständig ein.
Jetzt befand sie sich jenseits der Welt. Es war das vertraute Gefühl der Verlorenheit, das sie verspürte, in das sie heimkehrte wie in ihre wahre Heimat.
Ihr Herz schlug flach, als wolle es nicht gehört werden. Dann begann es leicht zu flattern. Schwach und schwächer ging ihr Puls.
Verwandlung
In dem Moment, in dem sie die Schwelle des Übergangs erreichte, erschienen drei große, in Blau gewandete Feen. Ein machtvolles Strahlen umgab sie. Ihre Lichtbahnen krochen hinter die Stirn der Prinzessin und leuchteten das Dunkel aus, bis es kein Entkommen mehr gab. Was sollte das, was versperrten sie ihr den Weg?