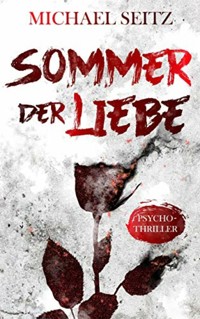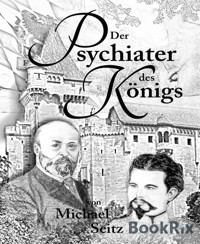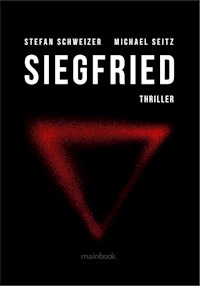
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mainbook Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Wagner-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Das kongeniale Autoren-Duo Michael Seitz und Stefan Schweizer legt mit "Siegfried" den zweiten Teil der "Wagner"-Trilogie – nach dem Polit-Thriller "Götterdämmerung" – vor. Rechte Revolutionäre, Politiker, Geheimdienstler und andere zwielichtige Gestalten reichen sich in "Siegfried" die Hand mit arabischen Despoten, um an den Grundpfeilern der europäischen Demokratie zu rütteln – für Fans authentisch-harter Storys mit Tiefgang und Gänsehautspannung. Beide Teile sind abgeschlossene Geschichten und können einzeln gelesen werden. Die brandgefährliche Welt deutschsprachiger Neonazis, die den Sturz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung herbeiführen wollen … Politik-Redakteur Tscharly Huber sucht verzweifelt nach seiner Tochter Milla, von der es kein Lebenszeichen gibt, seit sie in der rechtsextremen Szene untergetaucht ist. Seine Recherchen führen ihn nach Wien, wo er auf den Bundesverfassungsschutz-Agenten Wagner trifft, der im Alpenland Österreich die demokratische Ordnung zum Tanzen bringen möchte. Tscharlys Ex-Kollegin Kira wird aus unbekannter Quelle ein Dossier über rechtsterroristische und antisemitische Umsturzpläne zugespielt. Eine lebensgefährliche Odyssee durch die Abgründe rechter Fanatiker, die den Tag X vorbereiten, beginnt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Seitz
Stefan Schweizer
Siegfried
Thriller
eISBN 978-3-948987-53-4
Copyright © 2022 mainbook Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Gerd Fischer
Covergestaltung und Bildrechte: Lukas Hüttner
Auf der Verlagshomepage finden Sie weitere spannende Bücher: www.mainbook.de
Autor Michael Seitz
Michael Seitz, Jahrgang 1976, hat seine Kindheit und Jugend in München und im ländlichen Niederbayern verbracht und lebt seit 2005 in Wien. Er schreibt vorwiegend historische Romane und Gegenwartskrimis. Seitz genießt es, mit seiner Frau und seinen beiden Kindern durch Wien zu flanieren und in Buchgeschäften zu schmökern.
Veröffentlichungen (Auswahl): „Die verlorenen Kinder“ (Droe-mer Knaur, 2017), „Der Falter“ (Droemer Knaur, 2018), „Kinderspiel – Die Fesseln der Vergangenheit“ (Droemer Knaur, 2019), „Sechs“ (Droemer Knaur, 2019)
Autor Stefan Schweizer
Stefan Schweizer studierte, promovierte und lehrte an der Universität Stuttgart. Er lebt im Speckgürtel der Bundeshauptstadt, bewegt sich gerne in fremden Kulturen, in exotischen subkul-turellen Milieus und ist Grenzgänger zwischen den Scenes.
Veröffentlichungen (Auswahl): „Mörderklima“ (Klimawandel-Krimi, mainbook, 2020), „Die Akte Baader“ (Gmeiner, 2018), „Roter Herbst 77 – RAF 2.0“ (Südwestbuch, 2017), „Roter Frühling 72, RAF 1.0“ (Südwestbuch, 2017), „BERLIN GANGSTAS“ (Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2016), „Goldener Schuss“ (Gmeiner, 2015).
Inhalt
Vorwort
Samstag, 27. September 2008, 20:27 Uhr, in der Nähe von Kassel
Sonntag, 28. September 2008 – Wien
Drei Tage zuvor – Donnerstag, 25. September – München
Sonntag, 28. September, Wien
Sonntag, 28. September, Wien, 18:00 Uhr
Samstag, 27. September 2008, 20:30 Uhr – Im Inneren der Ritterburg bei Kassel
Sonntag, 28. September 2008, 20:00 Uhr – Wien
Sonntag, 28. September 2008, 20:30 Uhr – Wien
Sonntag, 28. September 2008, 20:55 Uhr – Wien
Sonntag, 28. September 2008, 21:00 Uhr – Wien
Sonntag, 28. September 2008, 22:00 Uhr – Wien
Sonntag, 28. September, 22:15 Uhr – Wien
Sonntag, 28. September 2008, 22:30 Uhr – Wien
Sonntag, 28. September 2008, 22:40 Uhr – Wien
Sonntag, 28. September 2008, 23:20 Uhr – Wien
Sonntag, 28. September 2008, 23:23 Uhr – Wien
Sonntag, 28. September 2008, kurz vor Mitternacht – Wien
Montag, 29. September 2008 – Ostbrandenburg an der Grenze zum benachbarten Polen, 5:00 Uhr
Dienstag, 30. September 2008, 8:00 Uhr – Wien
Dienstag, 30. September 2008, 9:00 Uhr – Wien
Dienstag, 30. September 2008, 9:33 Uhr – Wien
Dienstag, 30. September 2008, 9:41 Uhr – Wien
Dienstag, 30. September 2008, 10:00 Uhr – Gutshof
Dienstag, 30. September 2008, 10:45 Uhr – Ostbrandenburg an der Grenze zum benachbarten Polen
Dienstag, 30. September 2008, 13:00 Uhr – Wien
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 8:30 Uhr – Gutshof/Ritterburg bei Kassel
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 10:30 Uhr – Gutshof
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 10:30 Uhr – Weg von Odins Gutshof zur Hauptpost in Kassel
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 12:00 Uhr – Klagenfurt
Dienstag, 3. Oktober 2000, Tag der Osmanischen Unabhängigkeit – Internationaler Flughafen von Osman
Mittwoch, 1. Oktober 2008 12:30 Uhr – Klagenfurt
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 19:00 Uhr – Gutshof
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 9:15 Uhr und 18:30 Uhr, Gutshof
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 3:15 Uhr – Waldviertel
Freitag, 3. Oktober 2008, 8:15 Uhr – Gutshof
Freitag, 3. Oktober 2008, 8:30 Uhr – Waldviertel
Freitag, 3. Oktober 2008, 16:00 Uhr – Linz
Samstag, 4. Oktober 2008, 10:00 Uhr – zwanzig Kilometer außerhalb von Klagenfurt
Samstag, 4. Oktober 2008, 13:00 Uhr – Klagenfurt
Samstag, 4. Oktober 2008, 17:00 Uhr – Klagenfurt
Samstag, 4. Oktober 2008, 18:00 Uhr – Klagenfurt
Samstag, 4. Oktober und Sonntag, 5. Oktober 2008, Gutshof
Sonntag, 5. Oktober 2008, 8:00 Uhr – kurz vor Passau an der Autobahn (A1)
Sonntag, 5. Oktober 2008, 12:00 Uhr – Bratislava
Sonntag, 5. Oktober 2008, 12.00 Uhr – kurz vor Passau
Sonntag, 5. Oktober 2008, 12:30 Uhr – Bratislava
Sonntag, 5. Oktober 2008, 13.00 Uhr – Ried im Innkreis
Sonntag, 5. Oktober 2008, 17:30 Uhr – A1 zwischen Wels und Linz
Montag, 6. Oktober 2008, 7:00 Uhr – Wien, unterhalb der Mariahilfer Kirche, 6. Bezirk
Montag, 6. Oktober 2008, 10:00 Uhr – Kärnten, Grenze zu Slowenien
Montag, 6. Oktober 2008, 12:00 Uhr – Wien, Lainzer Tiergarten
Montag, 6. Oktober 2008, 15:00 Uhr – Kärnten, Grenze zu Slowenien
Dienstag, 7. Oktober 2008, 8:00 Uhr, Kärnten, Grenze zu Slowenien
Dienstag, 7. Oktober 2008, 9:30 Uhr, Kärnten, Grenze zu Slowenien
Viertes Reich I
Hotel in Kärnten, unweit der Grenze zu Slowenien
Viertes Reich II
Viertes Reich III
Viertes Reich IV, später am Tag
Viertes Reich V, später
Wien, 10. Oktober 2008, Hotel Topazz, 2:19 Uhr
Viertes Reich VI, später
Viertes Reich, außerhalb des Bunkers 1
Viertes Reich VII
Viertes Reich, außerhalb des Bunkers 2
Viertes Reich VIII
Viertes Reich, außerhalb des Bunkers 3
Viertes Reich IX
Viertes Reich X
Viertes Reich XI
Vorwort
Die drei ebenso berühmten wie berüchtigten Ts (tarnen, tricksen, täuschen) sind vor allem aus konspirativen Gründen den in diesem Politthriller beschriebenen Kreisen zuzuordnen.
Jedoch haben auch wir beim Schreiben auf diese Taktik zurückgegriffen, indem wir z. B. Personen der Zeitgeschichte bewusst nur teilweise beschrieben oder Persönlichkeiten verfremdet dargestellt haben. Auch Orte haben wir bei Bedarf, wenn möglich, verschoben. Das im Nahen Osten gelegene Land mit dem fiktiven Namen „Osman“, steht z. B. für gleich zwei Militärdiktaturen, die im Jahr 2000 eine Rolle spielten, jedoch auch der Einfachheit halber auf einen Staat sozusagen „zusammengefasst“ wurden. Der Einmarsch der US-Truppen im Jahr 2003 veränderte die geopolitische Machtlage in diesem Teil der Welt nachhaltig; später tat der sogenannte Arabische Frühling seinen Teil dazu. Auch die Figur des Mannes, den wir als den „Österreicher“ bezeichnet haben, existierte in der Realität, wurde jedoch so weit verändert, dass es keine Ähnlichkeiten zur realen Person eines gewissen Kärtner Landeshauptmannes mehr gibt. Das haben wir vor allem gemacht, um uns nicht dem Vorwurf ausgesetzt zu sehen, in unserem Roman nur die Realität zu beschreiben. Dennoch enthält unsere Fiktion mehr Wahrheit als die meisten Leserinnen und Leser auf den ersten Blick vermuten werden.
Heinrich Böll fasste das Dilemma von realem Leben und Kunst 1974 in seinem Blum-Roman in einem Vorwort zusammen: „Personen und Handlung dieser Erzählung sind frei erfunden. … Ähnlichkeiten (sind) weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich.“ Mit diesem bekannten Vorwort bereitete der Literat die Leserinnen und Leser darauf vor, was sie auf den folgenden Seiten erwartete: die Darstellung einer fiktiven Realität. Und nicht zuletzt darin steckt die Tragik des heutigen Autors, denn mit Jörg Fauser sind wir stets „auf der Suche nach einem Satz, der mehr sagt“, als wir eigentlich wissen. Wir wissen viel, aber eben nicht alles und dennoch muss es das Bestreben des Schriftstellers sein, die unendlichen Möglichkeitsmatrizen, die sowohl das reale Leben als auch die literarische Kunst bieten, zu einem möglichst kohärenten, aber interaktiv-rekursiven Gesamtgebilde zusammenzufügen, das den Leserinnen und Lesern möglichst viel Erkenntnis offeriert. Eine stetige Spannungskurve, geschliffene Dialoge und ein schlüssiger Gesamtplot dürfen dabei allerdings keinesfalls fehlen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen spannende Stunden beim Lesen dieses Faction-Thrillers.
Michael Seitz & Stefan Schweizer
Wien und Potsdam, im März 2022
Samstag, 27. September 2008, 20:27 Uhr, in der Nähe von Kassel
Der restaurierte Gutshof hatte im Laufe der Jahrhunderte Raubrittern und lichtscheuem Gesindel einen Rückzugsort geboten. Er lag auf der einzigen Anhöhe im Umkreis von fünf Quadratkilometern. Eingebettet zwischen Felsen und Tanngestrüpp waren seine Besitzer vor dem Arm des Gesetzes quasi unerreichbar gewesen. Weit und breit fürchtete man die dunklen Gesellen, die zwischen diesen Gemäuern ihren Trinkgelagen frönten und von dort ihre blutrünstigen Raubzüge planten. Der Dreißigjährige Krieg läutete mit der Einführung von Kanonen den endgültigen Niedergang sämtlichen Rittertums ein. Die einst stolze Burg verwandelte sich in eine Ruine, die Romantikern im 19. Jahrhundert Inspiration zu Gedichten und Geschichten bot. Zuletzt fanden sich Investoren, die die abgeschiedene Lage wieder zu schätzen wussten. Niedersachsen und Thüringen waren mit dem Auto innerhalb einer halben Stunde zu erreichen. Auch Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz waren nicht aus der Welt. Das bot Angriffsflächen und Fluchtrouten und praktisch die Möglichkeit, an einer Vielzahl von Orten gleichzeitig zuschlagen zu können. Das Autobahnnetz verschaffte ihnen Möglichkeiten, von denen ihre Vorgänger niemals zu träumen gewagt hätten. Der Flughafen in Frankfurt war ebenfalls kaum mehr als zwei Stunden mit dem Auto entfernt. Polen und Tschechien waren innerhalb von sieben Fahrstunden erreichbar – ideal für Geschäfte aller Art. Und dank der Abschaffung der Grenzkontrollen im Personenverkehr innerhalb der europäischen Union bestand eine der leichtesten Übungen darin, in den ehemaligen östlichen Bruderstaaten unterzutauchen.
Das mit dem feudalen Anwesen verbundene Dorf umfasste heute kaum mehr als zweihundert Einwohner. Die Hälfte der Einwohnerschaft bestand aus zugezogenen Menschen, die über eine gefestigte Weltanschauung, entsprechende Normen und Werte verfügten. Die Neonazis hatten sich hier Macht und Einfluss gesichert. Und so galt dieser Flecken Land als national befreite Zone. Sie war zum Niemandsland im Kampf gegen den bundesdeutschen Staat geworden, den zu bekriegen sich die neuen Raubritter Ehre und Treue bis zum letzten Tropfen ihres Blutes geschworen hatten. Die Geschichte würde ihnen einst recht geben, daran hegten sie keinerlei Zweifel.
Durch die vielen Autos vor der Einfahrt zum ummauerten Gutshof war klar, dass an diesem Abend eine Versammlung stattfand. Eine ziemlich hochkarätige Zusammenkunft, den Nobel-Karossen nach zu schließen, meinte einer der beiden Beamten. Hauptsächlich vertreten waren die Marken VW, Audi und Porsche.
Zweihundert Meter von der Ritterburg entfernt standen auf dem Feld zwei zivile metallic-grau lackierte Fahrzeuge. Die beiden Beamten beobachteten seit Stunden das Anwesen durch Ferngläser und lauschten angestrengt durch die Lautsprecher im Ohr. Doch seit geraumer Zeit gab es keine Anweisungen mehr von Seiten der Dienststelle.
Die Verfassungsschützer hatten jedes der Autokennzeichen akribisch notiert und an die Zentrale weitergeleitet. Hartnäckig verfolgten sie durch die Ferngläser, was sich vor dem Grundstück tat.
Die hohen Herren der rechten Bewegung hatten sich längst in die nicht einsehbare Festung begeben. Da das Anwesen schon mehrfach wegen Hausdurchsuchungen polizeilich erfasst worden war, machten sich die Beamten keine Illusionen: Der Gutshof war besser gesichert als mancher Hochsicherheitstrakt in einem amerikanischen Gefängnis. Der Gutshof mit Burggebäude und Mauern besaß fünfzehn Ein- und zwanzig Ausgänge. Angeblich existierte sogar noch ein unterirdischer Geheimgang, der bereits den Raubrittern im Falle einer Eroberung zur Flucht gedient hatte. Überall waren Lichtschranken und Kameras montiert. Pitbulls wachten in Zwingern, deren Türen sich per Fernsteuerung automatisch öffneten.
Es war ein Ding der Unmöglichkeit, unbemerkt hineinzugelangen. Natürlich aus gutem Grund. Schon häufig hatten die Antifa und andere linksmilitante Organisationen versucht, den Gutshof im Sturm zu erobern. Bisher vergeblich – die Rechten hatten jeden Angriff erfolgreich abgewehrt.
Die Beamten hatten zudem keine Möglichkeit, sich zu verstecken. Es gab nur Felder und weder Büsche noch Bäume, hinter denen Feinde Deckung hätten suchen können.
Ein mobiles Einsatzkommando wartete in fünf Kilometern Entfernung, bereit zum Einsatz für alle: die Verfassungsschützer, die ominöse Versammlung im Haus und potenzielle Angreifer. Vielleicht hatten die Linken einen Wink erhalten, was jedoch unwahrscheinlich war. Denn die rechte Elite duldete keine Maulwürfe, nachdem sie jahrelang von staatlich alimentierten V-Männern unterwandert gewesen war.
Was die wachsamen Verfassungsschützer nicht bemerkten, war, dass sie ihrerseits ebenfalls observiert wurden. Zwei Kameraden hatten sich einen Kilometer entfernt in Erdlöcher eingegraben. Sie sahen und hörten durch ein Richtmikrofon jedes Wort der beiden mit. Über Funk machten sie sich über die Staatsmachtvertreter lustig und bezeichneten sie verächtlich als „staatliches Söldner-Muschi-Pack“. Im Falle eines Zugriffs würden sie ein sorgsam orchestriertes Ablenkungsmanöver starten, um den Gästen des Hauses ein paar zusätzliche Minuten Vorsprung vor dem Zugriff zu ermöglichen.
„So ein Stelldichein hat es schon lange nicht mehr gegeben“, sagte der bulligere Beamte zu seinem Kollegen und fuhr im Telegrammstil fort: „Das Who is Who der rechten Szene. Hier versammelt. Auf einem Haufen. Wäre doch ein Aufwasch, alle auf einmal einzukassieren. Aber wegen der Störsender haben wir nicht einmal die Chance mitzuhören, was im Haus vor sich geht. Die Kollegen in der Homebase geben zwar ihr Bestes, haben aber gerade gemeldet, dass es kein akustisches Durchkommen gibt.“
Der größere Mann zuckte mit den Schultern und vergewisserte sich mit einem Griff an das Rückenholster. Die Glock saß perfekt. War eigentlich nicht erlaubt, aber angesichts der Brisanz des Einsatzes unumgänglich.
„Ist doch klar, dass der alle Tricks kennt. Aber wir haben ja unser trojanisches Pferd bereits untergebracht.“
„Ja, zum Glück“, stimmte der Kleinere zu, „Wagner ist nicht mit Geld zu bezahlen. Der hat sich da tief reingewühlt. Manchmal weiß man nicht mehr, auf wessen Seite der wirklich steht.“
Die Männer lachten – das Problem war im Amt bekannt. Um an die richtigen Kreise zu gelangen, war mehr als nur schauspielerisches Talent gefragt. Da bedurfte es einer gewissen Empathie, die überzeugend nach außen transportiert werden musste. Bei Wagner schieden sich die Geister. Während die einen sein Talent bewunderten, alles und jeden unterwandern zu können, sagten ihm seine Neider massive Affinitäten nach rechts nach. Noch schwerer wog seine persönliche Nähe zum Präsidenten des Amts, der auch nicht frei vom Ruch einer gewissen rechten Einstellung war und sich anschickte, zum Enfant Terrible der Republik zu werden. Aber vielleicht waren die beiden einfach nur großartige Schauspieler.
„Verdammt kalt“, fluchte der Hagere. „Manchmal hasse ich meinen Job.“
Die Akteure der Gegenobservation mussten sich zusammenreißen, um nicht in schallendes Gelächter auszubrechen. In ihren Erdlöchern saßen sie komfortabel in Bundeswehrunterwäsche und Parkas eingepackt und spürten kaum was von der Kälte. Die Trottel vom Verfassungsschutz trugen Übergangsmäntel und Polohemden darunter. Deren Problem, wenn sie glaubten, damit bis Stalingrad durchdringen zu können. Das kommt davon, wenn man aus der Geschichte nichts gelernt hat.
„Ja, die Kohle ist hart genug verdient“, stimmte der Stämmige zu. „Vor allem, wenn ich daran denke, was da drinnen vor sich geht. Die braunen Wichser werden es sich schön gemütlich gemacht haben – vermutlich im Kaminzimmer oder im restaurierten Keller mit Bar. Ich will gar nicht wissen, was da alles an Gourmet-Freuden aufgetafelt wird.“
Sein Kollege nickte.
„Die Getränke nicht zu vergessen. Die pfeifen sich bestimmt bestes Bier und feinste Weine rein.“
Die Gegenobservanten hielten sich mit Mühe zurück, nicht loszuwiehern und sich auf die Schenkel zu klopfen.
„Irgendwo habe ich beim letzten Aldi-Stopp noch ein Sixpack-Plastikflaschenbier im Dienstwagen versteckt“, gestand der Stämmige. „Ich glaube, es wäre an der Zeit für ein Fläschchen und gut gekühlt dürfte es auch sein.“
Einer der Gegenobservanten funkte seinem Partner etwas mit „Türkenkoffer auf vier Rädern“ zu, was erneut zu großer Heiterkeit führte. Was die Verfassungsschützer nicht mitbekamen. Denn der Spiritus Rektor der militanten rechten Szene sorgte gut für seine Leute. Er hatte sie mit silbernen Flachmännern voll edelstem Stoff versorgt. Womit sie jetzt per Funk anstießen. Als Rechter ließ es sich gut leben. Auf jeden Fall besser als die Trottel vom Dienst, deren nach unten hängende Mundwinkel aussagekräftig genug waren.
„Na, dann Prost!“
Die Hüter der deutschen Verfassung stießen mit den Plastikkolben an; das war auf jeden Fall alles andere als Dienst nach Vorschrift.
„Was würde ich dafür geben, wenn wir den Laden aufmischen könnten“, sagte der Größere.
„Und ich müsste jetzt dringend mal pissen“, antwortete sein Kollege.
„Tu was du nicht lassen kannst.“
„An welchen Baum? Oder in welches Gebüsch denn?“, jammerte der Stämmige. „Diese Schweine haben doch alles plattgemacht! Monokultur nennt man das.“
„Umweltschutz ist wohl nicht so ihr Ding“, stimmte der Größere zu.
„Denen geht’s mehr um Heimatschutz.“
„Und ich muss trotzdem, verdammt.“
„Wir sind hier, um diesen Laden zu observieren und im Notfall einzugreifen, also reiß dich zusammen!“
„Meine Blase platzt gleich.“
„Vielleicht greift ja die Antifa doch noch an“, ignorierte der Größere scheinbar das Bedürfnis seines Kollegen, „wenn wir Glück haben! Die haben sicher mobile Klosetts im Gepäck. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.“
Es sollte jedoch beim frommen Wunsch bleiben; die Raubritter blieben unter sich.
Sonntag, 28. September 2008 – Wien
Tscharly Hubers Blick zentrierte sich auf die Gesichtszüge der Frau, der ihr Mutterglück unweigerlich anzusehen war; trotz aller schlaflosen Nächte und der Blässe ihrer Haut, strahlte sie. Die lebhaften blauen Augen erinnerten ihn an Milla, seine Tochter, die diese von seiner Ex-Frau geerbt hatte. Milla und die Frau waren gleich alt. Die junge Mutter und ihr Partner berieten miteinander, ob ein Gratis-Spaziergang im Schlosspark von Schönbrunn dem Zoobesuch nicht doch vorzuziehen sei. Der Zoo verlangte fünfzehn Euro Eintritt pro Person – ein gesalzener Preis! –, die man ebenso gut in einen Kaffeehausbesuch investieren könnte. Tscharly musste sich mit Gewalt vom Anblick der glücklichen Traumfamilie mit dem Kinderwagen loseisen, ehe der Schmerz in seiner Seele ihn wahnsinnig werden ließ. Er schlenderte an den dreien vorbei und konzentrierte seine Gedanken auf seine persönliche gegenwärtige Situation. Müde warf er dabei einen Blick auf seine alte Rado – noch zwei Stunden. Um achtzehn Uhr würden die österreichischen Medien das Ergebnis der Nationalratswahl bekannt geben, jenen Wahlen, die auch den Grund dafür darstellten, warum die Menschen diesen herrlichen Altweibersommertag heute so zahlreich nutzten, um das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden: den Spaziergang an der frischen Luft mit dem Gang zur Wahlurne.
Er hatte noch ein wenig Zeit, die Wiener Atmosphäre in sich aufzunehmen. Tscharly fingerte das Diktiergerät aus seiner Cordjacke und sprach: „Bayern wählt seinen alten und neuen Ministerpräsidenten“, das klang wie eine Prophezeiung, „Österreich den alten und neuen Bundeskanzler … und alles bleibt anders!“
Schöne neue Welt der Konservativen in Europa, dachte er.
Die Redaktion zu Hause in München hatte ausgerechnet ihn nach Wien entsandt, um über die Wahl und die Stimmung der Österreicher zu recherchieren. An Belanglosigkeit schienen ihm diese Wahl und sein Auftrag kaum zu überbieten. Manchmal sehnte er sich an seine Zeit im Nahen Osten zurück – zurück in den Irak-Krieg. Damals – nach der Gefangennahme des Diktators Saddam Hussein im Dezember 2003 – war er der erste Europäer in der Wüste von Tikrit gewesen, der live und vor laufender Kamera darüber berichtet hatte. Was waren das für glanzvolle Zeiten in seiner Laufbahn als Journalist gewesen. Im Gegensatz zu Österreich fand er den Irak sogar schön, was er der Verklärung zuschrieb.
Im österreichischen Bundesland Kärnten kandidierte an diesem Tag ein bekannter Rechtspopulist um die Wiederwahl zum Landeshauptmann – ein politisches Amt, das in Deutschland jenem des Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer entsprach. Wenigstens ersparten Tscharly seine Recherchen den alljährlichen Münchner Oktoberfesttrubel, tröstete er sich. Das berühmte „italienische Wochenende“ auf dem größten Rummelplatz der Welt, das die obligatorischen sechs Millionen Besucher in die bayerische Landeshauptstadt lockte, hätte ihn in seinem Gefühl der Einsamkeit nur unnötig bestärkt. Tscharly hatte im August seinen fünfundvierzigsten Geburtstag still und heimlich begangen. Er hatte sich frei genommen und das Smartphone für einen ganzen Tag ausgeschaltet.
Wie sollte ein Mann, dessen einziges Kind seit vier Jahren als vermisst galt, irgendeinen Anlass zum Feiern in seinem Leben finden?
Am 30. Juni 2004 hatte er Milla in Köln in der Psychiatrie besucht; seine Tochter hatte kein Wort mit ihm gesprochen. Die Ärzte hatten ihren Zustand als Mutismus bezeichnet. Nach allem, was ihr widerfahren war, hatte sie sich von der Außenwelt in ihr tiefstes Innerstes zurückgezogen. Genau drei Tage später erhielt Tscharly den Anruf des Oberarztes, Milla sei spurlos verschwunden. Wie immer sie es geschafft hatte, aus der geschlossenen Psychiatrie zu entweichen, blieb ein Rätsel. Seither hatten sowohl die Polizei als auch Tscharly selbst erfolglos nach Milla gesucht. Seine Ex-Frau Sara gab natürlich ihm die Schuld an Millas Verschwinden. „Das kommt davon, wenn man als Vater nur seine Karriere im Kopf hat“, hatte sie wie eine Richterin ihr Urteil über ihn gesprochen. Und im Grunde genommen hatte sie recht: Sie hatten sich damals scheiden lassen, als Milla noch keine fünf Jahre alt gewesen war. Tscharly hatte es vorgezogen, sich im Nahen Osten herumzutreiben, anstatt sich der Situation zu Hause in München zu stellen – lieber Bürgerkrieg statt Rosenkrieg, das war seine Devise gewesen. Und selbst eine zweite Chance muss man sich im Leben verdienen, dachte er jetzt. Ich habe diese zweite Chance jedenfalls nicht verdient.
Tscharly verließ durch das Hietzinger Tor den Schlosspark und wechselte auf die andere Straßenseite, wo das Schönbrunner Parkhotel damit warb, dass Thomas Edison angeblich in diesen altehrwürdigen Räumen die Glühbirne erfunden hatte. Tscharly schlenderte über den Bürgersteig und ignorierte erst eine – und dreißig Meter weiter – noch eine weitere Frau, die versuchte, mit ihm Blickkontakt aufzunehmen; das Wetter lud zum Flirten ein. Tscharly zog seine innere Eremitage jedoch einem One-Night-Stand vor. Er ging Menschen lieber aus dem Weg. Das galt auch in beruflicher Hinsicht. Das Treffen mit dem Informanten, der ihm geheime Details über die Wahlkampf-Finanzierung des Kärntner Rechtspopulisten hatte liefern wollen, war nicht zustande gekommen. Sie hatten sich bei der Gärtner Stiege im Schlosspark treffen wollen. Tscharlys Enttäuschung hielt sich dementsprechend in Grenzen. Ich habe genug von Wien gesehen, zog er in Gedanken Resümee über die letzten vierundzwanzig Stunden. Eigentlich könnte ich genauso gut in Ruhe eine Melange trinken, ein Stück Sachertorte essen und abreisen. Wie habe ich nur daran glauben können, in Wien auch nur einen Schritt weiterzukommen?
Drei Tage zuvor – Donnerstag, 25. September – München
„Wenn ich es nicht besser wüsste, Tscharly, dann müsste ich glatt glauben, du verheimlichst mir irgendwas. Und außerdem bist du schon wieder zu spät.“
„Der Wagen …“, stammelte Tscharly.
„Erzähl mir nichts von deinem Spielzeug“, entgegnete der alte Methusalem, „mit meinem einen Auge sehe ich mehr als der Großteil meiner Zeitgenossen, auch wenn man mir das nicht zutraut! Du hast den Alfa Spider erst vor Kurzem restaurieren lassen. Der fährt wie am Schnürchen. Hab dich gesehen, wie du eben draußen auf dem Parkplatz vor der Redaktion damit vorgefahren bist.“
„Ich …“ Tscharly scheiterte beim Versuch, sich eine weitere Ausrede auszudenken.
„Ist schon gut“, kam ihm sein Ex-Schwiegervater entgegen, „als Augenklappenträger verzeihe ich dir, vielleicht habe ich mich ja verschaut. Als dein Chef müsste ich dich allerdings ermahnen. Als dein Freund und Leidensgenosse habe ich Verständnis. Du ziehst dich zurück in dein Schneckenhaus. Es tut weh, wenn das eigene Kind keinen Kontakt zu einem mehr haben will.“
Tscharly wollte über dieses Thema nicht sprechen und wich aus: „Ich halte einfach die Kollegen in der Redaktionssitzung mit ihren selbstgefälligen Mienen nicht mehr aus. Das ist alles!“
„Ich kann dich nicht immer vor ihnen beschützen“, nickte der alte Methusalem, „aber deine Schnapsidee, ausgerechnet in Wien nach deiner Tochter zu recherchieren, halte ich für völlig daneben. Dass ich nicht lache, warum sollte sie sich ausgerechnet in die österreichische Hauptstadt abgesetzt haben?“
„Milla ist nicht freiwillig in Österreich!“
„Jetzt fängt das wieder an. Deine Tochter ist nicht die neue Natascha Kampusch. Und Roland Wagner ist nicht Priklopil1. Schmink dir das ab.“
„Milla ist entführt worden. Freiwillig ist sie ihm niemals gefolgt“, beharrte Tscharly.
„Es gab doch überhaupt keinen Hinweis darauf, dass Milla mit Gewalt aus der Psychiatrie befreit oder entführt worden ist, Tscharly. Du verrennst dich da in etwas, das nicht der Realität entspricht. Sie hat Schlimmes durchgemacht und ist auf der Flucht vor ihrem alten Leben.“
Er beschloss, dem alten Methusalem nichts von dem Anruf zu erzählen. Ein Peter Smuss hatte in seinem Leben genug Schicksalsschläge durchlitten, wovon auch die Tätowierung an seinem Handgelenk beredtes Zeugnis ablegte. Als einer der wenigen Überlebenden von Auschwitz hatte er nach dem Krieg eine Karriere vom Zeitungsjungen zum Verleger geschafft. Dass ihm seine erste Frau davongelaufen war, als seine Tochter Sara noch keine fünf Jahre alt gewesen war, gehörte zu den wunden Punkten in der Biografie des Selfmademans. Kein Wunder, dass er jeden Gedanken an die verschwundene Enkelin verdrängte und es verabscheute, wenn Tscharly darüber zu reden begann. Das Thema Milla gehörte für ihn – ebenso wie Auschwitz – zu den Tabus in seinem Leben, worauf man ihn besser niemals ansprach.
„Vielleicht hält sie sich in Israel auf. Bei ihrer Mutter“, meinte Smuss.
Sara hatte nach Millas Verschwinden das Leben in Deutschland nicht mehr ertragen und war vor einem halben Jahr endgültig ins Exil nach Israel gegangen. Dort lebte sie mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten – Smuss´ Nachfolger – in einem Kibbuz im Westjordanland. Einen Kakteenzüchter hatte seine Frau ihm damals vorgezogen. Daran erinnerte der Feigenkaktus, der seit Urzeiten auf dem Fensterbrett seines Büros stand – ein Abschiedsgeschenk seiner ersten Ehefrau. Einerseits war die Pflanze Symbol seiner Niederlage als Familienvater und Ehemann, andererseits hatte er wohl niemals ganz mit dieser Frau, die ihm eine Tochter geschenkt hatte, abschließen können, vermutete Tscharly.
„Wenn Milla bei ihrer Mutter und ihrer Oma wäre, hätte sie uns längst ein Lebenszeichen geschickt“, widersprach Tscharly.
„Wer versteht schon Frauen?“, entgegnete der Vierundachtzigjährige und sog an seiner Pfeife, die seine zweite Frau ihm an ihrem ersten Hochzeitstag geschenkt hatte. Jene Frau, die knapp vierzig Jahre jünger war als er, die zu Hause in seiner Villa in Schwabing auf ihn wartete. Diese Frau war ausgebildete Opernsängerin, warum auch immer sie für einen alten Mann ihre Karriere auf Eis gelegt hatte und es vorzog, in seinem Schatten zu stehen, konnte Tscharly nicht nachvollziehen. Aber jeder sollte auf seine Weise glücklich werden. Manchmal beneidete Tscharly den alten Verleger um die Tatsache, dass er nach Hause kam und jemand auf ihn wartete. Ganz egal, wie groß der Altersunterschied auch sein mochte. Der Klingelton von Tscharlys Smartphone unterbrach ihr Gespräch. Der Alte runzelte die Stirn. Keine Frage, das empfand der Alte als ungehörig mitten im Gespräch, wie seine Miene verriet. Private Nummer, zeigte das Display an. Tscharly schaltete das Handy auf stumm und ließ es in seiner Hosentasche verschwinden, wo es munter weiter vibrierte.
„Ich weiß, dass ich Milla in Österreich finden werde“, ließ Tscharly nicht locker.
„Geh nur ran“, ermutigte ihn der Alte sarkastisch. „Vielleicht ist ja sogar Milla höchstpersönlich dran.“
Tscharly ignorierte den Sarkasmus des Alten und blickte auf das Gerät. Keine gespeicherten Nachrichten auf Ihrer Mobilbox, stand dort, aber dafür hatte er eine WhatsApp-Nachricht erhalten.
11.17 Uhr München HBF, Gleis 7, Bahnsteigende.
„Brennt’s?“, fragte der alte Methusalem und fügte hinzu: „Schon gut, aber über Wien müssen wir uns noch unterhalten. Es gibt da eine alte Freundin von mir. Ich will, dass du sie besuchst. Das ist meine Bedingung. Und jetzt zieh deiner Wege. Mach das, was du beherrschst. Recherchiere, schreibe und bringe mir Anzeigenkunden zurück.“
„Ich melde mich“, versprach Tscharly und war schon zur Türe draußen.
„Ach“, rief Peter Smuss ihm hinterher, „noch was Tscharly.“
„Was?“
„Einen Wunsch habe ich.“
„Und der wäre?“
Smuss lächelte verschmitzt. „Einmal im Leben möchte ich, dass du mir die Schlüssel zu deinem Alfa Romeo überlässt und dann möchte ich eine Runde mit dem Spielzeug drehen dürfen. Ganz allein!“
Der Gedanke ließ Tscharly angst und bang werden; der Alte ließ sich seit Jahrzehnten von seinem Chauffeur herumkutschieren. Ihm die Schlüssel zu geben …
„Sonst lass ich dich nicht nach Wien fahren“, schob der Alte hinterher.
„Meinetwegen“, erwiderte Tscharly – und suchte nach einer Ausflucht, „wenn du das nächste Mal Geburtstag feierst, Peter – gerne.“ Vielleicht hatte der Alte bis dahin sein Versprechen längst wieder vergessen, hoffte er zumindest.
Als Tscharly zu seinem geliebten Cabrio zurückrannte, fühlte er sich in seinem Element. Sein Herz hämmerte in den lautesten Tönen. Hatte es sich also doch ausgezahlt, das Gerücht zu verbreiten, für sachdienliche Hinweise, die illegale Finanzierung rechter Netzwerke betreffend, attraktive Summen zu bezahlen. Die SMS war Beweis genug.
Er startete den Motor und raste los.
Auf Gleis sieben herrschte das übliche Gedränge. Männer, Frauen und Kinder warteten auf den ICE nach Berlin. Koffer, Taschen und Rucksäcke türmten sich. Tscharly lief Slalom. Er kämpfte sich ans Ende des Bahnsteigs vor. Da – ganz hinten, kurz vor dem Bahnsteigende, stand ein korpulenter Mann, der den Blick starr auf sein Handy gerichtet hielt. Die blonden Haare standen wie Schweineborsten ab und passten zum ungepflegten Erscheinungsbild und dem Jogginganzug unter einem schwarzen Ledertrenchcoat.
„Sind wir miteinander verabredet?“, fragte Tscharly.
Er wurde aus der Kleiderkombination nicht recht schlau; zur Jogginghose trug der Mann schwarze Slipper, die aussahen, als hätten sie locker dreihundert Euro gekostet. Bei dem Typen handelte es sich weder um Ober- noch um Unterschicht. Das Sprichwort „Kleider machen Leute!“ geriet in diesem speziellen Fall zur modischen Groteske.
„Wer will das wissen?“, entgegnete der Mann scharf und blickte Tscharly eingehend an.
Tscharly konnte sich nicht entscheiden, ob er das Gesicht eher als Hack- oder Schweinefresse bezeichnen würde. Spielte eigentlich auch keine Rolle. Es ging um Informationen und keine Freundschaften fürs Leben.
„Tscharly Huber. Ich habe eine Nachricht erhalten, dass ich mich jetzt hier einfinden soll.“
Der Mann salutierte. Das löste bei Tscharly unerfreuliche Assoziationen aus. In seiner kurzen Karriere bei der Bundeswehr war er der schlechteste Schütze gewesen. Warum nur kamen diese rot-grünen Politiker in Berlin nicht auf die Idee, die Wehrpflicht endlich abzuschaffen?
Tscharly erklärte: „Sie wollten mir sachdienliche Hinweise über die Finanzierung …“
Mit einer eindeutigen Handbewegung schnitt ihm der geheimnisvolle Mann das Wort ab. Der Schmiss über der Wange konnte ein Erklärungsansatz über seine politische Herkunft liefern. Vielleicht hatte dieser Typ sich aber auch nur beim Rasieren verletzt.
„Folgen Sie mir! Wir wandern ein wenig im Bahnhof herum. Das fällt am wenigsten auf. Und gleich vorneweg: Behalten Sie Ihre Kröten! Geld interessiert mich nicht die Bohne.“
Dieser Befehl leuchtete Tscharly keineswegs ein. Was sollte diese Taktik? Überall standen Polizisten und Kameras sorgten für zusätzliche Sicherheit. Abgesehen davon – was wollte dieser Mann, wenn es ihm nicht um Geld ging? Ihm blieb vorerst nichts übrig, als neben dem „Herrn General“, wie er ihn in Gedanken nannte, her zu trotten.
„Hier sind wir am sichersten“, erklärte der General. „Gerade da, wo sich Menschen tummeln und jeder Quadratzentimeter mit Kameras überwacht wird und unser Gespräch durch die Hintergrundgeräusche überdeckt werden, vermutet kein Mensch konspirative Gespräche. Sollte uns doch jemand entdecken und Sie später jemand darauf ansprechen, behaupten Sie, dass wir uns vom Studium kennen, uns zufällig hier über den Weg gelaufen sind und uns über alte Zeiten unterhalten haben.“
„Verstanden.“
„Mein Name tut nichts zur Sache und im Netz müssen Sie lange suchen, bis Sie ein Fitzelchen über meine Identität finden. Ich habe es bisher vermieden, elektronische Schleifspuren zu hinterlassen. Was ich Ihnen sage, entspricht der Wahrheit. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich bin einer der wenigen Menschen in Deutschland, die das Wort Ehre noch ernst nehmen. Und wenn Sie in die von mir angedeutete Richtung weiter bohren, werden Sie mehr Dreck finden, als Ihnen lieb ist und für Ihre Sicherheit möchte ich dann nicht meine Hand ins Feuer legen.“
Diese Worte hörten sich an, als entstammten sie dem Buche der Offenbarung aus der Bibel. Fehlten nur die Reiter der Apokalypse. In Tscharly bewirkte die Drohung ein Gefühl der Euphorie. Er würde jede noch so teuflische Gefahr in Kauf nehmen, um Rechtsterroristen und ihre Finanziers zu entlarven. Auch wenn es ihn sein Leben kostete.
„Ihre Ankündigungen klingen verheißungsvoll“, antwortete er und ließ nicht eine Spur von Zweifel in seiner Stimme durchklingen. „Ich hoffe, dass es sich um überprüfbare Angaben …“
Der General blickte ihn brüskiert an. „Ich kann auch gleich wieder gehen, wenn Sie mir nicht glauben. Ein wenig Eigenrecherche muss schon sein. Dafür werden Sie doch bezahlt. Aber stellen Sie nie meine Integrität in Frage, sonst war’s das.“
„So war das gar nicht gemeint“, beeilte sich Tscharly und fluchte einmal mehr innerlich, seine Zunge im Umgang mit diesen rechten Herren nicht genug im Griff zu haben. Hoffentlich merkte der Typ ihm seine Aversion nicht an. „Ich habe es leider oft mit sogenannten Informanten zu tun, die sich produzieren wollen und die wildesten Geschichten auftischen.“
Der Blick des Generals sprach Bände – noch ein frevlerisches Wort und das war’s … Dann atmete er sichtlich dreimal tief durch und gab sich einen Ruck.
„Es wird etwas auf uns zukommen, das sich noch niemand vorstellen kann“, orakelte er geheimnisvoll. „Ein Sturm wird über Deutschland hinwegfegen, nach dem kein Stein mehr auf dem anderen stehen wird.“ „Die rechte Revolution?“, hakte Tscharly ein.
Der Mann blieb bei einer Bäckerei stehen und bestellte einen Cappuccino to go. „Nennen Sie es, wie Sie wollen“, antwortete er, während er passend das Kleingeld abzählte. „Damit wir uns richtig verstehen: Ich rede hier weder über Parteien-Kindergarten noch über T-Shirt-Terroristen.“
Der Begriff war Tscharly neu: T-Shirt-Terroristen waren vermutlich Glatzen, die nach außen hin militant-martialisch auftraten, mit Stilgranaten und NS-Symbolen auf den Bekleidungsoberteilen, einer Menge verbotener Messer, CS-Gas, Wurfsterne, Armbrüsten, Stahlkappen in den Stiefeln und so weiter. Aber letztlich blieb es bei diesen Pappkameraden immer nur bei pubertärem Blabla, das sich mit jedem Bier steigerte, bis sie sich die Niederlage des Dritten Reichs im Zweiten Weltkrieg zum grandiosen Sieg gesoffen hatten. Alkohol verändert eben Wahrnehmungen. Manchmal drehten diese Typen durch und erschlugen im Vollrausch einen Afrikaner und fühlten sich dabei, als hätten sie Stalingrad im Alleingang eingenommen.
„Haben Sie sich einmal gefragt, was mit KSK-Kräften passiert, wenn sie mit knapp über dreißig zwangsweise ausgemustert werden?“, holte ihn seine Quelle aus seiner Gedankenwelt zurück ins Hier und Jetzt.
Diese Frage hatte Tscharly sich nie gestellt. Das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr war als Vorzeige-Elite-Truppe in Verruf geraten, soviel wusste er. In Journalistenkreisen munkelten die Kollegen über SS-Devotionalien in den Kasernen und Ritualen, die dem NS-Geist entsprangen. Bisher hatte die Politik alles in vorauseilendem Gehorsam gedeckelt. Und ein besonders umtriebiger Journalist, den Tscharly gut kannte, hatte bereits eine heftige Abreibung erhalten, ohne dass die Polizei den Tätern auf die Spur gekommen wäre.
„Ich denke, die machen sich selbstständig und gehen in die Sicherheitsbranche“, antwortete er, worauf der General lachte.
„Vielleicht heuern auch einige als Söldner irgendwo an“, fuhr Tscharly fort.
„Wen außer Politikern und eventuell Stars wollen diese Typen denn heutzutage beschützen, Huber?“ Er nippte und setzte seine beleibte Figur langsam wieder in Bewegung. „Und in den Busch zu fliegen, um ein paar Affen mit dem IQ eines Elfjährigen zu töten, ist nicht der feuchte Traum der ehemaligen Elitesoldaten der deutschen Bundeswehr, zumal die Besoldung dafür immer schlechter wird.“ Er machte eine wohlakzentuierte Pause. „Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Diese Männer sind hocheffiziente Tötungsmaschinen, deren Ausbildung einen Spezialisierungsgrad erreicht hat, die Ihresgleichen auf der Welt sucht. Versetzen Sie sich in die Psyche dieser Männer. Für sie gibt es schlagartig keine Verwendung mehr. Was denken Sie, wie die sich fühlen? Während der Dienstzeit wurde ihnen Korpsgeist vom Feinsten eingetrichtert und nun sollen sie als friedliche einsame Wölfe in die zivile Welt entlassen werden und klarkommen. Es eignet sich nicht jeder Ex-Bundeswehrler zum Fahrlehrer. Sie merken, da knirscht es.“
Das leuchtete Tscharly ein. „Aber gibt’s denn keine Möglichkeit, diese Leute weiter bei der Bundeswehr zu beschäftigen?“
Ein zynisches Lächeln zeichnete sich auf dem Gesicht der Schwabbelbacke ab. „Theoretisch schon. Aber diese Männer haben Würde. Rückgrat. Sie zählen jahrelang zur obersten militärischen Elite eines Landes, sind bereit ihr Leben zu geben und gehen in die heikelsten Geheimmissionen. Glauben Sie wirklich, dass diese Männer für den Rest ihres Lebens Schweinefleischkonserven und WC-Papier für Bundeswehrsoldaten bestellen wollen?“
„Würde mir vielleicht genauso gehen“, schmeichelte Tscharly sich ein.
„Jetzt nehmen Sie das zusammen mit frustrierten Rechten, die normale Soldaten beim Bund waren, also auf einem geringeren Level Töten gelernt haben und die danach im sozialen Nichts verschwinden. Diese Typen schließen sich in Freien Kameradschaften oder sonstigen Vereinen zusammen. Manchmal gibt es zudem Elite-Polizisten und Militärs, die aktiv, aber frustriert sind, weil sie bei Beförderungen übergangen worden sind oder sich ungerecht behandelt fühlen. Manche der im Dienst Aktiven sind im Grunde ihres Herzens überzeugte Rechtsextremisten. Stellen Sie sich vor, jemand finanziert paramilitärische Übungen, die von den KSK-Leuten, die militärisch, taktisch und strategisch die beste Ausbildung genossen haben, geleitet werden.“
Bei dieser Aussicht wurde Tscharly schwindelig. Solch ein Szenario hatte er sich nicht einmal in seinen übelsten Albträumen vorgestellt.
„Die arbeiten auf den Tag X hin?“, wagte er einen Schuss ins Blaue, wobei er sich ärgerte, dass ihm keine bessere Formulierung als „Tag X“ einfiel, aber Staatsstreich oder Putsch schienen ihm doch zu hoch gegriffen.
General Schweineborste winkte ab – vergiss den Tag X und höre zu, was ich zu sagen habe.
„Die Frage ist doch“, fuhr der General fort, während er den halbvollen Papp-Becher treffsicher in einen der silbernen Mülleimer versenkte, „wer hat Interesse daran, die Verhältnisse ins Wanken zu bringen?“
Die letzten Worte hatte Tscharly kaum verstanden, da eine Lautsprecherdurchsage über verspätete Züge die nächste jagte.
„Die Rechtsradikalen natürlich“, antwortete er seinem Gegenüber. „Die alten Seilschaften. Die ehemaligen Glatzen und heutigen Anzugträger. Vielleicht auch Topp-Militärs, Elite-Polizisten, Politiker am rechten Rand. Also potenziell alle, die Probleme mit dem freiheitlichdemokratischen System haben und sich die gute alte Zeit zurückwünschen.“
Der Mann mit dem Schmiss verzog verächtlich das Gesicht.
„Mehr haben Sie nicht auf Lager, Huber? Leute wie Sie landen bei der Presse? Kein Wunder, dass so viel unentdeckt bleibt. Ich gebe Ihnen ein paar weitere Hinweise und verschwinde dann. Erstens: Es gibt hochpotente Finanziers, die sich eine Destabilisierung der Verhältnisse in Deutschland auf die Fahnen geschrieben haben. Ihre persönliche Denke ist da viel zu eng, Huber. Weil es sich um Nationalsozialisten handelt, müssen nicht alle diesbezüglichen Zusammenhänge auf Deutschland beschränkt sein. Sie sollten vielmehr in geopolitischen Dimensionen denken. Noch nie was von Globalisierung gehört?“
Irgendwie stand Tscharly auf dem Schlauch und konnte das mimisch nicht überspielen.
„Ihr Stand hat schon lange nicht mehr den besten Ruf“, wurde der Informant aggressiv. „Pah, die Presse – da haben sogar Facility-Manager einen besseren Ruf. Ich stelle Ihnen mal eine Frage, um Ihrem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge zu helfen, Huber. Wieso unterstützt ein orientalischer Diktator wie Muamar al Gaddafi die IRA?“
Tscharly dämmerte, worauf der General hinauswollte.
„Zweitens: Alle Wege führen über die österreichische Hauptstadt.“
Tscharlys innerliches Beben verdiente mindestens eine Sieben auf der Skala eines Seismografen.
„Machen Sie es gut und passen Sie auf sich auf!“, beendete sein Informant das Gespräch und stand im Begriff sich umzudrehen. Dabei hatte Tscharly tausend Fragen. Warum der Typ ihm die Informationen zukommen ließ, wen er repräsentierte und überhaupt …
„Warten Sie!“, rief er dem korpulenten Mann hinterher.
Tatsächlich drehte dieser sich noch einmal um. „Versuchen Sie nicht mir zu folgen“, befahl er. „Und nur weil ich Ihre Naivität rührend finde, ein letzter Tipp, der Sie als Privatperson angeht: In Wien und Kärnten liegen die Antworten auf all Ihre Fragen, Sie müssen nur tief genug bohren.“
Dann formte er mit den Daumen und Zeigefingern ein Herz. Für einige Sekunden hatte Tscharly den Eindruck, dass sein Herzschlag aussetzte. Danach formte er mit Daumen- und Zeigefinger eine Pistole und drückte ab.
„Milla?“, schrie er wie ein Verrückter in das Irrenhaus des Hauptbahnhofes, doch im Gedränge entdeckte er den General nirgends mehr. Verdammt, dachte Tscharly. Jetzt habe ich mehr Fragen als Antworten in meinem Kopf. Ich hätte den Drecksack festhalten und aus ihm herausprügeln müssen, was er über Milla weiß. Er versuchte sich zu trösten: Immerhin weiß ich, dass die Wiener Spur kein Irrweg ist.
1 Natascha Kampuschs Entführer
Sonntag, 28. September, Wien
Die Matratze verbreitete einen Geruch von Desinfektionsmittel und Urin; Familiendynastien von Wiener Bettnässern hatten sich darin verewigt. Zwischen Dusche und Toilette hing ein Portrait von Kaiserin Elisabeth, die als Namensgeberin der Pension fungierte. Ob Sisi diese Ehre zu schätzen gewusst hätte, wagte Tscharly zu bezweifeln. Am ehesten hätte vielleicht Romy Schneider – als ihre Stellvertreterin auf Erden – diese Frage beantworten können. Aber sie weilte bekanntlich schon lange nicht mehr unter den Lebenden. Zwei Frauen, die auf tragische Weise das Zeitliche gesegnet hatten. Auf alle Fälle würde Tscharly dem alten Methusalem beim nächsten Mal ein großzügigeres Reisebudget abverlangen, das nahm er sich fest vor, während er das Antidepressiva, das er seit vier Jahren jede Nacht zum Einschlafen brauchte, schluckte. Die Tablette bewahrte ihn allerdings nicht davor, immer wieder aus ein und demselben Albtraum schweißgebadet zu erwachen. Tscharly war an diesem Sonntagmorgen, den 28. September, um drei Uhr in der Nacht schreiend erwacht. Aus Erfahrung wusste er, dass jeder weitere Versuch wieder einzuschlafen sich als sinnlos erwies. Also stand er auf und trank einen schwarzen Kaffee. Anschließend packte er sein Trainingsgewand ein. Er fand ein Sportstudio, das zu einer internationalen Fitnesskette mit Stammsitz in München gehörte und in Wien rund um die Uhr geöffnet hatte. Mit Blick auf den Stephansdom stemmte er Hanteln, machte Klimmzüge mit Zusatzgewicht und absolvierte ein einstündiges Ausdauertraining auf einem Laufband. Das Training half ihm, den Kopf wenigstens für ein paar Stunden freizubekommen. Dann dämmerte endlich der Morgen. Tscharly verbrachte den beginnenden Tag damit, durch Wien zu schlendern und die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen.
Er trieb sich in der Mariahilfer Straße rum; die Geschäfte waren geschlossen. Er ließ sich von einem Taxifahrer den Gürtel entlang fahren; die Prostituierten standen wie bestellt und nicht abgeholt. Er aß zu Mittag einen Tafelspitz in einem Gasthaus in Alt-Hietzing. Am Nachmittag machte er sich auf den Weg nach Schönbrunn, um seinen Informanten zu treffen. Zwei Stunden stand Tscharly neben der linken Säule der Gloriette im Schlosspark mit Blick auf das berühmte Sisi-Schloss. Keine Spur von seinem Informanten. Deshalb war er wieder bergabwärts marschiert – vorbei an glücklichen Familien, deren Kinder die Stadt-Eichhörnchen mit Haselnüssen und Brot fütterten. Was wie eine Tollwutepidemie aussah, war in Wien Normalität. „Wien ist anders“, las Tscharly auf Plakaten.
Er schaute auf die Rado. Noch eine Stunde, dann wusste die Welt, wer in Zukunft dem österreichischen Nationalrat als Kanzler für die nächsten vier Jahre vorstand. Und das Bundesland Kärnten erfuhr, ob es einem Rechtspopulisten ein zweites Mal eine Bühne bot. Tscharly ließ das Schloss und seine Umgebung hinter sich. In der Parkgarage bezahlte er an einem Automaten eine horrende Gebühr und lenkte den Alfa Spider über die Gleise einer Straßenbahnlinie. Er bog irgendwann links ab in eine Straße, die den Namen Jagdschlossgasse trug, und fand schließlich die Adresse einer Frau, die der alte Methusalem ihm in München diktiert hatte.
Auf der einen Seite der Straße standen prachtvolle Villen, die an Schlösser erinnerten, auf der anderen sogenannte Gemeindebauten – eine österreichische Bezeichnung für Sozialwohnungen. Böse Zungen behaupteten, Wien sei das Tor zum Balkan. Die mit Graffiti verzierten Bauten verhießen eine Gegenwelt zu den bekannten Wiener Touristenmeilen. Die eckigen Gebäude boten einen Innenhof mit Laubbäumen und Grünflächen. Dazwischen lockten Spielplätze mit Schaukeln, Rutschen und Sandkästen Kinder an. Ein halbes Dutzend Jungen mit dunklem Teint kickte einen Fußball hin und her neben einem Schild mit der Aufschrift: „Ballspielen verboten“. Sie schossen Tscharly das Leder zu, der es prompt den Jungen zurückpasste. Neben einem Schild mit der Aufschrift „Radfahren wird angezeigt“ brachte ein junger Vater seiner fünfjährigen Tochter das Fahren mit Stützrädern bei. Beide blickten ihn freundlich an. Rosensträucher rankten neben Hauswänden. Der Wildwuchs hätte ohne weiteres an Schönheit mit den gestutzten Hecken des Schönbrunner Schlossparks konkurrieren können, fand Tscharly. Das Leben im Gemeindebau war echter.
Tscharly betätigte die Türglocke. Keine Reaktion. Daraufhin wählte er eine Nummer auf seinem Smartphone. Ein Surren verhieß ihm, einzutreten. Im Treppenhaus bröckelte Putz von den Wänden. Der Geruch von Schimmel und würzigen Speisen lag in der Luft. Tscharly folgte den Stufen in den ersten Stock, wo eine Frau ihn vor ihrer Haustür erwartete.
„Herr Huber?“
„Der bin ich.“
„Mira. Mira Filipovic.“
Sie trug eine braune Bluse, Jeans und ging mit nackten Füßen in die Wohnung. Er folgte ihr. Sie blieben in einem Wohnzimmer, dessen bunte Einrichtung nach IKEA aussah, stehen. Tscharly blickte in ihr Gesicht und versuchte anhand ihrer Falten ihr Alter zu schätzen. Zwischen dreißig und vierzig, vermutete er. Andererseits wirkten die Augen jünger, wenn auch sehr traurig.
„Möchten Sie einen Kaffee?“
„Nein, danke, nicht um diese Zeit, ich kann sonst später nicht mehr einschlafen.“
Sie lächelte und wies ihm einen Sessel zu. Sie nahm auf einer roten Couch Platz und schlang das rechte Bein über das linke.
„Ich habe gewusst, dass Sie zu spät kommen werden, Herr Huber“, sagte sie wie eine Hellseherin.
„Mein Ex-Schwiegervater hat mein Kommen ja angekündigt. Ich weiß nicht, was er Ihnen über mich erzählt hat. Ich entschuldige mich jedenfalls. Ist nicht gerade …“ Er hatte vergessen, was er sagen wollte.
Sie lächelte und legte ihre Hände entspannt auf den Knien ab. Er verstummte und bemerkte ihre Fingerknöchel. Geschwollen und unbeweglich. Diese Frau musste wahnsinnige Schmerzen leiden. Er wandte seinen Blick ab und kam auf den Grund seines Kommens zu sprechen: „Mein Schwiegervater behauptete, Sie könnten mir etwas über die Lage der Roma und Sinti in Kärnten erzählen. Er meinte, Sie hätten dort eine Zeit lang gelebt, nachdem Sie 1995 aus Ex-Jugoslawien geflohen sind, Frau Filipovic.“
„Ich habe nach meiner Flucht ein paar Monate in München gelebt und als Putzfrau in seinem Haus gearbeitet. Ich war illegal in Deutschland. Peter Smuss hat mich großzügig bezahlt und mir ein Dach über den Kopf gegeben.“
Dermaßen selbstloses Verhalten hätte er dem Alten gar nicht zugetraut. „Hat er mir gar nicht erzählt, dass Sie Sklavenarbeit für ihn gemacht haben, Frau Filipovic.“
„Das war keine Sklavenarbeit. Ich war in Sicherheit.“
„Der alte Verleger hat Ihre Notlage ausgenutzt.“
„Er hat Anwälte bezahlt, die mir geholfen haben, einen legalen Aufenthaltsstatus für Deutschland zu bekommen. Ohne ihn wäre ich heute nicht hier, Herr Huber. Es würde mich vielleicht gar nicht mehr geben.“
„Warum sind Sie anschließend nach Kärnten gegangen? Und später nach Wien?“
„Sie stellen Fragen, dabei sind Sie doch selbst alles andere als ein typischer Gadsche.“
„Ein was?“
„Ein Gadsche. So nennen wir Roma die sesshaften Menschen. Wenn ich mich recht erinnere, waren Sie in den Neunzigerjahren auf Reisen. Bis vor sieben Jahren haben Sie sich ständig irgendwo in der Welt herumgetrieben, nur nicht dort, wo Sie dem Herzen nach hingehören. Peter hat mir viel über Sie erzählt.“
Tscharly brauste auf. „Was hat mein Ex-Schwiegervater Ihnen noch alles über mich erzählt?“
Mira Filipovic gab sich vom gereizten Klang seiner Stimme unbeeindruckt. „Jetzt hat Ihr Weg Sie jedenfalls zu mir geführt. Den Auftrag, für den Sie für Ihren Ex-Schwiegervater und die Münchener Neuesten Nachrichten recherchieren sollen, soll ich Ihnen erklären“, eröffnete sie ihm. „Smuss hat mich darum gebeten. Das ist der Grund, warum Sie heute hier sitzen.“
Tscharly fiel aus allen Wolken. „Warum erteilt er mir die Aufträge nicht selbst?“
„Sehen Sie, das hat Ihr Ex-Schwiegervater auch gesagt.“
„Was?“
„Dass Sie genau so reagieren werden.“
„Ist Smuss neuerdings unter die Hellseher gegangen?“
Er schaute sich um auf der Suche nach Gegenständen wie Traumfängern, Hasenpfoten oder sonstigen Glücksbringern, die an Esoterik, Schwarze Magie oder allerlei Humbug hätten denken lassen. Vergebens. Trotzdem befiel ihn eine Vorahnung, die ihn angst und bange werden ließ. „Ich glaube, ich bin der Falsche für den Job, Frau Filipovic.“
„Besitzen Sie denn eine Glaskugel, Tscharly?“, führte sie seine Angriffe ad absurdum.
„Nein.“
„Sehen Sie, ich auch nicht. Und das ist der Grund, warum ich auf Ihre Hilfe hoffe.“
Er musste an Milla denken. „Ich weiß nicht, ob ich momentan …“
„Herr Smuss hat mir von Ihrer Tochter erzählt. Und glauben Sie mir, wir sitzen beide im gleichen Boot. Auch ich habe ein Kind verloren. Mein Sohn, 1995, Srebrenica – und auch meinen Mann.“
Tscharly unterdrückte seinen Groll und erwiderte gereizt: „Meinetwegen kann ich mir das Ganze mal anhören.“
„Ich danke Ihnen von Herzen.“
„Haben Sie was dagegen, wenn ich unser Interview aufzeichne?“ Er legte das Diktiergerät auf den Wohnzimmertisch.
„Nein.“
„Dann legen Sie los.“
Vielleicht, tröstete er sich, schreibe ich ja eines Tages einen Roman über das alles.
Siegfried, Tatsachen-Roman von Tscharly Huber, Entwurf (Textschnipsel Nummer 1)