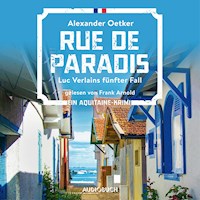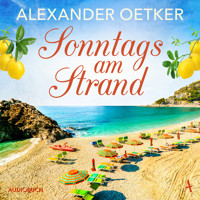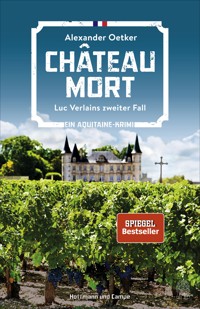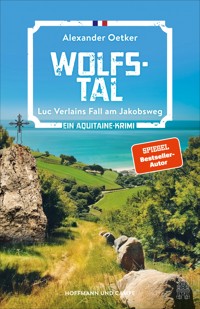15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Krimi
- Serie: Giulia Ferrari ermittelt
- Sprache: Deutsch
In den idyllischen Gassen der Florentiner Altstadt tauchen mysteriöse Vermisstenplakate auf: Die Frauen darauf sind angeblich verschwunden. Tatsächlich aber geht es ihnen gut – abgesehen davon, dass sie alle zutiefst erschrocken sind. Kurz zuvor wurde eine jede von ihnen von einem Unbekannten verfolgt. Was nur will er mit den Plakaten erreichen? Die dynamische Commissaria Giulia Ferrari und ihr einzigartiges Team – der blinde Polizist Enzo, der ehemalige Kripobeamte Luigi, dessen urgemütliche Bar die zentrale Anlaufstelle für das Team ist, und der Hund Tulipan mit seiner unbestechlichen Spürnase – machen sich gemeinsam an die Ermittlungen. Sie müssen sich beeilen, denn in immer kürzeren Abständen tauchen neue Plakate auf …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Alexander Oetker
Signora Commissaria und die kalte Rache
Ein Toskana-Krimi
Der erste Caffè,
der erste Plausch,
das erste Cornetto.
In der Bar.
Die Sonne am Firmament,
die Flaneure vor der Terrasse,
die rote Markise.
In der Bar.
Die Diskussionen,
Gott und die Welt,
Politik und Liebeskummer.
In der Bar.
Der Aperitivo,
gelöste Stimmung,
endlich Freiheit und Freigeist.
In der Bar.
Liebesschwüre,
Verwünschungen,
der letzte Caffè.
In der Bar.
(A.H.)
Prologo
»Ciao, Fabia, ciao Susanna«, sagte Lidia, und die Freundinnen schlossen sich in die Arme, alle drei gemeinsam. »Das war ein richtig schöner Abend.«
»Das stimmt«, erwiderte Fabia. »Mir hat besonders der Part mit dem miesen Date beim Rudern auf dem Fluss gefallen. Beim nächsten Mal lässt du das Boot kentern, einverstanden?«
»Dann krieg ich ja auch nasse Füße«, erwiderte Lidia, und alle mussten lachen.
»Sollen wir dich noch ein Stück begleiten?« Fabia und Susanna wohnten in einer WG in einer Seitenstraße des Palazzo Pitti. Doch Lidia winkte ab. »Nein, Quatsch, ich hab es doch gar nicht weit.« Außerdem war das hier Florenz, da waren zu jeder Tages- und Nachtzeit Menschen auf der Straße, Flaneure, Touristen, schlaflose Florentiner.
»Sehen wir uns morgen?«
»Ich hab frei«, erwiderte Lidia. »Übermorgen, okay?« Sie lächelte. »Ich hab euch echt lieb, wisst ihr das?«
Noch ein letztes Mal umarmten sie sich, dann zogen die beiden Freundinnen gemeinsam los, Lidia sah ihnen nach. Fabias Hand lag auf Susannas Hüfte, man hätte sie glatt für ein Paar halten können.
Dann wandte sie sich um und ging von der Piazza Santa Croce in die Altstadt hinein, sie musste nur die Piazza della Signoria überqueren und die Repubblica, dann wäre sie schon daheim. Sie freute sich auf zu Hause. Es war ein langer Tag in der Agentur gewesen, die Frischlinge mussten viel früher anfangen als die gestandenen Mitarbeiter, die Chefs kamen immer erst um zehn oder halb elf. Sie hingegen musste mit Susanna um acht im Büro sein, es gab so viele Excel-Tabellen auszufüllen, Kunden zu beschwichtigen, die dringend mit irgendwem sprechen wollten, und ab zehn musste sie allen Ernstes Caffè machen, damit die Chefs, die ja gerade erst aus der Bar unten im Haus kamen, gleich wieder etwas zu trinken auf ihrem Schreibtisch hatten.
Sie hatten sich herrlich über diese Sklavenschmiede aufgeregt, Susanna und Lidia, nur Fabia hatte nicht recht einstimmen wollen, schließlich war sie es, die den beiden den Job besorgt hatte, sie selbst kam mit den älteren Mitarbeitern frühestens um neun. Freundinnen waren sie trotzdem geworden.
Sie ging an der Bar Royal vorbei, vor der Tür standen zwei Jungs, rauchend und dickwandige Gläser mit Gin Tonic in der Hand. Lidia fand den linken hübsch, soweit sie das im schnellen Vorbeigehen beurteilen konnte. Doch sie blieb nicht stehen, wie hätte denn das ausgesehen? Stattdessen bog sie in die kleine Gasse ein, die sie einmal quer durch die Altstadt führte. Es war ihr Schleichweg, so gut wie alle Bewohner dieser Stadt hatten ihre Wege, winzige Straßen ohne Sehenswürdigkeiten oder allzu pittoreske Häuser, damit der Arbeitsweg nicht ständig von herumstehenden und staunenden Touristen oder Fotowünschen unterbrochen wurde.
Fabia musste lächeln, weil die Geschichte von ihrem Date so gut angekommen war. Das war aber auch ein echt komischer Kerl gewesen, dieser Steve. Ein Junge aus den USA, der zum Studium in Florenz war. Ein Kind aus feinem Hause, wie sonst hätten sich die Eltern auch ein Jahr Florenz leisten können, mit einer Wohnung im Stadtzentrum, Steve hatte sich sogar einen Roller gekauft, für dieses eine Jahr. Er war gutaussehend, breitschultrig, ein Schwimmerkreuz, Dreitagebart. Er hatte sie bei Tinder angeschrieben, nachdem sie ihn gematcht hatte. Drei Tage später hatten sie sich getroffen, sie schrieb nie gern lange mit den Typen, ein Treffen sagte so viel mehr als tausend Worte. Wenigstens sah er, als sie sich dann auf der Piazza della Signoria trafen, so aus wie auf seinen Fotos. Sie hatte schon Männer getroffen, deren Bilder mindestens zehn Jahre zuvor entstanden waren – oder mindestens fünfzig Kilo zuvor. Sie hatte Typen kennengelernt, die mit einunddreißig noch bei ihrer Mama wohnten. Und einen besonders hoffnungslosen Fall, der ihr, obwohl sie ihn mehrfach freundlich und später auch unfreundlich abgewiesen hatte, ewig vor ihrer Wohnung nächtliche Ständchen gebracht hatte, falsches Gitarrenspiel inklusive.
Steve war eine löbliche Ausnahme gewesen, zumindest optisch. Außerdem war er freundlich und schien nicht gänzlich durchgeknallt zu sein. Aber schon auf dem Weg zu seinem Ruderclub hatte er sie so dermaßen vollgequatscht, dass sie ganz kirre geworden war. Er sprach ausschließlich von einer Person, nämlich von sich, präsentierte sein Informatik-Studium, als würde er kurz vorm Nobelpreis stehen, lobte seine Leistungen im Fitnessstudio, als wäre er Hulk persönlich, und erzählte auf den letzten fünfhundert Metern noch von seiner Freundin in den Staaten, die er natürlich verlassen hatte, weil sie so doll an Gewicht zugelegt hätte. Er selbst ernährte sich als guter US-Bürger auch in good old Europe natürlich laktose-, gluten- und weitgehend fettfrei. Lidia wunderte sich kurz, dass er noch nicht verhungert war.
An dieser Stelle wäre sie am liebsten bereits umgekehrt. Andererseits hatte sie immer schon einmal auf dem Arno rudern wollen, und dieser reiche Bursche hatte eine Clubmitgliedschaft, was selbst für Bewohner von Florenz ein ziemliches Wunder war, weil die Wartezeit für den exklusiven Ruderclub am Ponte Vecchio ungefähr zehn Jahre betrug. Sie schluckte ihre Genervtheit also runter und folgte dem Ego- und Muskelkoloss zum Ufer des Flusses, wo er das Boot so versiert vorbereitete, als wolle er eine Bombe entschärfen. Als sie sich auszog, um die Schwimmweste überzustreifen, beeilte sie sich, weil sie nicht wollte, dass er ihre so gar nicht gluten- und laktosefreie Ernährung bemerkte. Andererseits hatte er sie offensichtlich für attraktiv befunden, da er ihr seit einer Stunde ununterbrochen sagte, wie beautiful und amazing sie aussehe.
Die ersten Minuten auf dem Fluss waren dann auch tatsächlich wunderschön. Es war ein warmer Tag, der blaue Himmel war mit ein paar weißen Schäfchenwolken gespickt, und die Sonne ließ die kleinen Wellen des Arno glitzern. Bald hatte sie sich an Steves Rhythmus angepasst, das langsame Ziehen an den Rudern machte Spaß, sie hatte immer gern Sport gemacht, aber eben zur Entspannung, als Ausgleich, und nicht als manischen Körperkult. Doch fit war sie. Das Boot glitt geradezu rasant über die Schnellen des Flusses, im Nu waren sie aus der Altstadt hinausgerudert, es ging schnurstracks gen Osten. Unangenehm wurde es erst, als Steve wieder und wieder sagte, wie schön es sei, dass sie endlich allein waren. Und dann das Boot in Richtung Ufer steuerte, an einer reichlich abgelegenen Flussaue, an der weder Touristen noch Einheimische zu sehen waren. Kurzum: Sie waren tatsächlich allein.
Kaum angelegt, half ihr der amerikanische Muskelprotz aus dem Boot, zog seine Schwimmweste aus und kam ihr, nun halbnackt, immer näher.
»Ich liebe es, dass ihr european girls so tabulos seid«, sagte er, und Lidia dachte, dass diese Annahme wohl der wahre Grund sein musste, aus dem er seine amerikanische Freundin verlassen hatte. Seine Lippen waren jedenfalls schon recht bald sehr nah, und sie entschied, dass es nun genug sei. Nachdem sie zweimal no, grazie gesagt hatte und er immer noch guten Mutes war, knallte sie ihm eine und zeigte ihm damit, dass european girls nicht nur tabulos, sondern auch mutig waren. Dann stieg sie, immer noch in Schwimmweste und Bikini, die Uferböschung hinauf, schnappte sich ein Taxi und fuhr bestens gelaunt wieder in die Stadt zurück. Steve meldete sich nie wieder, nun gut, sie bekam noch zwei Verwünschungen über die Tinder-App, bevor sie ihn blockierte. Und damit hatte sie erst mal genug von Amerikanern. Ihr nächstes Date wäre mit Sicherheit wieder ein Italiener – garantiert. Vielleicht lernte sie ja auch mal jemanden einfach so kennen, der Typ vorhin vor der Bar war doch echt schnuckelig gewesen.
Sie riss sich selbst aus ihren Gedanken, weil ihr die eigenen Schritte auf dem buckeligen Pflaster mit einem Mal so laut vorkamen. Dann fiel ihr auf, dass es gar nicht nur ihre Schritte waren. Da waren noch welche, nicht weit hinter ihr.
Sie hasste es, so wie wohl jede junge Frau, nein, nicht jede junge, sondern jede Frau. Warum konnten die Männer nicht einfach ein Stück Abstand halten – oder gleich eine andere Gasse nehmen? Sie wusste, dass es ein Mann war, der hinter ihr ging. Die Straßenlaterne an der Ecke hatte seinen Schatten so verlängert, dass sie seine Gestalt sehen konnte, und die gehörte hundertprozentig zu einem Mann.
Er musste jetzt direkt hinter ihr sein.
Sie beschleunigte nicht ihren Schritt, sondern ging ganz normal weiter. Hoffentlich konnte er nicht hören, dass ihr Atem stoßweise ging. Und nicht sehen, wie sie schwitzte.
Noch zwei Gassen, vielleicht drei Minuten, dann wäre sie in Sicherheit. In der näheren Umgebung ihrer Wohnung gab es keine Bar und kein Caffè, das so spät noch geöffnet war. Ihr Schleichweg war wie ausgestorben. Bis auf sie – und diesen Mann.
Sie nahm ihr Handy aus der Tasche, das Licht beruhigte sie ein wenig, aber sie wagte es nicht, Fabia anzurufen. Sie wollte den Typen nicht provozieren. Er wäre mit drei Schritten bei ihr – und was täte sie dann?
Sie überlegte, ein Foto zu machen, einfach stehen zu bleiben für ein Selfie, aber auch dann hätte er überreagieren können, wenn er die Kamera sah. Also steckte sie das Handy wieder weg, und dabei drehte sie sich einmal kurz um. Er lief doch ein gutes Stück hinter ihr, aber es wirkte tatsächlich, als würde er ihr folgen. Er trug einen langen Mantel und ein Basecap, das sein Gesicht verbarg. Sie konnte nicht sagen, ob er klein oder groß war, dick oder dünn. Er war ein Mann, und sie waren alleine in dieser Gasse, die nur von den roten Straßenlaternen erleuchtet war. Das reichte ihr, um Angst zu haben. Sie lief nun doch etwas schneller und lauschte, seine Schritte waren ganz normal, tapp, tapp, tapp. Vielleicht war er tatsächlich nur irgendjemand, der nach der Arbeit nach Hause ging und zufällig denselben Weg hatte wie sie.
Es gab keinen Laden hier, kein Schaufenster, vor dem sie hätte stehen bleiben können. Sie verfluchte sich, dass sie es liebte, sehr ruhig zu wohnen.
Sie beschleunigte ihre Schritte noch ein wenig. An der letzten Ecke angekommen ging sie nach rechts und kramte schon in der Handtasche nach ihrem Schlüssel. Sie hatte es immer abgelehnt, Pfefferspray einzustecken, weil sie es pathetisch fand, pathetisch und sinnlos. Am Ende sprühte man sich nur selbst an, hatte sie immer gesagt. Jetzt hätte sie für Pfefferspray gemordet. Auch der Schlüssel, kalt und spitz, fühlte sich gut an in ihrer Hand. Sie hörte, dass der Mann auch nach der Kurve noch hinter ihr war. In der kleinen Gasse, in der sie wohnte.
Sie rannte nun fast zu dem großen Portal, sie musste Abstand zwischen sich und den Mann bringen: Würde er sie ins Haus drücken, wenn sie aufschloss, wäre sie chancenlos. Aber als die Tür aufsprang und sie sich noch einmal umwandte, war er stehen geblieben, einfach so, zehn Meter von ihr entfernt. Sie sah ungläubig zu ihm hin, dann sprang sie in die offene Tür und drückte sie hinter sich ins Schloss. Zitternd blieb sie stehen, lauschte durch das Holz, aber da war nichts. Sie begann zu weinen, dann rannte sie die Treppe hinauf, bis zu ihrer Wohnung im zweiten Stock. Als sie drinnen war, schloss sie die Tür zweimal ab, ihr flossen immer noch die Tränen, nun wegen dieser Mischung aus Schock und Erleichterung. Ihre Beine zitterten. Lidia rannte zum Fenster und sah hinaus. Doch die kleine Gasse war leer.
Sie brauchte bestimmt zehn Minuten, bis sich ihr Atem beruhigt hatte. Sollte sie jetzt Fabia anrufen? Aber sie wollte auch keine Pferde scheu machen, derlei passierte schließlich jeder Frau ab und zu. Sie trank noch ein Glas Wasser, dann ging sie ins Bett und schlief während einer Folge Emily in Paris ein. In der Nacht träumte sie von ihrem Verfolger, der aussah wie eine Mischung aus Steve und ihrem nächtlichen Gitarrenspieler.
Sie wachte auf, weil die Klingel schellte. Als sie die Augen aufschlug, war es taghell.
»Was zur Hölle …«, murmelte sie. Der Wecker zeigte neun Uhr dreißig. Sie stand auf und zog ein T-Shirt über, dann ging sie zur Tür.
»Ja?«
»Signorina Lello?«
Sie erkannte die Stimme von Silvi, der alten Frau aus der Wohnung unter ihr.
»Sì?« Sie schloss schnell auf und öffnete. Ihre Nachbarin stand vor ihr, das Haar zerzaust, Tränen liefen ihr über die Wangen.
»Herrjeh, Silvi«, rief Lidia, »was ist denn passiert?«
»Sie sind da«, erwiderte die Alte und schloss sie in die Arme, schluchzend und so in Tränen aufgelöst, dass Lidias T-Shirt in Sekunden nass war.
»Wo soll ich denn sein?«, fragte sie und schob die Nachbarin sanft von sich weg.
Silvi brauchte einen Moment, um sich zu fassen, sie hielt etwas in den Händen. »Ich war eben auf dem Weg zum Mercato, ich hatte meinen kleinen Einkaufswagen dabei, und als ich aus dem Haus ging, na, da dachte ich: Was ist denn das? Hier, sehen Sie … das … Ich musste gleich wieder zurück, weil ich solche Angst um Sie hatte, Signorina, ich …«
»Was ist denn los?«, fragte Lidia wieder, langsam wurde sie ärgerlich. Da nahm Nonna Silvi das Blatt, das sie in der Hand hielt, und sagte: »Hier, das hing an der Haustür und auch an der Laterne gegenüber und bestimmt noch woanders. Sehen Sie doch, ich bin so froh, dass es Ihnen gut geht …«
Lidia spürte, wie ihr Atem wieder stoßweise ging, kalter Schweiß trat ihr auf die Stirn, und sie kniff die Augen zusammen.
Ihre Nachbarin reichte ihr das Blatt, es war ein Plakat, das aussah wie ein Fahndungsfoto. Es war ihr Bild, ganz klar und deutlich. Sie sah sich selbst, sie lachte und sah jemanden an, der nicht zu erkennen war. Lidias Herz pochte laut. Dann erst las sie den Text:
Vermisst stand da in dicken roten Lettern. Und dann, kleiner und in schwarz:
Lidia Lello, geboren am 25. Mai 1997 in Florenz.
Sie ist 1,64 Meter groß und hat braunes Haar und braune Augen.
Sie wurde zuletzt am Abend des 3. Juli gesehen.
Es besteht der Verdacht auf eine Entführung oder ein Verbrechen.
Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.
Sie sah das Plakat an, dann Silvi.
»Verstehen Sie jetzt, welche Sorgen ich mir gemacht habe, dass Sie …«
Lidia gab ihr das Plakat mit zitternden Händen wieder.
»Ich bin hier, mir geht es gut, aber …« Sie schüttelte den Kopf und betrachtete das Foto noch einmal eingehend.
»Verdammte Scheiße«, flüsterte sie. Sie trug die Klamotten, die sie am Abend zuvor in der Bar angehabt hatte. Das Foto war in dieser Bar gemacht worden. Er hatte es gemacht. Der Mann, der ihr in der Nacht bis nach Hause gefolgt war.
Uno – 1
Die Landschaft war so herrlich, wie sie dalag im Sonnenschein, dass sie ihre Hand ausstrecken wollte, um nach der Macchia zu greifen, dem wilden Dünengras mit den lilafarbenen Blüten, nach den schroffen Felsen, die sich über die Jahrhunderte aufgetürmt hatten. Ganz unten schlug das Meer gegen die Felsen, Wellen gegen Stein, mit einer Kraft, wie sie nur Naturgewalten zeitigen konnten. Die Straße wand sich in weitgeschwungenen Kurven den Berg empor, sie saß hinten im Wagen, und weil die Sonne so schräg stand, konnte sie Fahrer und Beifahrerin nicht erkennen, aber das musste sie auch nicht, dachte sie lächelnd, sie wusste ja, wer die beiden waren.
Der alte Mercedes fuhr schnell, sie liebte das sonore Geräusch des schweren Dieselmotors und den Antrieb, der ihr vorkam, als würde sie in einem großen Schiff sitzen, das Schaukeln der Wellen inklusive.
Bald würden sie ankommen, an einem Ziel irgendwo im Tal, dort sah es ganz anders aus als hier oben, wo die Luft so frisch und salzig war. Sie wollte ihr Fenster öffnen, aber es ließ sich nicht nach unten kurbeln, irgendetwas klemmte. Sie dachte noch: egal. Und dann hörte sie dieses leise Piepen, es schien von unterhalb des Wagens zu kommen, ein anschwellender Ton in zunehmender Geschwindigkeit.
Piep … piep … piep, und dann lauter und schneller: piep piep piep piep, bis der Ton schließlich in der Luft hing wie ein Tinnitus, sie wollte etwas sagen, aber ihr Mund konnte keine Worte formen, nicht Mama und nicht Papa, sie wollte sie warnen, sie musste sie warnen, raus hier, nur raus, aber es ging nicht, und sie verzog das Gesicht und wollte schreien, aber kein einziger Ton entstand, da war nur das Piepen, und dann, als es wirklich ein gleichbleibender Klang geworden war, stetig wie die Totenlinie im Krankenhaus, da explodierte die Welt.
Vor ihr und hinter ihr ein Feuerball, sie wurde nicht ohnmächtig, leider nicht, denn sie konnte alles sehen, wie die Schatten vor ihr aus dem Wagen geschleudert wurden, wie sich der Wagen selbst in Teile auflöste, Metall, Glas, Splitter, alles flog um sie herum, Teile, die in Flammen standen, Fetzen von Kleidung und Aktenkoffern und Papieren, verteilt in diesem Feuerball, die Landschaft nun ein Landeplatz für all diese Zeugnisse des Lebens, die sie bald aufheben würden, sammeln, sichten, kopfschüttelnd über diese Sinnlosigkeit und ohne jede Illusionen, denjenigen, der für das Piepen verantwortlich war, jemals bestrafen zu können.
Sie selbst saß immer noch auf ihrem Sitz, sie suchte nach dem Schmerz, sie konnte das ja unmöglich überstanden haben, den Knall, das Feuer, die Explosion, doch sie spürte nichts, kein Blut, keine Wunden, aber auch kein Gefühl mehr, gar nichts. Mit wachen Augen sah sie nach vorne, suchte nach den Schatten, die ihr eben entwichen waren, bis ihr auffiel, wer noch fehlte. Sie hatte es die ganze Zeit nicht bemerkt. Das Wort, das ihr als Erstes gelang, war nun doch ein Schrei: Sofia.
Sie rief den Namen ihrer Schwester, Sofia, Sofia, wo war sie nur, sie sollte doch hier neben ihr sitzen, auf dem Weg zu ihr, Sofiaaaaaaaa.
Die Hand an ihrem Arm, das Ruckeln, die tiefe Stimme mit dem Timbre, Giulia, Giulia, sie tauchte tief ab und dann wieder auf, schreckte hoch und fand sich im Halbdunkel des Zimmers wieder, sitzend in ihrem Bett, neben ihr saß Enzo, den Arm um sie gelegt, er flüsterte ganz sanft: »Es ist alles in Ordnung«, dann glitt sie in seine Arme, und er hielt sie ganz fest, ohne sie zu erdrücken, er beschützte sie in dieser festen Umarmung, und sie konnte es zulassen, sie spürte noch die Nachwehen des Traumes, das leichte Zittern in ihren Muskeln, die Bilder, so nah, so scharf, als wäre sie wirklich dabei gewesen. Sofia.
Sie sanken wieder ins Bett, Giulia legte ihren Kopf auf Enzos Brust. Seine warme Hand ruhte auf ihrem Rücken.
»Besser?«, fragte er leise.
Sie liebte seine Stimme.
»Ja …«, murmelte sie. Sie wünschte sich, dass er weitersprach, andererseits konnte sie jetzt auf keinen Fall weitere Fragen beantworten. Sie betrachtete die Lichtflecken, die durch die Fensterläden hereinfielen, draußen musste schon strahlender Sonnenschein sein.
Enzo war am Abend zuvor mit ihr heimgekommen, seit ein paar Wochen schlief er regelmäßig bei ihr.
Sie hatte bei dem ersten Dinner in seiner Wohnung nicht geahnt, wie nah sie einander kommen würden. Das war inzwischen zwei Monaten her. Er hatte ihr die Augen verbunden, weil er wollte, dass sie auf dem gleichen Stand war wie er. Dann hatten sie zusammen gekocht, Spinatknödel aus seiner Heimat in Südtirol, und es war so sinnlich und lustig und romantisch gewesen, dass der erste Kuss reine Formsache war. Sie hatten in dieser Nacht nicht miteinander geschlafen, aber Giulia hatte gespürt, wie viel Lust sie auf diesen Mann hatte.
Drei Nächte später hatte sie gewusst, dass ihr Gefühl sie nicht getrogen hatte. Enzo sah nichts, von Kindesbeinen an. Aber er wusste genau, was er tat, und er konnte auf eine beinahe beängstigende Art spüren, was sie wollte, was sie sich wünschte. Er war so sensibel und einfühlsam, im nächsten Moment aber war er rau und fordernd, ohne jemals lieblos zu sein. Mittlerweile glaubte Giulia, dass genau dies das Geheimnis ihrer Nähe war: Weil er sie nicht sah, konnte sie sich fallen lassen. Er sah nicht, dass auch sie nicht immer stark war, dass sie Angst hatte, Angst und furchtbare Träume – aber er spürte es.
»Gerade kommt es oft«, murmelte er, es klang ein wenig verschlafen, aber Giulia wusste, dass er hellwach war. Enzo hatte recht. Sie war schon letzte Nacht hochgeschreckt, genau wie drei Nächte zuvor.
»Die Träume gleichen sich«, sagte sie.
»Magst du mir davon erzählen?«, fragte er. Sie hatten nur einmal darüber gesprochen, was passiert war, ganz am Anfang. Seitdem hatte sie nicht das Bedürfnis verspürt, darüber zu reden – und er hatte nicht nachgefragt. Allerdings verstand sie natürlich, dass er mehr darüber wissen wollte. Er war Teil ihres Lebens geworden, auch wenn sie nie offiziell darüber gesprochen hatten. Waren sie ein Paar? Giulia wusste es nicht. Sie wusste nur, dass es sehr schön war, wie es war.
»Nicht im Dunkeln«, sagte sie leise.
Eine halbe Stunde später trat sie frisch geduscht auf die Terrasse, ihre nassen Haare waren noch in ein Handtuch gewickelt, sie war ungeschminkt und spürte, wie die Sonne mit jedem Strahl ihr Gesicht wärmte. Enzo hatte den Tisch draußen im Garten gedeckt, es war beinahe ein Wunder, wie gut er sich bereits in ihrem Haus auskannte, wie er alles fand, Teller, Tassen, die Marmeladen, wie gut er ihren Herd und die kleine Bialetti-Maschine bedienen konnte. Es war beinahe, als wäre er hier schon zu Hause. Und zum ersten Mal, seitdem sie eine junge Frau war, störte sie dieser Gedanke nicht: dass ein Mann ihr nahe kam.
Der Tisch stand im Schatten der schönen Pergola, die mit wildem Wein und den Rosen bewachsen war. Sie hatte alles so gelassen, wie ihre Mutter es vor fünfzehn Jahren angepflanzt hatte. Der Garten schien endlos, es war wirklich ein riesiges Gelände, und dadurch, dass es mitten im Naturschutzgebiet lag, blieb es ein Paradies, mit dem unverbaubaren Panorama der sanften Hügel der Toskana.
Sie drehte ihren Stuhl der Sonne zu und goss ihnen beiden Caffè ein. Enzo hatte sogar Orangen ausgepresst, Giulia probierte und sagte: »Wow, ist der gut.«
»Orangen aus der Markthalle«, erwiderte Enzo, »ich habe sie extra für unser Frühstück gekauft. Genau wie diesen Schinken hier.« Er wies auf vier große hellrote Scheiben eines luftgetrockneten Schinkens, der ganz dünn aufgeschnitten war. Giulia lief das Wasser im Mund zusammen. Sie nahm ein Stück von dem aufgebackenen Ciabatta, gab Butter darauf und dann eine der Scheiben von dem Schinken. Sie biss ab und schmeckte sofort das Salz und die lange Reifezeit des Schinkens, die Würze und den Schmelz. Es schmeckte phantastisch.
»Grazie, caro.« Sie beugte sich über den Tisch und küsste ihn unvermittelt. »Das war eine sehr schöne Nacht.«
»Das war es«, erwiderte Enzo. Dann senkte er die Stimme. »Du kannst immer mit mir darüber sprechen, was dich beschäftigt, okay?«
Sie nickte, bis ihr auffiel, dass er das nicht sehen konnte. Dennoch sagte sie nichts. Sie trank einen Schluck von dem süßsauren Orangensaft und dann vom Caffè, der heiß und stark war, beinahe, als habe ihn ein Sizilianer gekocht. Schließlich sagte sie leise: »Ich weiß nicht, warum mir das gerade jede Nacht in den Sinn kommt. Es scheint …«, sie stockte, »es scheint, ich würde gerade erst so richtig verarbeiten, was damals passiert ist.«
»Du durchlebst den Unfall?«
Giulia nickte wieder. »Ja. Und es ist jedes Mal, als wäre ich dabei gewesen. Dabei saß ich im Flugzeug aus Rom, als meine Eltern auf der Küstenstraße unterwegs waren. Ich kann sie im Wagen nicht sehen, sie sind nur Schatten. Aber meine Schwester – sie fehlt. Sie war im Auto, sie wollten mich alle zusammen vom Flughafen abholen. In meinem Traum aber sitzt sie nicht neben mir. Sie ist nirgendwo. Dabei würde ich mir so wünschen, sie zu sehen. Ich … Weißt du, ich kann im Traum die Gesichter meiner Eltern nicht sehen, weil ich nicht mehr richtig weiß, wie sie ausgesehen haben. Natürlich, es gibt Fotos, aber ich sehe es trotzdem nicht mehr richtig vor mir. An Sofias Gesicht aber kann ich mich immer noch erinnern, so, als hätte ich sie gestern zum letzten Mal gesehen. Sie war so hübsch, weißt du?«
Enzo ergriff über den Tisch ihre Hand.
»Sie haben deine Schwester nie gefunden, oder?«
»Die Leichen meiner Eltern lagen in dem Autowrack, sie wurden beigesetzt, hier auf dem Friedhof von Santa Croce, in einem Grab, das mit anderen Namen beschrieben wurde, damit die Mafia nicht … na ja, damit sie nicht das Grab schändet. Aber meine Schwester haben sie nie gefunden. Man glaubt …«, sie stockte wieder, sie hatte noch nie so richtig darüber gesprochen, und jetzt, hier, an diesem sonnigen Tag, war es so schmerzhaft, dass sich ihr Herz zusammenzog, »… man glaubt, dass sie durch die Kraft der Explosion ins Meer geschleudert wurde. Die Felsen dort, an der Ostküste Sardiniens, sind so schroff, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Es ist so schrecklich. Wenn sie ins Meer gefallen ist, dann ist sie durch die Strömung weggetrieben worden.«
»Du sagst wenn sie ins Meer gefallen ist«, wiederholte Enzo ihre Worte. »Glaubst du nicht daran?« Wieder schien er sie direkt anzusehen, sein Blick, wenn man denn so sagen konnte, ging ihr durch Mark und Bein. Keine Ahnung, wie dieser Mann das machte, aber er erkannte sie besser als jeder andere Mensch zuvor.
»Ich … ich hoffe.« Sie schluckte und trank einen weiteren Schluck von dem Caffè. »Ja, ich weiß, wie bescheuert das ist und wie kindisch. Aber ich hoffe noch immer, dass sie irgendwann um die Ecke biegt und an der Haustür klingelt.«
»Das ist nicht bescheuert. Und auch nicht kindisch. Ich verstehe dich«, erwiderte Enzo.
»Sie ist tot. Ganz bestimmt ist sie das. Wie sollte sie diese Explosion überlebt haben?« Ihre Stimme klang nun rau. Rau und realistisch. »Ich habe das Autowrack gesehen, von dem Mercedes war nichts mehr übrig. Was denke ich mir denn? Dass sie da rausgeklettert ist und seither als einsame Bäuerin in den sardischen Bergen lebt?«
Enzo erwiderte nichts darauf, stattdessen fragte er: »Und sie haben die Täter nie gefunden?«
»Sie haben nie jemanden dafür verhaftet«, sagte Giulia. »Natürlich haben sie die großen Mafiapaten überführt, die meisten von ihnen sitzen seit Jahren und Jahrzehnten in Haft. Aber die Männer, die tatsächlich den Sprengsatz am Auto meines Vaters angebracht haben, die wurden nie überführt. Es gab auch kein Bekennerschreiben.«
»Hast du dich nie gefragt, warum ihre Rache erst nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst kam? Er war doch schon längst nicht mehr Richter, oder?«
»Nein«, sagte sie tonlos. »Er war schon in Pension.«
»Er stellte also gar keine Gefahr mehr für sie dar. Und trotzdem haben sie ihn umgebracht, so aufsehenerregend, wie es nur möglich war.«
Giulia zuckte zusammen. Enzo hatte recherchiert. Natürlich hatte er das. Er wollte wissen, wer sie war. Auch wenn sie das lieber für sich behalten hätte.
»Sie wollten ein Exempel statuieren, denke ich.« Ihre Stimme klang selbst für ihre Ohren heiser. »Er war nach dem Tod von Falcone und Borsellino einer der erbittertsten Kämpfer gegen die Mafia, er hat viele von ihnen ins Gefängnis gebracht, und er hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, nicht nur in den Dörfern im Süden die großen Clanfamilien auszuhebeln, dort, wo sie alle Macht haben. Sondern auch ihre Zweige hier im Norden.«
»Was meinst du?«
»Du weißt, dass die Mafia ein Krake ist. Der Kopf sitzt im Süden, in Kampanien, Kalabrien und auf Sizilien. Aber die Krakenarme sind überall – und die große Kohle machen sie hier oben im Norden, wo es der Wirtschaft gut geht und wo Geld zu verdienen ist. Und hier hat mein Vater ordentlich aufgeräumt.«
Enzo nickte. »Ich habe davon gelesen.« Er schwieg einen Augenblick. »Und wenn es anders war?«
»Was meinst du?«
»Wenn es kein Exempel war, das sie an ihm statuieren wollten? Die Mafia ist rachsüchtig, ich weiß, aber sie würden nicht so viel Aufsehen erregen, wenn es eigentlich nichts mehr zu holen gibt. Was wäre denn, wenn er in seinem Kampf immer noch nicht fertig war?«
Giulia lief ein kalter Schauer über den Rücken, obwohl die Sonne sie so schön wärmte. »Du meinst, sie haben ihn aus dem Weg geräumt, weil er weitergemacht hat?« Sie legte ihren Kopf schief. Enzo fand wieder ihre Augen, dann sagte er leise: »Das ist doch möglich. Nach allem, was ich herausgefunden habe, war dein Vater ein so leidenschaftlicher Kämpfer gegen die Mafia, dass er vielleicht nicht einfach damit aufgehört hat, nur weil er in Rente war. Hast du denn eine Erinnerung an damals? Hat er noch … gearbeitet?«
Giulia schloss die Augen und versuchte, sich die Monate vor der Explosion in Erinnerung zu rufen. Ihre Eltern waren viel gereist, endlich hatten sie Zeit dafür gehabt. Aber wenn sie die beiden hier im Haus in der Toskana besucht hatte, hatte Papa sich oft in seinem Arbeitszimmer vergraben. Andererseits …
Sie wurde vom fernen Klingeln des Telefons aus den Gedanken gerissen. Es war ihr freies Wochenende, deshalb lag das Handy auf der überdachten Terrasse.
»Entschuldige«, sagte sie, stand auf und ging durch den Garten. Als sie ihr Telefon erreichte, war das Klingeln verstummt. Sie sah die Nummer der Bereitschaft in der Questura und rief sofort zurück. Der Diensthabende meldete sich.
»Questura di Firenze …«
»Hier ist Commissaria Ferrari.«
»Ich habe schon Ihre Nummer erkannt, Commissaria, danke, dass Sie sich so schnell melden. Tut mir leid, dass ich Sie am Wochenende stören muss. Aber Sie hatten Anweisung gegeben, dass wir Sie sofort informieren sollen …«
Giulia kratzte sich am Kopf, in ihr raste es. Sie hatte nicht viele Fälle, wegen denen sie am Wochenende gestört werden wollte. Wenn der Mann trotzdem anrief, dann konnte das nur heißen …
»Gab es wieder einen Vorfall?«
»Ja, Commissaria.«
»Ist das Opfer unbeschadet?«
»Zum Glück ja«, erwiderte der Diensthabende. »Es hat wieder eine junge Frau getroffen. Sie hat vor einer Stunde die Polizei informiert, eine Streife hat die Plakate vor ihrer Wohnung gesichert. Jetzt ist die Frau hier in der Questura, die Kollegen haben sie hergebracht.«
»In Ordnung. Wir kommen sofort.« Mist, dachte Giulia, jetzt hatte sie sich verquatscht. Sie hasste Klatsch und Tratsch – und die Sache mit Enzo wollte sie wirklich geheim halten. Aber es war ihr einfach so herausgerutscht.
Sie legte auf und ging zurück in den Garten, der nun komplett in der Sonne lag, die Tautropfen des Morgens waren getrocknet, die Rosen und der Oleander reckten sich dem Himmel entgegen. Sie hätte gern die Schönheit dieses Anblicks genossen, aber der kurze Anruf hatte sie aus dem Konzept gebracht. Verdammt, sie hatte es geahnt. Ihr Mann machte weiter.
»Ein neuer Fall?« Enzo fragte es schon von weitem. Giulia räusperte sich.
»Der Plakatmann.«
»Wieder in der Altstadt?«
»Hmm …«, murmelte Giulia.
»Die Abstände werden kürzer«, sagte der Sergente. Das Gleiche hatte sie eben auch gedacht.
»Die Frau ist in der Questura. Ich weiß, es ist dein freies Wochenende, aber …«
»Natürlich komme ich mit«, erwiderte Enzo, ohne sie aussprechen zu lassen. »Ist mir doch egal, ob ich im Garten oder im Vernehmungsraum sitze, Hauptsache, du sitzt neben mir.«
Sie grinste, weil sie unsicher war, ob er das ernst oder ironisch gemeint hatte. Aber sie sah seinen sanften Blick, deshalb ging sie zu ihm und küsste ihn sanft.
»Na, dann los«, sagte sie, als sie sich von ihm löste. Er stand auf und ging, wie stets, ganz nah neben ihr. Früher hatte er das gemacht, um den Weg besser zu finden, jetzt kannte er sich in ihrem Haus und ihrem Garten schon so gut aus, dass es nicht mehr nötig war, aber er tat es dennoch – und sie genoss seine Nähe.
Langsam wurde ihr klar, dass sie zuvor am Telefon nicht zufällig wir gesagt hatte. Es fühlte sich tatsächlich so sehr nach einem Wir an. Es war so selbstverständlich mit ihnen, wie sie hier durch den Garten gingen, so, als hätte sie sehr lange darauf gewartet. Giulia lächelte. Das hatte sie auch. Wenn das hier ernst wurde, dann wäre Enzo der erste feste Freund in ihrem Leben.
Due – 2
Sie parkte den alten VW Käfer auf dem Platz für die Streifenwagen, direkt vor der Questura. Am Wochenende war hier nicht viel los. Sie stiegen aus und gingen vorbei an der Wache, die salutierend die Hand an die Stirn hob, nur eine schnelle Geste, auch der Mann wäre bei diesem Wetter wohl lieber mit seiner Familie am Strand als hier im Dienst.
Der Spätsommer war herrlich dieses Jahr, nach einem endlosen August hielten sich die Temperaturen auch jetzt, Ende September, noch weit jenseits der 25-Grad-C-Marke.
Sie stiegen die Treppen hinauf, das Büro der Kriminalpolizei befand sich im zweiten Stock des alten Palazzo, der das Hauptquartier der Polizia di Stato von Florenz war. Der lange Flur war ein dunkler Schlauch, an der hinteren Tür ihrer Einheit hing seit kurzem das neue Schild:
Polizia Criminale di Firenze
Commissaria Capo Giulia Ferrari
Seit Giulia ihr Amt als Leiterin der Einheit angetreten hatte, war das Büro nicht mehr ganz so dunkel und verstaubt. Sie hatte dafür gesorgt, dass es Pflanzen in den Ecken des alten Großraumbüros gab, dass die Fenster einmal pro Woche geputzt wurden, damit es hier nicht mehr aussah, als sei es ein Gefängnis – und sie hatte zur Freude der Kollegen eine neue Kaffeemaschine angeschafft. Der Vice Questore hatte die Nase gerümpft, als sie ihre Bitte vorgetragen hatte, doch sie hatte nur auf seine Bar und den Kühlschrank darunter gezeigt, in dem der eitle Pfau einen Vorrat an Weißwein, Prosecco und Spirituosen für Gäste bereithielt – danach hatte er ihre Bestellung großzügig durchgewunken.
Enzo ging zu seinem Schreibtisch, um seinen Computer hochzufahren, die Polizia hatte ihm ein eigenes System angeschafft, das es ihm ermöglichte, auch ohne funktionierende Augen in den Polizeidatenbanken zu recherchieren. Denn das konnte er besser als jeder andere Polizist in ihren Reihen.