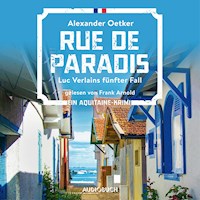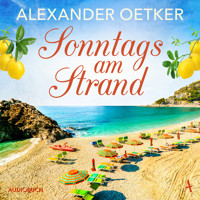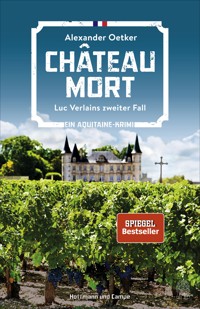Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Luc Verlain ermittelt
- Sprache: Deutsch
Der Schäfer, der Wolf und der Tod Umgeben von sanften Pyrenäenausläufern und berühmt für seine Gewürzpaprika, lädt das malerische Espelette alle zu einer Rast ein, die hier auf dem Jakobsweg vorüberwandern. Doch ein Schatten fällt auf das Idyll, als ein Schäfer aus dem Dorf brutal getötet wird. Dem von der baskischen Polizei zu Hilfe gerufenen Luc Verlain kommen die schweigsamen Dorfbewohner seltsam mitleidlos vor, und bald schon stößt er auf so einige schlüssige Mordmotive. Waren die vom Schäfer abgegebenen Luftschüsse, wenn Pilger seinen Weiden nahekamen, den Hoteliers ein zu großer Dorn im Auge? Hat sein Einsatz für den Wolf, der in der Gegend umgeht, seine Schäferkollegen zu sehr aufgebracht? Und weshalb war er ein so menschenscheuer Einzelgänger? Mord in der Aquitaine - Luc Verlain ermittelt: - Band 1: Retour - Band 2: Château Mort - Band 3: Winteraustern - Band 4: Baskische Tragödie - Band 5: Rue de Paradis - Band 6: Sternenmeer - Band 7: Revanche - Band 8: Wilder Wein - Band 9: Wolfstal Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Oetker
Wolfstal
Luc Verlains Fall am Jakobsweg
Krimi
PrologMiniatures
Col des Trois Croix, in den Bergen über Espelette, Frankreich
Er brauchte nur einen Pfiff durch die Zähne, nicht einmal laut musste er sein. Gigi, die schon so alt war, dass sie daheim in der Hütte kaum noch einen Ton vernahm, hob sofort die Ohren in die Luft, erfasste seinen Blick und wetzte los. In Sekunden hatte sie die Ziege erreicht, die sich zu weit von der Herde entfernt hatte, und holte sie zurück, indem sie direkt vor ihr stehen blieb und die Zähne fletschte. Das Tier schien nicht verängstigt, es hatte nur keine Lust auf Stress, so sah es jedenfalls aus. So trottete es einfach zurück zu den anderen, und der kleine Ausflug auf die vermeintlich noch grünere Wiese gegenüber war gleich wieder beendet.
Gigi kam sofort zu ihm, und Jacques beugte sich zu der Hündin hinunter, um sie zu streicheln. »Reste …«, murmelte er und kramte in seiner Bauchtasche. Er hielt ihr ein kleines Stück Käse entgegen, und sie nahm es dankbar an. Chèvre-Käse von den Ziegen, die sie gemeinsam hüteten – wie er selbst liebte auch seine Hündin die eigenen Produkte am meisten. Als sie das Stück verschlungen hatte, sah Gigi kurz nach, ob noch etwas zu tun war, dann ließ sie sich nieder und bettete den Kopf auf das weiche Gras.
Jacques liebte seine Hündin, seit dreizehn Jahren nun schon. Sie war so treu und so klug mit ihren dunkelbraunen Augen. Ihr Fell war rotblond und buschig. Jetzt im Frühling verlor sie langsam das dicke Winterfell, denn der Sommer kam in großen Schritten. Gigi war ein baskischer Schäferhund, die Rasse hieß hier Perro Pastor Vasco, und es gab keine andere Rasse auf der Welt, die so perfekt dafür gemacht war, auf den steilen Hängen des Baskenlandes Schaf- und Ziegenherden zu bewachen.
Jacques spürte den Wind, der aus den Pyrenäen kam. Hier waren die Hügel noch tiefgrün und nur sanft gewellt, doch nur vier, fünf Kilometer weiter südlich begannen die Berge schnell anzusteigen, die Frankreich von Spanien trennten. Dort ging die freundliche Sanftheit der Natur in eine schroffe Feindlichkeit über. Es gab nur noch karge Landschaften mit herben Kräutern, keine Dörfer mehr, sondern einfache Holzhütten ohne Strom und Wasser, so weit verstreut, dass ein Tagesmarsch manchmal nicht ausreichte, um seine Nachbarn zu treffen.
Wenn man keine Menschen mochte, war es genau richtig. Genau dort oben wollte er sein, in drei Wochen schon, wenn der Frühsommer begann und die Touristen hier ankamen. Die Touristen, die er nicht leiden konnte, weil sie die Wiesen platt trampelten und seine Tiere verrückt machten. Weil sie alles veränderten. Möglicherweise auch für ihn.
Deshalb würde er in zwei Wochen alles zusammenpacken. Alles war in seinem Fall nicht viel. Hemden und Arbeitshosen. Einen Wollpullover gegen die Kälte, die es dort oben auch im Sommer gab, nachts, wenn im Tal alle schwitzten. Töpfe und Pfannen waren noch oben und ein Vorrat an Wein und Selbstgebranntem. Die Ziegen würden sie hinauffahren mit zwei Transportern bis zur letzten Stelle, zu der Fahrzeuge durchkamen. Die restlichen Kilometer würden sie zu Fuß bewältigen, es waren eher die Höhenmeter, die anstrengend waren. Nicht für die Ziegen und die Schafe, die waren schnell. Aber Gigi und er waren nun mal nicht mehr die Jüngsten, fand Jacques, obwohl seine Hündin immer noch besser durchhielt als er selbst.
Er hoffte, dass er noch drei Jahre auf die Sommerweide würde gehen können, ganz nach oben in die Berge. In die Einsamkeit. La solitude. Es war so ein schönes Wort, fand er. Solitude. Es hatte den gleichen Klang wie dieses Gefühl, das sich dort oben einstellte. Eine Sinfonie der Einsamkeit. Ein auf sich selbst Zurückgeworfensein. Dort war er allein mit seinen Gedanken. Und der Stille. Nirgendwo war er so zufrieden wie oben in den Bergen. Zufrieden hieß für ihn, dass er ohne Angst war.
Jacques hatte Zeit seines Lebens Angst gehabt. Je älter er wurde, desto schlimmer wurde es. Von außen musste er auf die Leute wirken, als wäre er furchtlos. Weil er nie zusammenzuckte, nie diskutierte, ohnehin nie mit irgendwem sprach. Aber innen drin, da waren die Dämonen. Und die waren am besten zu bändigen, wenn er ganz allein war, nur mit sich und seinen Tieren.
Er würde vielleicht auch sein Rudel wiedersehen. Es waren sieben gewesen letztes Jahr. Sieben braune Wölfe. Bis hier herab auf die grünen Hügel kamen sie selten. Einmal waren sie in diesem Winter unten gewesen, er hatte ihre Spuren gefunden. Sie kamen nur, wenn es oben zu verschneit war, um noch zu jagen. Jacques wusste, wie sehr die Menschen im Tal die Wölfe fürchteten. Die dummen Bauern und Schäfer aus Espelette und Aldudes und aus dem Tal von Banka. Wie sie sich aufregten und ein Drama veranstalteten, als würden die Tiere ihnen die Verdammnis bringen oder die Pest.
Sie bauten hohe Stromzäune, diskutierten ewig über die Tiere. Und wenn es ganz wild wurde, schossen sie auf sie. Jacques hatte keine Angst vor den Wölfen. Er war ohnehin immer bei seiner Herde, tagsüber und nachts.
Er hatte nur Angst vor den Menschen, die Angst vor den Wölfen hatten.
Irgendwann hatte er verstanden, dass es gar nicht um die Tiere an sich ging. Es ging um Jäger. Die Wölfe waren Jäger, einsame Jäger, die immer unter sich blieben und die niemand sehen konnte. Er selbst war auch so ein Jäger. Ein Mann, der nicht sprach und von dem niemand wusste, was er dachte. Wahrscheinlich hatten sie im Dorf auch vor ihm Angst. Einmal hatte ein Schulkind kehrtgemacht, als es Jacques auf dem Schotterweg im Tal hatte stehen sehen. Die Augen des Jungen waren angstgeweitet gewesen. Er war schlecht eingeschlafen in dieser Nacht, weil er das Gesicht des Kindes nicht vergessen konnte.
Wieder stieß er einen Pfiff aus, und Gigi hob sofort ihren Kopf.
»Allez, ma chère«, sagte Jacques mit zärtlichem Unterton, »ça suffit, das reicht für heute. Bringen wir die Tiere in den Stall, es ist noch zu kalt für eine Nacht auf der Weide.«
Sofort tobte die Hündin los und gab ihr hartes, kurzes Bellen ab, um die Tiere erst zu alarmieren und dann zusammenzutreiben. Die Schafe mussten eigentlich wissen, dass Gigi absolut harmlos war, sie biss niemals zu – dennoch hatten sie absoluten Respekt vor der baskischen Hündin und ließen sofort von der saftigen grünen Wiese ab, um sich genau dorthin treiben zu lassen, wo Gigi sie haben wollte.
Jacques hob den Kopf, als er Stimmen hörte. Sie waren noch ein gutes Stück entfernt, aber der Frühjahrswind trug den Schall herüber. Der Schäfer kniff die Augen zusammen. Es waren drei Leute, nein, vier, der eine Mann stand verdeckt hinter den anderen. Sie trugen riesige Rucksäcke und diese schrecklich bunten Jacken, die Nordeuropäer für Funktionskleidung hielten. Dabei sahen sie darin aus wie Clowns. Sie kamen in seine Richtung, eine der beiden Frauen zeigte auf die Schafe, er hörte Lachen, das herüberwehte.
Jacques nahm das Gewehr, das über seiner Schulter baumelte, und lud es durch. Er sah sogar aus der Ferne, wie sich die Augen der Wanderer weiteten. Jacques hielt das Gewehr in die Luft und schoss. Einmal. Der Knall war ohrenbetäubend, er wurde von den Bergwänden ringsum zurückgeworfen, eine Explosion in der Stille dieses Tals. Die Schafe blökten nur einmal kurz auf, und während er selbst nicht mal zusammenzuckte, ertönten auf der anderen Seite des Tals die spitzen Schreie der vier Leute, die sofort die Beine in die Hände nahmen und davonliefen. Eine der Frauen stürzte, sie war in totaler Panik. Einer der Männer zog sie auf die Beine, dann rannten sie weiter, ohne sich noch einmal umzudrehen. Aber Jacques konnte die Verwünschungen hören, die ihm zugerufen wurden.
Er wollte sie hier nicht haben, diese Leute, konnte sie hier nicht gebrauchen. Er brauchte niemanden.
Hôtel & Restaurant Chez Claude, Espelette, Frankreich
Die Sonne stand schon tief über den roten Dächern des Dorfes. Claude zog den herben Rauch der letzten Zigarette in seine Lunge. Gleich würde der Stress beginnen, beim Abendservice blieb keine freie Sekunde für eine Pause. Er trank den kleinen café, den er sich eben noch aus der Maschine gezogen hatte, und nickte einem Paar zu, das aus der Boucherie gegenüber trat. Wahrscheinlich hatten sie noch ein Steak gekauft fürs Abendessen, das sie ganz gemütlich zu Hause zubereiten würden, bei einem Glas Wein. Während er gleich stundenlang am Herd stehen würde, im heißen Dampf seiner Großküche, um für hundert hungrige Mäuler zu kochen. Er leckte sich über die Unterkante seines Schnauzbarts, in der sich immer der Kaffeeschaum verfing.
Es war Montag, früher war das immer sein freier Tag gewesen, Ruhetag. Doch seitdem die Deutschen und die Niederländer den Jakobsweg für sich entdeckt hatten, gab es keinen Ruhetag mehr. Sein kleines Hotel war ständig voll, und da er keine Angestellten mehr fand, musste er eben selbst am Herd stehen. Corona hatte dafür gesorgt, dass viele seiner Köche dem Beruf den Rücken gekehrt hatten und nun lieber im Kindergarten im Dorf kochten oder gleich Solaranlagen auf dem Land aufbauten oder Versicherungen verkauften. Da verdienten sie mehr und mussten nicht am Wochenende arbeiten. Ganz anders als in der Küche des nach ihm benannten Restaurants, wo es an Wochenenden und Feiertagen am meisten brummte.
Aber auch heute sollten die Pilger nach ihrer langen Wanderung etwas Ordentliches auf den Tisch bekommen, schließlich machten sie ihm das Hotel voll und zahlten gar nicht mal so schlecht für die Zimmer. Früher hatten die Herbergen entlang des Jakobswegs aus simplen Zimmerchen bestanden, die kargen Klosterzellen gar nicht so unähnlich gewesen waren. Doch mit dem Trendsport Pilgern hatten sich auch die Klientel und ihre Anspruchshaltung verändert. Heute waren die Pilger irgendwelche reichen jungen Leute, Börsenmakler oder Ärztegattinnen, denen mitten in der Karriere plötzlich aufgefallen war, dass sie eigentlich lieber nach dem Sinn des Lebens suchen wollten, nach Achtsamkeit und innerer Zufriedenheit. Also liefen sie die drei, vier Wochen in der Hoffnung, dass danach alles anders wäre. Auf dem Weg aber wollten sie nicht mehr darben wie die Gläubigen vor fünfzig Jahren, weder beim Nächtigen noch beim dîner. Sie wollten einen Pool und ein weiches Bett, Netflix auf dem Zimmer genau wie entrée, plat und dessert und natürlich eine exquisite Weinkarte. Das war kein Problem für Claude und seine Gattin, die die Zeichen der Zeit früh erkannt und ihre einstige Pilgerherberge zu einem Hotel umgebaut hatten, das mittlerweile von der Vereinigung der Gastbetriebe im Südwesten Frankreichs vier Sterne erhalten hatte. Der Pilgerboom hatte ihnen ein ausgebuchtes Hotel beschert, und zwar fast das ganze Jahr über – und ein Restaurant, in dem jeden Abend nur schwer ein Platz zu bekommen war.
Er hätte nie gedacht, dass er einmal so kleine Portionen für die Pilger kochen würde – aber gut, es war eben die neue Welt. Und er konnte auch nichts dafür, wenn diese dauerschlanken Ärztegattinnen irgendwann auf dem Jakobsweg vor Erschöpfung umkippten. Schließlich bot er neben den leichten Diätgerichten immer noch die reichhaltigen Portionen Lamm und Kalbsgulasch an, die die Pilger vor hundert Jahren brauchten, um die anstrengenden Steigungen der Pyrenäen auszuhalten und die Bergkette zu überqueren, die Frankreich von Spanien trennte.
Claude sah zu, wie die Sonne hinter dem Dach gegenüber verschwand. Es war das Dach des Postamtes von Espelette. Über dem klassischen Schriftzug »La Poste« hing auch an diesem weißen Gebäude mit seinen roten Balken und Fensterläden die traditionelle Dekoration des Dorfes. Die Paprikaschoten waren eng zu kleinen Zöpfen zusammengebunden und an Nägeln festgemacht, sodass sie einmal die ganze Außenwand lang herunterbaumelten. So sahen auch fast alle anderen Fassaden des Ortes aus, die des Fleischers, der Boulangerie, des Andenkenladens und der privaten Wohnhäuser der alten Familien des Dorfes. Überall hingen die Schoten des Piment d’Espelette, als würden die Produzenten ihre Paprika immer noch zum Sonnentrocknen an die Häuser hängen. Dabei war das alles längst Folklore, die echten Schoten für den Piment wurden inzwischen in Lagerhäusern im Industriegebiet getrocknet. Hier im Dorf waren es nur noch die Hausbesitzer, die ihre Schoten für den eigenen Bedarf aufhängten, an die weißen Fassaden, damit die scharfe baskische Sonne ihren Piment brutzelte und sich durch die Hitze das ganze Aroma entfalten konnte.
Es war die größte Sehenswürdigkeit des kleinen Dorfes mitten in den Ausläufern der baskischen Berge und seine größte Tradition. Immerhin hatten die Schoten des Piment d’Espelette eine geschützte Herkunftsbezeichnung und durften nur aus Espelette selbst und einigen Tälern ringsum stammen, die gemahlenen Schoten aber gab es in ganz Frankreich und auch in anderen Ländern. Die Paprika hatte das abgelegene kleine Dorf berühmt gemacht.
Auch er würde gleich reichlich davon benutzen, aus seiner eigenen Ernte natürlich. Hinter dem Haus baute er auf einer kleinen Parzelle die hellroten Gorria-Schoten an, die am Ende des letzten Sommers tiefrot getrocknet an seiner Fassade gehangen hatten. Für das Kalbsgulasch, das er gleich für morgen ansetzen würde, brauchte er eine Menge Schärfe. Heute hingegen gab es den baskischen Bohneneintopf, Baba Gorriak.
Claude drückte seine Zigarette in dem kleinen Aschenbecher aus, der an der Wand hing, dann ging er wieder hinein. Er wollte gerade an der Rezeption in die Küche abbiegen, da hörte er laute Stimmen, die sich in schlechtem Französisch über irgendetwas aufregten. Erst als er das Wort »Schuss« vernahm, wurde er hellhörig.
Er krempelte sich die weißen Ärmel seiner Kochjacke herunter und bog um die Ecke. Seine Frau stand hinter dem Tresen, den Kopf hatte sie schief gelegt, weil sie sich bemühte, etwas von den radebrechenden Fremdsprachenversuchen zu verstehen. Vor ihr standen vier junge Leute in Regenjacken, die Rucksäcke hatten sie gegen den Tresen gelehnt. Sie waren sehr aufgebracht, besonders die Frauen. Eine von ihnen schien geweint zu haben. Vermutlich Engländerinnen, dachte Claude, als er ihre roten Wangen sah und die recht properen Gesichter. Sie gestikulierten wild, etwas musste ganz und gar nicht in Ordnung sein.
Er beeilte sich, hinter den Tresen zu kommen und sich zu seiner Frau zu gesellen.
»Alles okay?«, fragte er lang und gedehnt.
Die jüngere der beiden Frauen hob zu einem neuen Monolog an, doch Anne, Claudes Frau, war schneller. Sie sah etwas blass um die Nasenspitze aus.
»Schon wieder«, sagte sie leise auf Baskisch, wohl um auszuschließen, dass ihre Gäste etwas verstanden. »Sie sind den Weg oben am col entlanggegangen, sie wollten zu uns. Da haben sie von weitem einen Schäfer gesehen, und der hat geschossen. Einfach so. Er hat einfach in die Luft geschossen.«
Claudes Gesicht verzog sich zu einer grimmigen Miene. »Schon wieder?«
»Er ist wirklich verrückt geworden.«
Der Gastwirt besah sich die wütenden Gesichter der jungen Frauen. Die Männer standen eher teilnahmslos daneben, als würden sie das Gezeter auch nicht recht verstehen. Claude zuckte mit den Schultern und wandte sich ab. »Ich muss kochen, schaffst du das hier allein?«
»Na klar«, erwiderte Anne. Mit schnellen Schritten ging er in Richtung Küche. Er merkte erst auf dem Weg, dass er die ganze Zeit die Fäuste geballt hatte.
»Jacques«, murmelte er leise, »Jacques, dieser Teufel.«
Ferme Zabala, Espelette, Frankreich
Wer von außen zugesehen hätte, hätte es bestimmt merkwürdig gefunden, dieses Bild: wie der alte Kerl mit den riesigen Händen sich an diese filigrane Aufgabe machte. Aber es schaute niemand zu, er war ganz allein auf seiner großen Farm. Und obwohl jeder einzelne Finger von Aitor Zabala so dick war wie eine luftgetrocknete Salami, gelang es ihm spielerisch, die kleinen Löcher in die Erde zu drücken und dann die winzigen grünen Pflanzen zu nehmen und dort hineinzusetzen. Er arbeitete schnell und gewissenhaft: Loch drücken, Pflanze am Stiel greifen, einsetzen, Erde auffüllen, ab zum nächsten Töpfchen. Mit einem Seitenblick sah er, dass noch mehrere Hundert Pflanzen warteten.
Es war Akkordarbeit, wie immer im Frühjahr. Frauenarbeit, so hätten sie früher gesagt, weil es um Feinheiten ging, um kleine Pflänzchen und präzise Handgriffe. Aber Aitor fand das Quatsch. Er wollte allen zeigen, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehörte. Und auch wenn die Beine nicht mehr so gut mitmachten, als dass er noch in die Berge hätte stapfen können, um seine Schafherde zu hüten, so konnte er sich doch hier unten nützlich machen. Auf dem Bauernhof wurde er immer noch gebraucht – schließlich war dies hier sein Betrieb –, und neben dem Schafskäse machte die Familie seit Jahren den größten Umsatz mit dem Anbau der roten Paprikaschote Piment d’Espelette.
In diesen Tagen war es an der Zeit, die Pflanzen in die Gewächshäuser zu bringen, aber vorher mussten sie eben umgepflanzt werden. Geld für Angestellte hatten Aitor und seine Tochter nicht, also blieb ihnen nur, alles selbst zu machen. Deshalb stand er nun an dem Arbeitstisch im Schatten der alten Scheune mit ihren weißen Wänden und den roten Balken, die so typisch für das Baskenland waren. Die Sonne stand schon tief, es war später Nachmittag. Der alte Mann mit dem schlohweißen Haar sah hinauf in die Berge. Er konnte nicht anders, die Sorge um seine Tochter ließ nie nach. Auch wenn sie inzwischen kein kleines Mädchen mehr war, sondern eine gestandene Frau. Eine Schafshüterin, die mit allen Wassern gewaschen war, die Sturm und Fluten getrotzt hatte – den Naturgewalten, die in dieser ursprünglichen Landschaft ganz normal waren, die manchmal in Minuten über die grünen Hügel hereinbrachen und schon so manches Leben auf den Kopf gestellt hatten. Aber Aitor hatte seiner Tochter beigebracht, worauf sie achten und wann sie sich in Sicherheit bringen musste – er hatte sie stark gemacht für ihr Leben als Schäferin. So wie ihn sein Vater stark gemacht hatte damals, damit er ihm nachfolgen würde.
War Aitor traurig gewesen, als seine Frau ihm eine Tochter geboren hatte? Hätte er lieber einen Sohn gewollt? Instinktiv musste er kurz seine Augen schließen, weil er sich schämte, diese Frage damals mit Ja beantwortet zu haben. Besonders weil sie Tage nach Elorris Geburt gestorben war, eine unerwartete Blutung, die die Ärzte in dem kleinen Krankenhaus in Saint-Palais nicht rechtzeitig hatten stillen können. So war Elorri Aitors einzige Nachfahrin geblieben. Und er hatte alles darangesetzt, sie wie einen Sohn zu erziehen. Daher kam auch seine Scham: Es war gar nicht nötig gewesen. Elorri war zäh und stark und ganz und gar geeignet, seinen Hof zu übernehmen. Ohne jeden Zweifel.
Und doch machte er sich Sorgen um sie, jeden Tag wachte er mit Sorgen auf, und jeden Tag schlief er mit Sorgen ein. Sorgen um die Natur, die sich um sie herum veränderte, die extremer wurde und feindseliger. Sorgen um die Wölfe, die aus den Bergen kamen und ihre Herden bedrohten. Und Sorgen um die Menschen, die sich nur noch um Geld und den eigenen Vorteil zu kümmern schienen – und nicht mehr um das Gemeinwohl wie früher, als er noch jung war.
Aber manchmal dachte Aitor, dass all die Sorgen auch daher kamen, dass er selbst immer älter wurde. Alte Menschen machten sich Sorgen, so war es immer gewesen.
Er hatte den Berg immer noch fest im Blick, aber noch sah er seine Tochter nicht. Sie ließ sich heute wirklich viel Zeit, dachte er, als er sah, wie die Sonne nur noch knapp über der Bergkuppe des Col des Trois Croix stand. In einer Stunde würde die Dämmerung über das Tal hereinbrechen.
Er schüttelte den Kopf und blickte auf die Pflanzen, die er noch umtopfen musste. Egal, die würden auch morgen noch auf ihn warten. Er griff nach seinem Spazierstock und schlurfte langsam los. Direkt hinter dem Bauernhof begann die Weide, auf der sich die Schafe in der Nacht aufhielten, dann begann der Aufstieg auf den Gipfel.
Er würde ihr entgegengehen, vielleicht war ja etwas passiert, und seine Tochter brauchte Hilfe.
Aitor hatte kein Handy, er hatte nie eines besessen. Wer ihn erreichen wollte, musste zu seinem Bauernhof kommen – und wenn er mit den Schafen in den Bergen gewesen war, hatte es nie einen Anlass gegeben, ihn sprechen zu müssen.
Heute aber wünschte er sich ein Handy, dann hätte er Elorri fragen können, ob alles in Ordnung sei.
Er legte einen Zahn zu, auch wenn sein Knie schon von den wenigen Hundert Metern Aufstieg schmerzte. Dieses verdammte Knie. Der Weg führte durch ein kleines Wäldchen, das er sehr gut kannte. Er wollte es eigentlich nur zügig passieren, aber dann stutzte er. Aitor kniff die Augen zusammen und sah genauer zu der Stelle, an der er vor drei Wochen Reisig aufgeschichtet hatte, um zu verdecken, was er dort aufgestellt hatte. Er hatte sich nicht getäuscht. Aitor knurrte und trat näher an die Stelle heran, die sich zwischen zwei riesigen Eichen befand. Vorsichtig bückte er sich und zog ein wenig von dem Reisig zur Seite, vielleicht hatte er sich ja doch verguckt – aber dann könnte er seine Hand verlieren. Doch als er dann die Falle freigelegt hatte, sah er, dass sie zugeschnappt war. Keine Gefahr mehr. Nicht für seine Hand – und nicht für die Tiere, für die diese Falle gedacht war.
Er verzog das Gesicht. Nicht weil das Aas, dass er in die Tellerfalle gelegt hatte, bevor er sie aufspannte, so widerlich roch.
Sondern weil er wusste, dass hier jemand mit purer Absicht gehandelt hatte. Er sah den Stock, den jemand neben die Falle geworfen hatte. Ein stummer Gruß.
»Putain«, murmelte er leise, »Jacques, dieser Teufel.«
Col des Trois Croix, Espelette, Frankreich
»Putain«, fluchte sie immer wieder auf Baskisch, »putain, wo steckst du nur?«
Es war schon spät am Abend, die Pyrenäen im Süden waren nur noch schemenhafte Schatten, weil die Sonne vor einer halben Stunde untergegangen war.
Elorri hatte ihren Stock dabei und ging schnurstracks und ohne zu stolpern gen Westen, immer steil bergauf. Sie hatte keine Angst vor dem felsigen Untergrund, sie kannte diesen Weg seit ihrer Kindheit, sie würde nicht stolpern, auch wenn schon fast nichts mehr zu sehen war. Das hier war ihre Welt, ihr Vater hatte sie schon mit in die Berge genommen, als sie noch nicht einmal lesen oder schreiben konnte, und nun war sie seit zwei Jahren allein für die Herde verantwortlich. Die Herde, die sie eben bei ihm unten gelassen hatte; er würde die Tiere versorgen und für die Nacht in den Stall bringen.
Und sie musste sich nun beeilen. Sie fürchtete die Dunkelheit nicht um ihrer selbst willen, aber sie wollte das kleine Lamm finden, bevor die Nacht vollends hereinbrach. Das Wetter sollte nämlich bald umschlagen, und ein Unwetter in den Pyrenäen war nun wirklich kein Vergnügen. Wenn sie das Kleine nicht in den nächsten zwanzig Minuten finden würde, müsste sie ihn zurücklassen – und das wäre sein Todesurteil. In der Dunkelheit lauerten nämlich echte Gefahren, die Wölfe suchten genau nach so einer Gelegenheit: ein Lamm, getrennt von seiner Herde, ohne Zäune und ohne wachsamen Hund, wäre ein gefundenes Fressen. Sie hatte das Kleine vorhin schon gesucht, deshalb war sie später unten gewesen. Sie hatte erwartet, dass Papa wütend sein würde, aber er hatte ganz abwesend gewirkt und die Schafe einfach so entgegengenommen. Aber sie hatte nicht länger darüber nachgedacht, sie war sofort wieder losgegangen, zurück auf den Berg.
Natürlich, Elorri wusste, dass es nur ein Lamm war. Sie führte eine Herde mit dreihundert Tieren, die, nun von ihrem Schäferhund bewacht, schon unten auf dem Hof waren. Aber Papa hatte ihr immer beigebracht, dass sie nie eines ihrer Tiere zurücklassen solle. Hier im Baskenland sorgten Mensch und Tier füreinander – auch für ein einziges verlorenes Lamm. Und sie würde dieses Mantra befolgen, auch heute Abend und auch in der hereinbrechenden Dunkelheit.
Der Anstieg war steil, und ihr Atem ging stoßweise. Die warme Luft entwich ihrem Mund in weißen Wolken. Sie hielt inne und versuchte sich auf die Umgebung zu konzentrieren. War da ein Geräusch? Oder war es nur ihr eigenes Keuchen?
Sie sah sich um. Doch da war nichts, nur dunkle Schatten in der Einöde. Hier oben gab es keine Bäume mehr, der Weg war karg und schroff. Eigentlich war es gar kein richtiger Weg mehr, sie musste sich ihren Pfad durch die Felsen bahnen. Elorri wollte gerade wieder loslaufen, da hörte sie es. Sie legte den Kopf schief und schloss die Augen. Tatsächlich, von oben war leises Blöken zu hören.
»Putain«, flüsterte sie, »hab ich dich.« Sie stieg nun noch steiler bergan, das Blöken wurde lauter. Und dann, hinter dem nächsten Felsvorsprung, sah sie das weiße Etwas, fünfzig Meter weiter südlich stand es, sah irgendwie verkrampft aus und gab so hohe Töne von sich, dass es Elorri beinahe das Herz zerriss.
Sie ging näher heran und sagte ganz leise: »Ich bin da, ich bin da.« Dann sah sie es: Das kleine Lamm hatte nur drei Beine auf den Felsen, die aber krumm und schief standen – es sah aus, als wäre es gerade geboren worden. Das lag aber daran, dass das vierte Bein in einer Felsspalte klemmte. Immer wieder versuchte das kleine Tier sich zu befreien, aber es steckte einfach zu fest.
»Calme-toi«, flüsterte Elorri beruhigend und trat vorsichtig näher. Das Kleine sollte keine Angst haben, damit es sich nicht das Beinchen brach. Aber das Lamm stand nun sowieso schon ganz ruhig da, die Ohren angelegt, den Blick fest auf Elorri gerichtet. Sie hatte ihre Hirtin erkannt. Nun würde alles gut.
Nach vier Schritten war sie bei dem Kleinen und kniete sich hin, um es zu streicheln, sie fühlte sein Herz heftig schlagen und strich mit ihren Fingern über die Nasenspitze des Tieres, damit es ein wenig ruhiger wurde. Dann besah sie sich das Bein. Es steckte tief in einer Spalte im Fels, irgendwo musste es sich verhakt haben. Sie beugte sich hinunter und fasste nach dem Beinchen. Sie ging etwas in die Hocke, dann löste sie den Stein ab, der das Bein dort eingeklemmt hatte. Sie hörte, wie er sehr tief fiel und irgendwo aufschlug. Das Tier hob das Bein an, zog es aus der Lücke, und dann machte es einen Satz, der so heftig war, dass Elorri ins Taumeln geriet. Sie musste sich mit der Hand auf dem Boden abstützen, doch dabei glitt ihr Bein weg, und sie trat ins Leere, ausgerechnet in die Spalte, die nun durch den fehlenden Stein breiter geworden war. Es krachte, und sie spürte den Schmerz.
»Au«, schrie sie, »verdammt!«, und dann war es wie ein Messer, das ihren Unterschenkel durchschnitt. Sie versuchte ihr Bein herauszuziehen, aber es steckte fest, so fest, dass sie vor Schmerzen aufschrie, als sie es noch einmal versuchte.
»Putain«, fluchte sie noch einmal, aber diesmal war es vor Schmerz und Wut und nicht vor Sorge. Sie sah sich um. Das Lamm lief schnell davon, es war schon auf dem Weg Richtung Tal. Dass die Sonne verschwunden war, schien für das Tier das wichtige Zeichen, dass es nun schnell in den Stall musste.
Aber … was würde sie hier oben machen? Elorri verzog das schmerzverzerrte Gesicht und betrachtete die Dunkelheit über ihr und die Schatten, die sie umfingen. Ihr Handy fiel ihr ein. Als sie in ihre Tasche griff, bewegte sich ihr eingequetschtes Bein, und sie stöhnte vor Schmerzen. Dann sah sie auf das Display und schrie auf. Verdammt. Kein Netz. Das geschah oft hier oben – die spanische Grenze war nah, die beiden Netze, das französische und das spanische, griffen irgendwie ineinander, und es konnte auch passieren, dass man an mancher Stelle gar kein Netz mehr hatte. Ein paar Meter weiter war dann alles wieder gut, aber sie konnte sich im Moment eben keinen Meter wegbewegen. Was für ein Albtraum.
Zu dem Schmerz, der ihr den Atem raubte, gesellte sich nun eine kalte und klare Angst. Nein, es war nicht Winter, sie würde hier oben nicht erfrieren, auch wenn es nachts noch sehr kalt werden konnte. Aber es waren die Feinde, die es hier oben gab, die Füchse und … die Wölfe. Ihr Unterschenkel blutete, daran hatte sie keinen Zweifel. Und Blut lockte die Jäger an. Sie spürte die Gänsehaut auf ihrem Rücken.
Hatten die Wölfe schon Witterung aufgenommen?
Sie war noch nie in der Nacht allein in den Bergen gewesen. Natürlich in ihrer Hütte an der Sommerweide, aber nicht draußen und ungeschützt. Sie zog noch einmal und versuchte den Fuß aus der Spalte zu ziehen, aber der Schmerz bohrte sich sofort wieder in ihr Fleisch. Sie schrie, weil er sich bis in die Nervenbahnen zog und sie regelrecht in ihr pulsierten.
Elorri sah ins Tal hinab, das von hier so weit entfernt schien. Dort, wo sich die grünen Hügel aneinanderreihten und es einzelne Höfe gab, die ganz verstreut lagen, waren die Fenster hell erleuchtet, und sie stellte sich vor, wie ihre Freunde und ihre Familie jetzt dort in der Küche standen und kochten. Niemand hatte eine Ahnung von ihrer Situation. Wann würden sie anfangen, nach ihr zu suchen? Am nächsten Morgen? Aber wo sollten sie suchen? Niemand wusste, dass ein Lamm entlaufen war. Sie war gefangen. Ihr kamen die Tränen, weil der Schmerz so schlimm war und die Verzweiflung sie lähmte.
»Hilfe!«, rief sie auf Französisch, dann auf Baskisch, »Laguntza!« Wieder und wieder rief sie es, bis die Tränen ihre Worte erstickten. Sie spürte ihr Herz in der Brust und das Blut, das durch ihre Adern rauschte. Doch dann war da noch etwas. Ein Geräusch wie ein Klopfen. Wie …? Kamen jetzt etwa die Wölfe?
Aber dann vernahm sie es, es waren Schritte. Feste Schritte auf hartem Stein. Es klang nach schweren Stiefeln. Sie rief noch einmal: »Hilfe, helfen Sie mir!« Hoffnung keimte in ihr auf. Und dann trat er aus den Schatten, dieser große Mann, der ein wenig gebückt ging, ein Gewehr über seiner Schulter. Sie kniff die Augen zusammen und erkannte ihn, wollte noch etwas rufen, aber dann ließ sie es, weil sie irgendwie nicht wusste, wie diese Situation ausgehen würde. Er kam näher, zügig, aber ganz still, seine Füße steckten tatsächlich in schweren Bergstiefeln, und sie schwor sich, künftig auch nur noch mit echter Ausrüstung in die Berge zu gehen.
Er kam immer näher, sah sie nicht an und sprach kein Wort. Sie sah auch zu Boden, ihr Herz schlug nun noch schneller. Hatte sie Angst? Sie hatte um alles in der Welt gerettet werden wollen, aber sie hätte nie gedacht, dass er es wäre, der kommen würde. Das Gewehr baumelte dort, sie wusste, was sich die Leute über ihn erzählten.
Nun war er bei ihr, kniete sich nieder und griff nach ihrem Bein. »Psst«, machte er einmal, und dann zog er nicht, sondern drehte ihr Knie. Es war eine feste und doch ganz einfache Bewegung, sie hatte nicht einmal Schmerzen. Er drehte es so weit, dass ihr Fuß auf einmal frei war, dann zog er mit der fließenden Bewegung seiner starken großen Hand ihren Unterschenkel heraus, und sie war in Freiheit. Ihr Bein brannte, aber Elorri spürte keinen Schmerz mehr, jetzt kamen ihr die Tränen vor Freude – und weil die Anspannung einfach rausmusste. Sie sah das Blut an ihrem Schenkel, es war nicht viel, keine schlimme Verletzung, nur eine Schürfwunde, Gott sei Dank.
Er stellte ihren Fuß wieder auf den Felsen, dann stand er auf und drehte sich dem Tal zu. Er sagte immer noch nichts, sondern ging einfach los, stapfte Richtung Dorf, und sie konnte nicht anders, als den Kopf zu schütteln, sodass die Tränen zu Boden fielen. Leise flüsterte sie: »Merci.«
Mairie d’Espelette, Frankreich
»Oui?«, rief sie ins Telefon. »Ja, ich weiß, dass alle schon warten. Ich komme ja gleich.« Béatrice Blanc legte auf und schüttelte gleich darauf den Kopf. Aber nicht über ihre Vorzimmerdame, sondern über sich selbst. Ihre Stimme hatte schon wieder so genervt geklungen, dass es sie selbst ärgerte. Sie hatte sich doch vorgenommen, freundlicher zu sein, sonst hätte sie sich die Kosten für das Coaching in Paris ja sparen können. Das hatte ein ganzes Monatsgehalt verschlungen, und die einzige Lehre, die sie daraus mitgenommen hatte, war: Sei freundlich und zugewandt. Nimm die Bürger ernst. Und lächle, auch wenn es schwerfällt. Sie übte seither das Lächeln am Morgen im Badezimmerspiegel, aber fand, dass es immer noch so aussah, als bleckte sie die Zähne.
Und wenn wie heute Nachmittag das Telefon im Zehnminutentakt klingelte, dann war sie eben wie immer: unbeherrscht und genervt – es war aber auch alles zu anstrengend.
Die Kommunalpolitik war einfach ein hartes und undankbares Geschäft – ihr Mann hatte es ihr ja nicht nur einmal gesagt, sondern mehrere Dutzend Male, als sie zur Bürgermeisterwahl angetreten war.
Aber ihre Antwort war klar gewesen: Wenn ich diese kleine Welt hier eines Tages verlassen möchte, um in Paris bei den wirklich großen Fischen mitzuspielen, dann muss mein Amt ein Erfolg werden. Nun war sie schon seit sechs Jahren und acht Monaten Bürgermeisterin – und in drei Wochen würde bei den Kommunalwahlen über ihre Wiederwahl entschieden. Das war die Grundlage dafür, dass ihre Partei sie endlich fragen würde. Die große Frage, ob sie für die französische Nationalversammlung kandidieren wolle. Denn im nächsten Jahr waren die landesweiten Wahlen. Und die waren ihr Ziel. Auf keinen Fall wollte sie weitere sieben Jahre in Espelette festhängen.
Sie hatte einfach unterschätzt, wie starrköpfig und unregierbar die Basken waren. Schon die Franzosen waren ja nicht ohne – nicht umsonst hatte Charles de Gaulle schon in seinem Bonmot die Frage aufgeworfen, wie jemand ein Land regieren solle, in dem es zweihundertsechsundvierzig Käsesorten gebe. Aber die Franzosen waren nichts gegen die Basken, dachte Béatrice wieder einmal. Diese stolzen Bewahrer der Tradition, die aufmüpfig gegen alle Mächtigen waren und Regeln nur dann akzeptierten, wenn sie ihnen dienten. Und die sich miteinander stritten wie die Kesselflicker, aber am Ende immer zusammenhielten, dann nämlich, wenn es gegen die Staatsmacht ging.
Hier im Dorf kam noch etwas anderes zusammen: Tradition stand gegen Moderne. Weil sich hier in den letzten Jahren einfach sehr viel verändert hatte.
Espelette lag am Ende der Welt und war ganz und gar bezaubernd: ein Dörfchen im Tal, umgeben von grünen Hügeln, mit wunderschönen alten Häusern im baskischen Stil, mit Post und Bäcker und vielen Bars und Delikatessengeschäften – und jeder Menge Touristen. Da waren die, die hierherkamen, um die guten Würste und Käse zu verkosten, jene, die nach den Weinen der Region suchten und sich die herrliche Landschaft ansehen wollten – und es gab die Tausenden Pilger, die hier den Zubringer zum Camino del Norte nahmen, jenen Teil des Jakobswegs, der nicht durch die Pyrenäen führte, sondern vom spanischen Irun immer an der Küste entlang bis nach Santiago de Compostela. Es war eine herrliche Route, weil sie nicht an schmucklosen Schnellstraßen entlang durchs Landesinnere führte wie der übervolle Camino Francés, sondern immer wieder atemberaubende Panoramen auf wilde Felslandschaften und den Ozean bot.
Die Pilgerzahlen waren in den letzten Jahren explodiert, seit zwanzig Jahren hatte sich die Anzahl der Heilsuchenden mindestens vervierfacht. Und all diese müden Wanderer brauchten Unterkünfte und Verpflegung, weshalb sich viele Gastgeber im Dorf darauf spezialisiert hatten, sich um die vielen Pilger zu kümmern – ein einträgliches Geschäft.
Leider gab es aber einige wenige, die sich an diesem Geschäft nicht beteiligen wollten. Und die jene, die mit den Pilgern reich geworden waren, nicht nur kritisch sahen, sondern offen sabotierten.
Und genau deshalb hatten die Bewohner mal wieder eine Sitzung des Gemeinderats erzwungen. Es hatte offenbar reichlich Probleme gegeben, auch wenn sie noch nicht genau wusste, welche es diesmal waren. Auf jeden Fall würde es hoch hergehen, aber das war sie ja bereits gewohnt.
Béatrice Blanc stand auf und ging zu dem Garderobenständer, sie nahm die Schärpe in bleu-blanc-rouge und legte sie sich um. Natürlich waren Bürgermeister bei solchen Versammlungen nicht gezwungen, diese respektgebietende Kleidung in den Nationalfarben anzulegen, eigentlich war die Schärpe nur offiziellen Ehrentagen und Hochzeiten vorbehalten. Aber Béatrice fand, dass dieses Schmuckstück Respekt ausstrahlte – und an ihre störrischen Bürger auch ein Signal sendete, wer hier die Macht hatte: nämlich sie selbst, als Vertreterin der Republik.
Sie richtete die Schärpe, dann strich sie sich noch einmal durch die Haare und trat ans Fenster. Das Rathaus glich einem Kastell, einer Trutzburg. Es gab sogar einen kleinen Rundturm mit einem Fenster, doch nur sie konnte diesen Ausblick genießen, weil sie den Zugang mit einem Schloss gesichert hatte, für das nur sie den Schlüssel hatte. Das Rathaus stand auf einem Hügel, das Dorf zu Füßen. Vor dem Eingang wehte neben der französischen auch die baskische Flagge, und gleich darunter befand sich der Frontón-Platz, ein Spielfeld für den baskischen Nationalsport, dessen Regeln sie immer noch nicht begriffen hatte. Herrje, sie verabscheute diese Region mit all ihren Bräuchen und Traditionen – und bis heute war es für sie ein Wunder, dass die Bewohner von Espelette ausgerechnet sie als Nichtbaskin gewählt hatten. Das lag aber wahrscheinlich daran, dass ihr Mann ein beliebter Baske war – und dass niemand sonst diesen anstrengenden Job hatte machen wollen. Nicht einmal er.
Nun aber. Béatrice straffte ihre Schultern. Sie würde in die Höhle der Löwen gehen und ihnen zeigen, dass sie die Dinge im Griff hatte. Dass sie alles tun würde, um den Frieden im Dorf wiederherzustellen. Damit sie wiedergewählt würde – und endlich diese aufmüpfigen Kleingeister hinter sich lassen konnte.
»Paris, ich komme«, murmelte Béatrice Blanc und verließ ihr Büro, um die steinerne Treppe zu nehmen, deren Stufen ausgetreten waren, weil schon seit Jahrhunderten die Bürgermeister des Dorfes diesen Weg gegangen waren. Hier im oberen Stockwerk saß die Verwaltung, sie selbst nannte natürlich das größte Büro der Mairie ihr Eigen.
Im Erdgeschoss befanden sich das Bürgerbüro für Meldeangelegenheiten – und der große Versammlungssaal. Von drinnen waren schon Stimmen zu hören, die wild durcheinanderredeten. Noch einmal straffte Béatrice ihre Schultern, dann trat sie ein. Die Luft hier drinnen war zum Schneiden, es war warm und stickig wegen der vielen Menschen, viele davon Bauern, die es wohl mit der Körperhygiene nicht ganz so genau nahmen, wie Béatrice naserümpfend bemerkte. Sofort verstummten die Gespräche, und die Bürgermeisterin wurde von ihren Untertanen beobachtet, wie sie durch den Mittelgang schritt, den Kopf hochgereckt, damit die Schärpe gut zur Geltung kam. Wie von ihr angeordnet, stand der Tisch auf der Bühne, sodass sie die Bürger um mindestens einen halben Meter überragte und von allen Seiten gut gesehen werden konnte.
Sie verzichtete darauf, aufs Mikrofon zu klopfen, um zu prüfen, ob es eingeschaltet war. Der Pariser Coach hatte ihr gesagt, dass diese Maßnahme gänzlich unprofessionell rüberkam, und sie hatte sich selbst eingebläut, einfach in das Gerät hineinzusprechen. Aber erst mal ließ sie sich Zeit, um sich bequem hinzusetzen, dann betrachtete sie all die erwartungsvollen Mienen, die ihrerseits die Bürgermeisterin anstarrten.
»Messieurs-dames«, sagte sie und hörte ihre eigene Stimme aus den Lautsprechern, die ihr wie immer allzu hoch und schrill vorkam, »ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Hiermit eröffne ich die außerplanmäßige Sitzung des Gemeinderats. Es gibt nur einen Tagesordnungspunkt: die unschönen Vorfälle in der Gemeinde, die mir seit Tagen zu Ohren gekommen sind.« Sie räusperte sich. »Ich bin hier, um mich wie immer für Ihre Belange einzusetzen. Also, bitte: Sprechen wir über Ihre Sorgen – und dann lösen wir sie. Wie immer zu Ihrer aller Zufriedenheit.«
Sofort flogen einige Hände in die Luft. Béatrice betrachtete die Meldungen, blieb dann aber an Claude, dem Hotelbesitzer hängen. Er hatte ihre Kampagne zur Wiederwahl mit großzügigen Spenden finanziert, deshalb war es kein Wunder, dass sie sagte: »Monsieur Isabal, bitte …«
»Madame le maire«, sagte der Glatzkopf mit der tiefen Stimme, die so gar nicht zu seiner schmächtigen Erscheinung passen wollte, »wirklich, so geht es nicht weiter. Wir treffen uns ja nicht zum ersten Mal in dieser Angelegenheit, sondern zum x-ten. Und es ist seitdem gar nichts passiert. Außer dass dieser Mann dafür sorgt, dass in den sozialen Netzwerken und in Pilgerforen vor unserem Dorf gewarnt wird, weil hier ein Verrückter auf Wanderer schießt. Und was tun Sie, madame le maire? Nichts. Gar nichts.«
»Nun«, sie räusperte sich erneut, um ihre Überraschung zu verbergen, denn eigentlich hatte sie einen dicken Kloß im Hals. »Das kann ich so nicht stehen lassen, Monsieur Isabal, bei aller Freundschaft.«
»Das müssen Sie auch nicht, madame le maire. Freundschaft ist das eine – aber zu handeln, wenn Freunde in Not sind, das andere. Und Sie wissen: Ich war immer ein Freund Ihrer Person. Aber so etwas kann sich auch ändern.«
Die Bürgermeisterin war zutiefst erstaunt darüber, dass sich der Wirt so drastisch äußerte – und dass seine Stimme so barsch und unversöhnlich klang.
»Es gab also einen neuen Vorfall?«
»Erst vorgestern«, erwiderte Claude Isabal. »Er hat auf vier Wanderer geschossen. Sie waren Gäste in meinem Hotel – und sie waren außer sich. Sie wollten eigentlich zwei Nächte bleiben, um noch unser Dorf zu genießen, aber sie sind schon am nächsten Morgen panisch weitergezogen.«
»Und es war ganz sicher Monsieur Jacques, der auf die Pilger geschossen hat?«
Claude machte eine wegwerfende Handbewegung. »Was denken Sie denn? Wer rennt denn noch mit einem Gewehr durchs Dorf und macht Jagd auf Touristen?«
»Also … Jagd – so würde ich es dann doch nicht nennen …«
»Wie denn dann, madame le maire?«
»Wenn ich auch mal etwas sagen darf«, brummte eine tiefe Stimme in der hinteren Reihe, und dann erhob sich ein alter Mann mit schlohweißem Haar und stand mit seiner massiven Gestalt einfach nur da. Alle sahen ihn an. Béatrice war so gespannt wie sie alle, schließlich hatte Monsieur Zabala als einer der Dorfältesten bisher noch nie an einer solchen Sitzung teilgenommen. Sie wusste nicht einmal, ob sie ihn vor diesem Satz jemals hatte sprechen hören.
»Ja?«, fragte sie.
»Es ist ja nicht nur das mit den Pilgern«, brummte der Schäfer, »es ist auch so, dass er die Wölfe nicht fürchtet.« Aitor Zabala machte eine lange Atempause, erst dann sprach er langsam weiter. Alle hingen an seinen Lippen. »Genau die Wölfe, die sich immer weiter ins Tal wagen. Ich habe im letzten Winter vier Schafe verloren. Und deshalb …« Er sah im Saal umher, als wäre er nicht sicher, ob er fortfahren sollte, aber dann entschied er sich. »Deshalb habe ich etwas unternommen. Aber gestern habe ich gesehen, dass jemand meine Falle zerstört hat – und ich bin mir sicher, dass er es war. Jacques – dieser dumme Kerl.«
»Aber …« Madame Blanc wusste nicht, ob sie sich verhört hatte. »Habe ich das richtig verstanden? Sie haben eine Wolfsfalle aufgebaut? In der Gemeinde?«
»Nein, oben bei uns, am Wald.«
»Ich hoffe doch, es war eine Lebendfalle?«
»Nein, Madame. Es war eine Tellerfalle. Ich möchte keinen Wolf lebend treffen – und die Kinder aus dem Dorf sicher auch nicht. Wölfe gehören in die Berge – oder ausgestopft ins Museum.«
Die Bürgermeisterin war blass geworden.
»Monsieur Zabala, Sie wissen doch, dass Tellerfallen in Europa verboten sind. Was wäre denn, wenn ein Kind aus Versehen in diese Falle treten würde – ich mag es mir gar nicht vorstellen …«
»In meinem Wald gibt es keine Kinder«, antwortete Aitor Zabala. »Ich muss etwas tun. Wir müssen die Schafe schützen, weil Jacques sich gegen uns alle stellt, gegen uns Schäfer, obwohl er selbst Tiere hält und …«
»Aber Papa …« Nun war es die junge Frau neben ihm, die den alten Mann erschrocken ansah. »Was sagst du denn da?« Sie klang erschrocken. »Ich … Ich verstehe, was du machst und dass du die Falle einsetzt – aber ich finde, dass ihr alle hier viel zu hart seid. Monsieur Jacques ist eigentlich ein netter Mann, vorgestern hat er mich sogar aus einer Felsspalte gerettet …«
»Was hat er?« Ihr Vater riss die Augen auf, und sein Gesicht wurde wutrot. »Warum hast du mir das nicht erzählt?«
»Weil du ihn hasst!«, rief nun seine Tochter. »Weil ihr alle hier ihn hasst und weil ich dich nicht aufregen wollte. Nun, aber ich finde jedenfalls, dass Monsieur Jacques es nicht verdient, dass sich hier alle an ihm abarbeiten. Ja, vielleicht ist er ein Eigenbrötler, und vielleicht liebt er die Wölfe auch zu sehr, aber …«
»Ich finde, Ihre Tochter hat recht«, unterbrach sie die Bürgermeisterin, »und ich möchte wirklich wiederholen: Ein Tellereisen ist verboten – und ich muss Sie dringlich auffordern …«
»Ach, jetzt wenden Sie sich auch noch gegen einen unserer verdienstvollsten Schäfer – was wollen Sie denn tun?« Nun unterbrach Claude Isabal seinerseits die Bürgermeisterin. »Wollen Sie ihm die Polizei auf den Hals hetzen? Wegen einer Wolfsfalle? Anstatt sich um das eigentliche Problem zu kümmern?« Nun stand der Wirt auf. »Hören Sie, madame le maire, Sie haben eine Woche. Gehen Sie zu Jacques und verklickern Sie ihm, dass er mit diesem Unfug aufhören muss. Ich weiß, er ist ja ohnehin bald auf der Sommerweide, aber im Herbst würde der ganze Mist wieder von vorn beginnen. Deshalb haben Sie noch diese Woche Zeit – und wenn Sie sich bis dahin der Sache nicht angenommen haben, dann brauchen Sie in drei Wochen gar nicht erst kandidieren – weil Ihre eigene Stimme dann auch Ihre einzige sein wird.«
»Und dann gehen wir zu ihm und lösen das Problem ganz anders!«, schrie eine Stimme weiter hinten. Béatrice zuckte zusammen, weil sie glaubte, den Urheber zu erkennen, der der Aggressivität nach ein grobschlächtiger Mann war. Aber in dieser Gruppe von Männern weiter hinten ließ sich niemand genau identifizieren.
Sofort erklangen von allen Seiten wütende Rufe der Zustimmung, es gab sogar Applaus. Béatrice Blanc zuckte zusammen. Das war Erpressung. Und eine Kriegserklärung. Erst recht, weil er sie so unverhohlen ausgesprochen hatte. Aber sie wusste auch: Claude Isabal war im Dorf so mächtig, dass er seine Drohung wahrmachen würde. Sie musste also etwas tun. Sie musste diesen störrischen alten Mann besuchen. Und sie würde ihn stoppen. Ein Wolfsfreund und Menschenhasser würde nicht ihre politische Karriere beenden. Ganz sicher nicht.
Ferme du Col Vert, Espelette, Frankreich
Es war noch sehr früh, der Tau lag in dicken Tropfen im Gras und darüber stand der Nebel auf dem Hügel, dicht und weiß wie eine Wolke. Es war ein wunderschöner Anblick, und dazu duftete der Kaffee in seiner Tasse so gut, dass Jacques ein leichtes Lächeln im Gesicht hatte.
Vor einer Stunde war er aufgestanden, als es noch dunkel war, dann hatte er auf seinem alten Gasherd den café aufgebrüht. Und nun war er nach draußen getreten, um die volle und feuchte Luft durch seine Lungen strömen zu lassen. In ein paar Minuten würde er sich bereitmachen, um seine Schafe auf die grüne Weide zu schicken. Die letzten vier Tage im Tal, bevor er dann endlich auf seine Sommerweide in den Bergen reisen würde. Er konnte es kaum erwarten.
Weg von hier, weg aus dem sommervollen Tal. Wenn die Touristen kamen und noch viel mehr Pilger als ohnehin. Als wäre eine Wanderung bei vierzig Grad ein Vergnügen. Er hatte nie verstanden, warum Menschen wanderten, wenn sie keine Herde bei sich hatten, die sie hüteten. Es kam ihm unsinnig vor, unnatürlich.
Plötzlich hörte er einen Knall, dann einen zweiten – harte Schüsse, die von den Bergwänden zurückgeworfen wurden. Jacques zuckte nicht zusammen, aber sein Blick wurde grimmig.
Diese verdammten Kerle.
Er hörte sein Tor knarzen und wandte den Kopf. Der Hof war verlassen. Da war niemand. Es hatte eindeutig geklungen wie das Tor seiner Farm, doch das konnte eigentlich gar nicht sein. Ihn besuchte nie jemand, weil der Bauernhof so abgelegen war und die Leute im Dorf wussten, dass er keinen Besuch duldete.
Also trank er weiter von seinem Kaffee, in der Ferne blökten die Schafe. Sie hatten diese innere Uhr, die durch nichts durcheinanderzubringen war – und sie wussten, dass er bald zu ihnen kommen würde.
Die junge Frau bemerkte er erst, als sie schon fast vor ihm stand. Zu spät, um in die Hütte zu fliehen. Sie lächelte, dann folgte ihr Blick dem seinen, den Berg hinauf.
»Schießen die wieder?«, fragte sie mit ruhiger Stimme, ganz so, als hätten sie schon viele Gespräche miteinander geführt. Tatsächlich hatten sie noch nie ein Wort miteinander gewechselt.
»Wahrscheinlich haben sie wieder einen Hund für einen Wolf gehalten. Die Menschheit wird immer dümmer«, erwiderte Jacques, und seine Stimme war rau. So klang es wohl, wenn man sonst nur mit sich selbst sprach – und vielleicht noch mit seinem Hund.
»Ich wollte mich bedanken«, sagte die junge Frau unvermittelt. Jacques kannte sie nur vom Sehen, so wie er jeden aus Espelette nur vom Sehen kannte. Aber er ahnte, zu wem sie gehörte. Sie war eben erst wieder aus Paris hergezogen, so hatte er es zumindest bei einer seiner monatlichen Besorgungen gehört. Im Dorf wurde viel geredet. Sie war die Tochter des alten Aitor.
Sie sah ihn an, als würde sie auf eine Reaktion warten. Aber Jacques zuckte nur mit den Schultern.
»Ehrlich, Sie haben mir vielleicht … das Leben gerettet.«
»In den Bergen hilft man einander«, sagte er knapp.
»Nein, wirklich, das war total lieb von Ihnen. Aber ich konnte nicht mal danke sagen, weil sie sofort davongestapft sind. Aber da, wo ich herkomme, da bedankt man sich richtig.«
»Wo ist das denn?«
»Was?« Sie sah ihn überrascht an.
»Wo ist da, wo Sie herkommen?« Er fragte es ohne eine Regung in seinem Gesicht, aber sie grinste, weil sie seine Worte offenbar für Ironie hielt.