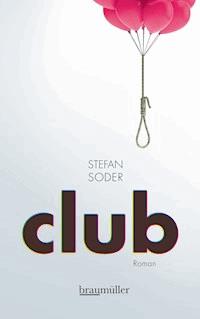16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Bergbauernhof in den Alpen. Hoch oben, abgelegen, weitgehend autark, scheinbar kaum verbunden mit der großen Geschichte und doch voller Erzählungen, in denen sich die bedeutenden Veränderungen in der Lebenswelt von vier Generationen widerspiegeln. In Zeiten bitterer Armut wird eine Alm vom ersten Simonbauer am Kartentisch erobert und mit Geschick und Beharrlichkeit zum Bauernhof ausgebaut. Später, am Rande des Zweiten Weltkrieges, wächst der Simonhof, die Pflichtkontingente werden mithilfe von Zwangsarbeitern erfüllt. In den 1970er-Jahren bringen technischer Fortschritt und der Fremdenverkehr, der anderswo Bauerndörfer zu mondänen Treffpunkten der besseren Gesellschaft macht, einen Wohlstandsschub. Der Fortschritt lässt sich von manchem Sturkopf bremsen, aber nicht aufhalten und so steht der letzte der Simonbauern vor den Herausforderungen eines Tourismusindustriellen. So strebt jede Generation nach einer besseren Zukunft. Die Suche nach den Spuren einer Herkunft, erzählt mit der Distanziertheit einer Außenstehenden und der vertrauten Intimität einer Angehörigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Stefan Soder
Simonhof
Roman
STEFAN SODER
Simonhof
Roman
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
1. Auflage 2017
© 2017 by Braumüller GmbH
Servitengasse 5, A-1090 Wien
www.braumueller.at
Coverfoto: © Shutterstock | Pecold
ISBN Printausgabe: 978-3-99200-179-8
ISBN E-Book: 978-3-99200-180-4
Inhalt
Not und Wendigkeit
In der Alpenfestung
Heiße Sommer, kaltes Wasser
Schnee und Geld
Wo das Erzählen keine Tradition hat, vermisst man es nicht. Wer damit beschäftigt ist, sich und seine Familie zu erhalten, findet keine Muße, um mehr als das Nötigste zu reden oder gar in der Vergangenheit zu schwelgen. Selbst in Zeiten wirtschaftlichen Wohlstandes gibt es stets Dringlicheres zu tun.
Die Gegenwart und das greifbare bisschen Zukunft sind das, was zählt. Es gilt zu kämpfen, früher wie heute, ums nackte Überleben oder darum, sich leisten zu können, was die Nachbarn noch nicht oder alle anderen längst haben.
Was das Erzählen betrifft, stellt meine Familie eine Ausnahme dar. Es waren die Frauen, die jedes Jahr zu Allerheiligen die alten Geschichten aufwärmten. Nachdem sie am Grabstein der Verstorbenen gefroren hatten, setzten sie sich zu Hause mit einem Getränk an den Kachelofen, tratschten ein wenig, um sich warm zu reden, bis sie zu erzählen begannen, zuerst von den Toten, später auch von den Lebenden.
Wenn es Abend wurde und die Kinder im Bett lagen, tranken und erzählten sie weiter. Als einzige Regel galt, dass nichts erlogen sein durfte, dass man bei dem bleiben musste, worauf man sich geeinigt hatte und das so im Lauf der Zeit zu einer Art Wahrheit geronnen war. Die Männer taten gelangweilt, aber hörten genau zu, stets bereit, um berichtigend einzugreifen, wenn sie einen von ihnen ins falsche Licht gerückt fanden. Im besten Fall ergänzten sie das Wiedergegebene mit überraschend persönlichen Anekdoten. Diese erzählten sie nicht ohne Eitelkeit, aber doch so roh und ungeschmückt, zuweilen naiv, dass sie sich mir besonders gut einprägten.
Wir Frauen spielten die Nebenrollen. Meist handelten die Geschichten von den Bauern, diesen zähen, starken Männern, die ihre Sturheit wie eine Trophäe vor sich hertrugen. Ihre Psychologie war nur gelegentlich von Interesse. Was die Bauern taten, das zählte und wurde erzählt.
Not und Wendigkeit
Am Anfang war die Arbeit.
Wenn man auf die Zeit nach dem ersten großen Krieg zurückschaut, lässt sich kaum begreifen, was Arbeit damals bedeutete, wie unmittelbar sie mit dem eigenen Überleben und dem der Familie zu tun hatte. Für die meisten Arbeitstauglichen gab es keine echte Freizeit, so wurden die weniger anstrengenden Tätigkeiten zum Vergnügen und zur Erholung.
Simon war ein schmächtiger Bursche von vierzehn Jahren, der, seit er nicht mehr zur Schule ging, für seine Mutter einmal pro Woche vom elterlichen Bergbauernhof ins Dorf hinunterlief, um einzukaufen. Während sein älterer Bruder beim Vater, bei der Arbeit bleiben musste, genoss Simon das Privileg, sich alleine und unbeaufsichtigt auf den Weg zu machen. Als er den Wald hinter sich gelassen hatte, rastete er, blickte über die tief verschneiten Felder ins Dorf hinab, darüber hinaus ins Tal, wo es sich öffnete, bevor es ins nächste, breitere Tal führte, in eine unbekannte Welt, die er nie betreten hatte. Eine Welt, in die er sich voller Neugierde hineinträumte, bis er sich wieder seiner Aufgabe besann und weitermarschierte.
Nachdem er im Dorf beim Krämer eingekauft hatte, lauschte er am Fenster des Wirtshauses den sentimentalen Kriegsliedern eines invaliden Ziehharmonikaspielers, der sich mit seiner Musik Essensreste und Alkohol verdiente, seit er ohne Beine aus dem Krieg heimgekehrt war. Dabei beobachtete Simon die Kartenspieler, gebrechliche oder versehrte Männer, die einzigen, die tagsüber im Wirtshaus saßen.
Wenn Simon sich endlich losreißen konnte, beeilte er sich mit geschulterter Kraxe auf dem schmal durch den Tiefschnee gestapften Pfad zum Hof seiner Eltern. Seine Schuhe passten ihm nicht, weil er sie stets erst dann bekam, wenn sie seinem um zwei Jahre älteren Bruder Vitus zu klein geworden waren. Mit der Kleidung war es das Gleiche, seine Mutter kam mit dem Stopfen der vielen Löcher, dem Annähen von Knöpfen an seinem ausrangierten Gewand kaum nach. Zu Hause brüllte immer zumindest eines der Kleinen.
Weil seine Mutter die Kinder beruhigen und gleichzeitig kochen musste, vergaß sie, mit Simon zu schimpfen, obwohl er wieder einmal zu lange gebraucht hatte. Er reihte die Kerzen, Mehl und Salz vor ihr auf und erklärte, dass der Pfeffer fehle, weil der Krämer ihn nichts mehr hatte anschreiben lassen. Seine Mutter fluchte ganz leise, bekreuzigte sich, dann schickte sie Simon zu seinem Bruder in den Stall und machte sich weiter daran, aus den knappen Lebensmitteln ein Essen für zu viele Mäuler zu rühren.
Sobald der Vater nicht in der Nähe war, packte Vitus seine Spielkarten aus und die Brüder hockten sich in einer Ecke des Stalls ins Heu. Beim Schnapsen ging es immer um einen Spieleinsatz. Wenn einer von ihnen an einen Schatz gekommen war – eine Murmel, ein Gummiband, einen Quarzstein oder einen Bleistift –, dann waren das willkommene Anlässe, um darum zu spielen. Sie hatten beide ihre Schatztruhen, die abwechselnd gefüllt waren, je nachdem, wer bei ihren Duellen im Kartenspiel gerade die Oberhand behielt. Seit Tagen hatten sie um ein Stück Katzengold gekämpft. Sie wussten um die Wertlosigkeit des Steines, aber es ging längst ums Prinzip. Sie spielten so verbissen darum, als stünde das Erbe des Hofes auf dem Spiel.
Das Kommen des Vaters kündigte sich auf dem Bretterboden rechtzeitig an, das Klopfen seines Holzbeines war ein verlässlicher Alarm. Sie ließen die Karten verschwinden und arbeiteten weiter, mit gesenktem Kopf, leise flüsternd, um den Zwischenstand des laufenden Spieles nicht zu vergessen oder darüber zu streiten, falls sie sich nicht einig waren.
Die Mutter musste nur einmal rufen, damit sich alle zum Essen versammelten. Die beiden Brüder und ihre fünf kleinen Geschwister redeten durcheinander, bis der Bauer sich dazusetzte. Wenn nur noch ihre hungrigen Bäuche zu hören waren, sprach er das Gebet. Als sich alle bekreuzigt hatten, schaufelten sie sogleich gierig in sich hinein. Wer nicht hungrig zu Bett gehen wollte, musste sich beeilen, den heißen Grießbrei aus der Eisenpfanne zu verschlingen und möglicherweise noch etwas von der geschmolzenen Butter in der Mitte zu erwischen. Wer zu wenig bekam, schabte mit dem Holzlöffel über den Boden der Pfanne, bis kein Körnchen Grieß, kein Tropfen Milch, kein Spritzer Butter mehr übrig war.
Nach dem Essen zog Vitus Simon mit sich hinaus, um weiter um das Stück Katzengold zu spielen, doch der Bauer rief sie zurück. Im Beisein der Bäuerin erklärte er Simon in knappen Worten, dass er den Hof bald verlassen und woanders arbeiten müsse. Vitus würde den Hof übernehmen, sobald er alt genug dafür sei. Bauer konnte es eben nur einen geben. Die Mutter versicherte Simon, dass sie einen guten Platz für ihn finden werde, wo es mehr zu essen gebe als bei ihnen. Der Vater ermahnte die beiden, sich das Kartenspielen und andere Flausen abzugewöhnen, weil sonst nichts aus ihnen werden könne. Als Männer hätten sie sich wie solche zu verhalten und hart zu arbeiten. Dann durften die beiden gehen.
Simon schlich sich von Vitus weg und legte sich im Stall ins Heu, wo er sich vornahm, fleißiger zu sein, sich so nützlich zu machen wie noch nie, bis er so unersetzlich wäre, dass sie es sich anders überlegen müssten und ihn nicht mehr fortschicken könnten.
Er spielte nicht mehr Karten mit Vitus, ließ sich auf keine Blödeleien ein und arbeitete jeden Tag so hart er nur konnte, bis seinem Vater abends beim besten Willen keine Aufgabe mehr für ihn einfiel.
Trotz aller Bemühungen spürte er, dass das alles nicht genug war, als hätten seine Eltern sich schon von ihm verabschiedet. Wie sehr er sich auch ins Zeug legte, die Suppen blieben wässrig, Knödel gab es selten, Fleisch war rar und die Portionen waren generell knapp bemessen. Also versuchte er, sich beim Essen zurückzuhalten und ging oft hungrig ins Bett. Dort kam ihm die Idee mit dem Wildern. Sie wollte ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen, bis er sich eines Nachts anzog und aus dem Zimmer schlich, ohne dass seine Geschwister es bemerkten.
Im Stall, ganz hinten über dem letzten Querbalken, nahm er die Büchse seines Vaters aus ihrem Versteck. Er band sich Schneeschuhe um und stapfte im Mondschein über das Feld nach oben in den Wald, in die Dunkelheit. Mit dem Willen eines Verzweifelten überwand er seine Angst, stieg weiter bergauf, bis an den Rand einer großen Lichtung, wo er sich auf einem Baumstumpf auf die Lauer legte.
Bald begann er zu zittern, aber er ließ sich nicht beirren und konzentrierte sich darauf, keine Äste zu knicken und seine Zähne vom Klappern abzuhalten. Es dauerte lange, bis tatsächlich ein erschöpftes Reh die Lichtung querte.
Simon hatte sich mit Vitus abgewechselt, als der Vater ihnen einmal erlaubt hatte, mit der Büchse zu schießen. Er war ein besserer Schütze als sein Bruder und sein Vater zusammen. Nur er hatte den rostigen Kübel bei drei Versuchen zwei Mal treffen können. Der Vater hatte ihn bestimmt nur deshalb nicht gelobt, weil er selbst nur ein Mal getroffen hatte. Er schieße wie ein Mädchen, meinte er dafür zu Vitus, weil dieser über Schmerzen in der Schulter klagte und ohne Treffer geblieben war. Wie ein Mädchen. Nicht wie ein Mann. Nicht wie ein Bauer. Diesen Kommentar zu hören, fühlte sich für Simon besser an, als selbst ein Lob zu bekommen. Vitus und Simon prügelten sich an jenem Abend, weil Vitus ihm zeigen wollte, dass er ein Mann, dass er der nächste Bauer sei. Einen eindeutigen Sieger gab es nie, wenn sie sich schlugen. Sie hörten einfach auf, wenn sie erschöpft waren oder einer von ihnen so stark blutete, dass die Mutter es bemerken musste.
Das Reh stand nahe genug. Simon wusste, wohin er zu zielen hatte. Das Blatt war größer als der rostige Eimer damals, dennoch zögerte er. Er begann erneut zu zittern, aber nicht vor Kälte. Bevor es noch schlimmer wurde, zog er am Hahn. Der Rückstoß überraschte ihn, der Schaft der Büchse schlug schmerzhaft auf sein Schlüsselbein und er fiel rücklings auf den Waldboden. Er hatte vergessen, was der Vater ihnen eingebläut hatte. Als er sich aufrappelte, war die Geiß verschwunden. Mit gezückter Waffe machte er sich daran, sie zu verfolgen, sein Herz raste, als er auf die Lichtung lief. Dabei wäre er beinahe über das Tier gestolpert, das nicht weit gekommen war und leblos vor ihm lag. Simon getraute sich kaum, es anzufassen, zögerlich legte er seine Hand in das feuchte, warme Fell. Er hätte das Reh vor Erleichterung umarmen wollen. Er riss sich zusammen, schaffte es irgendwie, es zu schultern und machte sich langsam an den Abstieg.
Auf den letzten Metern vor dem Hof kam ihm der Vater entgegen. Vom Schuss geweckt, hatte er seinen Sohn und die Büchse nicht an ihren üblichen Plätzen vorgefunden und schien erleichtert, den Buben gesund zu sehen. Sie stoppten erst, als sie so dicht beieinanderstanden, dass die ausgestoßenen Wolken ihres Atems sich berührten. Simon hatte alles so gemacht, wie er es von seinem Vater gelernt hatte, als dieser seinen Söhnen in einem seltenen Moment vertrauter Komplizenschaft erklärt hatte, wie man ein Wild erlegte. Sie durften der Mutter nichts davon sagen – zudem sei das Wildern streng verboten, hatte der Vater abschließend gemeint, aber die Buben spürten, mit welchem Stolz er von dem geheimen Abenteuer seiner Jugend erzählt hatte.
Als er dem Vater gegenüberstand und unter der Last seiner Beute einzuknicken drohte, verspürte er den gleichen Stolz und lächelte für einen Moment.
Die flache Hand traf ihn vollkommen unvorbereitet im Gesicht, mit einer Wucht, die Simon mitsamt dem geschulterten Reh in den Tiefschnee schleuderte. Der Vater riss ihm die Büchse von der Schulter, zog Simon an einem Ohr hoch und ließ ihn nicht mehr los, bis er mit ihm in die Stube gehumpelt war, wo er ihm noch eine Ohrfeige verpasste, die ihn erneut zu Boden warf. Dort blieb Simon zusammengekauert liegen, auch noch, als seine Eltern sich im Schein einiger Kerzen eilig daranmachten, das Tier zu zerlegen. Sorgfältig nahmen sie es aus, zerteilten es und wickelten Stück um Stück in Papier ein. Obwohl sie ihn keines Blickes würdigten, erschienen sie ihm wie Komplizen. Zusammen sorgten sie dafür, dass die Familie zu essen hatte.
Erst als alles verarbeitet und verstaut war und Mutter die Stube geschruppt hatte, kam sie zu Simon, strich ihm über den Kopf und brachte ihn ins Bett. Der Mond war untergegangen, einschlafen konnte er trotzdem nicht. Das Fieber der Jagd, das Töten des Tieres und der unbekannte Einfluss, den diese Tat auf seine Zukunft hatte, raubten ihm den Schlaf, in dieser und den folgenden Nächten.
Beim Frühstück drohte der Vater Simon und Vitus, er würde ihnen die Gurgel umdrehen, wenn sie die Büchse jemals wieder ohne seine Erlaubnis anfassten. Dann brachen die drei zur Holzarbeit in den Wald auf. Vitus konnte sich allmählich einiges zusammenreimen. Wenn er Simon danach fragte, was genau sich in der Nacht abgespielt hatte, verlor dieser jedoch kein Wort darüber. Der Vater erteilte die einsilbigen Arbeitskommandos noch knapper als gewöhnlich.
In der Dämmerung kehrten sie zum Hof zurück. Durch das Fenster sahen sie den Wildhüter am Tisch in der schwach beleuchteten Stube sitzen. Sein weiter, grüner Mantel war aufgeknöpft, Büchse und Jagdstock waren an den Tisch gelehnt, der Jagdhund lag ihm zu Füßen. Er saß vor einem Glas Schnaps und schaute der Mutter beim Kartoffelschälen zu. Bevor sie ihre Hüte abnahmen und in die Stube traten, zischte der Vater Simon mehrmals an. Ein Sauhund sei er, ein elendiger Sauhund, zu nichts zu gebrauchen.
Der Vater begrüßte den Wildhüter, indem er den Hut vor der Brust hielt und kurz den Kopf senkte. Erst dann setzte er sich an den Tisch. Als die Bäuerin ihm sein Glas Milch hinstellte, schob er es zur Seite und schickte sie nach einem Schnapsglas. Der Vater trank fast nie. Mit der Flasche, die er vom Nachbarbauern gegen zwei Kisten Äpfel eintauschte, kamen sie ein halbes Jahr aus, gebrauchten den Schnaps als Arznei oder zum Anlass eines der seltenen Besuche.
Nachdem sie wortlos ein Glas geleert hatten, kam der Wildhüter zur Sache und fragte, ob sie den nächtlichen Schuss gehört hätten.
Gar nichts hätten sie gehört, meinte die Bäuerin und stellte den Topf mit der Suppe auf den Tisch. Sie hob den Deckel und als der Dampf sich etwas verflüchtigt hatte, konnte man bis auf den Boden sehen, in der dünnen Suppe fand sich kein Fleisch, bestenfalls ein alter Knochen.
Ein Wildbret, das könne man riechen, bemerkte der Wildhüter. Dazu brauche er nicht einmal seinen Hund. Vor allem der Duft von Innereien hinge in der Luft, selbst wenn sie schon längst weggeschafft waren und man sich Mühe gegeben hatte, die Spuren zu beseitigen. Er trank aus und schenkte sich selbst noch einen Schnaps ein. Dabei drohte er dem Vater leise, ihn zu erschießen, wenn er ihn mit einer Büchse beim Wildern erwischen würde.
Der Kopf des Vaters war tief gebeugt, aus glasigen Augen blickte er zum Wildhüter, fast wie dessen Hund. Das wisse er natürlich, meinte der Bauer schließlich.
Simon hätte sich beinahe in die Hosen gemacht, weil er die ganze Zeit voller Angst angestrengt überlegte, wie er die Sache aufklären sollte. Um sich abzulenken, drückte er den Arm von Vitus so fest, bis der einen Schrei ausstieß und ihn boxte. Die Mutter schimpfte mehr als üblich mit ihnen, die Kleinen begannen zu weinen. Es wirkte: Der Wildhüter trank den Schnaps aus, schlüpfte in seinen Mantel und schulterte die Büchse.
Als der Jagdhund bei Simon vorbeikam, begann er zu knurren. Simon wollte auf der Stelle alles gestehen, schon alleine, um die Wahrheit zu sagen, vor Gott und vor seiner Familie. Da zwickte Vitus ihn schmerzhaft in die Hüfte und sie begannen sich hemmungslos zu prügeln, bis der Wildhüter draußen war. Der Vater riss die beiden auseinander und schleuderte sie in entgegengesetzte Ecken der Stube.
Knapp vor dem übernächsten Vollmond lag der Schnee nur noch in widerspenstigen Inseln auf den Feldern um den Hof. Wie jeden Morgen aß Simon sein Stück Brot, trank ein Glas Milch und stand vom Tisch auf, um mit der Arbeit zu beginnen. Dieses Mal hielt die Mutter ihn zurück. Der Vater und Vitus gingen ohne ihn in den Stall. Die Mutter brachte ihm ein zweites Stück Brot, Käse und sogar ein Ei, wie sonst nur zu Ostern oder an seinem Namenstag. Er überlegte, welche außergewöhnliche, anstrengende Arbeit ihn erwartete. Er zwang sich dazu, mehr zu essen, als er zu dieser frühen Stunde vertragen konnte, um für die Aufgaben gerüstet zu sein.
Der Vater kam bald wieder herein und setzte sich mit der Mutter zu ihm. Als er in ihre Gesichter blickte, wusste Simon mit einem Schlag, welcher Tag gekommen war. Es brauchte keine Worte. Der Vater kehrte zu seiner Arbeit zurück. Simon nahm sich vor, nicht zu heulen.
Während sie ein paar Sachen für ihn bereitlegte, erklärte die Mutter ihm den Weg, den er zu gehen hatte. Er würde einen, vielleicht auch zwei Tage unterwegs sein. Als er alles verstanden hatte, überreichte sie ihm eine Fotografie von seinem Ziel, dem prächtigen Sternhof. Unter anderem legte sie einen selbst gestrickten Pullover zu seinen Sachen, die er in den Rucksack packte. Als sie ihn alleine ließ, um sich um die Kleinen zu kümmern, begriff er, dass der Pullover neu war und nicht für den Bruder gemacht, ohne Löcher und Flecken. Da weinte er schließlich doch noch.
Als die Tränen getrocknet waren, trat Simon vor das Haus, wo seine Eltern und die jüngeren Geschwister ihn bereits erwarteten. Die Kleinen verstanden nicht genau, was passierte, aber als eines der Mädchen zu heulen anfing, steckte es die anderen an. Vitus schaute durch die Stalltür zu ihm, aber er kam nicht heraus. Das war Simon nur recht, weil er nicht wusste, ob er nochmals zu weinen beginnen oder versuchen würde, ihn zu verprügeln, wenn er ihm gegenübergestanden wäre.
Der Vater packte Simon bei der Schulter und beschrieb ihm nochmals in knappen Worten den Weg. Er ermahnte ihn, sich nicht mit Fremden einzulassen, gottesfürchtig zu sein, fleißig zu arbeiten und nicht zu vergessen, wo er herkomme. Keine Schande solle er ihnen machen.
Alles Notwendige war gesagt. Der Vater ließ ihn los und hob den Rucksack auf seine Schultern. Die Mutter presste ihn kurz an sich. Als ihre Arme ihn freiließen, blickte Simon noch einmal in jedes ihrer Gesichter, bis er schließlich losmarschierte.
Erst am Ende der Wiese, bevor der Weg hinab in den Wald führte, drehte er sich um. Doch da war niemand mehr, dem er hätte zuwinken können. Der Moment der Verabschiedung war vorbei, das Leben am Hof nahm seinen gewohnten Lauf. Das Gebäude lag vor ihm wie auf einer Postkarte. Seine Familie war schon zur Erinnerung geworden. So wie Simon selbst bereits eine Erinnerung für seine Familie geworden war, die ihn für viele Jahre in ihre Gebete einschließen würde, sich aber im Alltag keine Sentimentalität zugestand.
Bei Sonnenschein wanderte Simon bergab und talauswärts. Wenn ihn im Tal ein Fuhrwerk überholte und der Fahrer anbot, ihn ein Stück weit mitzunehmen, tat er so, als hätte er nichts gehört, und marschierte mit eingezogenem Kopf weiter. Ein Pfannenflicker und Scherenschleifer lud ihn ein, mit ihm am Wegrand zu rasten, aber Simon ließ sich nicht darauf ein, weil er Angst hatte vor dem Unbekannten mit seinen struppigen, kohlschwarzen Haaren und der dunkelbraunen Haut.
Das Tal wurde breiter, die Wiesen saftig grün. Simon begriff, dass es an ihm lag, wohin er gehen würde, dass niemand ihn aufhielte, wenn er einen anderen Weg als den von den Eltern beschriebenen einschlagen wollte. Er setzte sich hinter einem Heustadl auf den Boden, um darüber nachzudenken. An einen Holzstapel gelehnt, befreite er seine schmerzenden Füße von Schuhen und Kieselsteinen und döste in der Sonne ein.
Als er fröstelnd erwachte, hatte er den halben Nachmittag verschlafen. Er fühlte sich verloren und alleine an dem fremden Ort und machte sich fast panisch zurück auf den Weg. Die Sonne verschwand hinter einem Bergkamm. Er gelangte in einen Wald, der düster und bedrohlich auf ihn wirkte. Obwohl er nicht anders aussah als der elterliche Wald, den er so gut kannte, wagte er sich nicht tiefer hinein, kehrte um und ging zurück zu dem Stadl. Er kletterte hinein und richtete sich auf den letzten Resten Heu, die im Winter nicht verfüttert worden waren, ein Lager für die Nacht. So hatte der Vater es ihm aufgetragen, für den Fall, dass er den Marsch nicht an einem Tag schaffte.
Er dachte an alle Orte der Welt, von denen er jemals gehört hatte, in der Schule oder in den Geschichten des Pfarrers. Er träumte sich an den Hamburger Hafen, den er von einem Bild im Wirtshaus kannte, als letzten Punkt christlicher Zivilisation, dem Tor zum exotischen Rest der Welt.
Er war gerade eingeschlafen, da weckten ihn Schritte auf dem vorbeiführenden Weg auf. Sie kamen ganz dicht an ihn heran. Er konnte den keuchenden Atem eines Mannes hinter der Bretterwand hören. Eilig durchsuchte er seinen Rucksack nach dem Feitel. Im nächsten Moment zog der Fremde sich hinauf in die Öffnung des Stadls. Im Mondlicht sah Simon den riesigen, bedrohlichen Schatten über sich. Als er endlich das Messer in der Hand hielt, sprach er den Eindringling mit gespielt tiefer Stimme an. Er war sich nicht sicher, ob dieser den Feitel, mit dem er herumfuchtelte, überhaupt sehen konnte. Der Riese ließ sich jedenfalls nicht beeindrucken, warf sein Bündel in die gegenüberliegende Ecke, sprang herein und legte sich zu seinem Gepäck ins Heu.
Er wolle nur noch schlafen, brummte der Mann, nichts als schlafen. Er murmelte noch weiter, aber Simon konnte ihn nicht verstehen, weil der Fremde so undeutlich sprach, als hätte er etwas in seinem Mund.
Simon saß noch lange mit gezücktem Messer auf seinem Schlafplatz, selbst als der Mann längst schnarchte. Erst langsam, als der Mond untergegangen war, überkam auch ihn die Müdigkeit und seine Furcht löste sich wieder in abenteuerlichen Träumen von fernen Ländern auf.
Am Vormittag weckten ihn die Sonnenstrahlen, die durch die Ritzen und Astlöcher des Stadls drangen. So lange hatte er sonst nur am Palmsonntag geschlafen. Erst allmählich fand er sich in der ungewohnten Umgebung zurecht – er hatte schließlich noch nie woanders geschlafen als daheim in seiner Bettstatt, Fuß an Fuß mit dem Bruder.
Er bemerkte den Feitl mit ausgeklappter Klinge neben seinem Körper. Da erinnerte er sich an den nächtlichen Besucher, schreckte auf, aber er war allein und nicht mehr sicher, ob der Fremde nicht bloß in seinen Träumen existiert hatte – bis er entdeckte, dass seine Schuhe verschwunden waren. Er sprang auf und suchte in den Heuresten, aber sie waren nicht zu finden. Seine eigene Blödheit und den Unbekannten verfluchend packte er seine Sachen in den Rucksack und kletterte ins Freie.
Als er um die Ecke bog, sah er den Mann, wie er sich mit nacktem Oberkörper über die Viehtränke beugte und den Kopf darin eintauchte. Mit einem Ruck richtete er sich wieder auf und schüttelte das Wasser aus seinen langen Haaren. Simon hatte noch nie einen langhaarigen Mann gesehen, aber das war überhaupt der längste Mensch, den er je zu Gesicht bekommen hatte. Im Dorf war der Zimmermann der mit Abstand Größte, der sich bücken musste, um durch die von ihm selbst gezimmerten Türrahmen zu schlüpfen.
Simon zückte erneut seinen Feitel, nahm all seinen Mut zusammen und trat breitbeinig vor den Fremden. Wo seine Schuhe geblieben seien, herrschte er ihn an und sprach dabei jedes Wort lauter aus als das vorhergehende, um das Zittern in seiner Stimme zu übertönen. Der Mann lachte lauthals, band seine Haare zusammen und setzte sich neben Simon auf den Brennholzstapel. Da entdeckte Simon seine Schuhe, die neben jenen des Unbekannten zum Trocknen in der Sonne glänzten. Er steckte sein Messer weg, inspizierte seine Schuhe und sah, dass sie nicht nur eingefettet waren, sondern auch noch an der Stelle geflickt, wo die Sohle sich zu lösen begonnen hatte.
Als der Fremde sich sein Hemd angezogen hatte, nahm er eine Jause aus seiner Kraxe und breitete sie zwischen den beiden aus. Simon verstand kaum, was er sagte, aber er begriff, dass er eingeladen war. Da holte auch er Brot, Speck, Käse und die getrockneten Apfelspalten aus seinem Rucksack und während sie zu essen begannen, erzählte der Mann aus dem Frankenland ihm von seinen Reisen. Simon dachte, es handle sich um einen Franzosen, der eben französisch sprach. Dass der Riese dermaßen sonderbares Essen als Proviant mit sich führte, wunderte ihn nicht. Wenn seine Mutter nämlich einmal etwas anderes kochte als das Übliche, konnte man davon ausgehen, dass der Vater sie fragen würde, ob sie glaube, er sei ein Franzose.
Die schrumpeligen Würste, die sonderbaren eingelegten Gemüsesorten, die eigenartigen Nüsse und der weiche Käse des Fremden waren Simon nicht geheuer. Dafür zeigte sich der Mann von Simons Speck und Käse begeistert, was ihn auf neue Anekdoten über seine Reisen brachte. Simon gewöhnte sich ein wenig an die sonderbare Sprache, wenn der Langhaarige aber plötzlich laut auflachte, wusste er, dass er nicht einmal die Hälfte von dem Französisch verstand. Der Mann stellte Simon Fragen über sein Dorf, ob und wie viel gebaut wurde. Unter Zuhilfenahme von Händen und Füßen versuchte Simon, ihm Auskunft zu geben. Dann packten sie ihren Proviant ein, Simon bedankte sich für das Flicken der Schuhe, sie wünschten sich Glück und gingen ihrer Wege, der eine hinein in das Tal, der andere hinaus.
Simon gelangte bald in das nächste, breitere Tal, wo er weitläufig einer kleinen Stadt auswich und einem Fluss stromaufwärts folgte, um nach ein paar Kilometern eine Kapelle am Fuß des Berghanges anzusteuern. Er setzte sich für einen Moment hin – nicht aus Müdigkeit, sondern weil er zögerte. Erst später wurde ihm bewusst, dass er sich hier entschieden hatte, nicht in die weite Welt hinaus, sondern wieder zurück in die Berge zu gehen. Als Kind hatte er davon geträumt, das Meer zu sehen, Inseln, Strände und Palmen. Er konnte sich im Leben nichts Schöneres vorstellen, als keine Winter mehr in Schnee und Eis zu verbringen. Aber alles Ferne war zu abstrakt, nicht greifbar. Er wusste nicht einmal, was von den Erzählungen stimmte, die er über die Welt außerhalb seiner Heimat gehört hatte – von Leuten, die ihr Wissen selbst nur vom Hörensagen oder aus Büchern hatten.
Schließlich gab er sich einen Ruck und folgte der von den Eltern vorgegebenen Route, bog auf Höhe der Kapelle in den steilen Weg ein, wieder hinauf in die Berge, wo die Winter so unerbittlich waren, wie er es gewohnt war.
Als er es durch den steilen Graben nach oben geschafft hatte, durchquerte er einen Wald, immer höher, bis er auf eine weite Ebene gelangte. Hinter ausgedehnten Wiesen und Äckern konnte er auf einer Anhöhe den Hof erkennen. Er wusste, dass er richtig war, aber er zog das Bild der Mutter aus der Tasche, weil er zum ersten Mal die Gelegenheit hatte, eine Fotografie von einem unbekannten Ort mit dem Original zu vergleichen.
Die Bäuerin des Sternhofs war eine entfernte Verwandte seiner Mutter. Obwohl sie selbst nur einmal als Kind ein paar Tage dort gewesen war, erzählte die Mutter wiederkehrend vom Sternhof, geriet ins Schwärmen, wenn sie von diesem Ort des Überflusses und des Reichtums sprach, bis der Vater sie mit einem Brummen verstummen ließ. Ihre Augen leuchteten dann noch ein bisschen weiter, bis die Arbeit ihre Erinnerungen oder Fantasien verdrängte.
Während Simon sich seinem Ziel näherte, begriff er, dass seine Mutter nicht übertrieben hatte. Nie zuvor hatte er ein so mächtiges Bauernhaus gesehen. Durch die zahlreichen Nebengebäude erschien der Hof ihm wie ein kleines Dorf.
Es war mitten am Nachmittag, Mägde und Knechte eilten geschäftig an ihm vorbei, nahmen ihn bestenfalls mit einem kurzen Blick und grußlos wahr. Als er eine Magd nach der Bäuerin fragte, ignorierte sie ihn einfach. Er folgte einem Knecht zu einem Nebengebäude, weil er von dort Stimmen hörte. Er trat in den Eingang zur Scheune. Hier wurden Strohballen gebunden und gestapelt. Er erschrak, als eine laute Stimme ein Kommando brüllte. Nachdem sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte er den hageren Oberknecht erkennen, der oben auf den Strohballen saß, mit einem Rohrstock herumfuchtelte und mit seinen kurzen Schreien die Arbeiter antrieb.
Bevor er entdeckt wurde, schlüpfte Simon wieder nach draußen. Er ging zum Haupthaus, klopfte an die Tür, zog seinen Hut und grüßte in den dunklen Flur hinein. Als er keine Antwort erhielt, folgte er den gedämpften Stimmen, dem geschäftigen Klappern und Klirren. Er stürzte über einen Putzeimer und blickte auf dem Boden liegend in die Gesichter einer Schar von Mägden, die aus der Küche auf ihn starrten und ihn im Chor auslachten, als er im Liegen versuchte, nochmals seinen Hut zu ziehen. Er beeilte sich, wieder auf die Beine zu kommen, war aber hochrot angelaufen, sodass die Frauen nicht zu lachen aufhörten, bis eine von ihnen die anderen ermahnte und sie sich wieder auf ihre Arbeit konzentrierten. Jene Magd, die am nächsten bei Simon stand, fragte ihn, was er denn wolle. Seine Stimme überschlug sich und klang wie die eines Mädchens, als er nach der Bäuerin fragte. Er schämte sich wieder, erneut prasselte Gelächter auf ihn ein. Also wiederholte er, laut und kräftig, dass er zur Bäuerin wolle. Eine ältere Magd erbarmte sich und geleitete ihn zu einer Bank in der Stube, wo er sich hinsetzen sollte. Er überreichte ihr den Brief seiner Mutter.
Es dauerte lange und er wäre in der warmen Stube fast eingeschlafen, als die Bäuerin eintrat, ihm ein Glas Milch hinschob und sich zu ihm setzte. Sie war eine stämmige Frau mit grauen Haaren und roten Wangen.
Sie breitete den Brief vor ihr aus, überflog ihn und als er die Milch trank, musterte sie ihn eindringlich. Sie sei also seine Großtante, stellte sie schließlich fest, tätschelte seinen Kopf und meinte, er solle sie Aloisia nennen. Sie nahm ihn bei der Hand und führte ihn in das Innere des Hauses, bis sie am Ende eines langen Ganges in eine getäfelte Stube traten.
Der Sternhofbauer saß mit einem älteren Mann zusammen bei Speck, Bier und Schnaps vor einer Wand, die dicht mit Jagdtrophäen behangen war. Er ließ sich von den beiden nicht stören und redete weiter über den Hof des Älteren, den er offenbar kaufen wollte, nachdem dessen Söhne im Krieg gefallen waren und er zu alt wurde, um die Arbeit bewältigen zu können.
Aloisia startete mehrere zögerliche Versuche, ihren Mann mit einem Räuspern zu unterbrechen. Dieser redete aber konzentriert auf den alten Bauern ein, um ihm sein Angebot schmackhaft zu machen, betonte, wie frei er ohne seinen Hof wäre, um zu tun, was er wolle. Er müsse nicht mehr arbeiten, könne sich vergnügen und die Welt ansehen. Das schien den Alten nicht zu interessieren. Ob er denn keinen Wunsch, keinen Traum habe, fragte der Sternhofbauer.
Der Alte schaute ihn verständnislos an. Er sei ein Bauer und bleibe einer, bis er unter der Erde läge. Etwas anderes kenne er nicht, etwas anderes wolle er nicht.
Das könne er natürlich auch, meinte der Sternhofbauer rasch. Solange er arbeiten wolle, könne er Bauer bleiben und trotzdem das Geld nehmen und es sich gut gehen lassen. Zumindest am Sonntag, im Wirtshaus.
Als die beiden Herren für einen Moment still waren, zog Aloisia Simon mit sich, so nahe an ihren Mann heran, dass er sie nicht mehr ignorieren konnte. Sie stellte Simon als ihren Neffen vor. Als der Sternhofbauer ihn musterte, sah Simon augenblicklich, dass er nichts mit ihm anzufangen wusste. Er stellte sich aufrecht hin und drückte seine schmale Brust heraus.
Aloisia breitete den Brief vor ihrem Mann auf dem Tisch aus. Der Bub sollte bei ihnen bleiben, er sei ein guter Arbeiter, das stehe in dem Schreiben.
Schwächlich sehe er aus. Wenn er ein guter Arbeiter wäre, hätten sie ihn wohl dabehalten, wo er herkomme, brummte der Sternhofbauer in seinen Bierkrug.
Bei den Holzfällern würde er bestimmt rasch kräftiger werden, entgegnete sie, Arbeit hätten die jedenfalls genug. Sie blieb dicht bei ihm stehen. Niemand sagte etwas, bis selbst der Alte Simon zu mustern begann und der Sternhofbauer endlich nachgab und meinte, es solle so geschehen. Beim Hinausgehen senkte Simon seinen Kopf und krächzte mit dünner Stimme ein Vergelt’s Gott.
Er durfte sich in der Stube stärken, bedankte sich artig für jeden Bissen, den man ihm vorsetzte. Schon wieder aß er weit mehr, als er es gewohnt war. Dann trug Aloisia ihm auf, draußen auf Ignatz, den Oberholzknecht, zu warten. Simon hockte sich vor der Tür auf die Bank. Erst wartete er stramm sitzend, jeden Moment bereit, um aufzuspringen und mit einem der vorbeieilenden Knechte an die Arbeit zu gehen. Doch allmählich entspannte er sich und machte es sich in der Sonne gemütlich, bis sich vor ihm ein Schatten aufbaute. Sepp, der Oberknecht, blickte auf ihn herab und fragte ihn, ob er der Bauer sei. Simon lächelte blinzelnd über den offensichtlichen Scherzbold, schüttelte den Kopf, wollte ihm erklären, dass er auf Ignatz warte, aber er kam nicht dazu. Sepp packte ihn am Kragen und zog ihn daran hoch, trat ihm mit dem Stiefel gegen die Beine, zückte seinen Rohrstock und trieb Simon damit vor sich her bis zum Misthaufen. Er ließ Simon Mist auf einen Anhänger laden. Dabei brüllte er ihn an, schneller zu arbeiten, und fragte ihn wiederholt, ob er immer noch glaube, der Bauer zu sein, weil nur der Bauer es sich leisten könne, faul in der Sonne zu liegen. Simon schaufelte so schnell er konnte, aber der Mist war so schwer, dass er sich überanstrengte und das ungewohnt reichhaltige Essen erbrach. Er musste noch ein paar Schläge ertragen, bis Aloisia zu den beiden geeilt kam, mit Sepp schimpfte und dieser endlich von ihm abließ. Simon folgte der Bäuerin zurück zum Hauptgebäude. Sepp rief ihm hinterher, dass er ihn sich noch holen würde, wenn er einmal nicht an einem Rockzipfel hing.
Die Magd rümpfte die Nase, als Aloisia sie damit beauftragte, für Simon ein Bad einzulassen.
Zum ersten Mal in seinem Leben lag Simon in einer richtigen Badewanne, groß genug, um darin ganz unterzutauchen. Nachdem er sich beruhigt hatte, hinterließen diese Minuten alleine in dem warmen Wasser einen so starken Eindruck, dass er sich sein Leben lang mit leuchtenden Augen daran erinnern konnte.
Kleidung und Schuhe wurden notdürftig gesäubert, und als Simon wieder angezogen war, wartete Ignatz bereits auf ihn. Der Oberholzknecht war fast zwanzig Jahre älter, begrüßte ihn kameradschaftlich, aber schüttelte ihm nicht die Hand. Simon half ihm, das Fuhrwerk mit Werkzeug und neuen Sägeblättern zu beladen. Erst dabei bemerkte er, dass Ignatz an der rechten Hand zwei Finger fehlten. Die Geschicklichkeit, mit der Ignatz die Sachen verstaute, beeindruckte ihn umso mehr. Nur seinen Vater hatte er je mit einer solchen Gewandtheit und Effizienz arbeiten gesehen.
Bei der Holzarbeit müsse man immer Obacht geben, meinte Ignatz. Simon war es peinlich, seine Hand so lange angestarrt zu haben. Doch Ignatz lachte bloß und gemeinsam wuchteten sie zum Schluss den Korb mit dem Proviant auf den Wagen.
Aloisia gab Ignatz vertraulich Anweisungen, die dieser nickend wiederholte, und meinte, er würde schon aufpassen auf den Kleinen. Vom wegfahrenden Wagen aus zog Simon seinen Hut, als er sich nach der Bäuerin umdrehte.