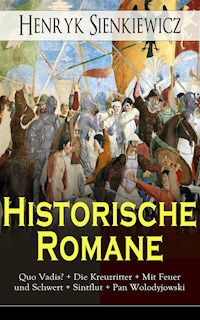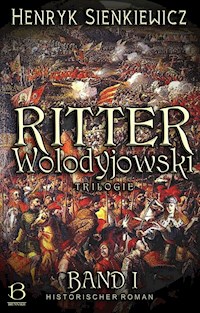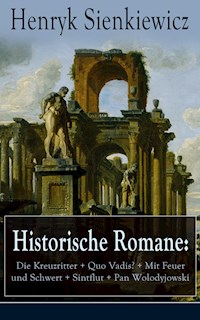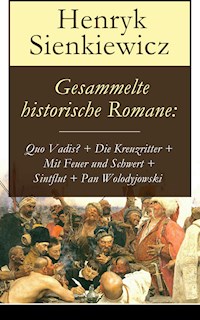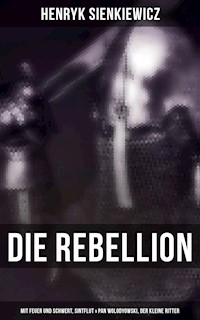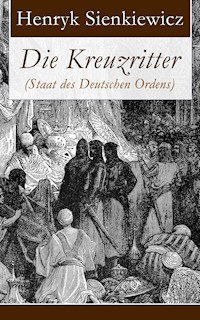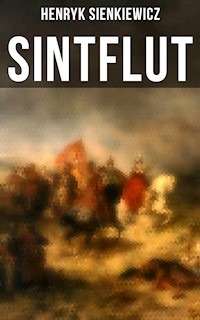
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Sintflut" von Henryk Sienkiewicz taucht der Leser ein in die faszinierende Welt des 17. Jahrhunderts, geprägt von Intrigen, politischen Machenschaften und persönlichen Dramen. Der Roman, der Teil der berühmten Trilogie des Autors ist, besticht durch seinen detailreichen historischen Hintergrund und seinen einzigartigen literarischen Stil. Sienkiewicz verwebt gekonnt Fiktion mit historischen Fakten und entführt den Leser in eine Welt voller Abenteuer und Emotionen. Die Geschichte folgt den Schicksalen von verschiedenen Charakteren, die inmitten des Krieges und gesellschaftlicher Umbrüche nach ihrem Platz in der Welt suchen. Henryk Sienkiewicz, ein polnischer Schriftsteller und Nobelpreisträger, wurde durch seine historischen Romane weltberühmt. Sein tiefes Interesse an Geschichte und seine Fähigkeit, komplexe Charaktere zu erschaffen, spiegeln sich deutlich in "Sintflut" wider. Als Zeitgenosse der beschriebenen Ereignisse konnte Sienkiewicz einzigartige Einblicke in die damalige Welt bieten und diese gekonnt in fesselnder Prosa festhalten. "Sintflut" ist ein Meisterwerk der historischen Literatur, das sowohl Kenner als auch Neueinsteiger in seinen Bann ziehen wird. Mit seiner packenden Handlung und seinen vielschichtigen Charakteren bietet es Lesegenuss auf höchstem Niveau. Tauchen Sie ein in die Vergangenheit und erleben Sie die dramatischen Ereignisse des 17. Jahrhunderts mit Henryk Sienkiewicz als Ihrem faszinierenden Begleiter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1006
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sintflut
Inhaltsverzeichnis
Erster Band
Erstes Buch.
Einleitung.
In Smudien lebte das Adelsgeschlecht der Billewicz’, das in der ganzen Gegend von Rosien sehr geachtet wurde und mit dem höchsten Adel des Landes eng verwandt war. Im Staatsdienste hatten die Billewicz’ nicht die ersten Stufen erklommen, aber auf dem Kriegsfelde leisteten sie dem Vaterlande große Dienste und erhielten dafür freigiebig viele Auszeichnungen. Ihr Stammsitz, der noch heutigen Tages unversehrt ist, hieß auch Billewicze, aber sie besaßen außerdem noch viele Güter; in der Gegend von Rosien, auf dem Wege nach Krakinowo, längs der Lauda, Szoja, Niewiaza, bis hinter Poniewiez erstreckten sich ihre Besitztümer. Die Billewicz’ waren so reich und nahmen eine so angesehene Stellung ein, daß selbst die in Litauen und Smudien lebenden Radziwills mit ihnen rechnen mußten.
Das Familienoberhaupt aller Billewicz’ war Heraklus Billewicz, der zur Zeit Johann Kasimirs Oberst und Kammerherr von Upita war. Er wohnte nicht auf seinem Stammgute, das damals im Besitz von Tomasz Billewicz war. Heraklus gehörten die an der Lauda liegenden Domänen Wodokty, Lubicz und Mitruni. In der ganzen Umgegend des Flusses wimmelte es von kleinen Besitzungen des in der Geschichte Smudiens berühmt gewordenen Laudaer Adels.
Alle Laudaer Adligen dienten im Banner des alten Heraklus je nach ihrem Vermögen mit ein oder zwei Pferden. Sie liebten alle das Kriegshandwerk und interessierten sich sehr wenig für die Verhandlungen des Landtages. Es genügte ihnen zu wissen, daß der König in Warschau, Pan Radziwill und Pan Hliebowicz, der Starost, in Smudien und Pan Billewicz in Wodokty lebten. Sie stimmten, wie Pan Billewicz es wünschte, da sie überzeugt waren, daß er ein gleiches wolle wie Pan Hliebowicz, der wiederum mit Pan Radziwill übereinstimmte, der in Litauen und Smudien Vertreter des Königs war; der König aber ist der Gatte der Republik, der Vater des Adelsstandes.
An der ganzen Ostgrenze der Republik entbrannte im Jahre 1654 ein furchtbarer Krieg. Pan Billewicz zog seines hohen Alters wegen nicht mehr in den Kampf, aber alle Laudaer zogen ins Feld. Und da, als die Nachricht kam, daß Hetman Radziwill bei Szklow eine schreckliche Niederlage erlitten und das ganze Laudaer Banner beim Angriff der französischen Söldner fast völlig vernichtet worden war, gab der alte Oberst, vom Schlage gerührt, seinen Geist auf.
Niedergeschlagen, abgemattet und ausgehungert kehrten die Reste der Laudaer in die Heimat zurück, geführt von einem jungen, aber schon berühmt gewordenen Krieger, Pan Michail Wolodyjowski, der an Stelle Pan Heraklus’ die Leute von Lauda geführt hatte. Alle waren erbittert über den Hetman, der, blindlings dem Ruhme seines Namens trauend, sich mit ungenügenden Kräften auf den so zahlreichen Feind geworfen und dadurch das ganze Heer und das ganze Land ins Verderben gestürzt hatte.
Gegen den jungen Oberst Michail Wolodyjowski aber erhob sich keine Stimme. Im Gegenteil, diejenigen von Lauda, die der Vernichtung entgangen waren, hoben ihn bis zum Himmel und erzählten wahre Wunder von seinen Heldentaten und seiner Kriegskunst. Mit Trauer, aber zugleich mit Stolz, hörten alle die, die erst bei Einberufung des Landsturmes sich stellen mußten, diese Erzählungen, und man war entschlossen, falls der Landsturm einberufen werden sollte, wie man allgemein erwartete, einstimmig Pan Wolodyjowski zum Rittmeister des Laudaer Heeres zu wählen. Man wußte, daß man keinen besseren Führer finden konnte. Ganz Lauda trug ihn auf Händen, man riß sich um die Ehre seines Besuches. Von Gut zu Gut mußte er wandern, bis er sich endlich bei Pakocz Gasztowt in Pacunele häuslich niederließ.
Nachdem Heraklus Billewicz beigesetzt worden war, wurde sein Testament eröffnet. Der alte Oberst hatte seine Enkelin Panna Alexandra Billewicz zur Universalerbin all seiner Güter, ausgenommen des Gutes Lubicz, ernannt, und sie selbst bis zu ihrer Verheiratung der Vormundschaft des gesamten Laudaer Landadels unterstellt.
»… Alle, die mich liebten, – so lautete sein Testament, – und die Gutes mit Gutem vergelten wollen, möchte ich bitten, ebenso der Waise gegenüber zu handeln und sie in meinem Namen vor jeglichem Unglück zu behüten. Da in dieser gegenwärtigen Zeit sich niemand vor menschlicher Gewalt sicher fühlen kann, so sollen alle danach trachten, daß meine Erbin ungehindert die Nutznießung aller der ihr vermachten Güter behält. Ausgenommen ist das Landgut Lubicz, das ich Pan Kmicic, dem jungen Bannerherrn von Orsza, vermache. Damit sich aber niemand über mein Wohlwollen dem Pan Andreas Kmicic gegenüber wundere, so wisse jeder, daß ich seit langen Jahren bis zum Tode die brüderliche Liebe des alten Kmicic genossen habe. Seite an Seite focht er mit mir und rettete mir mehrmals das Leben. Vor vier Jahren ging ich, Heraklus Billewicz, Kammerherr von Upita, der jetzt vor dem schrecklichen Richterstuhle Gottes steht, zum alten Pan Kmicic, um ihm meine Dankbarkeit und herzliche Zuneigung zu bezeugen. Wir beide kamen dort überein, den alten christlichen und Adelstraditionen folgend, daß unsere Kinder, sein Sohn Andreas und meine Enkelin Alexandra, sich ehelichen sollten. Dies wünsche ich von Herzen und erwarte, daß sich meine Enkelin Alexandra meinem hier kundgetanen Willen unterwerfen werde. Es sei denn, was Gott verhüten möge, daß der Fahnenträger von Orsza seinen Ruf durch schändliche Taten beflecke und für ehrlos erklärt worden sei. Falls er aber seiner Güter verlustig ginge und auch auf Lubicz verzichtete, so muß ihn trotzdem meine Enkelin heiraten. –
Einzig und allein, wenn meine Enkelin durch besondere Gnade Gottes und zu seinem Ruhme ihre Jungfräulichkeit bewahren und Nonne werden will, so soll man ihr keine Hindernisse in den Weg legen; denn Gottesdienst steht vor Menschendienst.«
So hatte Pan Heraklus Billewicz über sein Hab und Gut und seine Enkelin verfügt, und niemand wunderte sich darüber. Panna Alexandra wußte schon lange, was ihrer harrte, und auch der Landadel kannte die Freundschaft zwischen Billewicz und Kmicic. Endlich waren auch die Gemüter in dieser Zeit durch ernstere Dinge beschäftigt, so daß man bald aufhörte, vom Testamente zu reden.
Inzwischen hatte sich der Krieg weiter und weiter über das Land verbreitet. Nach Radziwills furchtbarer Niederlage konnte keiner mehr rechten Widerstand leisten. Feld-Hetman Gosiewski hatte nicht ausreichende Kräfte zur Verfügung, die Kron-Hetmans kämpften mit den Resten ihrer Heere in der Ukraina, und die Republik, erschöpft durch die Kosakenkämpfe, konnte ihnen keine Hilfstruppen schicken. Der Feind überflutete das ganze Land; nur hier und da leisteten einige Festungen Widerstand, aber schließlich fielen auch diese und unter ihnen Smolensk. Im Smolenskaer Bezirk lagen die Güter der Kmicic’, die man für rettungslos verloren hielt.
Die Kmicic’ genossen in der ganzen Umgegend von Orsza großes Ansehen. Sie besaßen ein bedeutendes Vermögen, waren aber durch den Krieg zugrunde gerichtet. Ihre Äcker, die in Wüsten verwandelt waren, standen öde und verlassen, denn Tausende hatte der Krieg in ihren Domänen dahingerafft. Von dem jungen Pan Andreas Kmicic liefen wunderbare Gerüchte um. Man wußte, daß er mit seinem Banner an der Spitze einer Freiwilligenschar aus Orsza tapfer bei Szklow gefochten hatte. Seit dieser Zeit aber war er verschwunden. Zweifellos war er noch am Leben; denn der Tod eines so edlen, kühnen Ritters konnte nicht unbemerkt bleiben. Aber in solchen Zeiten allgemeiner Verwirrung und Unruhe zerstreuen sich die Menschen wie Blätter, die vom Winde gejagt werden. – Niemand wußte, was aus dem jungen Bannerherrn von Orsza geworden war.
Da der Feind noch nicht bis zur Smudier Starostei vorgedrungen war, konnte sich der Laudaer Landadel allmählich von der Szklower Vernichtungsschlacht wieder erholen. Die älteren Leute von Lauda versammelten sich unter dem Vorsitz der beiden Patriarchen des Kreises, Pan Pakosz Gasztowt und Kassian Butrym; die anderen, die sich durch das Vertrauen des verstorbenen Pan Billewicz sehr geschmeichelt fühlten, schwuren, sein Vermächtnis treu zu erfüllen, und nahmen Panna Alexandra unter ihren väterlichen Schutz. Man nannte sie in der ganzen Gegend nur »unsere Panna«. Und die jungen Mädchen des Kreises erwarteten die Wiederkunft des Pan Kmicic fast ungeduldiger als sie selbst.
Unterdessen kam die erwartete Einberufung des Landsturmes. Der ganze Laudagau kam in Bewegung. Knaben, die kaum das Jünglingsalter erreicht hatten, und Männer, die das Alter noch nicht ganz zur Erde gebeugt hatte, sie alle zogen ins Feld. Man versammelte sich in Grodno, wohin Jan-Kasimir auch gekommen war. Die ersten vom Laudaer Adel, die kamen, waren die schweigsamen Butryms, nach ihnen alle die anderen und zuletzt die Gasztowts. Ihnen, so sagte man, wurde es schwer, sich von den durch ihre Schönheit weit bekannten Pacunellinen zu trennen.
Aus den anderen Gebieten des Landes erschien die Schlachta nur spärlich, und so blieb das Vaterland ohne den rechten Schutz; aus dem frommen Laudagebiet allein war Mann für Mann in den Kampf gezogen. Nur Pan Wolodyjowski blieb daheim; er lag krank auf dem Gute Pan Gasztowts.
Nun war es öde und leer im Laudagau. Still war es in Poniewiez und Upita. Nur Frauen und Greise versammelten sich an den Herden und warteten sehnsüchtig auf Nachrichten.
Panna Alexandra schloß sich in Wodokty ein, und nur ihre Dienerschaft und ihre Laudaer Vormünder bekamen sie zu sehen.
1. Kapitel.
Man war im Januar des Jahres 1655. Es war ein trockener, strenger Winter. Das heilige Smudien war in einen weißen, ellendicken Pelz eingehüllt. Die Wälder bogen sich und brachen fast unter der Last des Schnees, der an sonnenhellen Tagen die Augen blendete und des Nachts in Millionen verschiedener Farben glitzerte. Die wilden Tiere kamen bis dicht an die menschlichen Wohnungen, und die grauen Vögel klopften mit ihren Schnäbeln an die von Eisblumen bedeckten Fensterscheiben.
Eines Abends saß Panna Alexandra mit ihren Dienstmägden in der Gesindestube. Bei denen von Billewicz’ war es von alters her Sitte, wenn keine Gäste da waren, die Abende mit dem Gesinde gemeinsam zu verbringen. So tat auch Panna Alexandra; denn viele ihrer Mägde waren adlige arme Waisen, andere Bauernmädchen, die sich jedoch nur durch die Sprache von den ersteren unterschieden. Viele von ihnen sprachen überhaupt nicht polnisch.
Panna Alexandra saß mit ihrer Verwandtin, Panna Kulwiec, in der Mitte des Zimmers; ringsherum an den Wänden auf Bänken die Mägde. Alle spannen. Große Kiefernscheite brannten im Kamin, deren Schein die dunklen Wände des sehr großen Raumes und die niedere Balkendecke beleuchteten. Überall hingen von den Balken Strähnen gekämmten Flachses herab. An den Wänden glitzerten gleich Sternen bleierne Gefäße in allen Größen, die auf schweren, eichenen Brettern standen.
Panna Alexandra ließ schweigend den Rosenkranz durch ihre Hände gleiten, und die Spinnerinnen spannen, ohne ein Wort zu wechseln. – An der Tür saß ein zottiger Smudier und drehte mit vielem Geräusch eine Handmühle. Ab und zu, wenn die Mühle nicht in Ordnung war, hörte er laut schimpfend auf. Dann erhob Panna Alexandra, wie aus einem Traume kommend, den Kopf.
Sie war ein hübsches Mädchen, mit edlen Gesichtszügen, mit dichtem, flachsblondem Haar und blauen Augen, die ernst unter den schwarzen Brauen hervorsahen. Das schwarze Trauerkleid gab ihr ein etwas düsteres Aussehen. Sie war ganz in Gedanken versunken und sann über ihre eigene, so unklare Zukunft.
Das Testament des Großvaters bestimmte ihr, der Zwanzigjährigen, einen Menschen zum Manne, den sie seit mehr als zehn Jahren nicht gesehen hatte. Aus ihren Kindheitstagen hatte sie nur eine sehr unklare Erinnerung von einem halbwüchsigen Hitzkopf, der während des Aufenthalts mit seinem Vater in Wodokty sich mehr mit der Büchse in den Sümpfen herumtrieb, als im Hause war.
»Wo kann er jetzt sein? und wie mag er aussehen?« dachte sie unaufhörlich.
Aus den Erzählungen des Großvaters wußte sie, daß er ein sehr tapferer Ritter war, von sehr heißem Geblüt. Wäre nicht der Krieg gewesen, so hätte er sich schon längst der Braut vorgestellt. Vielleicht sehnte sie sich nach dem unbekannten Bräutigam. In ihrem reinen, von keiner Leidenschaft berührten Herzen wohnte ein tiefes Bedürfnis nach Liebe. Ein Funken würde genügen, um auf diesem Herde ein Feuer zu entflammen, – ein ruhiges, gleichmäßiges, unauslöschliches Feuer.
Oft ergriff sie eine Unruhe, die ihre Seele bald mit süßen Träumereien erfüllte, bald mit schweren Fragen peinigte, auf die sie keine bestimmte Antwort fand. – Wird er mich aus freiem Willen ehelichen? Wird er meine Zuneigung erwiedern? Wird er mich liebgewinnen? – Und eine Gedankenfülle bestürmte sie, wie ein Zug Vögel, der sich auf einen einsam in öder Steppe stehenden Baum niederläßt. – Wer bist du? Wie bist du? Lebst du noch irgendwo in der weiten Welt, oder bist du auf dem Schlachtfelde gefallen? Bist du fern oder nahe? – Das offene Herz der Panna, einem Tore gleich, das zum Einzug lieber Gäste weit offen gehalten wird, rief unwillkürlich den fernen Ländern, den schneebedeckten Wäldern und Feldern zu: »Komm, Ritter! komm! Gibt es etwas Schwereres in der ganzen Welt als die Erwartung!«
Und plötzlich, gleichsam als Antwort auf ihren Ruf, vernahm man von draußen, aus der schneebedeckten Ferne, Schellengeläut.
Panna Alexandra fuhr zusammen, gleich aber faßte sie sich. Sie erinnerte sich, daß man fast allabendlich aus Pacunele einen Boten nach Heilmitteln für den jungen Oberst schickte. Auch Panna Kulwiec dachte daran, denn sie sagte:
»‘s wird wohl ein Bote von Gasztowts sein.«
Das ungestüme Klingeln eines Glöckchens näherte sich mehr und mehr, bis es schließlich mit einem Male verstummte. Ein Schlitten hielt vor dem Hause.
»Sieh nach, wer gekommen,« sagte Panna Kulwiec zu dem Smudier.
Dieser ging hinaus, kam aber gleich zurück, und indem er seine Arbeit wieder aufnahm, sagte er phlegmatisch:
»Kmicic.«
Die Spinnerinnen sprangen von ihren Plätzen auf, die Spindeln fielen zur Erde.
Panna Alexandra stand auch auf; ihr Herz schlug heftig. Zuerst bedeckte eine helle Röte ihr Gesicht, dann erblich sie. Sie wandte sich absichtlich vom Kamin fort, um ihre Verlegenheit zu verbergen.
In der Tür erschien eine hohe, mit einem Pelz und einer Pelzmütze bekleidete Gestalt. Der junge Mann trat in die Mitte der Stube, und da er bemerkte, daß er sich im Gesindezimmer befand, fragte er, ohne die Mütze abzunehmen, mit helltönender Stimme:
»He! Wo ist denn eure Panna?«
»Hier!« antwortete in ziemlich festem Tone Panna Alexandra.
Der Angekommene nahm die Mütze ab, warf sie zur Erde und verbeugte sich tief.
»Ich bin Andreas Kmicic.«
Panna Alexandra streifte mit einem Blick das Gesicht des Gastes, dann schlug sie die Augen nieder. Sie hatte genügend Zeit gehabt, um das goldblonde Haar, die brünette Gesichtsfarbe, die glänzenden, grauen Augen, den schwarzen Schnurrbart und das junge, adlergleiche, muntere, ritterliche Gesicht Pan Andreas’ zu sehen. –
Er stand mit in die Seite gestützter Hand, drehte mit der rechten seinen Schnurrbart und sprach:
»Ich war noch nicht in Lubicz; schnell wie ein Vogel eilte ich hierher, um der Panna meine Ehrfurcht zu erzeigen. Ein Wind brachte mich geradeswegs vom Lager nach hier – ich hoffe, ein glücklicher.«
»Wußten Sie von dem Tode des Kammerherrn, – des Großvaters?« fragte die Panna.
»Ich wußte es nicht: aber als ich es erfuhr, habe ich ihn mit bitteren Tränen beweint. Er war meinem verstorbenen Vater ein Freund, ein Bruder. Sie wissen wohl, daß er vor vier Jahren bei uns in Orsza war. Damals versprach er mir Ihre Hand; er zeigte mir Ihr Bild, zu dem ich nachts betete. Ich wäre gern früher gekommen; aber der Krieg führt einen nur mit dem Tode zusammen.«
Alexandra errötete leicht ob dieser kühnen Rede, und um das Gespräch auf ein anderes Gebiet zu lenken, fragte sie:
»In Lubicz sind Sie also noch nicht gewesen?«
»Dazu wird es noch immer Zeit sein. Hier liegt meine heiligste Pflicht, hier ist das wertvollste Geschenk Ihres seligen Großvaters, zu dem es mich zu allererst zog. Aber Sie wenden sich so, daß ich Ihnen nicht in die Augen sehen kann. Drehen Sie sich doch um, – so kann ich Sie sehen! So!«
Der kühne Soldat faßte unerwartet Panna Alexandra am Arm und drehte sie zum Feuer. Sie wurde noch verlegener, senkte die Lider und stand ganz bestürzt vor ihm. Endlich gab Kmicic sie frei und klatschte laut in die Hände. »Bei Gott, eine seltene Schönheit. Tausend Messen stifte ich für die Seele meines Wohltäters! – Und wann soll die Hochzeit sein?«
»Gemach! Nicht so bald, noch bin ich nicht die Ihre.«
»Aber Sie werden die meine! Und wenn ich Ihr Haus in Brand setzen müßte! Bei Gott! Sie werden mein! Und ich, Tor, glaubte, Ihr Bild sei geschmeichelt. Jetzt sehe ich, der Maler war ein Stümper, nicht ein Hundertstel Ihrer Schönheit hat er wiedergegeben. Stockschläge verdiente er! Zäune kann er wohl anstreichen, aber er soll seine Kunst nicht an einer blendenden Schönheit versuchen! – Wahrhaftig, ein großartiges Vermächtnis!«
»Der Großvater hatte recht, als er mir sagte, Sie seien ein Hitzkopf.«
»Wir, im Smolenskaer Bezirk, wir sind alle so, nicht wie Ihr in Smudien. – Bei uns heißt’s: Eins, zwei, drei! Und alles muß gehen, wie wir es wollen, sonst Tod und Teufel!«
Alexandra lächelte und sah schon etwas beherzter auf ihren Gast.
»So wohnen denn Tataren bei euch?«
»Gleichviel! Sie sind doch mein, dem Willen der Eltern und meinem Herzen nach.«
»Dem Herzen nach? Das weiß ich noch nicht.«
»Nein? Sagen Sie Nein? Dieses Messer stoße ich mir ins Herz.«
»Aber wir sind ja noch immer im Leutezimmer. – Bitte, folgen Sie mir in die anderen Gemächer. Nach dem langen Weg tut Ihnen Ruhe gut.« Und dann wandte sich Alexandra zur Panna Kulwiec:
»Und Sie, Tante, kommen wohl mit uns!«
»Tante?« fragte schnell der junge Ritter. »Was für eine Tante?«
»Hier, meine Tante, Panna Kulwiec.«
»Dann auch die meine,« antwortete Pan Andreas und küßte Panna Kulwiec die Hand. »Bei uns im Banner gibt es einen Offizier mit Namen Kulwiec. Wohl ein Verwandter von Ihnen, Panna?«
»Ja,« sagte die alte Panna und knixte.
Die Hausfrau und der Gast gingen in die Diele, wo Pan Andreas seinen Pelz ablegte, und von dort aus in die Empfangszimmer. Panna Kulwiec eilte, ein Nachtmahl herzurichten, und so blieben Alexandra und Pan Kmicic allein.
Pan Kmicic blickte unverwandt auf Alexandra, und in seinen Augen entbrannte ein tiefes Feuer.
»Es gibt Menschen,« brach er endlich das Schweigen, »die Reichtum über alles in der Welt schätzen, – andere lieben die Kriegsbeute, wieder andere lassen ihr Liebstes für Pferde, – ich aber würde Sie um nichts in der Welt hergeben! Das schwöre ich bei Gott! Je länger ich Sie ansehe, je eher möchte ich Sie zum Altare führen, – am liebsten morgen schon! – Diese Brauen! – Diese Augen! Wie des Himmels Bläue am Sommertage! Ihr Anblick verwirrt mich so, daß ich kaum Worte finde –«
»Mir scheinen Sie gar nicht sehr verwirrt zu sein. Sie sprechen mit mir, daß ich gar nicht weiß –«
»Das ist unsere Smolenskaer Art. – Auf ein Weib und auf den Feind kühn drauf los! – Daran, o Königin, werden Sie sich noch gewöhnen; denn so wird es immer sein!«
»Das, Ritter, werden Sie sich noch abgewöhnen; denn so darf es nicht sein.«
»Mag man mich hängen! Ihnen werde ich mich vielleicht auch unterwerfen. Glauben Sie es oder nicht, aber ich bin bereit, für Sie den Mond vom Himmel herunterzuholen. Für Sie, meine Gebieterin, bin ich bereit, fremde Sitten zu lernen. – Ich weiß, ich bin nur ein rauher Kriegsmann und habe mich mehr im Lager als in Empfangsräumen bewegt.«
»Das tut nichts! Auch mein Großvater war Soldat. – Ich aber danke Ihnen für Ihren guten Willen,« sagte Alexandra und sah Pan Andreas so freundlich an, daß sein Herz erzitterte. »Sie werden mich immer regieren können!« rief er aus.
»O, Sie sehen nicht aus wie einer, der sich beherrschen läßt! Unstete Leute sind am schwersten zu regieren.«
Kmicic lächelte und zeigte eine Reihe weißer, scharfer Zähne.
»Wie! Sollten die heiligen Meister in der Schule noch zu wenig Ruten an mir zerbrochen haben, damit ich lerne, mich gesittet zu benehmen, und die wichtigsten Lebensregeln behalte, – und ich –«
»Nun, welche Regel haben Sie denn am besten behalten?«
»Wenn du liebst, so sollst du zu Füßen fallen, – so –«
Im gleichen Augenblick lag Pan Andreas auf den Knien, und das Mädchen schrie auf und verbarg eiligst ihre Füße unter dem Tisch.
»Um Gottes willen! So etwas lehrt man doch nicht in der Schule! Stehen Sie sofort auf, oder ich werde ärgerlich! Und die Tante kommt gleich!«
Er hob den Kopf und sah ihr fest in die Augen.
»Mag ein ganzes Regiment von Tanten kommen; – sie können mir nicht verbieten, Sie zu lieben.«
»So stehen Sie doch auf!«
»Ich stehe schon auf.«
»Setzen Sie sich!«
»Ich sitze.«
»Sie sind ein Treuloser, ein Verräter!«
»Das ist nicht wahr! – Verräter küssen nicht so aufrichtig! Wollen Sie sich überzeugen!«
»Unterstehen Sie sich nicht!«
Panna Alexandra lachte, und auf seinem Gesicht erstrahlten Jugend und Frohsinn. Seine Nasenflügel bebten leise wie bei einem edlen Araberhengst.
»Oh, oh!« rief er, »diese Augen! Dieses Gesichtchen! Steht mir bei, alle Heiligen, ich kann nicht sitzen bleiben!«
»Man darf die Heiligen nicht anrufen! Vier Jahre haben Sie ruhig sitzen können, ohne mit einem Auge hierher zu blicken. So bleiben Sie nur ruhig jetzt weiter sitzen.«
»Ich habe doch nur Ihr Bild gekannt! Ich werde diesen Taugenichts von Maler mit Teer begießen und dann mit Federn beschütten und auf dem Markt zu Upita herumführen lassen. – Ich werde ganz aufrichtig zu Ihnen sein: Wollen Sie mir vergeben? Vergeben Sie? – Nein? – So reißen Sie mir den Kopf herunter. – Als ich Ihr Bild sah, dachte ich, häßlich ist sie nicht; aber solche laufen eine Menge in der Welt umher, – es hat also keine Eile. Mein seliger Vater drängte, ich solle herreisen. Ich aber blieb dabei, es hat Zeit. Die Pannas gehen nicht in den Krieg und kommen um. Gott ist mein Zeuge. Ich widersetzte mich nicht ganz dem väterlichen Willen, aber ich wollte erst an der eigenen Haut den Krieg spüren. Jetzt erst sehe ich, wie dumm ich war! Konnte ich nicht auch verheiratet in den Krieg ziehen! Und welch ein Glück hier meiner harrte! – Gott sei Dank, daß man mich nicht hingeschlachtet hat! Gestatten Sie, Panna, daß ich Ihnen die Hand küsse.«
»Ich werde es lieber nicht gestatten.«
»So werde ich erst gar nicht fragen. Bei uns in Orsza sagt man: Bitte, und gibt man nicht, so nimmt man von selbst.«
Pan Andreas drückte auf Alexandras Hand einen langen Kuß, und die Panna, um nicht unliebenswürdig zu scheinen, sträubte sich nicht.
In der Tür erschien Panna Kulwiec, und als sie sah, was vorging, schlug sie die Augen gen Himmel. Diese Vertrautheit gefiel ihr nicht, aber sie fürchtete, ihre Unzufriedenheit zu zeigen. Sie bat die beiden zum Abendessen zu kommen.
Im Speisezimmer brach der Tisch fast unter der Last der verschiedenen Gerichte und der mit Schimmel bedeckten Flaschen. Die jungen Leute waren in guter Stimmung, froh und glücklich. Die Panna hatte schon vorher zu Abend gegessen. Pan Kmicic aber aß jetzt mit demselben Eifer, mit dem er zuvor von seiner Liebe gesprochen.
Alexandra sah ihn von der Seite an; sie freute sich, daß es ihm so gut schmeckte.
»Kommen Sie jetzt aus der Gegend von Orsza?« fragte sie.
»Weiß selbst nicht woher. – Heute bin ich hier, morgen dort. Ich schlich mich so dicht an den Feind heran, wie der Wolf an die Schafherde. Und was ich ihr entreißen konnte, das habe ich ihr entrissen.«
»Und Sie haben es gewagt, mit einer Macht zu kämpfen, der selbst der Groß-Hetman weichen mußte?«
»Natürlich habe ich das gewagt. Ich gehe auf alles drauf los. Das ist so meine Natur.«
»Dasselbe erzählte mir auch der selige Großvater…. Es ist nur ein Glück, daß Sie dabei nicht umkamen.«
»Ha, mit Mütze und Helm hat man mich zugedeckt, wie den Vogel im Netz. Heidi! weg war ich. – Ich habe ihnen so mitgespielt, daß sie auf meinen Kopf einen Preis setzten! – Was für einen großartigen Met Sie hier haben!«
»Im Namen des Vaters und des Sohnes!« rief Alexandra mit Schrecken aus und sah voll Bewunderung den Jüngling an, der in einem Atem von dem Preise auf seinen Kopf und dem Met redete. »Sie hatten wohl tüchtige Kräfte zur Seite?« fuhr sie fort.
»Natürlich, ich hatte tüchtige Dragoner; aber im Laufe eines Monats hat man sie mir alle getötet. Dann fing ich mit Freiwilligen an, die ich, ohne wählerisch zu sein, an allen Orten sammelte. Gute Jungens für den Krieg, aber Erzhalunken. Diejenigen, die mit heiler Haut aus dem Krieg kommen, werden alle früher oder später ein Leckerbissen für die Krähen.« Pan Andreas lachte laut und leerte seinen Becher. »Solche Galgenstricke haben Sie noch nie zu Gesicht bekommen. Die Offiziere sind alles Adlige aus guter Familie; was tut’s, daß ein jeder von ihnen mit dem Strafrichter in Konflikt lebt. Jetzt habe ich sie in Lubicz gelassen. Meine Soldaten aber habe ich in Poniewiez und in Upita einquartiert.«
»Und wo trafen unsere Laudaer Leute Sie?«
»Ich wäre auch ohne diese hierher gekommen; denn ich war schon auf dem Wege nach Poniewiez.«
»Haben sie Ihnen von des Großvaters Tode und seinem Testament gesprochen?«
»Sei Gott ihm gnädig, meinem Wohltäter. Haben Sie mir die Boten geschickt?«
»Ganz und gar nicht. Ich lebte nur meinem Schmerze.«
»So erzählten sie mir. – Was für ein stolzes Völkchen diese Laudaer Bauern sind! Ich wollte ihnen ihre Bemühungen belohnen, da fuhren sie hoch und meinten: der Adel vom Orszagau nähme vielleicht Almosen, Laudaer Edle aber nicht! – Ich aber dachte bei mir, wollt ihr kein Geld, so werde ich euch hundert Stockschläge verabreichen lassen.«
Panna Alexandra schlug die Hände über den Kopf: »Jesus, Maria! Und haben Sie das getan?«
Kmicic sah sie verwundert an. »Beruhigen Sie sich, ich habe es nicht getan, obgleich mir die Galle überläuft beim Anblick solcher Edelleute, die sich dünken, uns gleich zu sein. Ich fürchtete aber, sie würden mich bei Ihnen verklatschen und anschwärzen.«
»Das ist ein großes Glück,« sagte Alexandra, tief Atem holend. »Sonst hätte ich Sie nie sehen mögen.«
»Und warum das?«
»Unser Adel ist nur klein, aber alt und berühmt. Mein Großvater liebte ihn und führte ihn in den Krieg sein Leben lang. In Friedenszeiten verkehrte er in seinem Hause. Auch Sie müssen diese alten Bande heilig halten. Sie werden nicht das Herz haben, die Eintracht, in der wir bisher lebten, zu zerstören!«
»Und ich Ahnungsloser, davon habe ich nichts gewußt. Ich muß Ihnen gestehen, dieser barfüßige Adel will mir nicht recht in den Sinn. – Bei uns ist Bauer eben Bauer. Die Adligen sind aus angesehener Familie, die nicht zu zweien das Roß besteigen. Bei Gott! Solche Habenichtse sollten sich nicht mit denen von Kmicic’ und Billewicz’ vergleichen, ebensowenig wie der Gründling mit dem Hecht, obwohl beide Fische sind.«
»Großvater sagte: »Reichtum bedeutet nichts im Vergleich zur Ehrlichkeit.« Und es sind alles würdige Leute. Großvater hätte sie sonst nicht zu meinen Vormündern bestellt.«
Pan Andreas riß vor Erstaunen die Augen weit auf.
»Die – hat der Großvater zu Ihren Vormündern ernannt!? – Die ganze Laudaer Schlachta?«
»Ja, und Sie haben durchaus keine Ursache, verdrießlich zu sein; des Verstorbenen Wille ist Gesetz. – Ich wundere mich nur, daß Ihnen die Boten dies nicht gesagt haben.«
»Ich würde sie! – Aber nein, es kann ja nicht sein; es gibt doch hier viele Adlige, und sie alle sollten Ihre Berater sein! Vielleicht der ganze Landtag auch! Und sie werden über mich zu Gericht sitzen, ob ich ihnen recht bin oder nicht. Ei, scherzen Sie nicht, Panna! Das Blut siedet in mir!«
»Pan Andreas, ich scherze nicht. Was ich sage, ist heilige, aufrichtige Wahrheit! Sie werden Ihretwegen nicht den Landtag einberufen, und wenn Sie sie nicht durch Ihren Stolz verletzen, so werden Sie zugleich ihnen und mir einen Gefallen tun. Sie und ich, wir werden Ihnen unser Leben lang dankbar sein.«
Ihre Stimme zitterte, ihre Brauen waren hochgezogen.
Er brach nicht in Zorn aus, obwohl es auf seinem Gesicht verräterisch zuckte. Schließlich sagte er hochmütigen Tones:
»Das habe ich nicht erwartet. Ich achte den Willen des Seligen, aber ich meine, der Herr Kammerherr hat diesen verbauerten Adel nur bis zu meiner Ankunft zu Ihren Vormündern bestimmt. Sobald mein Fuß aber diese Schwelle betreten hat, wird niemand außer mir Ihr Vormund sein. – Nicht nur diese Habenichtse, selbst die Fürsten Radziwill haben hier nichts zu suchen.«
Panna Alexandra wurde ernst; nach kurzem Schweigen sagte sie:
»Es ist nicht schön, daß Sie so hochmütig sind. – Ich sehe hier nur einen Weg: entweder Sie erkennen Großvaters Vermächtnis bedingungslos an, oder sie verwerfen es ganz, einen anderen Weg gibt es nicht! Die Laudaer werden sich Ihnen nicht aufdrängen. Es sind gute, ruhige Leute, die Ihnen nicht zur Last fallen werden. Ich denke, diese Vormundschaft wird uns nie bedrücken.«
Er schwieg einen Augenblick.
»Es ist wahr, die Hochzeit wird ja alledem ein Ende machen. Hier gibt’s nichts zu streiten. Sie sollen mir nur nicht in die Quere kommen; denn ich schwöre, ich werde mir nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Gestatten Sie mir nur, die Hochzeit zu bestimmen, das wird das beste sein.«
»Während der Trauerzeit paßt es sich nicht, darüber zu sprechen.«
»Und werde ich noch lange warten müssen?«
»Großvater bestimmte selbst nicht mehr als ein halbes Jahr.«
»Bis dahin werde ich wie ein Holzspan verdorren. Nehmen Sie es mir nur nicht übel, Panna. Sie sehen mich so streng an wie der Richter den Angeklagten. Meine Königin, was kann ich dafür, daß meine Natur so ist! Bin ich auf jemand böse, so möchte ich ihn in Stücke zerreißen, nachher freilich möchte ich ihn auch wieder zusammenflicken.«
»Es muß schrecklich sein, mit so einem Menschen Seite an Seite zu leben,« sagte Alexandra heiter.
»Auf Ihre Gesundheit, Panna! Guter Wein und ein Degen sind doch das schönste auf der Welt! Warum sollte es schrecklich sein, mit mir zu leben? Ihre schönen Augen werden mich zu Ihrem Sklaven machen, mich, der sich nie einer fremden Macht gebeugt hat. Reichen Sie mir Ihre Hand, holde Schönheit; ich schwöre, Sie sind mir stark ans Herz gewachsen. – Wer weiß, ob ich den Weg nach Lubicz finden werde?«
»So werde ich Ihnen einen Führer mitgeben.«
»O, ich werde auch so hinkommen. Ich bin gewöhnt, nachts umherzuirren. Auch habe ich einen kleinen Jungen aus Poniewiez mit, der muß den Weg kennen. Und dann erwartet mich Pan Kokosinski mit der ganzen Gesellschaft. – Eine feine Familie – die Kokosinskis, – Er ist seiner Ehren verlustig gesprochen, weil er das Haus von Pan Orniszewski ansteckte, seine Tochter entführte und die Dienerschaft tötete. – Ein feiner Kamerad! Panna, geben Sie mir nochmals Ihr Händchen! – Ach, es ist Zeit, daß ich mich auf den Weg mache.«
Die große Danziger Uhr im Eßzimmer schlug Mitternacht.
»Mein Gott, es ist Zeit, höchste Zeit!« schrie Kmicic auf. »Eins nur bitte ich Sie, Panna, lieben Sie mich ein wenig.«
»Später, – später, – Sie werden mich doch besuchen?«
»Täglich! Selbst wenn die Erde mich zu verschlingen drohte.«
Kmicic stand auf und ging in Begleitung der Hausfrau in die Diele. Sein Schlitten stand schon vor der Auffahrt.
»Gute Nacht, meine Königin,« sagte der Ritter, »schlafen Sie gut. Ich für mein Teil werde kein Auge zutun, immer werde ich an Sie denken.«
»Ich werde Ihnen doch lieber einen Diener mit einer Laterne mitgeben; denn bei Wolmontowicze gibt es viele Wölfe!«
»Bin ich ein Schaf, daß ich mich vor Wölfen fürchte! Der Wolf ist der Freund der Soldaten, oft genug kriegt er von ihm Almosen. Auch habe ich meine Waffe bei mir. – Gute Nacht, meine Teure, gute Nacht!«
»Mit Gott!«
Alexandra ging in das Wohnzimmer zurück, und Pan Andreas trat auf die Veranda. Beim Gehen warf er noch einen Blick auf die halbgeöffnete Tür der Gesindestube. Die Mädchen waren noch auf, um den angekommenen Gast noch einmal zu sehen. Pan Andreas warf ihnen eine Kußhand zu und sprang fröhlich auf den Schlitten. Bald hörte man das Geklingel der Schellen; zuerst laut, dann immer leiser, und zuletzt verlor es sich ganz in der Ferne.
Es wurde still in Wodokty, so still, daß Panna Alexandra sich darüber wunderte. Vor ihren Augen stand noch die stattliche Figur des jungen Mannes, in ihren Ohren klangen noch seine Worte, sie hörte sein aufrichtiges, fröhliches Lachen, – und jetzt, nach diesem Gewirr von Lustigkeit und Lachen, umgab sie eine so seltsame Ruhe. – Alexandra strengte sich an, ob sie nicht noch einen Ton der Glöcklein hören könnte, aber nein, sie klingelten jetzt schon in den Wäldern von Wolmontowicze. Und eine quälende Sehnsucht erfaßte das Mädchen; – noch nie im Leben hatte sie sich so einsam gefühlt.
Sie nahm eine Kerze und ging langsam in ihr Schlafzimmer; hier begann sie zu beten. Fünfmal mußte sie von vorn anfangen, ehe sie das Gebet einmal richtig beendete. – Wie auf Flügeln eilten ihre Gedanken hinter dem Schlitten und der darin sitzenden Gestalt her … Wald auf der einen Seite, – Wald auf der anderen Seite, in der Mitte ein breiter Weg, auf dem er dahinsaust! Zum Greifen deutlich sah Panna Alexandra seinen blonden Schopf, die grauen Augen, die lachenden Lippen und die weißen, scharfen Zähne vor sich. Vergeblich versuchte sie sich selbst zu verheimlichen, wie sehr ihr dieser waghalsige Ritter gefallen habe. Ein wenig hatte er sie beunruhigt, ein wenig erschreckt, aber seine Kühnheit, Fröhlichkeit und Aufrichtigkeit hatten sie doch ganz besiegt. Errötend gestand sie sich, daß selbst sein Hochmut ihr gefiel, wie er mit stolz zurückgeworfenem Kopfe sagte: »Selbst die Fürsten Radziwills haben hier nichts zu suchen.« – Das ist kein schwacher, verweichlichter Mensch. Ein echter Mann und ein Soldat, so recht wie ihn der Großvater liebte, – – – der ist’s wohl wert,« so dachte die Panna. Und bald ergriff sie ein ungetrübtes Glücksgefühl, bald eine Unruhe, aber selbst diese war wohltuend.
Sie begann sich auszuziehen, als die Tür knarrte, und Panna Kulwiec mit einer Kerze in der Hand hereintrat.
»Ihr seid lange beisammen gewesen,« sagte sie. »Ich wollte euch nicht stören, daß ihr euch nach Herzenslust aussprechen konntet. Es scheint ein guter Mensch zu sein. Und was meinst du, Alexandra?«
Panna Alexandra antwortete nicht gleich. Sie lief nur auf die Tante zu, umarmte sie und verbarg ihr Goldköpfchen an ihrer Brust. Dann seufzte sie leise: »Ach, Tantchen, Tantchen!«
»Oho!« murmelte die alte Panna mit gen Himmel geschlagenen Augen.
2. Kapitel.
Im Herrenhause zu Lubicz, wohin Pan Andreas fuhr, waren alle Zimmer hell erleuchtet, und wüster Lärm ertönte bis auf den Hof hinaus. Beim ersten Klang der Schellen stürzte die ganze Dienerschaft heraus, um ihren neuen Gebieter, Pan Andreas, zu empfangen. Der alte Verwalter stand mit Salz und Brot und machte eifrig tiefe Bücklinge. Kmicic nahm seine Börse und warf sie auf die Schüssel. Erstaunt, daß von seinen Kameraden keiner herausgekommen war, fragte er nach ihnen.
Die aber konnten nicht zu seiner Begrüßung kommen. Seit drei Stunden saßen sie schon am Tische, der mit Bechern und Krügen reich besetzt war. Wahrscheinlich hatten sie bei ihrem Gelage nicht einmal die Ankunft des Schlittens gehört.
Sobald Kmicic das Zimmer betrat, sprangen alle von ihren Plätzen auf und umringten ihn. Er lachte hell auf, als er sah, wie sie es in seiner Abwesenheit in seinem Hause getrieben hatten. Da kam zuerst der Riese, Pan Jaromir Kokosinski, der durch seine Rauf-und Zanksucht bekannt war. Eine fürchterliche Narbe zog sich über sein ganzes Gesicht hin. Es war Kmicic’ »guter Kamerad«. Ihm folgte Pan Ranicki, der des Mordes zweier kleiner Adliger wegen ausgewiesen war. Der dritte, Pan Rekuc, hatte sein Vermögen durchgebracht, teils verspielt, teils versoffen. Er aß seit drei Jahren bei Pan Kmicic das Gnadenbrot. Der vierte, Pan Uglik, war wegen Beleidigung des Gerichtshofes zum Tode verurteilt. Seines Klarinettenspieles wegen genoß er Kmicic’ Schutz. Außerdem waren noch da: Pan Kulwiec und Zend, der Zureiter, ein Mann von zweifelhafter Abkunft, der eine große Fertigkeit besaß, Tierstimmen nachzuahmen, und andere Ritter mehr.
Sie alle umringten den lachenden Pan Andreas.
Kmicic nahm einen Becher zur Hand und rief:
»Die Gesundheit meiner Braut!«
»Vivat! Vivat!« schrien alle so, daß die Fensterscheiben erzitterten.
Dann ergossen sich über Pan Andreas eine Menge Fragen.
»Wie sieht sie aus, Andreas? – Ist sie hübsch? – Ist sie so, wie du sie dir vorgestellt hast? – Gibt es mehr solche in Orsza?«
»In Orsza!« schrie Kmicic, »ei, zum Teufel! In der weiten Welt gibt es keine zweite so.«
»Und wann soll die Hochzeit sein?« fragte Pan Ranicki.
»Sobald die Trauerzeit zu Ende ist.«
»Unsinn! Trauerzeit. – Zur Hochzeit legt man doch die Trauer ab, und die Kinder kommen auch nicht schwarz, sondern weiß zur Welt. Drum immer zu, Andreas!«
»Meine lieben Lämmer,« unterbrach ihn Kmicic, »wartet ‘mal ein bißchen, oder, besser gesagt, schert euch alle zum Teufel, ich will mich ‘mal jetzt in meinem Hause umsehen.«
»Um keinen Preis!« widersetzte sich Uglik. »Morgen ist auch noch ein Tag, – jetzt geht’s zu Tisch.«
»Die Besichtigung haben wir schon besorgt. Eine Goldgrube ist dies Lubicz,« sagte Ranicki.
»Und was für einen Pferdestall es hat!« fügte Zend hinzu.
»Also alles in Ordnung,« sagte erfreut Kmicic, »nun denn, zu Tisch.«
Kaum waren die Becher gefüllt, als sich Pan Ranicki erhob:
»Auf die Gesundheit des Kammerherrn Billewicz!«
»Dummkopf!« sagte Kmicic, »die Gesundheit eines Toten!«
»Nun denn Eure Gesundheit!«
»Daß ihr in diesen Zimmern gute Tage verlebt!«
Kmicic sah sich unwillkürlich im Zimmer um. Von den vom Alter schwarz gewordenen Kieferwänden sahen Dutzende von finsteren Augen auf ihn herab. Diese Augen gehörten zu den Porträts der Billewicz’. Ringsherum über den Bildern hingen Schädel verschiedenen Wildes.
»Die Jagd muß hier sehr ergiebig sein,« bemerkte Kmicic.
»Du bist ein Glückspilz, Andreas, du hast eine Stätte, dein Haupt niederzulegen,« sagte Kokosinski.
»Nicht wie wir!« seufzte Ranicki.
»Trinken wir eins aus Gram.« sagte Rekuc.
»Laßt nur; was mir gehört, ist auch das eurige.«
Ein Toast folgte dem anderen; alle sprachen auf einmal. Kokosinski stimmte ein Lied an, Uglik zog aus seinem Busen eine Klarinette und begleitete ihn, und Pan Ranicki machte mit seinen nackten Armen Fechtbewegungen.
Der Hüne Kulwiec sah ihn mit großen Augen an.
»Du bist ein Narr! Fuchtele mit deinen Armen herum soviel du willst, Kmicic kannst du doch nicht übertreffen, und schießen tust du auch nicht so gut wie ich.«
»Einen Dukaten für den Schuß!«
»Gut, doch wo ist das Ziel?«
Ranicki sah sich mit seinen schwimmenden Augen um, endlich rief er, auf einen Schädel an der Wand zeigend:
»Hier, zwischen die Hörner! Um einen Dukaten!«
Kmicic fragte nach der Ursache des Streites.
»Einverstanden!« rief Pan Andreas. »Meinetwegen um drei Dukaten. Zend, die Pistolen!«
Es entstand ein wüster Lärm. Zend brachte bald Pistolen, einen Sack mit Kugeln und einen Berg Pulver herein. Es verging keine Viertelstunde, so fielen im Zimmer Schüsse. Der Pulverdampf zog sich in dichten Knäueln zusammen. Und um die Unordnung voll zu machen, begann Zend seine Künste zu zeigen. Er krähte wie eine Krähe, heulte wie ein Wolf und brüllte wie ein wilder Stier. Fast in jeder Minute sauste eine Kugel. Von den Wänden, den Bilderrahmen, den Schädeln flogen Stücke im Zimmer umher. Im Wirrwarr schoß man auch auf die verstorbenen Billewiecz, und Ranicki, der in Raserei verfiel, zerhackte die Bilder mit seinem Säbel.
Die erschrockene Dienerschaft lief zusammen und blieb versteinert stehen beim Anblick dieses Zeitvertreibs, der mehr einem Überfall der Tataren ähnelte. Die Hunde wurden unruhig und bellten und heulten. Alles im Hause kam auf die Beine. Auf dem Hofe standen die Leute in Gruppen. Die Mägde drückten ihre Gesichter an die Fensterscheiben.
Zend bemerkte das.
»Herrschaften, hinter den Fenstern stehen Mädchen!«
»Mädchen! Mädchen!«
»Tanzen! Tanzen wollen wir!«
Die betrunkene Menge stürzte auf den Hof hinaus. Selbst der Frost kühlte um nichts ihre erhitzten Gemüter. Die Mädchen schrien verzweifelt und stoben auseinander, die Offiziere hinter ihnen her. – Bald begann inmitten des Pulverdampfes, der Knochensplitter, der Holzstühle ein wüstes Tanzen um den Tisch herum, der mit Wein begossen war. – – – So zechten Pan Kmicic und seine Gäste in Lubicz.
3. Kapitel.
Pan Andreas kam täglich nach Wodokty. Jedesmal kehrte er um einen Grad verliebter nach Lubicz zurück. Jeden Tag erschien ihm seine Alexandra bewunderungswürdiger.
»Hört mal, meine lieben Lämmer, heute will ich euch meiner Braut vorstellen, und dann wollen wir, wie ich mit der Panna verabredet habe, alle zusammen nach Mitruni, um unser drittes Gut zu besichtigen. Gebt aber acht, daß ihr euch anständig benehmt, jeden, der sie verletzt, haue ich in tausend Stücke.«
Die Ritter gingen bereitwillig, sich sorgfältig anzukleiden, und bald brachten vier Schlitten die ungestümen jungen Leute nach Wodokty.
Beim Erscheinen der Gäste blieb Panna Alexandra, verwundert über die vielzählige Gesellschaft, an der Schwelle stehen. Pan Kmicic, der sie bisher nur abends gesehen hatte, war starr und betroffen von ihrer Schönheit. Sie stand unbefangen, ohne die Augen zu senken, da, wie eine Herrin, die bei sich im Hause empfängt. Das schwarze Gewand, das mit Hermelin besetzt war, stand besonders gut zu ihrem klaren Teint und dem goldblonden Haar. Eine so schöne Panna hatten die Soldaten noch nie zu Gesicht bekommen, sie waren an Frauen anderen Schlages gewöhnt. Vor Verlegenheit scharrten sie mit den Füßen und verbeugten sich. Pan Kmicic trat hervor und küßte Alexandra die Hand.
»Meine Teure,« sagte er, »ich habe dir meine Kameraden mitgebracht, mit denen ich im letzten Kriege zusammen kämpfte.«
»Eine große Ehre für mich,« erwiderte Panna Alexandra, »in meinem Hause so ehrwürdige Ritter zu empfangen, von denen mir Pan Andreas schon soviel erzählt hat.«
Sie verneigte sich mit der größten Würde, und Pan Kmicic biß sich auf die Lippen und wurde rot: so keck sprach seine Braut.
Die ehrwürdigen Ritter scharrten noch immer mit den Füßen.
Schließlich machte Pan Kokosinski einen Schritt vorwärts, räusperte sich und begann:
»Erlauchtigste Panna! Ich weiß nicht, was ich am meisten preisen soll im Namen ganz Orszas: Ihre Schönheit und Tugend oder das ungewöhnliche Glück unseres Rittmeisters und Kollegen, Pan Kmicic. Denn mag er sich selbst bis zum Himmel hinaufschwingen, – selbst den Himmel erreichen, – den Himmel, – sage ich –«
»Kommt doch, bitte, endlich vom Himmel herunter,« unterbrach ihn Pan Kmicic.
Die Ritter lachten alle laut auf; dann aber erinnerten sie sich an Kmicic’ strengen Befehl und faßten schnell an die Schnurrbärte.
Pan Kokosinski wurde rettungslos verwirrt und sagte:
»So redet doch selbst, Rindviecher ihr, wenn ihr mich stört.«
»Ich werde nicht imstande sein, Ihnen recht zu antworten. Ich denke, daß ich all Ihre Begrüßungsworte nicht wert bin, die Sie mir von ganz Orsza bestellen,« sagte Panna Alexandra und verneigte sich mit seltener Würde.
»Doch wir sind hergekommen, um, wie gestern verabredet, nach Mitruni zu fahren,« sagte Kmicic. »Der Weg ist weit, und Gott hat einen starken Frost geschickt.«
»Tantchen habe ich schon vorausgesandt, daß sie uns ein gutes Mittagsmahl bereitet. Haben die Herren, bitte, ein wenig Geduld, ich bin gleich bereit.«
»Nun, ist sie nicht eine Fürstentochter?… Wie?…« fragte Kmicic gleich, nachdem das Mädchen gegangen war. »Wo habt ihr so eine gesehen? Der selige Kammerherr verbrachte den größten Teil des Jahres mit ihr beim Fürsten Wojewod oder bei Pan Hliebowicz. Dort hat sie die feinen Manieren angenommen.«
Bald trat Panna Alexandra wieder ins Zimmer. Auf ihrem Kopfe hatte sie ein Mardermützchen, das ihr vortrefflich stand.
Alle traten ins Freie.
Zuerst stand ein Schlitten, der die Gestalt eines weißen Bären hatte.
»Wir fahren wohl mit diesem Schlitten?« fragte das Mädchen, auf den weißen Bären zeigend. »Ich habe noch nie einen schöneren Schlitten gesehen!«
»Er ist eine Kriegsbeute. Wir sind Verbannte, der Krieg hat uns unsere Güter geraubt, so bleibt uns nichts übrig, als vom Kriege zu leben. Ich habe ihm treu gedient, darum hat er mich auch belohnt.«
»Den einzelnen belohnt er, und das ganze Land verwüstet er.«
Kmicic legte Panna Alexandra noch eine weiße Tuchdecke, die mit weißem Wolfspelz gefüttert war, über, setzte sich zu ihr, rief dem Kutscher »fahr« zu, und die Pferde eilten davon. – Die übrigen folgten in den drei anderen Schlitten.
Sie fuhren schweigend dahin. Man hörte nur das Knirschen des Schnees, das Schnauben der Pferde und die antreibenden Worte der Kutscher.
Plötzlich neigte sich Pan Andreas zu Alexandra.
»Ist Ihnen gut so, Panna?«
»Ja, gut,« antwortete sie und schützte ihr Gesicht mit dem Ärmel vor dem kalten Wind.
Die Schlitten rasten dahin. Es war ein klarer, frostiger Wintertag. Wie Millionen verschiedenfarbiger Funken erglänzte der Schnee. Aus den Schornsteinen der Hütten, die am Wegen lagen, stiegen rosige Rauchsäulchen empor. Und neben den Schlitten kreisten mit lautem Krächzen Scharen von Krähen. Zwei Meilen von Wodokty entfernt führte der Weg durch einen dichten, schweigsamen, unter der starken Schneedecke eingeschlafenen Wald. Die Bäume schienen an ihnen vorüberzulaufen, und schneller und schneller flogen die Schlitten dahin, gleich, als ob den Pferden Flügel gewachsen wären.
Eine solche Fahrt macht schwindelig, und auch bei Alexandra begann sich alles im Kopfe zu drehen. Sie lehnte sich in den Schlitten zurück und schloß die Augen. Eine süße Mattigkeit beschlich sie. Es schien ihr, als ob dieser Bojar sie entführe, sie aber nicht die Kraft zu schreien oder sich zu wehren habe. Und sie fliegen dahin, rascher und rascher. Alexandra fühlte, daß sie umarmt wird, sie fühlte auf ihrer Wange die Berührung von weichen, warmen Lippen; aber ihre Augen wollen sich nicht öffnen, sie liegt wie im Traume. Und sie fliegen, – fliegen.
Die Panna wurde durch eine Stimme geweckt.
»Liebst du mich?«
Sie öffnete die Augen.
»Aber alles, – wie meine Seele!«
»Und ich liebe dich mehr als Leben und Tod!«
Wieder neigte sich Kmicic’ Zobelmütze über Alexandras Mardermützchen. Sie war wie berauscht; war’s von den Küssen, war’s von dieser sinnbetörenden Fahrt? Alexandra wußte es selbst nicht.
»Bis ans Ende der Welt möchte ich so mit dir fahren!«
»Und ist es nicht Sünde?« flüsterte Alexandra.
»Sünde? So laß mich noch einmal sündigen!«
»Das geht nicht, bald sind wir in Mitruni.«
»Mitruni nah oder weit, das ist gleich.«
Plötzlich vernahm man aus dem letzten Schlitten ein verzweifeltes Geschrei: »Halt! Halt!«
Pan Andreas war zornig und erstaunt. Er drehte sich um und sah mehrere Schritte von seinem Schlitten entfernt einen Reiter, der in rasendem Galopp heransprengte.
»Mein Gott! Das ist mein Wachtmeister Soroka! Da ist irgend etwas passiert!« sagte Pan Andreas.
Der Wachtmeister hielt sein Pferd an, das sich hoch aufbäumte.
»Pan Rittmeister,« sagte er atemlos.
»Was ist los, Soroka?«
»Upita brennt … Eine Schlägerei ist entstanden!«
»Jesus Maria!« schrie Alexandra auf.
»Fürchten Sie nichts, Panna. – Wer schlägt sich dort?«
»Ihre Soldaten mit den Städtern. – Der Marktplatz brennt. Die Städter haben nach Poniewiez geschickt, die Garnison zu alarmieren. – Und ich bin hierher geeilt, um es Euer Gnaden zu melden!«
Inzwischen kamen die anderen Schlitten an; die Offiziere umringten die Sprechenden.
»Was gab den Grund dazu?« fragte Kmicic.
»Die Städter wollten weder Proviant für die Mannschaften noch Fourage für die Pferde liefern. Die Soldaten nahmen sich alles mit Gewalt und zündeten zwei Häuser an. Jetzt ist überall Aufruhr, die Glocken läuten.«
Kmicic’ Augen begannen vor Zorn zu funkeln.
»Wir müssen zu Hilfe eilen!« schrie Kokosinski.
»Sie werden unsere Soldaten besiegen,« rief Ranicki: »Schande, Blamage!«
»Wer an Gott glaubt, muß drauf loshauen! Zum Teufel mit ihnen!« fügte Zend hinzu.
»Ruhig!« donnerte Kmicic. »Kein Gemetzel. Verteilt ihr euch auf zwei Schlitten, den dritten laßt mir. Ihr fahrt nach Lubicz und wartet dort ruhig ab, ob ich eure Hilfe nötig habe.«
»Wie?« wollte Ranicki protestieren, aber Pan Andreas schnürte ihm die Kehle zu, und in seinen Augen lag furchtbare Wut.
»Kein Wort weiter!« sagte er drohend. – »Sie, Panna Alexandra, kehren nach Wodokty zurück oder holen erst die Tante von Mitruni ab. Unsere schöne Fahrt ist nun zum Teufel! Ich wußte gleich, daß sie dort nicht Ruhe halten werden. – Nun, sie werden schon kleinlaut werden, wenn erst mehrere Köpfe geflogen sind. – Bleiben Sie gesund, Panna, und seien Sie ohne Sorge, ich kehre bald zurück.«
Er küßte ihr die Hand, hüllte sie sorgfältig in die Wolfsdecke ein, setzte sich in den dritten Schlitten und rief seinem Kutscher zu:
»Nach Upita!«
4. Kapitel.
Es vergingen mehrere Tage, und Kmicic ließ sich nicht in Wodokty sehen; aber drei Laudaer Schlachtschitzen kamen und suchten die Panna auf. Es waren Pakosz Gasztowt aus Pacunele, bei dem Pan Wolodyjowski wohnte, und der durch seinen Reichtum und seine sechs Töchter, von denen drei an Butryms verheiratet waren, weit bekannt war. Kassian Butrym, der älteste Greis in Lauda, und Juzwa Butrym, Pakosz’ Schwiegersohn, dem die Kosaken ein Bein weggeschossen hatten. Er war ein kluger, sehr kräftiger Mann, aber mürrisch und händelsüchtig. Es kam nur selten vor, daß er betrunken war, in diesem Zustand aber war er schrecklich gewalttätig.
Die Panna empfing ihre Gäste freundlich, obwohl sie erriet, daß sie sie über Pan Kmicic ausfragen wollten.
»Wir wollten Pan Kmicic unsere Aufwartung machen, aber er ist noch nicht aus Upita zurück,« sagte Pakosz. »Nun wollen wir dich fragen, wann wir ihn wohl treffen können?«
»Ja, er ist bis jetzt noch nicht zurück. Aber er wird sich sehr über euer Kommen freuen. Er hat schon viel Gutes von euch gehört, vom Großvater und jetzt von mir.«
»Wenn er uns nur nicht so empfangen wird wie die Domaszewicz’, als sie ihm die Nachricht vom Tode des Großvaters brachten,« sagte finster Juzwa.
»Sie müssen ihm das nicht übel nehmen,« erwiderte lebhaft die Panna. »Man darf nicht vergessen, er kam eben aus dem Kriege, wo er soviel Mühen und Unannehmlichkeiten durchgemacht hatte.«
»Und gefällt er dir, meine Liebe, oder nicht?« fragte Kassian Butrym. »Wir möchten das doch gerne wissen?«
»Vergelt euch Gott eure Fürsorge! Pan Kmicic ist ein heldenmütiger Ritter!«
»Und habt Ihr auch schon über die Hochzeit gesprochen?«
Alexandra senkte die Augen.
»Pan Kmicic möchte möglichst bald –«
»So? – Warum sollte er auch nicht?« brummte Juzwa. »Ist er denn ein Narr? Welcher Bär will nicht Honig aus dem Bienenstock haben? Aber wozu diese Eile? Ist es nicht besser, ihn erst richtig kennen zu lernen, zu sehen, was für ein Mensch er ist? Vater Kassian, sagen Sie doch Ihre Meinung, schlafen Sie doch nicht, wie der Hase zur Mittagszeit.«
»Ich schlummere nicht, – ich denke nur.«
»Nun, so sagen Sie doch, worüber denken Sie?«
»Worüber? – Über Pan Kmicic. – Es ist wahr, er ist ja ein vornehmer Herr, aus einer berühmten Familie – und wir sind nur einfache Leute. Und er ist ein berühmter Ritter Er zog allein gegen den Feind, als andere die Arme herabhängen ließen. Das ist wahr. – Möge Gott dem Lande mehr solche Leute schenken! – Aber sein Gefolge – das sind lauter Taugenichtse! Nachbar Pakosz, was haben Sie nicht alles von Domaszewicz’ über seine Offiziere gehört! Es sind alles ehrlose Leute, die vom Strafrichter gesucht werden. Einfach Mörder! Im eigenen Lande sengen sie, sie rauben, sie sind gewalttätig. – Die reinen Tataren! Am ersten Tage ihrer Ankunft in Lubicz schossen sie mit ihren Pistolen – nach den Bildern der Billewicz’. – Das durfte doch Pan Kmicic nicht zulassen!«
Alexandra verdeckte ihre Augen mit den Händen.
»Das kann nicht sein! Das kann nicht sein!«
»Kann schon; denn es ist so! – Und dann schleppten sie die Mädchen herein und verführten sie. – Pfui! – Gleich am ersten Tage solche Geschichten!«
Der alte Kassian geriet in Zorn und stampfte mit seinem Stock auf den Fußboden. Alexandras Gesicht bedeckte sich mit tiefer Röte.
»Und die Soldaten, die er in Upita gelassen hat, sind die etwa besser?« begann Juzwa. »Wie die Offiziere, so die Gemeinen. Dem Pan Sollohub raubt man sein Vieh. Friedliche Bauern prügelt man. Und jetzt sengt und mordet man in Upita! – Wie friedlich lebte es sich hier früher, jetzt aber lädt man die Flinte und muß immer auf der Hut sein. Und das alles, weil Pan Kmicic mit seiner Rotte hierher gekommen ist.«
»Sagen Sie nicht mehr so etwas! O, sagen Sie nichts mehr!« bat Alexandra.
»Was kann ich anderes sagen. Wäre Pan Kmicic besser, so lieferte er diese Leute dem Henker aus. Von den Schandtaten dieser Bande spricht man doch in der ganzen Gegend.«
»Was soll ich tun?« fragte Alexandra. »Es sind vielleicht schlechte Menschen; aber sie waren seine Kameraden im Krieg. Wird er sie auf meine Bitte verjagen?«
»Verjagt er sie nicht, so ist er selbst nicht besser,« brummte Juzwa.
»Gut, – er muß sich von ihnen trennen! – Er soll wählen zwischen mir und ihnen. Mögen sie tun, was sie wollen, aber nicht in Lubicz. Ich danke Ihnen, daß Sie mir die Augen öffneten. Solange ich lebe, soll es nicht so weiter gehen. Schreiben Sie es der Jugend Pan Kmicic’ zu und seiner Gesellschaft. Sie verführt ihn zu Ausschweifungen, sie befleckt seinen Namen. – Er ist nicht schlecht!«
Zorn und Entrüstung über Kmicic’ Kameraden wuchsen mehr und mehr in Alexandras Herzen. Sie fühlte ihre Liebe und ihr Vertrauen beschmutzt. Sie schämte sich Pan Andreas’! Und ihr verletztes Schamgefühl suchte am allerersten nach Schuldigen. Sie wollte noch etwas sagen, aber plötzlich brach sie in Schluchzen aus.
Vergebens versuchten die Herren sie zu trösten. – Nach ihrer Abreise blieben in Alexandras Seele Gram und Unruhe. Es kränkte die stolze Panna tief, daß sie ihren Bräutigam schützen, seine Vergehen entschuldigen mußte. Und erst seine Kumpane! – Ihre kleinen Händchen ballten sich krampfhaft, und sie begann das ihr bis dahin unbekannte Gefühl des Hasses kennen zu lernen. Sie litt schrecklich unter der Kränkung, die ihr Kmicic zugefügt hatte. – »Es ist eine Schande! eine Schande!« flüsterten ihre bleich gewordenen Lippen. »Von mir aus zu den Mägden, alle Abende! Alle Abende!«
Sie fühlte sich ganz zerschlagen. Eine unerträgliche Last raubte ihr den Atem.
Draußen dämmerte es schon, aber Alexandra lief noch im Zimmer umher; in ihrer Seele kochte es wie früher. Sie war eine Natur, die sich nicht kampflos den Schicksalsschlägen beugen konnte. In ihren Adern floß ritterliches Blut. – Ihre Seele forderte den Krieg gegen jene Bande böser Geister, – sofort den Krieg! – Aber was konnte sie tun? Nichts! – Nur weinen konnte sie und Pan Andreas bitten, daß er seine Freunde nach allen Himmelsrichtungen verjagen solle. »Und wenn er es nicht tun will?«
»Und wenn er nicht will?« – –
Sie wagte nicht, weiter darüber nachzudenken.
Die Panna wurde in ihrem Sinnen durch einen Knaben gestört, der Holz für den Kamin brachte. Plötzlich durchfuhr Alexandra ein neuer Gedanke.
»Kostek!« sagte sie, »reite schnell nach Lubicz. Ist der Pan zurück, so bitte ihn zu mir zu kommen. Wenn nicht, soll der alte Verwalter herkommen. Aber schnell, hörst du!«
Der Junge warf eine Hand voll Kieferspäne auf die Kohlen, legte Holzscheite darauf und lief rasch aus dem Zimmer.
Im Kamin loderte bald ein helles Feuer. Alexandra wurde mit einem Male leichter ums Herz.
»Vielleicht erbarmt sich Gott,« dachte sie. »Vielleicht ist alles nicht so schlimm gewesen, wie die Vormünder erzählten!« – –
Und sie ging nach der Gesindestube, um nach den Spinnerinnen zu sehen und fromme Lieder zu singen.
Zwei Stunden später kam Kostek zurück.
»Der Verwalter ist in der Diele,« bestellte er. »Der Pan ist noch nicht wieder in Lubicz.«
Alexandra sprang schnell von ihrem Platze auf und ging in die Diele. Der Verwalter verbeugte sich bis zur Erde.
Sie ging mit ihm nach dem Eßzimmer, der Verwalter blieb an der Tür stehen.
»Wie geht es bei euch in Lubicz zu? Sag’ mir alles offen, es soll dir kein Haar gekrümmt werden. Man sagt, der Pan sei gutherzig, – aber seine Kameraden seien Raufbolde?«
»Ich darf ja nichts sagen. – Ich fürchte, sonst – , man hat es mir doch verboten.«
»Wer hat es dir verboten? – Höre, du kehrst nicht mehr nach Lubicz zurück. Du bleibst hier. Und nun befehle ich dir, mir alles zu sagen, was du weißt!«
Der Bauer fiel in die Kniee.
»Gnädigste Panna, ich danke Euch. Ich will auch nicht zurück nach Lubicz, denn dort ist eine Zucht! Der reine Weltuntergang! Diese Herren, das sind Räuber, – Mörder, – nicht eine Minute ist ein Mensch seines Lebens dort sicher.«
Panna Billewicz wankte, wie von einem Pfeil verwundet. Sie wurde ganz blaß: aber sie fragte ruhig:
»Und haben sie wirklich in die Bilder der verstorbenen Billewicz’ geschossen?«
»Gewiß, das taten sie. Sie schleppen täglich die Mägde in ihre Zimmer. Im Dorfe ist ein Gejammer; im Herrenhause – Sodom und Gomorrha. Das Vieh ist alles abgeschlachtet. Einen Stallknecht haben sie totgeschlagen. Und jetzt lassen sie sich auch schon die Mädchen aus dem Dorfe ins Haus schleppen!«
»Wann erwartet man den Pan?«
»Das wissen sie nicht. Sie wollen alle nach Upita und haben schon Pferde bestellt. Von hier wollten sie Pulver holen.«
»Hierher kommen sie? – Gut, – geh jetzt in die Küche, – nach Lubicz brauchst du nicht zurück.« – –
Um nächsten Morgen, ehe noch die Panna zur Kirche abgefahren war, – es war ein Sonntag, – kamen die Offiziere aus Lubicz mit ihrer Dienerschaft angeritten.
Die Schloßherrin trat ihnen kühl und hochmütig entgegen und erwiderte ihre tiefen Verbeugungen nur mit einem kaum bemerkbaren Kopfneigen.
Kokosinski trat hervor:
»Erlauchtigste Panna! Wir entbieten Ihnen unseren ehrfurchtsvollsten Gruß und bitten Sie, Ihrer Dienerschaft zu befehlen, uns zu folgen. Wir werden Upita stürmen und den Kleinbürgern ein wenig Blut abzapfen.«
»Mich wundert,« sagte Panna Billewicz, »daß Sie nach Upita gehen, nachdem ich selbst Pan Kmicic’ Befehl gehört habe, in Lubicz still zu sitzen. Ich meine, es wäre ratsamer, daß Sie, als seine Untergebenen, seinen Befehlen gehorchen.«
Die Ritter sahen sich einander verständnislos an.
»Bei Gott!« sagte Kokosinski, »ein Unbeteiligter könnte meinen, Sie sprechen mit Pan Kmicic’ Knechten. Es ist wahr, wir sollten still sitzen. Aber Pan Andreas ist schon seit vier Tagen fort, und wir meinen, unsere Schwerter könnten ihm nützlich sein.«
»Pan Kmicic ist nicht in den Krieg gezogen; er ist gegangen, um gewalttätige Soldaten zur Vernunft zu bringen. Und Ihnen könnte es auch so gehen, wenn Sie sich seinen Befehlen nicht unterordnen. Auch würde Ihre Anwesenheit die Unordnung in Upita nur vergrößern.«
»Wir wiederholen unsere Bitte um Ihre Dienerschaft und um Pulver!«
»Weder das eine noch das andere werde ich Ihnen bewilligen. Haben Sie mich verstanden?«
»Wie! – Wa-as!« schrie Kokosinski: »Fürchten Sie nicht für Pan Kmicic?«
»Das größte Unglück, das ihm zustoßen könnte, ist Ihre Anwesenheit.«
Die Augen des jungen Mädchens funkelten. Mit erhobenem Haupte machte sie einige Schritte auf ihre Gäste zu.
»Verräter!« sagte sie. »Ihr seid seine bösen Geister! Ich kenne euch wohl, ich kenne euer liederliches Leben, eure schändlichen Taten. Die Strafrichter verfolgen euch; anständige Menschen wenden sich von euch ab. Und auf wen fällt die Schande? Auf ihn! Ihr ehrlosen Bösewichter!«
Panna Billewicz ging noch einen Schritt vor und wies mit der Hand auf die Tür.
»Hinaus, sage ich!«
Die Ritter wurden bleich; aber keiner sagte ein Wort. Unwillkürlich griffen sie an ihre Säbel, ihre Augen sprühten Funken. – Aber ach! Dieses Haus stand unter dem Schutze des mächtigen Kmicic, und dieses Mädchen war seine Braut. – Es blieb ihnen nichts übrig, als die Beleidigung herunterzuschlucken.
»Wenn man uns hier so liebenswürdig empfängt.« sagte Kokosinski mit vor Wut stockender Stimme, »so bleibt uns – nichts übrig, – als zu gehen, der Hausfrau höflichst für die Gastfreundschaft dankend.«
Er verbeugte sich mit übertriebener Ehrfurcht, und die anderen folgten seinem Beispiele.
Als die Tür sich hinter den Offizieren schloß, fiel Alexandra kraftlos in den Sessel. Mit ihrem Willen und ihrer Stärke war es nun zu Ende.
Die Ritter schlugen den Weg nach Upita ein und machten nach mehreren Stunden in einer Schenke, Doly mit Namen, die zwischen Wolmontowicze und Mitruni lag, Halt. Vor der Schenke standen schon einige Schlitten und gesattelte Pferde. Als die Ritter in die große, finstere Stube eintraten, fanden sie sie schon überfüllt. Die Schlachta der Umgegend saß auf den Bänken oder stand gruppenweise vor dem Schenktisch und trank Bier oder Krupnik, ein Getränk aus Met, Branntwein, Öl und Kräutern. Es waren alles Abkömmlinge der Butryms, lauter kräftige, finstere und ungewöhnlich schweigsame Menschen. Sie trugen graue Halbröcke aus selbstgewebtem Tuch, die mit Schaffellen gefüttert waren, schwarze Ledergürtel und Säbel in schwarzen Scheiden. Zum großen Teil waren es Greise oder halbwüchsige Knaben, die das zwanzigste Jahr noch nicht überschritten hatten; denn die anderen hatten sich alle in Rosien zum Landsturm gestellt.