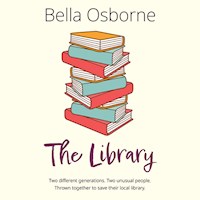19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Ein tröstlicher Roman, der zu Herzen geht und die Hoffnung schürt, dass man mit einem Freund an der einen und einem guten Buch in der anderen Hand auch die schwierigsten Zeiten im Leben meistert. Freundschaft hat viele Seiten – Tom und Maggie sind die perfekte Gesellschaft für gemütliche Lesenachmittage! Tom führt ein alles andere als normales Teenagerleben. Vor sieben Jahren starb seine Mutter, und sein Vater verfällt zunehmend dem Whisky. Trost findet Tom in der örtlichen Bücherei und in den Büchern, meist Romanzen, die seine Mutter so sehr mochte. Das darf natürlich niemand wissen, vor allem nicht die coole Farah aus der Schule, die ebenfalls oft Bücher ausleiht. Maggie ist Rentnerin, bestellt ihren Hof aber noch immer selbst, nur der störrische Traktorreifen macht Probleme. Seit einiger Zeit fällt ihr bei ihren Buchclub-Treffen in der Bücherei ein verloren wirkender Junge auf. Als sie von seiner Geschichte erfährt, macht sie ihm ein Angebot: Er hilft ihr auf dem Hof und bekommt dafür endlich einmal etwas anderes zu essen als Fischstäbchen. Bald entsteht eine Freundschaft zwischen ihnen, alles könnte wunderbar sein – doch dann soll die Bücherei geschlossen werden. Gemeinsam mit Farah und dem Buchclub schmieden Tom und Maggie einen Plan, um ihren Lieblingsort zu retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Ähnliche
Bella Osborne
So was wie Freunde
Roman
Über dieses Buch
Freundschaft hat viele Seiten.
Tom fühlt sich unsichtbar. Sein Vater nimmt mehr Notiz von seiner Whiskyflasche als von ihm, und auch für seine Mitschülerin Farah ist er Luft. Richtig wohl fühlt sich Tom nur in der Bücherei, wo er heimlich Liebesromane verschlingt. Als ein Taschendieb dort eine der älteren Buchklub-Ladys überfällt, kommt Tom ihr zu Hilfe – dabei kann sie sich selbst ganz gut verteidigen. Immerhin ist Maggie zwar Rentnerin, fährt aber Quad und beherrscht Jiu-Jitsu. Nur das Bestellen ihrer Farm bereitet ihr manchmal Probleme. Als Maggie von Toms Situation erfährt, macht sie ihm ein Angebot: Er hilft ihr aus und bekommt dafür endlich einmal wieder ein anständiges Sonntagsessen. Schon bald formt sich zwischen den beiden eine Freundschaft und alles könnte wunderbar sein – doch dann soll die Bibliothek geschlossen werden …
Ein zu Herzen gehender Roman, der Hoffnung gibt, dass man mit einem Freund an der einen und einem guten Buch in der anderen Hand auch die schwierigsten Zeiten im Leben meistert.
Vita
Bella Osborne hat sich schon immer gern Geschichten ausgedacht. Geschichten über Freundschaft, Liebe und darüber, wie man mit ein wenig Humor die Hürden überwindet, die einem das Leben in den Weg wirft. 2013 erschien ihr erster Roman, es folgten mehrere Bestseller. 2022 wurde sie mit dem Romantic Comedy Novel of the Year Award ausgezeichnet. Die Autorin lebt in Warwickshire, England, zusammen mit ihrem Mann, ihrer Tochter und ihrer Katze.
Birgit Schmitz studierte Theater, Film- und Fernsehwissenschaft in Köln und Berlin und arbeitete einige Jahre als Dramaturgin. Nach Engagements am Burgtheater Wien und am Thalia Theater Hamburg wechselte sie in die Freiberuflichkeit. Heute lebt sie als Literaturübersetzerin, Lektorin und Texterin/Interviewerin in Frankfurt am Main.
Impressum
Die englische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel «The Library» bei Head of Zeus, UK.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«The Library» Copyright © 2022 by Bella Osborne
Redaktion Tobias Schumacher-Hernández
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Roberta Murray/Arcangel
ISBN 978-3-644-01833-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für die Schuppen-Gang:
Anne, Carol, Charlotte, Emma, Heather, Jane und Riannah
Ich liebe euch!
1Tom
Mein Name ist Tom Harris, und ich bin unsichtbar.
Nicht wirklich unsichtbar – das würde mich ja interessant machen, und das bin ich nicht. Ich bin einer, den man leicht übersieht. Der in der Menge verschwindet. Ehrlich gesagt, finde ich es ganz angenehm, unsichtbar zu sein. Ich hasse es, wenn ich plötzlich im Rampenlicht stehe. Lieber bleibe ich im Hintergrund. In den unpassendsten Momenten kriege ich rote Flecken am Hals – zum Beispiel wenn ein Lehrer mich was fragt. «Thomas Harris, was meint der Autor, wenn er schreibt: ‹Wir sind füreinander verantwortlich?›» Woher soll ich das denn wissen? In der Schule werde ich immer Thomas Harris oder Tom H. genannt, nie einfach nur Tom oder Thomas. Der Name ist nämlich echt häufig. Allein in meinem Jahrgang gibt’s fünf von mir. Einen superselbstbewussten Thomas, einen sportlichen, einen, der laut und lustig ist, einen aufmüpfigen, auf den die Mädchen stehen, und dann noch mich, den anderen.
Wenn ein Mädchen mich ansieht, wird mir immer ganz heiß. Vielleicht will mich irgendwas in meiner DNA daran hindern, eine neue Generation von unsichtbaren Menschen hervorzubringen. Bislang mit Erfolg. Es ist einfacher, wenn ich Mädchen aus dem Weg gehe. Allerdings gibt es ein Mädchen in meiner Stufe, das ich gern anschauen würde, ohne rot anzulaufen wie eine Tomate. Sie heißt Farah Shah. Farah ist perfekt, von ihrem schwarzen Haar, das so glatt ist wie mit dem Lineal gezogen, bis zu ihrem fröhlichen Lachen. Und klug ist sie auch. Sie stellt die Art von Fragen, über die die Lehrer erst mal nachdenken müssen. Mir ist schon klar, dass sie in einer komplett anderen Liga spielt, aber das ist okay, das tun die meisten.
«Tom!», sagte Dad laut, und sein rötliches Gesicht tauchte an meiner Zimmertür auf. Er schwang eine Tüte von der Imbissbude in der Hand. Statt einer Antwort zeigte ich auf meine Ohrhörer.
Er war nicht sauer, aber wahrscheinlich hatte er mich schon mehrmals gerufen. Mein Dad ist in Ordnung. Er ist auch der unsichtbare Typ, so wie ich. Ich folgte ihm nach unten. Wir reden nicht viel. Er arbeitet nachts, und ich bin den ganzen Tag in der Schule. Er verteilte das Essen, ich schnappte mir den Ketchup, und wir setzten uns mit den Tellern auf dem Schoß vor den Fernseher. So essen wir immer. Bei uns gibt es nur Dad, mich und den Fernseher. Mum ist gestorben, als ich in der zweiten Klasse war.
Ich wickelte mein Essen aus. «Brühwurst?» Ich zeigte auf das erschreckend rote Ding, das unter meinen Pommes hervorlugte.
«Ja, tut mir leid. Würstchen im Teigmantel waren aus.» Er aß weiter.
«Aber ich hasse Brühwurst.» Ich stupste sie mit der Gabel an.
«Echt?» Er wirkte überrascht. «Dann hab ich mich vertan. Deine Mum mochte die so gern. Als ich sie das erste Mal ausgeführt hab, wollte sie Brühwurst mit Pommes.»
Das überraschte mich etwas. Nicht, dass Mum Brühwurst mochte, sondern dass Dad sie erwähnt hatte. Er redet ohnehin nicht viel, aber über Mum schon gar nicht. Ich hatte mich schon dran gewöhnt, es gar nicht erst zu versuchen, weil es eh zwecklos war. Er hatte immer sofort das Thema gewechselt oder war einfach weggegangen. Aber jetzt sah ich meine Chance gekommen. Die Gelegenheit war günstig, denn es war ein Werktag, und er hatte den Whisky nicht angerührt. Nur: Was wollte ich eigentlich wissen?
Ich ignorierte die Ekelwurst und tunkte eine riesige Fritte in den Ketchup. Dabei kam mir eine Idee: «Wie habt du und Mum euch eigentlich kennengelernt?», fragte ich und drehte mich auf dem alten braunen Sofa in Dads Richtung, damit ich seine Reaktion sehen konnte. Ein paar Stoppeln an seinem Kinn zeigten, dass er sich nicht gründlich rasiert hatte.
Er legte sein Besteck weg und blies die Luft aus. «Puh, da muss ich nachdenken.» Er schien die Gedanken schweifen zu lassen. Sein Blick lag auf Mums Foto, das auf dem Kaminsims stand. Es ist während unseres letzten gemeinsamen Urlaubs entstanden, damals hatten wir einen Wohnwagen in Hunstanton gemietet. Ich liebe das Bild. Sie lacht darauf. Mum hat immer viel gelacht. Wir alle. Wenn ich mich doll konzentriere, kann ich sie noch lachen hören, aber ich hab Angst, eines Tages nicht mehr zu wissen, wie sie geklungen hat. Mir kommt’s so vor, als würde sie nach und nach ausradiert. Dad blinzelte und schaute mich traurig an. So sah er immer aus, wenn ich über Mum reden wollte. Ich erwartete, dass er das Thema wechseln würde. «Bei den Simpsons! Da haben wir uns zum ersten Mal getroffen», sagte er schließlich.
«Vor dem Fernseher?» Ich lachte bei der Vorstellung.
«Nein, du Dussel. Die Inhaber von dem kleinen Buchladen an der High Street hießen Simpson. Ich war da, um den neuesten Stephen King abzuholen. Hab so getan, als hätte ich ihn für mich bestellt, dabei war er für meinen Dad.» Er lächelte bei der Erinnerung. «Mum stand mit ihren Freundinnen kichernd vor dem Regal mit den Liebesromanen. Wir kamen ins Plaudern, und ich hab sie gefragt, ob sie nicht Lust auf ein Coke Float hat. Cola mit Vanilleeis, da stand ich damals total drauf. Warum gibt’s das eigentlich nicht mehr?»
Ich verdrehte die Augen, weil er immer alles von früher verklärt. Ich wusste, dass die beiden so alt waren wie ich jetzt, als sie zusammenkamen. Seine Seelenverwandte hat Dad sie in seiner kleinen Ansprache bei der Beerdigung genannt. Ich weiß nicht genau, was er damit meinte, aber ich weiß ganz sicher, dass sie glücklich waren. Ihre Ehe war nicht perfekt, es gab schon auch manchmal Streit, aber nichts, was ich als schlimm in Erinnerung hab. Dad hat mal gesagt, sie hätten nicht viel Geld gehabt, und das wäre das Einzige gewesen, worüber sie gestritten hätten.
«Deine Mum liebte Bücher.» Er schaute wieder zu dem Foto.
«Ich weiß noch, dass sie mir abends im Bett vorgelesen hat.»
Er sah mich mit Tränen in den Augen an. «Ich kann mit Büchern ja nichts anfangen. Liest du viel?»
Ich zuckte mit den Schultern, aber er wartete auf eine richtige Antwort. «Nur, was wir für die Schule lesen müssen.»
Er blickte sich in unserem kleinen Wohnzimmer um. Seit Mums Tod hatte es sich kaum verändert. Außer dass es etwas chaotischer aussah als früher.
Ich kam ins Grübeln. Mädchen lasen also gern Liebesromane. Ob das heute auch noch so war?
«Okay.» Dad schaute auf die Uhr. Er musste zur Arbeit. «Gehst du noch weg?»
Das fragte er mich immer, und jedes Mal schüttelte ich den Kopf. Ich gehe abends nie weg. Ich hab zwar ein paar Kumpel, aber wir spielen FIFA auf der Xbox. Das können wir bequem vom Bett aus, warum sollten wir also rausgehen? Wenn ich spiele, fühle ich mich weniger wie ein Loser, weil ich alleine hier rumhänge.
«Gut, also dann bis morgen früh. Vergiss nicht abzuschließen.» Er drückte im Vorbeigehen meine Schulter und nahm meinen Teller mit raus. Ich mache immer den Abwasch, bevor ich ins Bett gehe. So teilen wir uns die Arbeit. Dad besorgt was zu essen, ich spüle. Ich stelle die Wäsche an, Dad bügelt.
Meine Freunde stöhnen andauernd über ihre Eltern. Darüber, wie sehr sie ihr Leben kontrollieren wollen und ihnen auf die Nerven gehen. Ich stimme immer mit ein und behaupte, Dad wäre genauso, aber das stimmt gar nicht. Er nervt, wenn er sich über Rechnungen, Politik und den Zustand der Straßen auslässt, aber ich mache schätzungsweise auch hin und wieder irgendwas, was ihn stört. Ich könnte heute Abend ausgehen, ohne dass er weiß, wo ich bin oder was ich mache, und er fände das in Ordnung. Allerdings hab ich keinen Grund, vor die Tür zu gehen. Ich bin eh unsichtbar.
Ich wurde wach, als die Toilettenspülung ging. Dad war von der Arbeit zurück. Mein müder Blick wanderte zum Wecker: 6 Uhr 37. Ich zog die Decke über den Kopf. Es war Samstag, also konnte ich weiterschlafen. Dad würde gleich ins Bett gehen. Es muss seltsam sein, nachts zu arbeiten und tagsüber zu schlafen. So als würde man gezwungen, nachtaktiv zu sein. Aber wegen einem Typen aus Amerika, der mich in Call of Duty herausfordert und nachts bis drei Uhr wach hält, bekomme ich gerade einen kleinen Vorgeschmack darauf. Ich kuschelte mich wieder ein und versuchte, in meinen Traum über Ariana Grande zurückzufinden.
Ich drehte mich um und sah wieder auf die Uhr. 11 Uhr 58. Schon besser. In zwei Minuten würde Dads Wecker klingeln. Samstags gönnt er sich immer nur ein paar Stunden Schlaf, damit er in der Nacht auf Sonntag ein Auge zukriegt. Ich hörte seinen Wecker. Das war mein Zeichen, unter die Dusche zu hüpfen, bevor er es tat.
Als ich in die Küche kam, machte Dad gerade Kaffee. «Guten Tag, Sohn.» Er wollte mir durch die Haare fahren, aber ich wich ihm aus. Ich trank den Apfelsaft leer und warf die Plastikflasche in den Müll.
«Ich geh mal ins Dorf. Brauchen wir irgendwas?», fragte ich.
«Zauberbohnen», sagte Dad. Er starrte gerade auf einen Kontoauszug und blickte nicht auf.
«Sind das die zuckerreduzierten?» Diese Baked Beans kann ich nicht ausstehen, die schmecken echt scheiße. «Ach so!» Ich schnallte zu spät, dass er auf das Märchen anspielte.
«Mach dir nichts draus», sagte er, dann öffnete er den Schrank und schüttelte den Kopf. «Chips und Kekse, aber nur die billigen. Okay?» Er gab mir fünf Pfund.
Ich schnappte mir Rucksack, Ohrhörer und meine Jacke. Ich bin froh, dass er mich nicht gefragt hat, warum ich ins Dorf gehe. Ich bin nicht sicher, ob meine Idee was taugt, aber ich werd’s ja sehen. Farah Shah wohnt zwischen dem Dorf und der nächstgelegenen Kleinstadt. Keine Ahnung, woher ich das weiß. Ich bin kein Stalker; hab’s nur irgendwann mal mitgekriegt und mir gemerkt. Farah und ich haben ein paar Kurse zusammen, aber wir reden nie miteinander. Sie ist beliebt. Alle Jungs wollen mit ihr gehen, und alle Mädchen wollen so sein wie sie. Ich würde gern einfach mal Hallo zu ihr sagen können, ohne gleich knallrot anzulaufen.
Ich hielt für alle Fälle nach ihr Ausschau, während ich an der Ladenzeile vorbeilief. Wir haben im Ort einen Herrenfriseur, einen Friseursalon – die Sorte für ältere Damen –, das Postamt, eine Kunstgalerie (oh Wunder!) und einen Tante-Emma-Laden. Auf der anderen Straßenseite ist ein Pub – das Limping Fox, wo Dad früher gern hingegangen ist –, ein ganz nettes indisches Restaurant, ein Blumenladen und ein Copyshop, der fast nie geöffnet hat. Es waren ein paar Leute unterwegs, aber ich guckte nicht hoch. Wir hatten Februar, und es war kalt, da hielt sich niemand lange im Freien auf.
Mein Weg führte an der Dorfwiese und dem altertümlichen, bei Touristen beliebten Pranger vorbei, außerdem an der riesigen Zeder, um die sich immer alle Sorgen machen, wenn es mal stürmt. Versteckt hinter einer Reihe von Cottages liegt die Dorfbücherei. Die hatte ich schon Jahre nicht mehr von innen gesehen. Bei meinem letzten Besuch war ich bestimmt noch auf der Grundschule gewesen, aber sie sah noch ganz genauso aus, wie ich sie in Erinnerung hatte, was mich irgendwie beruhigte.
Der Inschrift auf der Tafel am Eingang kann man entnehmen, dass das Gebäude von 1837 ist und früher als Schule gedient hat. Den automatischen Türöffner hatte es bei meinem letzten Besuch noch nicht gegeben. Die Wärme, die mir beim Eintreten entgegenschlug, haute mich fast um. Über der Tür war ein Heizlüfter angebracht, und ich ging schnell weiter. Wenn man aus der Kälte kommt, ist warme Luft ja erst mal angenehm, aber wenn mir zu warm wird, schwitze ich, und das kann ich nicht ausstehen. Im Innern sah es kaum anders aus als früher. Die hohe Holzbalkendecke, die Bogenfenster, die vielen Regalreihen voller Bücher und dieser spezielle Bücherei-Geruch – es war alles noch da.
Vielleicht lag es an diesem Geruch, aber irgendwie bekam ich feuchte Augen. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll – es war, als würde eine riesige Welle verworrener Gefühle über mir zusammenschlagen. Ich war immer glücklich gewesen, wenn ich in die Bücherei kam, denn dann hatte ich Mum ganz für mich allein. Es gehörte zu den Sachen, die wir immer zusammen gemacht haben. Wir gingen regelmäßig in die Bücherei, ganz egal, wie viel Arbeit sie hatte, und ich hab’s geliebt. Ich hab sie geliebt. All diese Gefühle stürmten jetzt wieder auf mich ein. Zuerst wollte ich wieder rausrennen, aber irgendwas hielt mich zurück. Ich wollte die Zeit zurückdrehen und wieder dieser kleine Junge sein. Behütet und glücklich.
Ich musste an das letzte Mal zurückdenken, dass ich mit Mum hier gewesen war. Ich sah sie quasi vor mir, wie sie die Regale auf der Suche nach ihren Lieblingsautorinnen abscannte. Ich hatte mir unter anderem ein Buch über Dinosaurier ausgesucht und wollte mich hinsetzen und sie alle sofort lesen. Damals hab ich Bücher geradezu verschlungen. Ich blinzelte die Tränen weg und schaute mich in dem Raum um.
Einige ältere Frauen hatten sich um einen Tisch versammelt und unterbrachen ihr Gespräch, um zu sehen, wer hereingekommen war. Ich setzte den Rucksack ab, steuerte einen Platz in der entgegengesetzten Ecke an und öffnete unterwegs meine Jacke. Als ich saß, ließ ich meinen Blick durch die Bücherei schweifen. Sie war groß. Ich erinnerte mich, dass die Raumaufteilung damals anders gewesen war. Früher hatten Regale in der Mitte gestanden, die die Bücherei in verschiedene Bereiche unterteilten; jetzt gab es nur noch einen großen Raum. Es war still. In einem Bereich für Kinder saßen eine Mutter und ein kleines Mädchen. Sie hatten zwei Bücherstapel vor sich stehen. Das Mädchen zog einen Schmollmund. Ich konnte mir schon denken, was los war. Ich war genauso gewesen, wenn Mum mit mir hier war. Ich wollte immer alle Bücher mit nach Hause nehmen.
Mir wurde bewusst, dass ich lächelte, und ich machte schnell wieder ein ernstes Gesicht. Dann schaute ich mich unauffällig weiter um. Die um den Tisch sitzenden Frauen hatten alle das gleiche Buch vor sich liegen und unterhielten sich offenbar darüber.
Früher hatte man seine Bücher an einem speziellen Tresen ausgeliehen und zurückgegeben. Aber damals war ich ja noch kleiner, vielleicht war er in Wirklichkeit auch gar nicht so hoch. Jedenfalls war dieser Tresen durch eine Art Stehpult ersetzt worden, auf dem ein Bildschirm thronte. Davor stand eine Frau mit einem blauen Umhängeband um den Hals und tippte auf einer Tastatur herum. Das musste dann wohl die Bibliothekarin sein.
Auch wenn ich mich insgesamt langsam etwas wohler fühlte, war mir noch immer unangenehm warm. Ich wollte auf keinen Fall schwitzen für den Fall, dass Farah hereinschneite. Also fächelte ich mir mit dem Saum meines T-Shirts ein bisschen Luft unter die Achseln. Damit niemand auf die Idee kam, mich anzusprechen, ließ ich die Ohrhörer drin.
Von meinem Platz aus ließ ich den Blick über die Regale in meiner Nähe schweifen. K bis O. Auf einem Schild darüber stand: Belletristik. Ich verrenkte mir den Hals. Wie jetzt? Nur Belletristik, Sachbücher und Kinderbücher? Keine Abteilung für Krimis, Biografien und, vor allem, Liebesromane? Ich hätte die Bibliothekarin fragen können, nur, dass ich es einfach nicht konnte. Jedenfalls nicht, ohne radieschenrot anzulaufen und Schweißausbrüche von olympischen Ausmaßen zu riskieren. Ich vermutete, dass die Liebesromane unter die anderen Romane gemischt waren, was eine Abänderung meines clever durchdachten Plans erforderte. Doch als ich mich in der Bücherei umschaute, bemerkte ich noch ein weiteres Problem: das offensichtliche Fehlen anderer Menschen meines Alters.
Es war schon merkwürdig, wieder hier zu sein. Abgesehen von dem übereifrigen Heizlüfter war es ganz nett in der Bücherei. Ich weiß, nett ist ein blödes Wort – jedenfalls sagt meine Englischlehrerin mir das dauernd. Aber so fühlte sich dieser Ort nun mal an. Nett. Er hatte etwas Vertrautes, obwohl ich Jahre nicht hier gewesen war. Und in der Luft hing der Geruch von Büchern. Den hatte ich völlig vergessen. Schon als kleiner Junge hatte ich ihn in mich aufgesogen. Die Bücherei war für mich etwas ganz Besonderes gewesen, und ich schätze, sie war es noch immer – nur ich hatte mich verändert.
Plötzlich hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich drehte instinktiv den Kopf und sah, dass eine der Frauen an dem Tisch mich interessiert betrachtete. Sie hatte eine wilde graue Mähne und trug ein buntes Top mit Wirbelmuster. Wir beäugten uns gegenseitig, und der introvertierte Junge in mir schrie vor Entsetzen. Ich schaute weg. Sofort fühlte mein Hals sich wieder heiß an. Wahrscheinlich sah ich vage verdächtig aus. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass männliche Jugendliche viele Leute nervös machen. Sie glauben nämlich, dass wir alle entweder Drogen nehmen oder irgendwas mitgehen lassen wollen. Ich schaute hinter mich und erblickte ein Buch mit einem rosafarbenen Rücken im Regal. Das war bestimmt ein Liebesroman. Ich zog es heraus und schaute es mir an. Dich schickt der Himmel von Sophie Kinsella. Yep, das sah aus wie die Sorte Bücher, die meine Mum gelesen hatte. Ich überflog den Text auf der Rückseite.
Dann hob ich den Blick. Die Frau an dem Tisch starrte noch immer in meine Richtung, nur sah sie jetzt fasziniert aus. Das war nicht gut. Ich schaute wieder auf das Buch. Dass ich einen Liebesroman in der Hand hielt, machte mich bestimmt verdächtig. Ich schluckte schwer, drehte mich um und stellte das Buch vorsichtig ins Regal zurück. Als ich mich zurückdrehte, stand sie vor meinem Tisch.
«Kann ich helfen?», fragte die Bibliothekarin. Oh, shit!
Ich war nicht länger unsichtbar, und das gefiel mir nicht. «Äh, öh. Ähm.» Reiß dich zusammen, Tom.
Ich holte Luft. «Ich, ähm, ich …» Ich atmete noch mal tief ein. «Ich suche Bücher.» Wow, was für ein genialer Satz. Ich versuchte, ansatzweise zu lächeln. «Gab es hier nicht früher unterschiedliche Abteilungen? Wie Krimis und Liebesromane?» Ich konnte den Blickkontakt nicht länger halten. Wie anstrengend.
«Ja, stimmt, aber so funktioniert es auch ganz gut. Wir haben die Neuerscheinungen nach Genre unterteilt. Sie sind da drüben.» Sie zeigte auf die Regale neben der Tür. «Daneben stehen auch Bücher in einfacher Sprache, Großdruckbücher und Hörbücher.» Die hatte ich komplett übersehen.
«Gut, danke.» Ich schaute kurz hoch und hoffte, sie würde mich als hoffnungslosen Fall einstufen und in Ruhe lassen.
«Ich hab gesehen, dass du dir Sophie Kinsella angeschaut hast.»
«Bitte?» Mir fiel das rosafarbene Buch wieder ein. Bitte, lieber Gott, lass mich sterben. Jetzt sofort. Wenn es so was wie spontane Selbstentzündung gibt, dann erlöse mich. Mein Kopf war definitiv heiß genug, um kurz vorm Schmelzpunkt zu stehen.
«Wenn du Liebesromane suchst …», ich schüttelte bereits meinen überhitzten Kopf, «für dich oder für jemand anders …» Warum war ich da nicht selbst drauf gekommen? «Wir haben da drüben eine eigene Ecke.» Sie zeigte auf einen Drehständer. «Alle anderen Schmöker, wie zum Beispiel historische Romane, stehen bei der allgemeinen Belletristik, aber ich könnte dir ein paar Autorinnen empfehlen.» Sie übte ihren Beruf mit Begeisterung aus – das war mehr als schlecht.
Was sollte ich jetzt bloß machen? Ich öffnete den Mund und lieferte eine hervorragende Goldfisch-Imitation. Die Bibliothekarin beugte sich mit einem verschwörerischen Blinzeln zu mir herab. «Schickt deine Mum dich? Sollst du ihr ein Buch mitbringen?»
Ich nickte wie ein Wackeldackel im Auto nach einem Schlagloch. «Ja, Mum ist …» Denk dir was Glaubwürdiges aus. Tot ist kein guter Grund, um ein Buch aus der Bücherei zu benötigen. «Bei der Arbeit.» Meine Augen leuchteten vor Erleichterung auf, als ich begriff, dass ich eine gute Antwort gegeben hatte. Sicherheitshalber wiederholte ich die Lüge noch einmal. «Sie ist bei der Arbeit.» Wenigstens ließ das Schwitzen jetzt nach.
Die Bibliothekarin war sichtlich stolz auf sich. Sie verdrehte die Augen. «Mütter von heute, was?» Ich verbrüderte mich mit ihr und zuckte die Achseln. Das war super. «Wie heißt sie denn? Ich suche ihre Karte raus, dann können wir nachsehen, was sie sonst so ausleiht.»
Verflucht! Das konnte doch nicht wahr sein. Der Schweiß kehrte zurück wie ein Tsunami. Denk dir was aus. Sie guckte schon komisch. Für eine Antwort, die ein Sechzehnjähriger aus dem Ärmel schütteln können sollte, ließ ich mir ganz schön viel Zeit. DENK NACH. Mein Blick irrte auf der Suche nach Inspiration umher. Ein Schild an der Wand wies auf die Möglichkeit hin, E-Books auszuleihen. «Kindle!», rief ich geradezu, und die Frau zuckte zurück. Ich schluckte und versuchte, mir was zurechtzulegen. «Sie liest sonst nur E-Books, aber ihr Kindle hat den Geist aufgegeben.»
Die Bibliothekarin lächelte wieder. Ich nicht. Ich hätte mein T-Shirt auswringen können. «Ach so, ich verstehe. Hast du denn einen Büchereiausweis?»
«Nein, als Kind hatte ich einen, aber ich weiß nicht mehr, wo er ist.»
«Kein Problem. Bist du über sechzehn?» Ich nickte. «Dann brauchst du jetzt ohnehin einen Ausweis für Erwachsene. Ich kann entweder deine Daten in unsere EDV eingeben, oder du benutzt den Computer da drüben und meldest dich selbst an.»
«Ich mach’s selbst, danke.»
«Sehr schön. Soll ich in der Zwischenzeit schon mal ein paar Bücher für deine Mum raussuchen?»
«Ja, danke.» Nein! Ich brauche keine Liebesromane. Glücklicherweise hatte ich meinen Rucksack dabei, sonst hätte ich mit einer Ladung Chick-Lit im Arm da rausspazieren müssen. Wie war ich bloß in diesen Schlamassel reingeraten? Ach ja, dies war der Versuch eines Losers, Mädchen kennenzulernen. Hatte ja super funktioniert. Mein Plan war offenbar nicht so genial wie erhofft.
Ich schlich zu dem Computer und folgte den Anweisungen, die unter der Folie auf dem Tisch klebten. Als ich das letzte Mal auf Eingabe klickte, erschien neben mir ein Stapel mit acht Büchern. Acht! «Danke. Äh, da wird Mum sich aber freuen.» Die Bibliothekarin wirkte entzückt, und ich hätte mich am liebsten in eine Pfütze aufgelöst. Ich wischte mir die Handflächen an meiner Jeans trocken, dann nahm ich die Bücher, schob sie schnell in meine Tasche und zog den Reißverschluss zu. Die Bibliothekarin ließ mich keine Sekunde aus den Augen. Warum starrte sie mich immer noch so an?
«Kann ich sonst noch was für dich tun? Wir haben auch eine Abteilung mit Büchern für junge Erwachsene.» Ich sagte nichts – in meine Tasche hätte ich ohnehin nichts mehr reingekriegt. «Oder du kannst auf unseren Computern im Internet surfen, wenn du dir ein Zeitfenster reservierst.»
Es war klar, dass ich nicht einfach nur hier sitzen und darauf warten konnte, dass Mädchen auftauchten, und überzeugende Lügen fielen mir auch keine mehr ein. Was schade war, denn eigentlich hatte es mir gefallen, wieder mal in der Bücherei zu sein. «Nein, ich hab alles, was ich brauche, vielen Dank.» Ich klopfte auf meine Tasche und stand auf.
«Sie kann sie drei Wochen behalten, und wenn sie sie länger braucht, kannst du die Leihfrist online verlängern. Gut?»
Nein, gar nichts war gut. «Ja, super.» Ich nahm meine Jacke und entfleuchte mit gesenktem Kopf in die irrsinnig angenehme kalte Luft draußen. Als Erstes schaute ich nach, ob jemand in der Nähe war, den ich kannte. Niemand zu sehen. Also setzte ich meinen Rucksack auf und eilte mit meiner peinlichen Beute nach Hause.
2Maggie
Die Buchklub-Lektüre war diese Woche nicht nach Maggies Geschmack gewesen. Sie hatte die Nase voll von Psychothrillern, die stets so taten, als gäbe es am Schluss eine vollkommen unerwartete Wendung, während ihr die Auflösung immer schon lange vorher so offensichtlich erschien wie eine pink gestreifte Kuh auf einer Weide voller Schafe. Zudem bemerkte sie, dass einige dieser Geschichten ihr Angst machten, was für eine alleinstehende Zweiundsiebzigjährige nicht gut war. Nicht, dass das Alleinsein ihr Probleme bereitete; das tat es keineswegs. Sie lebte jetzt schon seit fast zehn Jahren allein. Maggie war gern für sich und liebte ihre Freiräume, aber sie zwang sich jeden Samstag, die Fahrt ins Dorf anzutreten. Sonst sah oder sprach sie womöglich gar niemanden, es sei denn, der Briefträger brachte mal etwas, wofür er ihre Unterschrift benötigte. Doch die Interaktion mit ihm beschränkte sich in der Regel auch nur darauf, dass er wortreich über die Schlaglöcher in ihrer Einfahrt klagte und über die bleibenden Schäden, die sie seinem Steißbein zugefügt hätten.
Die Diskussion war beendet, und die Mitglieder des Buchklubs brachen langsam auf. Maggie steckte ihre Ausgabe von Die Pickwickier ein, das sie als Nächstes lasen. Hin und wieder nahmen sie sich einen Klassiker vor, was gut war, denn anders als die meisten anderen in der Gruppe war Maggie nicht allzu belesen. Häufig genug hatte sie das Gefühl, sie hätte es schaffen müssen, sich mehr Zeit für Bücher zu nehmen, aber früher hatte sie ein sehr erfülltes, geradezu übervolles Leben gehabt. Erst vor Kurzem war ihr bewusst geworden, dass Dinge nicht mehr von selbst auf sie zukamen, sondern sie sich aktiv bemühen musste.
«Hast du den Jungen gesehen?», fragte Betty mit besorgter Miene, als sie in ihren Mantel schlüpfte.
Maggie hatte ihn bemerkt. «Er kam mir ein bisschen nervös vor.» Männer und noch dazu solche unter sechzig waren ein seltener Anblick in der Bücherei und eigentlich auch im ganzen Dorf.
«Glaubst du, er wollte das Objekt auskundschaften?»
Maggie lachte laut auf. «Das Objekt? Das ist eine Bücherei, Betty. Hier gibt’s kaum was, was zu stehlen sich lohnen würde. Und weil niemand seine Leihfrist überzieht, ist nicht mal ordentlich Bargeld in der Kasse.»
«Trotzdem», beharrte Betty und richtete sich kerzengerade auf, bevor sie wieder ihre übliche gekrümmte Haltung annahm. «Man liest ja ständig von so was. Drogen, Raubüberfälle, Mord!» Mit dem letzten Punkt schien sie sich selbst überrascht zu haben und knöpfte hastig ihren Mantel zu.
«Wenn du mich fragst, hatte er eher Angst vor uns. Geradezu panische Angst sogar. Ich glaube nicht, dass er noch mal wiederkommt.»
Das schien Betty zu beruhigen. «Dann ist gut. Bis nächste Woche!», fügte sie fröhlich hinzu und ging. Draußen würde ihr Ehemann pflichtbewusst in seinem frisch gewaschenen Škoda auf sie warten.
Maggie war der Junge gleich bei seiner Ankunft aufgefallen. Er hatte diesen ängstlichen Blick gehabt, wie die meisten Menschen in einer ungewohnten Umgebung. Allerdings hatte er sich offenbar nicht nur wie ein Fisch auf dem Trockenen gefühlt, sondern gleich wie ein Außerirdischer auf dem falschen Planeten. Als sie früher ihre Schafe transportiert hatte, hatte sie ähnliche Mienen gesehen. Aber diesem Schäfchen fehlte die Sicherheit der Herde. Der Junge war allein gekommen, und das hatte ihre Neugier erregt.
Sie beschloss, wo sie schon mal da war, in den Zeitungen nachzulesen, was in der Welt so passierte. Es war kalt im Februar, und je länger sie blieb, desto später musste sie zu Hause den Kamin anwerfen.
Maggie hatte sich schon immer gern in der Bücherei aufgehalten. Bücher boten stets eine geheime Tür, durch die man in andere Welten flüchten konnte – wofür sie in ihrem Leben häufig dankbar gewesen war. Auch für die Bücherei war sie dankbar. Sie hatte oft einen sicheren, ruhigen Ort gebraucht, an den sie fliehen konnte, und die Bücherei hatte sie nie enttäuscht. Heutzutage kam sie aus etwas anderen Gründen. Hier war es warm, und die meisten aus dem Buchklub waren freundlich. Maggie war gern unter Leuten. Und auch wenn die Leserunde nicht die aufregendste Truppe war, hatten doch immer alle etwas zu erzählen. Maggie hatte in letzter Zeit immer häufiger festgestellt, dass sie sonst niemanden hatte, mit dem sie reden konnte. Sie plauderte noch mit den anderen Nachzüglern aus der Gruppe, bis auch sie nach Hause gingen, und setzte sich dann in die Abteilung für Zeitungen und Zeitschriften. Zuerst las sie die Schlagzeilen. Die Klatschgeschichten hob sie sich für später auf, wenn die Nachrichten sie deprimiert hatten. Für gewöhnlich schafften sie es, sie dann wieder aufzumuntern.
Kurze Zeit später war sie dermaßen in die neuesten Skandale vertieft, dass sie fast vergessen hatte, wo sie war. Ein Artikel über einen Schauspieler, der sich aus seinem Hotelzimmer ausgesperrt hatte und seine Männlichkeit nur mit einer Socke bedecken konnte, amüsierte sie derart, dass sie laut lachen musste.
«Alles in Ordnung, Maggie?», fragte Christine, die Bibliothekarin, und rückte einen Stapel bereits perfekt aufeinanderliegender Bücher zurecht.
«Ja, alles gut.» Maggie schlug schnell die Illustrierte zu.
«Schön, dass junge Leute in die Bücherei kommen. Der von vorhin hat jetzt sogar einen Ausweis. Ich werde der Gemeindeverwaltung berichten können, dass meine Plakataktion erfolgreich war.» Christine zeigte auf die Anschlagtafel, wo ein trauriges Bild von einem Teddy Kinder darüber informierte, dass Lesen Spaß machte.
«Ich meinte, gehört zu haben, dass die Bücher für seine Mutter waren?»
Christine reagierte gereizt. «Ja, streng genommen schon. Aber wenn sie erst mal hier gewesen sind, haben sie die erste Hürde genommen.»
Maggie ließ das einfach mal so stehen. Was hatte es für einen Sinn, darüber zu streiten? «Dann hoffen wir mal, dass wir ihn nicht verschreckt haben.» Sie bemerkte, wie spät es geworden war, und packte ihre Sachen zusammen. Es dauerte zwar noch eine Weile, bis ihr Bus kam, aber Christine mochte es nicht, wenn das Ende der Öffnungszeit nahte und noch Leute da waren. Maggie verabschiedete sich und ging zur Tür.
Es war dunkel draußen, und es regnete. Maggie zog den Reißverschluss ihres geblümten Regenmantels zu, hängte sich die Tasche über die Schulter und trat ins Freie. Das Dorf lag nun still da. Bei ihrer Ankunft hatte noch ein ziemliches Gewusel geherrscht. Na ja, Gewusel war vielleicht übertrieben, aber es waren einige Leute unterwegs gewesen, was für Compton Mallow schon viel war. Sie zog den Kopf zwischen die Schultern und nahm die Abkürzung durch eine Gasse zwischen zwei Cottages. Gedanklich war sie mit der Frage beschäftigt, was sie sich zum Abendessen kochen würde. Sie hatte noch einen Rest Cottage Pie, aber darauf hatte sie keine Lust. Vielleicht würde sie sich einen Toast mit Käse überbacken. Sie liebte überbackenen Toast. Der einzige Nachteil war, dass das schnell ging, und Maggie brauchte Dinge, mit denen sie ihre Zeit ausfüllen konnte.
Auf einmal hörte sie Schritte und sah auf. Eine Gestalt kam mit hochgezogenen Schultern auf sie zu. Maggie erkannte den jungen Mann, der in der Bücherei gewesen war. Sie lächelte, und beide gingen ein bisschen zur Seite, um einander passieren zu können. Der Junge warf ihr einen flüchtigen Blick zu, bevor er sich wieder ganz auf den Boden konzentrierte. Maggie fragte sich, warum er wohl zurückgekommen war.
Kurz hinter ihm folgte noch jemand. Er hatte ungefähr die gleiche Größe und den gleichen Körperbau wie der Junge, trug eine schwarze Kapuze und hielt den Kopf gesenkt. Anders als sein Vorgänger wich er aber nicht aus, sondern rempelte Maggie an, sodass ihr die Tasche von der Schulter rutschte. Und bevor sie sie wieder hochziehen konnte, spürte sie, wie er an dem Henkel zog. Instinktiv hielt sie sie fest und machte sich schwer, indem sie sich auf den Boden setzte. So konnte ihr Angreifer sie wenigstens nicht umreißen. Dass nun so ein großes Gewicht an der Tasche hing, überraschte ihn.
«Hey!», schrie sie, den Henkel ihrer Tasche weiter mit aller Kraft umklammernd, musste jedoch feststellen, dass der Kapuzentyp sie nun einfach daran den Weg entlangzerrte. In ihr stieg Wut auf. Sie liebte diese Tasche und wollte sie auf keinen Fall verlieren.
«Lass los!», zischte der Kapuzentyp, während er sich weiter ein heftiges Tauziehen mit ihr lieferte.
«Hau ab!», rief Maggie. Allmählich verlor sie den Halt. Sie hatte nicht mehr so viel Kraft in den Fingern wie früher. Und sie war in einer schlechten Position. Von unten konnte sie wenig ausrichten. Sie hörte, wie jemand angerannt kam. Womöglich ein Komplize? Als ihr Angreifer das nächste Mal kräftig an der Tasche zog, bewegte sie sich mit der Tasche nach oben und ließ sich von ihm wieder auf die Füße ziehen. Das Überraschungsmoment gab ihr genug Zeit, um auszuholen.
«Aua! Verdammt!», schrie der Zweite, der Maggies Schlag abgekriegt hatte. Und weil Maggie die Tasche jetzt nur noch mit einer Hand festhielt, riss der Dieb sie los und floh. Seine Schritte hallten durch die Gasse.
Die Fäuste im Anschlag wandte Maggie sich dem Zweiten zu. Diesmal war sie bereit zum Kampf.
Doch der andere hielt abwehrend die Hände hoch. «Ich wollte doch nur helfen!», sagte er mit schmerzverzerrter Stimme.
Maggie schaute genauer hin. Es war der Junge aus der Bücherei. Und ihm lief Blut aus der Nase. «Ich dachte, du machst gemeinsame Sache mit ihm.» Sie zeigte in die Gasse, doch der Taschendieb war längst über alle Berge.
«Nein, ich hab Sie schreien hören, darum bin ich zurückgekommen.»
«Hier bitte», sagte sie und zog Papiertaschentücher aus der Manteltasche. «Du blutest.»
«Ja, ich hab den Schlag voll abbekommen.»
Maggie zog eine Grimasse. «Tut mir leid. Leg den Kopf in den Nacken.»
Er tat es, und sie hielt ihm die Nase zu. «Au, das tut weh.»
«Stell dich nicht an. So hört es auf zu bluten. Komm, lass uns das mal bei Licht anschauen.» Sie führte ihn zurück zur Bücherei.
Christine ordnete gerade einen Stapel Zeitungen und legte die, deren Schlagzeile die Schließung von Büchereien verkündete, ganz nach unten. «Hast du einen Erste-Hilfe-Kasten, Christine?», rief Maggie und schob den Jungen beherzt in ihr Sichtfeld.
«O mein Gott. Was ist passiert?»
«Sie hat mir eine –»
«Mir wurde die Handtasche geraubt, und er ist mir zu Hilfe gekommen, hat dabei aber einen Schlag abbekommen», sagte Maggie und zwinkerte dem Jungen zu, was ihn zu erschrecken schien.
«Oh, Maggie, geht’s dir gut?»
«Ja, mir geht’s prima. Das meiste hat er abbekommen.»
«Was für ein Held du bist!», sagte Christine und führte den Jungen herein. «Setz dich. Ich hole den Verbandskasten. Aber versuch bitte, den Teppich nicht vollzubluten.» Christine verschwand in einem kleinen Nebenraum.
Maggie und der Junge wechselten Blicke.
«Ich bin Maggie», sagte sie. «Und es tut mir wahnsinnig leid, dass ich dich getroffen habe.» Sie hielt ihm eine Hand hin. Er zögerte, bevor er sie nahm.
«Tom. Ich hab nicht vor, Sie wegen Körperverletzung anzuzeigen, falls Sie sich deswegen Sorgen machen.»
Darüber hatte sie keine Sekunde nachgedacht. In was für einer klagefreudigen Gesellschaft sie doch lebten. «Ich dachte eher, dass es dir bestimmt peinlich ist, von einer Rentnerin verprügelt worden zu sein.»
Tom schien zu überlegen. «Guter Punkt.»
«Ich werd’s nicht weitersagen, versprochen.»
«Danke», sagte er und brachte seinen Kopf wieder in eine normale Position.
Christine kehrte mit Mullkompressen und Verbandszeug zurück. «Hat es aufgehört zu bluten?», fragte sie und betrachtete prüfend den Teppich.
«Ja. Ihm geht’s wieder gut. Oder?», fragte Maggie.
Tom nahm die blutgetränkten Taschentücher von seiner Nase und erschrak bei dem Anblick. «Glaub schon.»
«Wir sollten die Polizei rufen», sagte Christine und griff bereits nach dem Telefon.
«Nein, nicht nötig. Es war nichts Wertvolles in der Tasche. Nur meine Seniorenkarte für den Bus und meine Brille, oh, und das olle Buch für nächste Woche. ’tschuldigung.»
«Schon gut», sagte Christine, doch ihre Miene sagte etwas anderes. «Sonst noch was?»
Maggie dachte nach. «Ein neues Päckchen Kaugummi und ein Geldbeutel mit ungefähr vierzig Pence drin.»
«Was ist mit Kreditkarten?», fragte Christine, den Hörer schon in der Hand.
«Hab keine.» Maggie nahm ein Desinfektionstuch aus dem Verbandskasten und wollte Tom das Blut um die Nase abwischen wie eine Mutter einem Kleinkind. Doch er riss ihr das Tuch aus der Hand und betupfte vorsichtig sein Gesicht.
Christine stand mit enttäuschter Miene über dem Telefon. «Aber er ist verletzt!»
«Ihm ist nichts passiert», sagte Maggie.
«Ihm ist wahrscheinlich nichts passiert», sagte Tom, die blutigen Taschentücher bestaunend.
«Und was ist mit dir, Maggie?», fragte Christine mit einem hoffnungsvollen Unterton.
Maggie hielt kurz inne, blickte an sich herab und zog Bilanz: «Ich krieg blaue Flecken am Hintern, und mein Mantel ist nass und schmutzig, ansonsten bin ich heil geblieben.»
«Oh.» Christine war noch enttäuschter. Sie schaute auf die Uhr. «Wenn wir die Polizei nicht einschalten, sollte ich jetzt mal nach Hause gehen. Alf wird sich wundern, wo ich bleibe.»
«Ja, ich muss auch los», sagte Maggie, denn ihr wurde gerade bewusst, dass sie nun ohne Busticket zu Fuß nach Hause gehen musste.
«Okay», sagte Christine und räumte fröhlich alles wieder in den Verbandskasten.
«Kann ich ein neues Exemplar unserer Lektüre für nächste Woche bekommen?», fragte Maggie.
Christines Lächeln wirkte ein wenig verkrampft, als sie es ihr überreichte und die beiden dann eilig aus der Tür komplimentierte. «Dann bis nächste Woche, Maggie. Und ich hoffe, dich sehe ich auch bald wieder.» Sie winkte Tom zu, und er zuckte erschrocken zurück.
Tom und Maggie blieben draußen vor der Bücherei stehen und schauten Christine dabei zu, wie sie in ihren Mini stieg und davonfuhr.
«Alf ist ihr Kater», sagte Maggie. Tom grinste breit. Es war das erste Mal, dass er lächelte, und es veränderte sein Gesicht völlig. Es brachte eine andere Version von ihm zum Vorschein, die sich in seinem Innern versteckte und auf einen sicheren Moment wartete, um sich hervorzuwagen. Auch Maggie lächelte. «Entschuldige noch mal. Auf Wiedersehen.» Sie wandte sich um und wollte sich auf den Heimweg machen.
«Sind Sie vorhin nicht in die Richtung gegangen?», fragte Tom mit hochgezogenen Augenbrauen.
«Ja, schon, aber dieser Arsch hat mein Seniorenticket geklaut, darum gehe ich zu Fuß nach Hause.» Sie zog ihre Kapuze auf, weil der Regen gerade stärker wurde.
«Wo wohnen Sie denn?», fragte er.
«Draußen bei Furrow’s Cross.»
Seine Augen weiteten sich. «Das dauert ja ewig.» Tom griff in seine Hosentasche und zog einen Fünf-Pfund-Schein heraus. «Hier.» Er drückte ihn Maggie in die Hand. «Und ich bringe Sie zur Bushaltestelle.»
«Nein, das kann ich nicht annehmen.»
Tom machte einen Schritt zurück, damit sie ihm das Geld nicht zurückgeben konnte. «Aber Sie müssen auf sich aufpassen. Hier laufen Brutalos rum …», er machte eine Pause, und sie nickte, «die schlagen sofort zu, wenn ihnen einer zu Hilfe kommt.»
«Wie gesagt: Es tut mir sehr leid.» Dieser Junge hatte etwas an sich, das ihr gefiel.
Sie grinsten sich an und liefen die Gasse entlang, Tom voran. Ihre Schritte bildeten einen gleichmäßigen Takt.
Als sie an der Bushaltestelle ankamen, flüchteten sie vor dem Regen unter das Dach.
«Danke dafür», sagte Maggie und hielt den Geldschein hoch. «Ich geb es dir wieder.»
«Hat keine Eile.»
Der Regen, der auf das Dach trommelte, klang wie leiser Applaus. Zwischen den beiden entstand eine unbehagliche Stille; sie schauten sich an und wussten nicht, was sie noch sagen sollten. Aber der herannahende Bus rettete sie.
«Dann auf Wiedersehen!», sagte Tom und wandte sich zum Gehen.
«Sehen wir uns nächste Woche in der Bücherei?»
«Ich weiß nicht. Vielleicht.»
«Wenn du kommst, kann ich dir das Geld zurückgeben.»
Er schien darüber nachzudenken. «Ach, das ist egal.»
Sie stieg ein und zahlte beim Fahrer. Sie setzte sich ans Fenster und schaute Tom nach. Als der Bus an ihm vorbeifuhr, blickte er hoch. Sie hob die Hand, und er nickte ihr kurz zu. Was für ein Samstag! Jemand hatte sie ausgeraubt. Das war das Aufregendste, was ihr seit Jahren passiert war.
3Tom
«Haben wir irgendwas zu essen da?», rief ich mit der Nase noch halb im Küchenschrank. Ich hatte einen Bärenhunger, aber wann hab ich den nicht. Den Kühlschrank hatte ich schon inspiziert, aber da waren nur Milch, Mayonnaise, Bier und irgendein nicht mehr ganz koscher aussehender Käse drin. Als Mum noch lebte, war das anders. Damals gab es immer was zu essen im Haus. Ich wünschte, wir hätten Kuchen da oder wenigstens irgendwas Anständiges.
Dad erschien in der Tür. «Du warst doch vorhin draußen. Wo sind denn die Sachen, die du eingekauft hast?»
Ich schätzte, dass Dad sauer werden würde, wenn ich ihm erzählte, ich hätte das Geld verschenkt, auch wenn ich es einer alten Dame gegeben hatte. Also dachte ich mir schnell was aus. «Hab ich schon verputzt.»
«Verdammt, Tom. Du frisst mir ja die Haare vom Kopf. Das ist nicht normal.»
«Ist es wohl!» Das weiß ich ganz sicher. Die wenigen Freunde, die ich habe, erzählen nämlich auch immer, ihre Eltern würden über die Mengen klagen, die sie verdrücken. Sobald sie die Einkäufe auspacken, fallen sie darüber her wie die Heuschrecken. «Was kann ich jetzt noch essen?» Mein Blick flog über die Dosentomaten im Schrank. Wir aßen nie Dosentomaten. Wofür waren die eigentlich? Wahrscheinlich längst abgelaufen.
«Toast.» Dad bewarf mich förmlich mit der Packung. Das würde reichen müssen. Ich steckte zwei Scheiben in den Toaster. «Du musst dir mal klarmachen, was das alles kostet.» Dad schüttelte den Kopf. Das macht er oft. «Ich bin froh, wenn du eines Tages arbeiten gehst», sagte er.
Ich schnaubte. «Das dauert aber noch ein paar Jährchen.»
Dad guckte pikiert. «In deinem Alter hab ich schon voll gearbeitet.» Er redet gern über die gute alte Zeit, die, um ehrlich zu sein, ätzend klingt. Kein Internet, keine Handys und nur vier Fernsehprogramme – das ist nicht das, was ich mir unter gut vorstelle.
«Ich trage Zeitungen aus.»
Jetzt schnaubte Dad. «Ein paar Tage die Woche. Das ist keine Arbeit. Aber wenn du mit der Schule fertig bist, musst du was in Aussicht haben.»
Ich starrte ihn an, denn ich glaubte nicht, dass er zu Scherzen aufgelegt war. Der Toast sprang hoch und beendete das Standbild. «Aber ich mach Abi und will danach studieren.» Mir war klar, dass ich mich dafür noch echt ins Zeug legen musste, aber trotzdem, heutzutage studieren doch alle. Oder?
Dad schüttelte weiter den Kopf. «Das kann ich mir nicht leisten.»
«Dann nehm ich einen Studienkredit auf.»
«Tom, hast du irgendeine Vorstellung davon, wie viel es kostet, für dieses Haus aufzukommen?»
Aus gegebenem Anlass schaute ich mich noch mal genauer in unserer düsteren kleinen Küche um. «Keine Ahnung. Aber wenn ich nicht mehr hier bin und alles aufesse, sparst du doch jede Menge Geld.»
«Jetzt spiel hier nicht den Schlaumeier. Ich arbeite mir den Arsch ab, um dir ein Dach über dem Kopf zu finanzieren.»
«Und was für eins», grummelte ich. Aber sobald es über meine Lippen war, wusste ich, dass ich damit die Lunte eines Feuerwerks entzündet hatte.
Dad ließ sich einen Moment Zeit, bis er so richtig auf hundertachtzig war, bevor er eine Schimpftirade auf mich losließ. Ich blendete mich aus. Das ist ein bisschen so, wie imaginäre Kopfhörer aufzusetzen. Ich hab das alles schon tausendmal gehört – es ist echt langweilig. Und ich streite nicht gern mit Dad.
Ich butterte meinen Toast und aß ihn in der Hoffnung, dass er bald aufhören würde, mich anzubrüllen.
«Hörst du mir überhaupt zu?» Sein Kopf hatte einen ungesunden Rotton angenommen.
«Ja. Ich bin undankbar. Du machst alles. Ich mache nichts. Wir haben kein Geld.» Eine angemessene Zusammenfassung, wie ich fand.
Alle Mann zurücktreten; Rakete Nummer zwei ist bereit zum Abschuss. «Jetzt werd bloß nicht frech, Freundchen!» Er schwang den Zeigefinger in meine Richtung. «Du wirst dich umsehen, Tom. Ich weiß nicht, wie lange ich diese ganzen Rechnungen noch bezahlen kann. Du musst echt aufwachen.» Er nahm eine Flasche Whisky aus dem Schrank, starrte sie finster an, weil nur noch ein kleiner Rest darin war, und kippte ihn in ein Glas. Ich hab ihn irgendwann mal probiert, als er bei der Arbeit war. Schmeckt ekelhaft.
Er blickte mich wütend an, während er seinen Whisky trank. «Hast du dich mit jemandem angelegt?»
«Nein», sagte ich reflexartig und merkte erst dann, worauf er anspielte.
«Du hast ein Veilchen am Auge.» Er zog die Augenbrauen hoch.
«Bin hingefallen.» Ich weiß nicht, warum ich log. Ich hatte allmählich das Gefühl, dass ich ohnehin nichts richtig machen konnte. Er schnalzte mit der Zunge und schüttelte wieder den Kopf.
Dann trank er sein Glas leer und ging hinaus. Ich machte mir noch zwei Scheiben Toast und nahm sie mit auf mein Zimmer. Danach vergingen schätzungsweise ein paar Stunden, in denen ich auf der Xbox spielte. Jedenfalls zuckte ich zusammen, als Dad plötzlich die Tür aufriss. Er fiel fast in mein Zimmer. Er war rot im Gesicht und verschwitzt, und er brüllte rum, aber ich konnte nicht ganz verstehen, was er sagte. Er war außer sich. Ich zog meine Stecker aus den Ohren.
«Ist alles in Ordnung?», fragte ich.
«Nein, nichts ist in Ordnung, verdammt noch mal.» Er lallte. Ich hasse es, wenn er trinkt. Er stach mit dem Finger auf den Fernsehbildschirm ein, mein Spiel hatte ich angehalten. «Das! Das ist das Problem.» Er stolperte, und ich musste lachen. Ich konnte nicht anders. «Du könntest arbeiten, aber nein, dazu bist du zu faul. Du sitzt auf deinem Hintern und vergeudest deine Zeit … mit … mit dem hier.» Er kam nicht auf das Wort, das er suchte, und ich musste mir auf die Zunge beißen, um nicht wieder zu lachen. Diesmal war es nicht lustig, aber ich glaube, es ist Nervosität, wenn ich manchmal in unangemessenen Situationen kichern muss. Er starrte mich an und forderte mich quasi heraus, in Lachen auszubrechen. «Das findest du lustig, ja?»
«Nein.»
«Nein … weil es nicht lustig ist.» Ich glaube, er hoffte, dass ich «doch» sagen würde. «Und ich zeig dir jetzt, was noch alles nicht lustig ist.» Er taumelte zur Spielekonsole, riss die Kabel heraus und hob die Box hoch.
«Hey! Was soll das?» Ich hatte meinen Fortschritt nicht gespeichert.
«Es wird Zeit, dass du erwachsen wirst! Dass du aufhörst zu spielen und rausfindest, wie das echte Leben aussieht.»
«Was, soll ich mir jetzt einen Job suchen?» Ich schaute auf den Wecker. «An einem Samstag, kurz vor Mitternacht?»
«Das liegt bei dir. Auf jeden Fall bleibt das hier bei mir, bis du es machst», sagte er mit einem fiesen spöttischen Grinsen, wie ein klassischer Disney-Bösewicht.
Meine Xbox war mein Leben. «Ist das dein Ernst?», brachte ich hervor. «Jetzt sei kein Arsch.»
Seine Miene veränderte sich und zeigte plötzlich einen Ausdruck, den ich noch nie an ihm gesehen hatte. Irgendwie beängstigend. «Wie hast du mich gerade genannt?», brüllte er.
«Ich hab dich gar nichts genannt.» Zum zweiten Mal an diesem Tag hielt ich die Hände hoch, um zu signalisieren, dass ich nicht auf Streit aus war.
«Ich – hab – gefragt – wie – du – mich – genannt – hast.» Er kam näher, die Konsole hielt er so fest umklammert, dass seine Fingerknöchel weiß anliefen. Ein starker Kontrast zu seinem dunkelroten Gesicht.
«Das war mehr ein Rat. Ich sagte: ‹Sei kein Arsch.›»
Er drehte sich um und ging, und ich atmete auf. Doch meine Erleichterung war nur von kurzer Dauer, denn dann hörte ich, wie etwas die Treppe hinuntergeworfen wurde. Ich sprang vom Bett auf und war mit zwei Schritten am Treppenabsatz. Dad stützte sich am Geländer ab und sah hinunter. Meine Xbox hielt er nicht mehr in der Hand.
Ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben schon mal so sauer war wie in diesem Moment. Ich hätte ihn am liebsten hinterhergeworfen. Ich hatte mein ganzes Geld vom Zeitungsaustragen, vom Geburtstag und von Weihnachten gespart, um mir die Konsole zu kaufen. Ich bebte vor Zorn, aber ich wollte ihm nicht zeigen, wie sehr mir das unter die Haut ging. Also zuckte ich nur die Achseln, ging zurück in mein Zimmer und schloss die Tür. Ich wartete eine Zeit lang, weil ich damit rechnete, dass er zurückkommen und mich anschreien würde, um eine Reaktion zu provozieren, doch er tat es nicht.
Ich reagierte meinen Frust ab, indem ich in meine Kissen boxte. Meine Xbox. MEINE VERDAMMTE XBOX! Was fiel ihm ein? Und noch wichtiger: Was zum Teufel sollte ich jetzt mit meinem Leben anfangen?
Am Sonntag war ich früh auf, weil ich die Zeitung austragen musste. Von Dad war keine Spur zu sehen. Nur eine leere Flasche im Wohnzimmer und die Plastiktrümmer meines Lebens unten an der Treppe. Ich ignorierte beides und verließ das Haus. Die kalte Morgenluft trug ebenso wenig dazu bei, meine Laune zu heben, wie die Extrabeilagen in den Zeitungen, mit denen ich schwer beladen war.
Als ich zurückkam, herrschte Stille im Haus. Einen Augenblick lang fürchtete ich, er könnte tot sein. Man hört ja manchmal von so was. Von Leuten, die sich derart betrinken, dass sie an ihrer eigenen Kotze ersticken. Ich eilte nach oben und öffnete seine Schlafzimmertür – meine Hand zitterte. Der Geruch war widerlich. Ich erinnerte mich an die Zeit, als das noch das Schlafzimmer meiner Eltern gewesen war. Damals war ich da reingerannt und aufs Bett gesprungen und hatte mich zwischen die beiden gekuschelt. Damals hatte es dort noch geduftet. Ein bisschen wie ein blumiger Weichspüler, so ähnlich wie Mum. Nach zu Hause hatte es gerochen. Aber davon war nichts mehr übrig. Alles war still. Mein Vater bildete einen reglosen Hügel im Bett. Ich wartete an der Tür, unsicher, was ich tun sollte. Schließlich hörte ich, wie er die Luft ausblies. Er lebte also. Ich schloss die Tür wieder und zog mich in mein Zimmer zurück.
Dort starrte ich erst mal lange auf den schwarzen Fernsehbildschirm, bis ich das Gerät einschaltete und feststellte, dass es nichts gab, was ich sehen wollte. Sky oder Netflix oder sonst irgendwas Interessantes konnten wir uns nicht leisten. Und ohne meine Konsole konnte ich nicht mal Clips von Game of Thrones auf YouTube sehen. Ich schaltete den Fernseher aus und ließ die Fernbedienung aufs Bett fallen. Mein Blick wanderte durchs Zimmer. Bett, Schrank, Regal und Fernseher. Nicht viel. Mein Rucksack stand auf dem Boden, und ich hob ihn aufs Bett. Er war echt schwer. Ich kippte die Bücher aus der Bücherei aus. All die blöden Liebesschmöker. Wo sollte ich damit hin, bis ich sie zurückbringen konnte? Wenn Dad sie sah, würde er sich nicht mehr einkriegen.
Ich stapelte sie hinter der Tür, das mit dem besten Cover zuoberst. Verstand und Gefühl. Ich nahm es in die Hand, drehte es um und las den Text auf dem Buchrücken. Klang halbwegs interessant. Ich schlug es auf und überflog die erste Seite – weil ich buchstäblich nichts Besseres zu tun hatte.
Ein paar Stunden später hörte ich, wie Dad die Dusche anstellte. Wenn ich heute was zu essen haben wollte, würde ich mich selbst darum kümmern müssen. Und wenn ich Dad aus dem Weg gehen wollte, musste ich jetzt sofort essen. Widerstrebend legte ich das Buch unter mein Kissen und ging in die Küche.
Ich fand eine Dose mit Nudeln in Tomatensoße, erhitzte den Inhalt in der Mikrowelle und aß ihn auf Toast.
Dad sah unwirsch aus, als er in die Küche kam. Er stellte den Wasserkocher an und ging schnell wieder, damit er den Lärm nicht ertragen musste. Ein Zeichen für einen ausgewachsenen Kater. Als das Wasser gekocht hatte, kam er wieder reingeschlichen und machte sich einen Kaffee. Ich stellte mein schmutziges Geschirr in die Spüle.
«Willst du das nicht abwaschen?»
Ich machte immer den Abwasch, aber heute hatte ich keine Lust. «Später.» Ich versuchte, mich an ihm vorbeizuschieben, doch er hielt mich am Arm fest. Ich schaute ihn nicht an.
«Tom, ich hab das zu deinem Besten gemacht.»
Das brachte mich richtig auf die Palme. «Wie kann es zu meinem Besten sein, wenn du das einzig Gute in meinem Leben schrottest?» Er hatte immer eine Ausrede. Immer eine Rechtfertigung für alles, was er tat. Wenn ich mich so verhalten hätte, hätte er gesagt, dass ich keine Verantwortung für mein Handeln übernahm. Aber wenn er so was machte, geschah es zu meinem Besten. Das war echt supernervig. Mein Ton überraschte ihn. Normalerweise regte ich mich nicht auf.
«Das ist nur Spielerei.» Er zuckte die Achseln und ließ mich los.
Meine Xbox war nicht nur eine Spielekonsole für mich – sie war mein Sozialleben und meine Fluchtmöglichkeit. Aber es hatte keinen Sinn, ihm das zu erklären. Es kümmerte ihn nicht, nicht mehr. Seit Mum tot war, kümmerte ihn nichts mehr so richtig.
4Maggie
Maggie bürstete ihr Haar aus und staunte, wie buschig es geworden war. Es war schon immer dick und lockig gewesen, aber jetzt, wo es grau wurde, hatte die Formulierung «schwer zu bändigen» eine neue Dimension bekommen. Sie band ihre Mähne zu einem unordentlichen Knoten zusammen und steckte sie mit einem Clip fest. Der Knoten würde nicht lange halten, aber das war egal; heute würde sie ohnehin niemand sehen.
Dieser Mittwoch hatte das Potenzial, ein guter Tag zu werden. Sie hatte einiges zu erledigen. Da waren die täglichen Pflichten wie das Versorgen der Hühner und Schafe, aber sie musste heute auch den Zaun ausbessern, und wenn sie noch einen Rest von der letztjährigen Ernte in der Kühltruhe fand, würde sie einen Rhabarber-Crumble backen.
Aus den Eiern, die ihr «die Mädels», wie sie ihre Hühner gern nannte, freundlicherweise gelegt hatten, machte Maggie sich Rührei zum Frühstück. Dann räumte sie auf, zog sich eine Jacke und Gummistiefel an und trat nach einem kurzen Streit mit der Hintertür hinaus. Wie ein großer Teil des alten Farmhauses war die Tür nicht mehr gut in Schuss und hätte ein bisschen liebevolle Zuwendung gebrauchen können. Draußen ging ein starker Wind und schüttelte die Apfelbäume kräftig durch. Nachdem Maggie am Wasserhahn einen Eimer gefüllt hatte, marschierte sie damit nach unten zur großen Wiese, wo ihr der Wind um die Ohren pfiff. Sie war froh um den Lärm, denn die meiste Zeit herrschte Stille in ihrem Leben.
Der Mittwoch war immer am schlimmsten. Dann hatte sie schon seit Tagen niemanden mehr gesehen, und bis zum Samstag war es noch lang hin. Diese Woche hatte sie den Vorteil gehabt, dass sie über die aufregenden Ereignisse des vergangenen Samstags nachdenken konnte. Was für ein Abenteuer das gewesen war. Die Erinnerung an das, was in dieser Gasse passiert war, hatte ihren Kopf beschäftigt, und dafür war sie dankbar. Sie wusste, dass sie Glück gehabt hatte. Ihr tat zwar noch alles weh, aber nicht mehr so schlimm wie am Sonntagmorgen, als sie sich aus dem Bett rollen musste, weil jeder einzelne Muskel schmerzte. Der Bluterguss an ihrem Hintern schillerte inzwischen in allen Farben, aber es hätte auch schlimmer ausgehen können. Sie hatte noch nie zu den Menschen gehört, die die Folgen ihres Handelns bis ins Letzte durchdachten. Sie gehörte eher zu denen, die einfach lossprangen und erst dann überlegten, wo sie landen konnten. Leichtsinnig hatte ihre Mutter sie genannt. Und ihr Ehemann stur wie ein Esel. Maggie war sauer, dass sie ihre Tasche eingebüßt hatte, und die ganze Aktion zeigte ihr, dass sie nicht mehr gut in Form war. Sie war beweglich – dafür sorgte ihr tägliches Yoga –, doch sie hatte nicht genug Kraft, und ihre Reflexe waren auch nicht mehr das, was sie mal waren. Letzteres erstaunte sie deshalb, weil sie doch täglich mit Colin zu kämpfen hatte.
Maggie wappnete sich und klopfte an das Gatter. Colin war ein junger Jakobschafbock. Sein Kopf schoss hoch, und er beäugte sie geringschätzig. Maggie machte ihn immer als Erstes auf sich aufmerksam, weil er noch aggressiver war, wenn er überrascht wurde. Er wackelte mit dem Kopf, als wollte er sich warm machen für einen Kampf. Dann senkte er sein Haupt und präsentierte herausfordernd seine kräftigen Hörner.
Sie löste das ausgefranste Seil von dem Torpfosten, öffnete das Gatter und huschte mit dem Eimer hinein. Dann goss sie das Wasser in seinen Trog und drehte sich zu ihm um. Colin kam über die Weide auf sie zugestürmt, und sie hielt schützend den Eimer vor sich. Colin prallte daran ab und zog sich zurück, um eine zweite Attacke vorzubereiten.
Ein Farmer aus ihrem Bekanntenkreis hatte ihn von Hand aufgezogen, und sie hatte ihn ausgeliehen, damit er ihre Mutterschafe bespringen konnte. Das war im August gewesen, und acht Monate später kapierte sie langsam, warum sein Besitzer es nicht eilig hatte, ihn zurückzubekommen. Colin war immer wütend und leicht verstört. Maggie eilte von der Weide und schloss das Tor gerade in dem Moment hinter sich, als Colin krachend dagegenstieß. Jeden Morgen dasselbe Spiel.
Zu dieser Jahreszeit musste Maggie die Mutterschafe sorgfältig untersuchen. Sie kreuzte Jakobschafe mit Poll Dorsets, um British Lavenders zu züchten, die ein wunderschönes Fell hatten. Sie hoffte, dass einige aus ihrer Herde trächtig waren und bald ablammen würden. Vorausgesetzt, Colin hatte es geschafft, seine Feindseligkeit lange genug abzulegen, aber sie war nicht sicher, ob er auf den Dreh gekommen war. Wie viele Lämmer es wurden, war ihr egal – jedes einzelne war ein Bonus, solange es gesund auf die Welt kam. Es herrschten milde Temperaturen, was ein Segen für die Lammzeit war. Sie hatte schon zu viele Nächte in der Kälte verbringen müssen, und vor ein paar Jahren hatten zwei Mutterschafe ihre Lämmer im Schnee zur Welt gebracht. Die Schafe ernährten sich von dem Gras und den Wildkräutern, die auf den Weiden wuchsen.
Maggie pfiff, und die Schafe blickten alle hoch und brauchten einen Moment, um zu begreifen, wer da war, dann kamen ihre drei Lieblinge angesprungen. Sie hießen Barbara, Nancy und Dolly. Schafe waren ziemlich dumm oder zumindest nicht in der Lage, auf individuelle Namen zu reagieren. Das hatte Maggie jedoch nicht davon abgehalten, viel Zeit auf die Auswahl zu verwenden.
Seit Samstag dachte sie viel über ihren Sohn nach. Sie