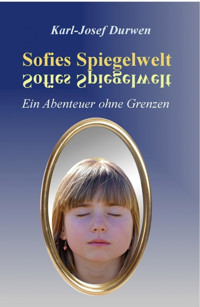
6,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Rätselhaftes dringt durch ein vermeintliches Computerspiel zunehmend in die Welt der Schwestern Iris (15) und Elena (13) ein: Sie werden in Parallelen zu "Sofies Welt" verstrickt und in die virtuelle Spiegelwelt Ureda versetzt. Die Mädchen verlieren Raum, Zeit und Identität, gewinnen aber eine Sicht der Welt, die Grenzen überwindet und Philosophie, Religion und Naturwissenschaften zusammenführt. Philosophie wird spannend erlebt, gewitzt gespiegelt und zeitgemäß entwickelt. Fantasie wird mit Fakten und Lockerheit mit Anspruch vereint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Der Roman
ist inspiriert von Jostein Gaarders „Sofies Welt“. In die Erlebnisse der Schwestern Iris (15) und Elena (13) - die Grenzen überschreiten und Welten verbinden - sind Handlungsfäden mit diesem Roman verwoben und Motive werden gespiegelt.
Philosophie wird jedoch nicht geschichtlich nacherzählt, vielmehr erlebt, vielfältig verknüpft und im Hinblick auf die Herausforderungen der Gegenwart entwickelt. Eine Entwicklung (die Wende aus der Kindheit) durchleben auch die Mädchen. Nicht zuletzt durch ein vermeintliches Computerspiel, das sie in Kontakt zu ihren virtuellen Spiegelschwestern bringt.
Diese sind die letzten Schülerinnen der Philosophieschule Ureda. Sie finden dort Sofies Zwinkerspiegel, ein Duplikat der Majorshütte und darin ein Manuskript, in dem sie selbst Hauptfiguren sind.
Die Schwesternpaare wollen hinter die Kulissen ihrer Existenz blicken, was – soweit dies möglich ist – gelingt: Ganz praktisch im Verlauf der Handlung, vor allem aber im übertragenen Sinne; dem Gewinn von Erkenntnis.
Das geschieht durch ihre Erlebnisse und die Gespräche mit ihrem Lehrer Wendur, in denen spontane, spitzzüngige, mitunter provozierende Jugendsprache auf die gerne dozierende, jedoch auch augenzwinkernd und bildhaft erklärende des alten Meisters trifft.
Im Hin und Her der Spiegelungen geht es um Raum und Zeit, Materie und Geist, Zufall und Notwendigkeit, Glauben und Wissen, Realität und Fantasie, Sein und Bewusstsein, Können und Verantworten.
Letztlich wird auf abenteuerlichen und unterhaltsamen Wegen eine zukunftsfähige, ganzheitliche Weltsicht entdeckt.
Der Autor
ist emeritierter Professor, hat zwei Töchter, lebt mit seiner Frau und Morbus Parkinson in der Region Stuttgart und ist der Meinung, dass das genug an Selbstdarstellung ist.
Karl-Josef Durwen
Sofies Spiegelwelt
Roman
© 2019 Karl-Josef Durwen
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7482-9623-2
Hardcover:
978-3-7482-9624-9
e-Book:
978-3-7482-9625-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http: //dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Teil I - Gefangen im Netz
Ein Fall und die Folgen
Data hat Angst
Heureka
Sofies Welt
Alles nur ein Spiel?
Die vierte Dimension
Wunderwelt
Zwischen gestern und morgen
Zeitig zurück
Hinter dem Spiegel
Zurück in der Zukunft
Die Erfindung der Zeit
Voraus in die Vergangenheit
Warten auf Gestern
Marionetten
Teil II - Spiegelbilder
Der Zwinkerspiegel
Der ungehörte Knall
Das geheime Turmzimmer
Beweggründe
Das Kartengeheimnis
Der Mann vom Turm
Zweifel
Gespaltene Welt
Reisen durch Raum und Zeit
Teil III — Wendezeit
Der neue Ton
Der allwissende Dämon
Notwendiger Zufall
Dass ich Eins und doppelt bin
Das Rätsel im Turmzimmer
Alberto
Auf verschlungenen Wegen
Sohn des Schlächters und der Nonne
Das Staunen der Welt
Der stumme Ochse, der brüllte
Der Glaube siegt
Wie aus einer anderen Welt
Im Band der Möglichkeiten
Verrat
Ein dunkles Wort
Teil IV - Der Rubikon-Effekt
Bewusst sein im Netz
Denkweb
Über den Tod hinaus
Die Seelenkette
Am Rubikon
Briefgeheimnis
Wahn-Sinn
Der Geist in der Materie
Schrödingers Katze
Bruno aus der Kiste
Im Möglichkeitsraum
Teil V - Das Buch der Wandlung
Das Spiel
Post für Hilde
Spiegel im Spiegel
Auf der Spur
Interstellare Beziehungskisten
Android, Cyborg und Mensch
Das Wunder
Der werdende Gott
Chat mit Data
Pingpong mit schwarzen Boxen
Das Gefühl für die Welt
Neues aus dem Jenseits
Der Traum des Schmetterlings
Teil I - Gefangen im Netz
Ein Fall und die Folgen
»Nein, nein, nein!« schreit sie im Sturz, im endlosen Fall, den kein Armrudern bremst. Ein Schlag gegen die Hand: Schmerz, Erwachen, Angstschweiß.
An Wiedereinschlafen ist nicht mehr zu denken, dafür sitzt die Beklemmung zu tief. Zudem dieses Klappern, das nicht geträumt sein kann. Ach, Kuschel! Iris knipst das Licht an, nimmt das Meerschweinchen aus dem Stall, um ihre Angst wegzustreicheln.
Ob so ein Tier auch träumt und Angst hat? Richtige Angst, nicht nur Erschrecken? Sogar die vor dem Tod? Das Mädchen denkt darüber nach, vermutet, dass man sich nicht vor etwas fürchten kann, was man noch nie erlebt hat und wovon ein Tier nichts wissen kann? »Du hast es gut«, flüstert Iris der Meerschweinchendame ins Ohr und krault sie sanft.
Zehn nach Fünf, liest sie auf der Uhr. Noch eine Stunde bis zum Aufstehen. Blöde Schule! Sie greift zu ihrem aktuellen Schmöker. Darin fürchtet sich dieser Zweiblum nie. Er läuft als Tourist auf der Scheibenwelt herum, findet alles toll und besteht locker die irrsten Abenteuer, weil er nie eine Gefahr sieht. Dagegen ist sein Freund Rincewind ein echter Feigling. Und Cohan, der alt gewordene Barbar, bewältigt seine Angst, weil er Heldentaten vollbringen muss.
Typisch die Szene, die sie gerade liest: Die Druiden wollen ein Mädchen opfern. Zweiblum tritt wie selbstverständlich in den Kreis der Priester und macht sie in aller Höflichkeit darauf aufmerksam, dass man den Göttern auch Beeren und Nüsse anbieten könne. Cohan dagegen sondiert die Lage und entwickelt seinen Plan (mangels Zähnen undeutlich): „In Tempel ftürmen, die Priefter erledigen, Gold ftehlen, Mädchen retten und abhauen.“ Rincewind antwortet: „Ich schlage vor, wir beschränken uns auf den letzten Punkt.“
Die Umstände, denkt Iris, sind für alle gleich, ihre Empfindungen aber völlig verschieden. Angst ist nicht wie Durst, hängt wohl von der Einstellung ab. Vielleicht auch von dem, was man Bewusstsein nennt. Das besitzen, so hieß es in der Schule, nur Menschen. Aber ob das stimmt? Lehrer reden zwar klug daher, wissen jedoch längst nicht alles. Bestimmt hat Kuschel ein Bewusstsein, so klug wie sie ist!
Soll sie ihren Vater fragen? Der liest ja sogar Bücher über Philosophie. Aber nein, lieber nicht; denn eigentlich spricht sie nie richtig mit ihm. Höchstens mal über Computer. Als Fünfzehnjährige mit dem Vater zu reden, ist verdammt schwer; noch dazu über Angst.
Warum auch? Der Traum ist vorbei. Zudem sind, wie üblich, noch nicht alle Hausaufgaben gemacht. Fünfzehn Minuten dafür, statt zu frühstücken, müssen reichen.
Am Abend nahm Iris eines ihrer Dauerbäder, die der Vater nicht schätzt: wegen Wasser- und Energieverbrauch, Kosten und Umweltschutz. Duschen soll sie, als ob das ein Genuss wäre! Er ist eben ein Grüner.
Nach dem Bad verspürte sie Hunger, machte sich auf zum Kühlschrank, nahm Käse und Wurst heraus. Dann dachte sie an die letzte Nacht und daran, dass ihre Mutter schon mehrfach gesagt hatte, vom späten Essen bekäme man schlechte Träume. So ließ sie alles stehen und verzog sich auf ihr Zimmer.
Noch bevor sie es erreichte, hörte sie den Vater aus dem Wohnzimmer kommen und war sich sicher, dass er die Lebensmittel in den Kühlschrank zurückstellen, das Geschirr in die Spülmaschine geben und das Küchenlicht löschen würde. Sie wusste ja, dass er die Unordnung hasst, die sie ständig verbreitet. Und eigentlich hatte sie auch alles wegräumen wollen; ganz bestimmt!
Im Zimmer lief der Computer. Rasch hatte Iris das Textprogramm geladen, um weiter an der begonnenen Weltraumstory zu schreiben. Denn liebend gern dachte sie sich Geschichten aus. Noch den Kopfhörer aufgesetzt, dann füllte Rock die Ohren und Captain Picard von der Enterprise ihre Fantasie.
Plötzlich hörte sie eine Stimme, die „bewusst sein“ sagte, blickte zur Zimmertür, doch war allein. Sollte etwas in die Musikaufnahme geraten sein? Rasch zurückgespult, konzentriert gelauscht. Nein, nichts! Wohl nur Einbildung. Sicher war sie zu müde.
Kein Traum schreckte in der Nacht, keine mysteriöse Stimme störte den Tag. Der Schulmorgen verlief ätzend wie immer, am Nachmittag nahm Iris sich wieder die Story vor. Elena, ihre jüngere und selbstverständlich viel ordentlichere Schwester, würde abends aus der Kur zurückkommen. Dann wollte sie ihr die neue Geschichte zu lesen geben. Auch Elena schrieb begeistert und will Schriftstellerin werden. Wie in einem kleinen Wettstreit tauschten sie die Werke ihrer Fantasien aus.
Mit Fantasie, schoss es ihr durch den Kopf, hat wahrscheinlich auch die Angst zu tun. Vielleicht empfindet man die umso mehr, je größere Vorstellungskraft man besitzt. In ihrer Fantasie kann sie ganze Universen entstehen lassen, die von der Enterprise erforscht werden. Es ist toll, denken zu können! Man kann sogar darüber nachdenken, dass man denkt.
Aber deswegen muss man nicht herumgrübeln. Das tat sie doch eigentlich nie. War der Angstraum schuld? Oder diese komische Stimme? Bewusstsein? Nein, die Betonung war anders. Zwei Wörter: bewusst sein. Egal! Es war nur Einbildung. Einbildung wie die Figuren ihrer Geschichten. Alles nur Fantasie. … Alles nur Fantasie! Iris erschrak bei diesem Gedanken.
Unsinn, Sie ist real! Wenn sie jedoch - nur mal angenommen - nicht wirklich wäre, lediglich Figur in einer Geschichte, was dann? Ist das nicht ein Thema in diesem Philosophie-Roman, von dem ihr Vater schwärmte und den sie lesen sollte? Wie hieß er noch? Irgendwas mit einem Mädchennamen. Ach egal, vergiss es! Als ob sie sich für Philosophiequatsch interessierte. Das ist ja schlimmer als Schule!
Doch Fantasie ist großartig. In der Vorstellung ist alles möglich. Das ist ja das Spannende. Scheinbar Unmögliches wird wie wirklich und manchmal deutlicher als das Zimmer ringsum oder das Scharren von Kuschel. Aber Kuschel existiert nicht nur in ihrem Kopf. Auch der Computer ist da. Und Elena.
Nun, Elena, der eigentlich das Meerschweinchen gehört, das sie während der langen Krankheit im letzten Jahr getröstet hatte, war nicht wirklich da. Noch nicht. Doch sobald sie aus der Kur zurückkam. Es gibt sie!
Aber wäre es hier und jetzt anders, wenn sie sich nur eine Schwester ausgedacht hätte, mit der sie Geschichten austauscht, Rollenspiele macht, vor dem Fernseher hängt? »Oh Mann, ich glaub, ich spinne!«, sagte Iris laut.
Jetzt endlich auf die Story konzentriert! Oder soll sie eine neue beginnen über ein kleines Pelztier, das superintelligent ist, und gemeinsam mit Data, dem perfekten Roboter in Menschengestalt, die Geheim-nisse der Realität und der Angst löst. Ja, das wäre cool.
„Der Roboter kam herein und brach in Tränen aus“, tippte Iris auf der Tastatur und stockte schon. Eine weinende Maschine? Woher sollten Gefühle und Tränen kommen? Löschtaste. Neu: „Data kam herein und sah aus, als würde er in Tränen ausbrechen, wenn er es könnte.“
Das war besser! Eine Maschine hat keine Gefühle und kann schon deswegen nicht weinen, weil man dafür Drüsen braucht, die einem Roboter wohl kaum eingebaut wurden. Das wäre albern. So wie früher die alte Puppe ihrer Mutter, die bei richtiger Bewegung einen Laut wie „Mama“ von sich gab und scheinbar Tränen vergoss, wenn man auf eine Stelle am Nacken drückte. Das war total blöde. Zudem litt das gute Stück unter verklebten Augen und stank, seit sie versuchsweise den kleinen Tank mit Milch befüllt hatte.
Im Grunde muss das Fantastische möglich werden können, wenn es nicht absurd ist. Ins Unmögliche darf man sich nicht verirren. Doch schon wieder verirrten sich ihre Gedanken, tanzten die Wörter Angst, Möglichkeit, Fantasie, Realität in ihrem Kopf, hüpften wirr umher, umkreisten den Begriff Bewusstsein. Zwecklos, sich auf die Story konzentrieren zu wollen. Warum nur war plötzlich alles so verdreht?
Entschlossen tat Iris, was sonst nicht ihre Art war: Sie ging zum Bücherregal im Wohnzimmer und schlug im Lexikon nach, um Ordnung in diesen Begriffstanz zu bringen. Doch welche Enttäuschung! Unter Bewusstsein las sie: „Psychologisch der Zustand des Habens von Erlebnissen; unterschieden in gegenständl. B. u. Ich-B., d.h. das Wissen um mich selbst als Subjekt meiner Erlebnisse“. Mann, was für ein geschraubter Stuss! Ein Erlebnis hatte sie bestimmt; das von Frust.
Dennoch schlug sie noch unter Angst nach und las: „[von lat. angustus], stark unlustgetönter →Affekt“. Und wie unlustgetönt sie nun war! Nein, diese Wortakrobatik, diese Abkürzungen und Verweise, das ist nicht ihr Ding. Das Lexikon blieb liegen, während sie selbst zur Küche trottete, um im Schrank nach Süßem als Trost zu forschen.
Wieder im eigenen Zimmer angekommen, stutzte sie. Ein großer Schriftzug bedeckte den Bildschirm: „Ich denke, also bin ich“. Ach, wieder einer der Scherze ihres Vaters! Der schrieb gelegentlich schon mal in die Startroutine so tolle Sprüche wie: „Wenn du nicht bald das Zimmer aufräumst, dann explodiere ich – dein Computer“. Das sollte wohl Erziehung sein.
Aber erstens hatte er so etwas lange nicht mehr getan, und zweitens passte dieser Spruch viel zu gut zu ihrem Problem, von dem der Erziehungsberechtigte nichts wissen konnte. Oder doch? Sie hatte das Lexikon offen liegen gelassen. Wenn er die aufgeschlagene Seite mit „Bewusstsein“ gesehen hatte, während sie in der Küche war, dann …
Schnell zurück ins Wohnzimmer. Ja, da lag das Lexikon noch aufgeschlagen. Jedoch beim Begriff Angst. Sicherheitshalber ging sie dennoch zum Arbeitszimmer ihres Vaters. Unbelegt. Er war nicht zuhause.
Data hat Angst
Iris schaltete den Fernseher ein, um die aktuelle Folge von Star Trek anzusehen und - wie alle der letzten Zeit - aufzunehmen. Denn Elena würde diese unbedingt sehen wollen. Während der Vorspann lief, rätselte das Mädchen erneut, wie der Spruch auf den Bildschirm gekommen sein könnte. »Ich denke, also bin ich«, wiederholte sie ihn und bemerkte zu sich selbst: »Das stimmt doch nicht! Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Weil es mich gibt, denke ich.«
Ja, in den Abenteuern des Raumschiffes Enterprise sind mysteriöse Stimmen und Erscheinungen nichts Besonderes. Und jedes Rätsel wird gelöst. Oft vom Androiden Data, der über gigantisches Wissen verfügt. Den müsste man fragen können, statt von einem blöden Lexikon gefrustet zu werden.
Doch bald war sie ins Bildschirmgeschehen eingetaucht. Denn das, was sich dort entwickelt, war faszinierend: Data zeigte angesichts der Bedrohung durch kybernetisch veränderte Wesen namens Borg Reaktionen, die man als Angst deuten musste. Konnte es Zufall sein, dass gerade jetzt diese Episode gesendet wurde? Zudem als Zweiteiler, obwohl Fortsetzungen bei Star Trek selten sind. Genau heute gab es noch keine Lösung!
Endlich war abends Elena wieder da. So viel gab es zu berichten, dass Iris die merkwürdigen Ereignisse unwichtig vorkamen: Computervirus, Übermüdung, Zufall, was soll's. Sie wollte sich vor ihrer Schwester nicht lächerlich machen mit Gedanken über Angst und Spinnerfragen. Nur die Sache mit Data, die war im grünen Bereich, die würde sie ansprechen.
Am nächsten Mittag sahen sich die Mädchen die Aufzeichnung vom Vortag an und diskutierten darüber. Sie waren sich einig, dass ein Roboter unmöglich Angst haben kann. Höchstens eine Verwirrung in den Schaltkreisen oder einen Defekt im Programm.
»Obwohl«, schränkte Iris dennoch ein, »Data ist wie lebendig. Ob Muskeln oder Motoren, ob Nerven oder Leitungen, ist doch nicht so wichtig. Und sein Elektronengehirn ist besser als das jedes Menschen.«
»Was aber nichts mit Gefühlen zu tun hat. Die gehören zum Körper, nicht zum Geist.«
»So einfach kann man das bestimmt nicht trennen«, widersprach Iris. »Eigentlich Mist, dass man so was nicht weiß, nur all den Schulkram.« Dann gestand sie: »Vorgestern weckte mich ein Albtraum. Deswegen habe ich überlegt, was Angst ist, und ob Kuschel sie haben kann. Weiter hätte mich das nicht beschäftigt, doch abends meinte ich, eine Stimme zu hören, die „bewusst sein“ sagte. Gestern erschien - vielleicht von einem Virus - ein komischer Satz über Sein und Denken auf dem Bildschirm. Dann das mit Data. Irgendwie passt das alles zusammen und kann eigentlich kein Zufall sein. Es ist unheimlich.«
»Klingt tatsächlich ziemlich schräg«, bestätigte die Jüngere. »Aber was Angst ist, könnten wir ja im Lexikon nachlesen.«
»Kannst du dir sparen. Weißt du hinterher noch weniger.«
»Dann hilft vielleicht ein Buch von Mama«, meinte Elena, denn ihre Mutter interessierte sich für Biologie und Psychologie.
Also die Treppen hoch zum Absturzregal. Das stand, obschon ein Hängeregal, auf dem Boden im Dachgeschoss. Es war vor Wochen mitsamt zu vielen Büchern, zu schwachen Wandhaken und riesigem Gepolter dem Gesetz der Schwerkraft gefolgt. Vaters Versprechen, es zu richten, unterlag dagegen dem Gesetz der Trägheit. Doch die Schwestern fanden es bequem und lustig, auf dem Boden zu sitzen, um die provisorisch wieder eingeräumten Bücher zu durchforschen.
»Ha, sag‘ ich doch!« Iris hatte ein Buch über Leben gefunden und las daraus zufrieden vor: »Es gibt keine scharfe Grenze zwischen Lebendigem und Unbelebtem. Man kennt Systeme, die nur einige Merkmale des Lebens aufweisen, z.B. Makromoleküle mit der Fähigkeit zur Selbstvermehrung.«
Elena erkannte den unausgesprochenen Bezug auf den Androiden und wandte ein: »Mit der Selbstvermehrung dürfte es aber bei Data Probleme geben«. Sie sahen sich an, jede dachte sich ihren Teil, beide kicherten. »Nur Lebewesen können sich fortpflanzen.«
»Wobei es schon komisch klingt, wenn man sagt, Tiere oder Menschen pflanzen sich fort«, fiel Iris auf. »Aber wenn ein Roboter wieder Roboter baut, ist das eigentlich nichts anderes.« Dann las sie weiter vor: »Das Leben ist an Eiweiße, Nukleinsäuren, Kohlehydrate und Fette gebunden.«
»Also ist Data aus dem Rennen«, stellte Elena fest. Doch Iris‘ Dickkopf wollte sich nicht überzeugen lassen: »Pah, bloß weil unsere Chemie so funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es einzig und allein so geht. Da wir alle von einer Urzelle abstammen, wird natürlich nach deren Rezept gekocht. Das schließt jedoch nicht aus, dass auch andere Suppen gelingen könnten.« Sie schob das Buch verärgert von sich.
Elena nahm es, las erst still, um den Anschluss zu finden, dann laut: »Ein lebendes System ist in ständiger Veränderung. Diese äußern sich insbesondere als Stoff- und Energiewechsel.«
»Data braucht auch Energie und zieht sich schon mal einen Silikonmix als Schmiermittel rein«, verteidigte Iris ihren Serienhelden.
Die Jüngere las unbeirrt weiter: »Die Frage, ob sich Leben völlig mit physikalischen und chemischen Gesetzen erklären lässt, wird von der modernen Naturwissenschaft bejaht. Die Vitalisten sehen dagegen einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Leben und unbelebter Materie. Sie gehen von einer übernatürlichen Lebenskraft aus, die den Lebewesen innewohnt.«
»Siehst du: Die Wissenschaft erklärt Leben mit physikalischen und chemischen Gesetzen. Data kann man sowieso nicht anders erklären! Wo, bitte schön, ist der Unterschied?«
»Der kleine Unterschied …«, das Kichern machte sich selbstständig, »ist vielleicht der, dass es diese übernatürliche Lebenskraft gibt.«
»Reliquatsch!«
»Aber man kann doch nicht alles und jedes mit Physik und Chemie erklären. Die Wand hier ist auch Physik und die Gardine Chemie. Doch die leben bestimmt nicht!«
»So simpel geht’s ja auch nicht. Es war ja von Systemen mit Veränderung und Energieverbrauch die Rede.«
»Dann, weise Schwester, lebt also auch ein Auto?«
»Das hat doch kein Gehirn, wie Data.«
»Aber elektronische Steuerungen. Und es geht um Gefühle. Die kommen nicht aus dem Gehirn, schon gar nicht aus einem künstlichen.«
»Verdammt!« Iris sprang unvermittelt auf. »Wir haben Star Trek verpasst, und ich habe den Timer für die Aufnahme nicht eingestellt!«
Mit Gepolter stürzten sie die Treppe hinunter. Kuschel raste in den Blumentopf, der ihr im Stall als Unterschlupf dient. Der Fernseher flog beinahe von seinem Untertisch, als Iris auf die Einschalttaste schlug. Die Mutter erschien – nicht weniger erschrocken als das Tier – zwar zeitlich deutlich vor dem Fernsehbild, zog jedoch hinsichtlich der Aufmerksamkeit den Kürzeren. Endlich zeigte sich auch auf dem Fernseher etwas. Doch zu spät; sie hatten es verpasst!
»Scheiße, Scheiße, Scheiße«, schrie Iris und schlug auf den nächsten Sessel ein, während ihre Schwester »so ein Saumist!« fluchte und der Mutter der Kragen platzte: »Jetzt benehmt euch! Ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Raus hier! Am besten unter die kalte Dusche.«
»Das ist ja nicht zu fassen«, murmelte sie und musste sich erst einmal setzen. Aus dieser Position konnte sie den dramatischen Abgang ihrer Töchter bewundern, die aus dem Zimmer polterten. Das laute Schlagen der Tür beendete den Akt. Kuschel aber blieb noch lange in seinem Topf verborgen.
Heureka
Am nächsten Tag werkelte der Vater an seinem Computer und dem Telefonanschluss herum, um ein Modem zu installieren. »Wurde auch Zeit«, kommentierte Iris, die in der Gebrauchsanweisung blätterte, denn ein Internetanschluss war überfällig.
»Fräulein Tochter«, rückte der Vater gleich die Relationen zurecht, »das ist mein Anschluss an meinem Computer für meine Arbeit. Er ist nicht für dein Vergnügen da.«
»Aber …«
»Kein Aber! Ich will nicht, dass du verblödende Spiele runterlädst oder deine Zeit damit vertust, der Menschheit die weltbewegende Botschaft zu übermitteln, dass dein Fahrrad einen Platten hat.«
»Aber, wegen der Schule, da wäre …«
»Schule ist doch sonst ein Fremdwort für dich. Für die brauchst du keinen Netzanschluss.«
»Ja doch, wegen Infos und so. Wenn man was sucht, …«
»Dann schlag in deinen Schulbüchern nach. Falls du sie findest.«
Iris zog in ihr Zimmer ab. Das war ja typisch! Ihr Erzeuger kann im Netz surfen. Und sie? Ist doch immer so: Er hat einen schnellen Rechner mit Farbdrucker und Scanner, sie nur eine lahme Kiste. Zudem wieder dieser Seitenhieb auf ihre Unordnung.
Nach einigen Minuten klopfte der Vater als Geste der Versöhnung an ihre Zimmertür: »So, das Modem ist angeschlossen. Willst du mit ausprobieren?«
Natürlich wollte sie. Bis zum Ende der Probieraktion hatte sie zudem den Vater davon überzeugt, dass die heranwachsende Generation auf die Anforderungen der Mediengesellschaft vorbereitet werden muss. Sie durfte gelegentlich ins Netz.
Elena interessierte sich weniger für Computer, ließ sich allerdings am nächsten Tag von ihrer Schwester zeigen, was diese an Funktionen, Verbindungen und Möglichkeiten entdeckt hatte. Nachdem sie immer gelangweilter zugesehen hatte, kam sie auf ihr gestriges Vorhaben zurück: »Wollen wir noch die Fragen nach dem Leben, nach Data und Gefühlen angehen? Oder lassen wir's?«
Iris hatte über die Beschäftigung mit dem Internet nicht mehr daran gedacht. Nun aber kam geradezu Begeisterung auf: »Klar! Denn jetzt hilft uns dieses nette kleine Weltnetz.« Sie gab in eine Suchmaschine den Begriff Leben ein. Es erschien eine Verweisliste mit Millionen Internetadressen zu Biografien, Lifestyle, Biologie, Esoterik, Klatsch und Werbung. Wie sollten sie da weiterkommen?
Mit den Suchbegriffen Roboter, Data und Angst war es ähnlich. Dann kam Iris der Gedanke, das einzugeben, was ihr vor zwei Tagen im Ohr geklungen hatte: „bewusst sein“. Unmittelbar wurde ein einziger Treffer angezeigt: www.ureda.de
»Uff, das sieht gut aus. Nur eine Adresse«, freute sich Iris. Rasch war die Verbindung aufgebaut. Eine schmucklose Nachricht erschien:
„Derzeit leider kein Dialog möglich. Beantworte aber gerne alle Fragen zum bewussten Dasein. Bitte Briefkastensymbol zum Mailing benutzen. Ich melde mich.“
Die Schwestern berieten sich. Das schien der Volltreffer zu sein. Warum sollten sie nicht ihre Frage stellen? Also folgte Iris der Anweisung und schrieb:
Wir, Iris (15) und Elena (13), haben ein Problem. Es ist klar, dass wir lebendig sind und Gefühle haben und Bewusstsein. Trotzdem ist unklar, was das eigentlich ist. Erst recht, warum und wozu man lebt. Kann nur ein Mensch Bewusstsein und Angst haben? Oder auch ein Androide?
Sie fanden, dass es genial einfach sei, einem Unbekannten über das Netz Fragen zu stellen, die sie ihren Eltern oder Lehrern nicht gestellt hätten. Solche wie die, was ein Atom ist, oder wie man Käsekuchen backt, sind leicht formuliert und werden gerne beantwortet. Da freut sich der Angesprochene über das Interesse und darüber, dass er Wissen zeigen darf. Aber Fragen, wie die nach dem Lebensinn sind irgendwie peinlich.
»Und wie kriegen wir die Antwort?«, wollte Elena wissen.
Nicht ohne Stolz erklärte die Schwester: »Wir haben gestern bei der Installation ein Benutzerprofil für mich angelegt. Wenn ich mich einlogge, wird das geladen. Als ich eben das Briefkastensymbol anklickte, wurde eine Verbindung aktiviert, in der meine Mailadresse als Absender erscheint. Die Antwort wird bei einem sogenannten Provider gespeichert, und wir können sie irgendwann aufrufen und lesen.«
Klar, dass Iris, weil der Vater ohnehin nicht da war, schon nach einer Stunde und abends erneut nachsah. Doch nichts. Auch am nächsten Mittag das gleiche Ergebnis. Also war der Kontakt wohl nur ein Flop. Nachmittags lag jedoch eine Mail in der Box, die sie ausdruckte:
Hallo, ihr beiden!
Herzlich danke ich für eure Anfrage, denn ich habe so viele Antworten vorrätig, dass mich jede Frage glücklich macht. Es wird nicht schwer sein, das Passende im Lager zu finden. Da gibt es ganz andere Fälle, sage ich euch: Ich habe Antworten, die sind schon seit Jahrzehnten ohne Nachfrage. Etwa die zum Möglichkeitsraum. Keiner will sie haben, keine Frage passt.
Iris murmelte enttäuscht: »Ein Spinner. Hätte man sich denken können.« Dennoch las sie weiter:
Aber kommen wir zu eurem Problem, das übrigens auch das von Data ist, der erst neulich bei mir nachfragte.
»Der will uns nur verscheißern!«, entrüstete sich Iris und knüllte wütend das Papier. Doch bald strich sie das Blatt wieder glatt.
Zweifellos sind eure Fragen wichtig. Wer so fragt, der ist - bitte erschreckt nicht! - ein Philosoph (oder eine Philosophin, wenn ihr nicht selbstsicher genug seid, um männliche Bezeichnungen für Charaktere, Berufe u.a. hinzunehmen, ohne euch zurückgesetzt zu fühlen). Philosophen sind nämlich Leute, die suchen, fragen und wie Kinder staunen können.
Wie gesagt, an Antworten mangelt es nicht. Um sie zu finden, muss man jedoch manchen Irrweg gehen, Rätsel lösen und sich auf Überraschungen gefasst machen. So wie du, Iris, bei deinen Abenteuer-Spielen auf dem Computer.“
Wie kann dieser Typ wissen, dass sie solche Games mitunter nächtelang spielt? Da ist doch etwas oberfaul! Oder … ja, vermutlich ging der Schreiber einfach davon aus, dass nahezu alle in ihrem Alter gamen, und nutzt den billigen Trick, um sich als eine Art Magier darzustellen.
„Spielen mit Hindernissen, Fallgruben und zunächst unwichtig erscheinenden Fundstücken, die man später unbedingt braucht, um weiterzukommen. Gerne will ich mit euch ein solches Abenteuer beginnen. Habt ihr Lust? Ihr könnt mich im Chat erreichen.
LG
Heureka.
Iris ließ das Schreiben sinken. Ob sie Lust hatte, wusste sie wirklich nicht. Sie hatte doch nur eine verständliche Antwort erhofft. Klar, dass man die nicht bekommt wie einen Beipackzettel zum CD-Player, doch gleich Philosophie!
Als sie mit dem Ausdruck zu Elena kam, war ihr Entschluss schon gefasst. Das klang zwar alles verrückt, doch mit der Aussicht auf ein Abenteuerspiel auch spannend. Schließlich konnte man ja jederzeit den Kontakt abbrechen.
Bald war auch Elena überzeugt. Nach mehreren Entwürfen hatten sie eine Antwort formuliert: „Lieber Herr Heureka! Wir haben ihre Mail erhalten und danken dafür! Gerne wollen wir das Angebot annehmen.“
Das war höflich, knapp und ließ alles offen. Denn auf die verwirrenden Behauptungen Heurekas wollten sie nicht eingehen. Gerne hätten sie zwar Infos zu seiner Person erbeten, doch schien ihnen das unhöflich.
So gerüstet drangen sie zum väterlichen Computer vor, der jedoch inzwischen von seinem Besitzer blockiert war. »Können wir heute noch ran?«, ging Iris in die Offensive und zog gleich ihre Trumpfkarte: »Ich muss nämlich einen saublöden Aufsatz zum Sinn des Lebens schreiben. Und wir hatten eine tolle Verbindung gefunden, die Material liefern würde. Wir dachten, du guckst sowieso gleich das Fußballspiel im Fernseher.«
Eine Meisterleistung der Psychologie und Diplomatie: Mit „saublöd“ und „müssen“ kam der notwendige Grad an Zwang und Unwillen durch, allen Nachfragen war durch das Aufsatzthema vorgebeugt, und dem Vater war ein angenehmer Grund gegeben, seinen Arbeitsplatz zu räumen.
»Na gut, in zehn Minuten. Erst muss ich das hier fertig schreiben.«
Eine Viertelstunde später war die Verbindung aufgebaut, und Iris hatte die Antwort an Heureka in ein Dialogfeld eingetippt. Der Unbekannte saß offensichtlich am Gerät, denn prompt erschien:
Hallo Elena und Iris!
Ich hatte erwartet, dass ihr Fragen würdet, wer, was und wo ich bin. Aber ich bin gar nicht wichtig. Darum freut es mich, dass ihr gleich zum Wesentlichen kommen wollt.
Die Schwestern blickten sich an und waren stolz auf sich, hatten sie doch offensichtlich die richtige Eröffnung gewählt.
Zunächst müssen wir ein wenig organisieren. E-Mails können wir zwar immer senden, doch Chats wollen wir nicht dem Zufall überlassen. Dazu sollten wir eine Zeit vereinbaren. Klärt dies am besten mit eurem Vater ab, damit es keinen Ärger mit seinem Rechner gibt.
»Hä«, stöhnte Elena, »wieso weiß der, dass wir an Dads Kiste sitzen?«
Also, gebt mir morgen bitte eine Zeit an. Zudem wird vieles leichter, wenn ihr das Buch „Sofies Welt“ lest. Sicher leiht es euch euer Vater gerne aus.
»Verdammt! Und woher weiß er, dass Papa den Schmöker hat?«, schnaufte Iris und war zudem erstaunt, dass sie erst vor wenigen Tagen an das Buch gedacht hatte. Doch der Text floss weiter:
Aber denkt beim Lesen daran, dass das eine Geschichte ist, eine Erfindung. Wir jedoch – ihr und ich – sind Realität. Nicht, dass ihr das vergesst.
Eure Fragen beantwortet das Buch allerdings kaum. Man muss sie auch in einen größeren Zusammenhang stellen. Das will ich tun. Leider geht man ja üblicherweise andersherum vor und löst das Ganze in immer kleinere Teile auf, die man zu verstehen meint, bis nichts mehr bleibt, das zu verstehen lohnt.
So viel sei schon gesagt: Leben gibt es natürlich nicht – und zwar natürlich im wahrsten Sinne des Wortes – ohne Tod. Die eigene Endlichkeit zu erkennen, ist der Ursprung der Angst. Sie wächst mit dem Bewusstsein, Freiheiten zu haben, also auch das Falsche zu wählen.
Würde ich versuchen mit eurer Frage nach dem Bewusstsein zu beginnen, so wäre es, als rissen wir die Blüte vom Stängel: Wir könnten uns an ihr erfreuen, jedoch nicht die Pflanze verstehen, die diese Schönheit hervorbringt. Begännen wir beim Leben, ohne zuvor über das Dasein nachgedacht zu haben, so wäre das, als wollten wir die Pflanze ohne Wurzel verstehen.
Also müssen wir gleichsam von unten nach oben klettern. Das geht nicht ohne Mühe und nur auf mitunter verschlungenen Wegen. Zudem kann man sich in platonische Höhlen verirren und muss aufpassen, nicht in kartesische Spalten zu fallen. Man begegnet Dämonen, scheintoten Katzen und sogar sich selbst. Wollt ihr das wagen?
Nach kurzem Zögern verdrängte Iris alle Irritationen und gab mit der Vorfreude auf das Abenteuerspiel ein: Seilschaft bereit.
Sofies Welt
Sofie bereitete Probleme. Denn ein Buch und zwei, die es lesen wollen, geht nicht auf. Zum Glück konnte Elena noch ein Exemplar der Stadtbücherei ausleihen. Gelungen war es auch, eine nachmittägliche Nutzungszeit an Vaters Rechner zu vereinbaren, die sie Heureka bereits per Mail mitgeteilt hatten.
Zur Vorbereitung des nächsten Kontaktes diskutierten sie mit untergeschlagenen Beinen, bei Saft, Plätzchen und ab und zu Kuschel einige Streicheleinheiten verpassend, im Chaoszimmer. Das war vom Vater so benannt worden, weil gelegentlich ein paar ihrer Sachen herumlagen. Na ja, vielleicht auch ein paar mehr und ständig. Aber schließlich war es ihr Zimmer! Wenigstens beinahe. Denn eigentlich sollte es zum Bügeln und als Gästezimmer dienen. Nach mehreren Aufräumkämpfen hatten jedoch die Schwestern den Sieg davongetragen: Die Hausfrau plättete im Schlafzimmer, und der Hausherr hatte zuletzt einen Freund im Gasthof einquartiert.
»Hammerhart finde ich, dass das Buch mit einem Gespräch über den Unterschied zwischen Mensch und Maschine anfängt, und wir gerade gestern darüber diskutierten«, begann Iris.
»Ohnehin ist bei Sofie vieles wie bei uns«, bestätigte Elena. »Genau wie sie, kamen wir durch eine geheimnisvolle Botschaft in Kontakt mit einem Unbekannten. Nur, dass Sofie die Frage zugespielt wird, wer sie ist, dir - wie eine Antwort - der Satz vom denkenden Ich.«
»Heureka hat die ja angeblich im Überfluss.«
»Bei Sofie kommen die Schreiben über den Hausbriefkasten, bei uns über den elektronischen.«
»Aber die Höhle im Gestrüpp kann man nur schwer mit dem Zimmer hier vergleichen«, fand Iris.
»Vor allem, so würde Papa sagen, ist jedes Gestrüpp ordentlicher«, ergänzte ihre Schwester. »Wirklich anders ist, dass wir zu zweit sind.«
»Sofie ist auch nicht allein«, schränkte Iris ein. »Sie hat Jorunn zur Freundin. Und was mit Hilde ist, an die diese mysteriösen Postkarten adressiert sind, bleibt abzuwarten.«
»Hätte Heureka uns nicht davor gewarnt, Realität mit Erfindung zu verwechseln, dann käme ich mir wie … wie abgeschrieben vor. Kein schöner Gedanke!«
»Kuschels Rolle wäre wohl die der Katze Sherekan. Na, würde dir das gefallen?« Iris hob das kleine Tier hoch und rieb ihre Nase an der seinen. »Jedenfalls ist mir Kuschel lieber als jede Katze. Und auch lieber als das Kaninchen, das der Autor aus dem Zauberhut zieht und mit der Welt vergleicht. Sich die Welt als Kaninchen vorzustellen, finde ich daneben.«
Auch Elena war mit diesem Bild unzufrieden: »Zieht man die Welt aus einem Hut, muss man erklären, woher der Hut kommt und wer zieht. Das ist keine richtige Antwort.«
Iris blätterte durch das Buch und meinte: »Heutzutage weiß doch jeder was vom Urknall und der Evolution. Davon lese ich kein Wort. Wenn Heureka nach seinen großartigen Ankündigungen nicht mehr bringt, braucht er sich nicht wichtig zu machen.«
»Mir gefällt auch nicht, dass es heißt, die Menschen würden tief unten im Fell des Kaninchens wie Gewürm herumkriechen. Nur die Philosophen versuchten, an den Haaren nach oben zu klettern. Denn ich mag mir einfach nicht vorstellen, dass es in dem Kaninchenfell von Würmern wimmelt, selbst wenn es nur symbolische sind.«
Elena nahm Kuschel an sich. »Jedenfalls hast du ein sauberes Fell und bist ein ganz liebes Tier. Aber«, wandte sie sich an Iris, »das mit den Postkarten an Hilde, die Sofie zugestellt werden, ist schon geheimnisvoll. Bin gespannt, was daraus wird.«
»Die Philosophenbriefe und die Postkarten hängen zusammen«, war sich Iris sicher. »Doch es ist Zeit für den Chat mit Heureka.«
Nachdem die Verbindung hergestellt war, sprachen sie die verblüffenden Ähnlichkeiten ihrer Situation mit der in „Sofies Welt“ an. Doch Heureka erklärte nüchtern:
Wenn ihr staunt, so geht ihr in die richtige Startposition. Denn Staunen, statt einfach hinzunehmen, ist die Basis der Philosophie. Doch man muss auch loslaufen und das Rätselhafte hinterfragen. Tut ihr das, so solltet ihr bemerken, dass ich mit meiner Warnung, Realität und Buchinhalt nicht zu verwechseln, einen Köder auslegte. Ihr suchtet geradezu nach Gemeinsamkeiten und fandet sie. Aber jeder Kontakt muss irgendwie aufgenommen werden, alle Jugendlichen denken über sich selbst in der Welt nach, beschäftigen sich mal mit Robotern und haben oft Haustiere. All die scheinbar mysteriösen Ähnlichkeiten lassen sich mit Vernunft erklären.
Aber glaubt mir, es bleibt mehr als genug Geheimnisvolles, Rätselhaftes und auch Unerklärliches übrig, wenn wir uns mit der Natur, dem Leben, der Seele, dem Geist beschäftigen und sogar nach dem Sinn des Ganzen fragen.
Doch jetzt muss ich mich um andere Kunden kümmern. Daher lest bitte im Buch weiter. Wenn ich mich morgen nicht persönlich melde, so wundert euch nicht.
»Klingt doch nicht übel«, kommentierte Elena und verschwand mit einem »Ich lese gleich mal weiter« in ihr Zimmer.
Sofies Philosophiekurs beginnt mit den Mythen. Diese Erzählungen sind mehr als Märchen und Sagen, denn sie dienten als Erklärungen für die Entstehung der Natur und die Rolle des Menschen. Heute belächelt man sie als naiv. Aber, so überlegte Elena, besitzen wir bessere Begründungen? Dass die Lehre vom Urknall besagt, unsere Welt sei aus einem Kern unendlicher Dichte und Energie entstanden, erklärt nichts zum Warum und Wozu. Vorstellen kann man es sich auch nicht. Zu Göttern und deren Taten konnte man sich in Beziehung setzen, zu Formeln nicht.
Doch es ist interessant darüber nachzudenken. Was für ein Bild hat wohl Kuschel von sich und der Welt? Braucht das Tierchen überhaupt Erklärungen? Es lebt, bekommt Futter und Zuneigung, egal, ob es dafür einen Grund sieht oder nicht. Sind Deutungen nicht überflüssig?
Aber angenommen, das Meerschweinchen hätte eine. Dann könnte es sie doch niemandem mitteilen. Sie bliebe allen anderen Lebewesen verborgen. Jede beliebige Erklärung wäre subjektiv richtig.
Jetzt hatte sie es: Mythen, doch auch wissenschaftliche Theorien, sind gemeinschaftliche Deutungen von Wesen, die Gedanken austauschen können. Sie erfinden gemeinsam für richtig gehaltene Begründungen und meinen, richtige gefunden zu haben. Die Welt braucht keine Erklärung, nur der, der über sie nachdenkt.
Elena freute sich, dass sie sich das selbst erschlossen hatte, fand aber ein Problem: Es muss doch etwas Wahres geben, das man nicht erfindet, sondern erkennt. Wie unterscheidet man Erdachtes von Wirklichem? Lange sann sie ohne Ergebnis darüber nach.
Also las sie weiter und stieß auf Thales von Milet. Der erkannte, dass die Bewegungen von Sonne, Mond und Planeten, oder Wettererscheinungen wie Donner, Blitz und Regen, natürlicher Art sind. Aus astronomischen Aufzeichnungen der Babylonier leitete er ab, dass es 575 v. Chr. zu einer Sonnenfinsternis kommen würde, was auch geschah. Er folgerte, dass die Natur nicht vom Wirken der Götter abhängen kann, denn Berechenbarkeit und Willkür schließen sich aus.
Somit verkündete er, der Mensch könne nicht durch Gebete und Opfer auf dem Umweg über die Götter Einfluss auf das natürliche Geschehen nehmen. Das war revolutionär in jener Zeit, in der man überzeugt war, dass höhere Mächte in das Schicksal der Einzelnen und ganzer Völker eingriffen; etwa durch Parteinahme in Kriegen. Sie schleuderten dabei Blitze, bewirkten Sturmfluten oder lenkten Pfeile.
Der Mileter lehrte, hinter allem und in allem der Natur steckt etwas Gleiches und Ursprüngliches. Er nannte es das Prinzip. Am Beispiel des Wassers veranschaulichte er, was er meinte: Es zeigt sich als Regen, als Bach oder Meer, als Eis oder Dampf. Doch es bleibt trotz der Vielfalt seiner Erscheinungen immer das Eine.
Thales ersetzte das Wirken der Götter durch das der natürlichen Kräfte. Damit bereitete er den Weg zum rationalen Denken und zur Wissenschaft.
»Der Junge hatte echt was drauf«, murmelte Elena, und fand Philosophie richtig spannend.
Alles nur ein Spiel?
Iris zappte durch die Fernsehkanäle: Werbung, Nachrichten, Werbung, Krimi, Sitcom, Talkshow, Werbung, Krimi, Volksmusik, Quiz. Etwas war faul an der Sache: Auf Ihre Fragen gab es nur bruchstückhafte Antworten und Versprechungen, die mysteriösen Parallelen zu „Sofies Welt“ wurden mit nüchternen Erklärungen abgetan, das erhoffte Abenteuer lief auf das Lesen eines bescheuertes Buches hinaus.
Werbung, Krimi, Talkshow, Sport, Krimi, Werbung, Krimi, Werbung, Sitcom. Heureka hatte zwar Rätselhaftes versprochen, aber das konnte nur wieder ein Köder sein. Warum sollte sie Lösungen für Probleme suchen, die bisher gar nicht hatte, statt es sich im Kaninchenfell gemütlich machen?
Die Philosophiererei mochte was für Elena sein. Die ist ja eine Streberin. Immer gute Noten. Liest sogar in der Tageszeitung. Die ist voll dabei, obwohl es eigentlich ihr Ding ist. Sie, Iris, hatte schließlich die mysteriöse Stimme gehört und die Bildschirmnachricht erhalten. Sie hatte Heureka im Internet gefunden. Aber klar, ihre Schwester verschlingt jetzt den ollen Schmöker, glaubt den Quatsch und findet ihn toll.
Werbung, Krimi, Schlagzeilen, Sport, Quiz, Krimi, Werbung. Elena ist wirklich genauso beknackt wie das naive Fräulein Sofie aus diesem Leseschinken. Welches normale Mädchen begeistert sich für Fragen wie: Gibt es einen Urstoff? Ja, die schwindelt sogar ihrer Mutter vor, sie bekäme Liebesbriefe, nur um heimlich einen Philosophiekurs zu machen! Sie hätte diesen Typ zum Fruchtzwerg gemacht, wenn der ihr anonyme Briefe geschickt und versucht hätte, sie an der Nase herumzuführen. Heureka ist bestimmt von der gleichen Sorte. Sie macht da nicht mehr mit! Werbung, Krimi, Talkshow, Werbung, Nachrichten; aus.
Sie ging Kuschel streicheln. Was brachte es, darüber nachzudenken, ob das kleine Tier Angst empfinden kann und sich seiner selbst bewusst ist? Nichts! Aber wissen wollte sie, wer Sofies Briefschreiber ist, und auf was die sich einlässt.
Also las Iris weiter und ärgerte sich über diesen Thales: Ersetzt der doch die so schön zu lesenden Geschichten von himmlischem Zank und göttlichen Listen durch langweilige, fantasielose Prinzipien. Oh arme Welt!
Am nächsten Mittag, Vater war zum Glück wieder nicht im Haus, lag ein Brief von Heureka in der Mailbox, den Iris ausdruckte:
Hallo, was machen die Studien?
Ich hoffe, ihr habt inzwischen von den Vorsokratikern gelesen. So nennt man die griechischen Denker, die vor dem wichtigen Philosophen Sokrates lebten. Sie stellten dem alten mythischen das neue logische Denken gegenüber. Damit begann in unserem Kulturraum die Philosophie.
Nicht verwechseln darf man das Mythische mit dem Mystischen, also dem Übersinnlichen: Mythen sind bildhafte Erklärungen, etwa für die Existenz der Welt und die Rolle des Menschen. Diese sind zwar nicht prüfbar, wurden aber nicht angezweifelt. Oft verknüpfen sie das menschliche Leben mit dem Wirken und Wollen der Götter.
Lasst mich ein Beispiel geben: Fragt man, warum die Sonne leuchtet, wärmt und sich über den Himmel bewegt, ist eine Deutung aus der Übertragung alltäglicher Erfahrungen, dass ein Feuerwagen über das Firmament fährt. Damit ist ein Naturvorgang anschaulich und verständlich erklärt. Gibt man diese Erklärung jedem Kind, so wird sie zur Selbstverständlichkeit.
Wagen haben Lenker. Der des Himmelswagens muss mächtiger als ein Mensch sein, ist also ein Gott. Man sollte sich gut mit ihm stellen, wenn man will, dass er auch künftig seinen Job macht. Das kann man durch Bitten (Gebet) und Belohnung (Opfer) tun. Dadurch ergibt sich eine religiöse Beziehung.
Gibt man dem Wagenlenker einen Namen, etwa Helios, wird dieser Kontakt persönlich und scheinbar vertraut. Der Mensch gewinnt das Gefühl, den höheren Mächten weniger ausgelieferte zu sein. Denn er hat nicht nur eine verständliche Erklärung gewonnen, sondern glaubt auch, die Götter durch Verehrung beeinflussen zu können.
Da man mit diesen nicht wie mit Seinesgleichen umgehen kann, bedarf es einer angemessenen Form. Daher entwickeln sich kultische Handlungen und Spezialisten für deren Durchführung; die Priester. Denen war daran gelegen, alles aufwändig und geheimnisvoll zu gestalten, um die eigene Stellung als Eingeweihter und Vermittler herauszuheben und leider auch auszunutzen. Je dümmer man das Volk hält, desto besser geht das.
So wurden und werden im angeblichen Auftrag der höheren Mächte die Gläubigen manipuliert. Denkt nur daran, wie viele Verfolgungen, Attentate und Kriege religiös begründet sind. Noch nie aber wurde zu derartigen Schandtaten im Namen der Philosophie aufgerufen.
Im Gegenteil; sie versucht aufzuklären und das eigene Denken zu fördern. Bereits 600 Jahre vor Christus sprach der Philosoph Thales Tacheles: Es könne keine Ordnung und Zuverlässigkeit geben bei einem Himmel voller sich zankender oder Scherze treibender, oft gar verlotterter Götter. Stattdessen wollte er – ich hoffe, ihr habt es schon gelesen – die Welt und alle Geschehnisse in ihr mit einem Prinzip erklären. Ein Prinzip ist eine allgemeingültige Regel.
Ein anderer Vorsokratiker, Heraklit, nahm den Gedanken auf und unterstellte eine die Welt durchwirkende Gesetzmäßigkeit, die er „Logos“ nannte. Seither beherrschte die Suche nach dem universalen Prinzip erst die Philosophie und bis heute die Naturwissenschaft, die die Weltformel zu finden hofft.
Die Vorsokratiker setzten also neutrale Ursachen an die Stelle persönlicher Urheber. Die somit in der Antike getrennten Kräfte des Glaubens und des Wissens dominieren jeweils in zwei großen Pendelschlägen die nachfolgenden Epochen: Im Mittelalter unterdrückte die Religion die Wissenschaft, in der Neuzeit machte die Wissenschaft die Religion scheinbar überflüssig. Doch aus Einseitigkeit kann kein besseres Neues entstehen. Dazu braucht es ein Gegenüber, einen Spiegel für das Wechselspiel zur Erkenntnis.
Doch jetzt genug, denn ich habe noch einiges vorzubereiten. Schließlich soll mein Programm besser sein als das, was du, Iris, beim Zappen gefunden hast.
Dieser Mistbock! Wie kommt er auf zappen? Heureka, so entsetzte sich Iris, verarscht mich total, kaum dass ich wieder einigermaßen auf Kurs bin. Schluss jetzt, endgültig! Soll sich Elena alleine verschaukeln lassen. Man wird schon sehen, wer den Durchblick hat! Den zerknüllten Ausdruck warf Iris ihrer Schwester vor die Zimmertür und rannte in den Keller, den Punchingball malträtieren.
Nachdem sie sich in Schweiß geschlagen und den Rest ihres Ärgers bei Kuschel abgestreichelt hatte, fasste Iris einen neuen Entschluss: Sie würde diesen Heureka weder so billig siegen lassen, noch ihm auf den Leim gehen. Soll er ruhig sein Kasperletheater spielen. Dann wird sie ihn - oder sie? - im Netz seiner eigenen Fäden fangen. Ja, das wird ihr Abenteuerspiel; unter ihrer Regie!
Auf die Bauernfängertricks wird sie nicht mehr hereinfallen. Bestimmt war das mit dem Zappen nur ein Schrotschuss: Die Richtung stimmt, denn wer switcht sich nicht von Zeit zu Zeit gelangweilt durch die Programme? Mit etwas Glück saß halt ein Kügelchen im Ziel. Wer weiß, wie viele Kids der Typ so zu beeindrucken versucht? Und zu welchem Zweck?
Da Elena noch nicht von einem Arzttermin zurück war, druckte Iris die Mail neu aus – jedoch ohne den Schlusssatz. Dann informierte sie sich im Netz über den Namen Heureka, deponierte den Ausdruck vor Elenas Zimmertüre und legte schließlich auf ihrem eigenen PC ein Datenblatt an:
Momentaner Wissensstand: Name Heureka (Ausruf des Archimedes auf Griechisch für „Ich habe es gefunden!“). Philosophisch bewandert. Sicher intelligent. Kennt sich mit Computern und Star Trek aus, also wohl nicht uralt. Internetanschluss mit .de, daher anzunehmender Wohnsitz Deutschland. Möglicherweise gefährlich!
Nun, sehr viel war das nicht, aber ein Anfang.
Um halb Sechs saßen die Schwestern am väterlichen Computer. Die eine mit Wissbegier, die andere, um Heureka auf die Schliche zu kommen. Überrascht stellten sie fest, dass inzwischen eine schlichte Seite mit Hypertext eingerichtet war:
»Ja, spinn ich denn?«, entfuhr es Elena, während Iris durch die Zähne pfiff und sich bestätigt fühlte: »Das ist doch ein Verrückter, Scharlatan oder Geschäftemacher.«
Selbstverständlich klickte sie zuerst auf das Wort Heureka, um mehr über den Unbekannten zu erfahren. Es erschien jedoch lediglich die Mitteilung: Aktivierbar erst ab Level fünf. Ihr habt Level null.
Die Schwestern sahen sich an. Es klang wie aus einem Mund: »Ein Computerspiel!«
Iris war schlagartig begeistert: »Das Game spiel ich gern. Heureka wird geknackt!«
Dagegen machte sich bei Elena Enttäuschung breit: »Ich hatte gedacht, da wäre ein vernünftiger Gesprächspartner. Es ließ sich doch gut an. Wobei …, es könnte ja ein Gag sein, um das Ganze spannender zu gestalten. Probiere mal weiter.«
Diese Aufforderung war überflüssig, denn Iris hatte schon in der Hoffnung, hier mehr über Heureka zu erfahren, auf „Name“ geklickt. Es erschien:
Kurz war Iris enttäuscht, murmelte dann aber: »Spielen wir das Spielchen!« Ohne weiter zu zögern, tippte sie die drei Zeilen ein: Unbenannt und Unbekannt / auf dem Weg von nirgendwo nach irgendwo / Ratten fangen.
Kaum war die Eingabe erfolgt, erschreckte sie eine Stimme: »Identifizierung Iris und Elena. Erste Eingabe originell. Zweite philosophisch. Dritte frech und mich traurig stimmend.«
Elena wurde blass: »Hast du den Sprecher erkannt? Das ist Data! … Und das Ratten fangen war wirklich blöd. Du bist überhaupt so aggressiv.«
»Zurecht, lieb Schwesterlein, zurecht! Aber Datas Stimme? Bist du sicher?«
»Ziemlich. Wir sollten uns entschuldigen.«
»Ich denk gar nicht dran! Merkst du denn nicht, wie der Typ uns anschmiert? Da passt eine verstellte Stimme genau ins Bild.
Entschuldigen! Der würde sich in die Hose machen vor Lachen!« Iris klickte zur Startseite zurück, dann auf den Link „Antworten“. Wieder erschien nicht das Vermutete, sondern:
„Irrtümlicherweise meint man, es gäbe zu viele Fragen und zu wenig Antworten. Tatsächlich ist der Vorrat an Antworten unerschöpflich. Das eigentliche Problem ist, die zugehörigen Fragen zu finden.“
Neben dem Text tauchte ein Icon mit einer Szenenklappe auf. Während Elena über den Satz nachdachte, der so ähnlich bereits in der Mail gestanden hatte, klickte Iris schon mit einem »Kommt sich wahnsinnig originell vor, der Spinner. Mal sehen, was er zu bieten hat« auf das Icon. Ein Video startete:
Zu sehen ist ein vom Alter gebeugter, weißhaariger Mann in einem Gewölbe, der vorsichtig eine schieferartige Platte aus einem schimmernden Flöz löst. Behutsam reinigt er sie, bis ein Schriftzug „Möglichkeitsraum“ hervorglitzert. Fachmännisch dreht und wendet er das Stück, prüfte es, taxiert, legt es auf ein Regal, murmelt: »Sehr schön. Die dritte Antwort heute, das langt. Mittagspause.«
Während man ihn ein einfaches Mahl entpacken sieht, ertönt die Stimme eines Sprechers: »Lassen wir ihn in seiner verdienten Pause und die Antwort im Regal der Erkenntnisse ruhen.
Ruhen? Oh nein! Sie wird aktiv, schleicht sich in Gehirne; als Erklärung und Erkenntnis. Doch wovon? Wir werden es am Ende eines langen Weges herausfinden und merken, dass wir es schon immer wussten.
Mit den beiden zuvor ergrabenen Antworten wird es uns ebenso ergehen: „Das Universum krümmt sich in sich selbst zurück“ und „Evolution ist die Ausfaltung des Einen“. Wir werden die Zusammenhänge finden und weitere Bruchstücke verschmelzen zu der Frage, auf die ihr die Antwort seid.«
Der Alte beendet seine Pause, holt die drei Fundstücke aus dem Regal, wiegt sie in der Hand, lässt sie wirken. Schön zu spüren, wie sie anregen. Ja, das sind gute Antworten, sehr gute, dessen ist er sicher. Behutsam schlägt er sie in Tücher, verlässt mit ihnen den Raum.
Sein Weg führt durch eine gewaltige Bibliothek mit den niedergeschriebenen Gedanken der Sucher, den Hoffnungen der Forscher, den Träumen der Poeten, dem Wahn der Fanatiker und Tausend offenen Fragen. Er treibt vorbei an den Sälen mit naturwissenschaftlichen Literatur, vorbei an den Gedichten, an Philosophie und Religion. Er zögert vor der Sammlung der ungeschriebenen Bücher, erreicht sein Ziel, den Raum mit Werken zur Evolution, biegt dann aber, einer Eingebung folgend, zur Halle der Fiktionen und Fantasien ab.
Er streift an Regalen entlang und zieht „Per Anhalter durch die Galaxis“ heraus. Ach ja, der Unwahrscheinlichkeitsantrieb! Mit unendlicher Unwahrscheinlichkeit im Nichtigstel einer Sekunde durch den Hyperraum. Der Alte schmunzelt: Was wäre geeigneter, um in den Möglichkeitsraum vorzustoßen!
Ein dünnes Bändchen fällt ihm in die Hand: „(R)evolutionäre Gedanken“. Der Alte blättert, überfliegt, liest auszugsweise: „Realität ist nur eine verwirklichte Möglichkeit. Sie verdeckt die Fülle der anderen“.
Er steckt das Büchlein ein, geht Treppen hinauf, durch Flure in einen achteckigen Saal mit einem geheimnisvoll leuchtenden, achteckigen Tisch, legt darauf behutsam die Funde ab.
Der Alte weiß, dass nun Geduld gefragt ist. Ebenso, dass das Kreativitätsfeld durch geeignete Resonanzformer verstärkt werden kann. Daher gruppiert er Bücher um die Fragmente auf dem Tisch: „Im Universum der Zeit“, „Intelligente Evolution“, „Der Anfang aller Dinge“, „Die unendliche Geschichte“, Schriften von Giordano Bruno, Hans Jonas und Rudy Rucker; eine bunte, scheinbar unsystematische Sammlung.
Dann zoomt die Kamera auf den Tisch der tanzenden Antworten, die kreisen, sich trennen und binden, Neues formen in Raum und Zeit.
Die vierte Dimension
»Warum wünscht man sich, wie ein Vogel fliegen zu können?«
»Weil es toll wäre, die Welt von oben zu sehen, sich leicht zu fühlen, frei durch die Luft zu bewegen.«
»Bewegst du dich sonst nicht durch Luft? Dann pass auf, dass du nicht erstickst.«
»Oh Mann, bist du kleinlich! Ich meine natürlich durch den Raum.«
»Dann sage, was du meinst. Schließlich wollen wir Missverständnisse vermeiden.«
»Okay, ich vermeide es, Miss Verständnis zu werden. Miss Teen ist eh cooler.«
»Sei nicht albern! Ohne klare Begriffe läuft Garnichts; kein logisches Denken und kein sinnvolles Gespräch. Höchstens die Wahl zur Miss Blödel.«
»Das war jetzt unmissverständlich.«
»Also, zurück zum Flug. Du würdest dich dabei, so sagtest du, frei durch den Raum bewegen. Tust du es sonst unfrei?«
»Irgendwie schon. Ich kann zwar bequem auf der Ebene gehen, brauche aber eine Treppe, Leiter oder Rampe, um rauf oder runter zu kommen.«
»Dann müssen wir also unterscheiden zwischen deiner Bewegung und deinem Weg im Raum.«
»Kapier‘ ich nicht.«
»Welche Beinbewegung machst du denn?«
»Nun, ich setze einen Fuß vor den anderen.«
»Würden ich dir eine Augenbinde verpassen und dich führen, wüsstest du dann, ob du schnurgerade, im Kreis über eine Fläche oder in Schlangenlinien über Bergpässe gingst?«
»Woher denn? Für mich gibt‘s immer nur die Vorwärtsbewegung.«
»Dann existiert also keinen Raum, durch den du gehst?«
»Quatsch. Auch wenn ich es nicht wahrnähme, so ging ich doch durch den Raum.«
»Woher wolltest du es wissen, wenn du dich nicht vor unserem Blinde-Kuh-Spiel als räumliches Wesen erlebt hättest?«
»Na ja, so betrachtet …«
»Du meinst also, es kommt auf die Betrachtung an? Dann stell dir einen Serpentinenweg an einem steilen Hang vor. Wie sieht ihn ein Vogel senkrecht von oben?«
»Lass mich Nachdenken. Nun, er sieht quasi den Grundriss; eine scheinbar ebene Schlangenlinie.«
»Was erkennt ein Frosch am Fuße des Berges?«
»Für ihn muss es so aussehen, als schlängele sich der Weg senkrecht hoch.«
»Beide sind überzeugt, das Richtige zu sehen, beharren auf ihrer Position und streiten. Wem gibst du recht?«
»Keinem.«
»Das heißt, die eine Sichtweise führt zu einem falschen Bild und die Gegenteilige auch.«
»Du sagst es.«
»Kannst du das Problem lösen?«
»Man könnte den Vogel aus der Froschperspektive blicken lassen und den Frosch aus der Vogelperspektive.«
»Sähen sie dann das Richtige«?
»Das nicht. Aber sie müssten erkennen, dass sie nicht auf ihren Positionen beharren können. Sie würden den Streit beenden und gemeinsam eine neue Sichtweise suchen.«
»Wahrscheinlicher ist zwar, dass sie sich weigern, die Blickweise das anderen anzunehmen, sich vielleicht auf die Offenbarungen des Froschgottes oder die Autorität des Großen Weisen Vogels berufen, oder gar die Macht des Stärkeren entscheiden lassen. Aber wir sind ja optimistisch. Finden sie eine bessere Erkenntnis?«
»Nichts leichter als das: Während sie von der einen zur anderen Position fliegen - der Frosch auf dem Rücken des Vogels und nicht in dessen Schnabel - erkennen sie aus dem mittleren Blickwinkel den dreidimensionalen Verlauf des Weges.«
»Gut. Halten wir also fest, dass die Vogel- und die Froschperspektive subjektiv sind. Durch das Hin und Her hast du sie als bloßen - zweidimensionalen – Anschein widerlegt. Letztlich wurde zwischen den Gegensätzen eine neue Position gewonnen, die mehr erkennen lässt; in unserem Fall die dritte Raumdimension. Auf einem gedanklichen Serpentinenweg gelangten wir also zu höherer Erkenntnis, so wie schon vier Jahrhunderte vor Christus der Philosoph Sokrates.«
»Wanderte der gerne im Gebirge?«
»Er trieb sich lieber auf dem Marktplatz herum und diskutierte über die Begründungen für Weltansichten, Sitten und Moral. Während die Denker vor ihm das Prinzip der Natur suchten, wollte er das des richtigen menschlichen Lebens und Handelns ergründen.
Dass man dies oder das schon seit jeher so tat, es eine Autorität behauptete oder vorgeschrieben sei, ließ er als Argumente nicht gelten. Er war davon überzeugt, dass jeder Mensch in der Lage ist, von der Meinung zur Erkenntnis, von der Beliebigkeit zur Wahrheit zu gelangen. Er nannte diese angeborene Fähigkeit die Vernunft, die unter Gewohnheiten, Vorurteilen und Scheinwissen verborgen ist. Trägt man diese Deckschichten ab, so findet man nach Sokrates das Wahre.
Um diese Vernunft zu ergraben, nahm er - so wie ich eben – in einer Art Fragespiel immer wieder und oft provozierend die Gegenposition zu den Argumenten des Gesprächspartners ein. Dadurch sollte dieser selbst auf seinem Serpentinenweg der Begründungen die Ungereimtheiten erkennen und das Unbegründete verwerfen.«
»Dann war Sokrates eine Art geistiger Bergführer?«
»Er führte nicht und belehrte nie. Eher kann man ihn einen Coach nennen, der anderen hilft, eigene Wege zu finden.
Um auf unseren Gang mit verbundenen Augen zurückzukommen, könnte man ihn auch mit einem Beobachter vergleichen. Denn nur ein Außenstehender sieht, ob dein für dich linearer Weg durch zwei oder drei Dimensionen führt.«
»Selbst kann man das nicht feststellen?«
»Im sinnlichen Erleben nicht, wohl aber im Denken. Das zeigten Thales und Sokrates jeweils auf ihre Art. Mit Logik und Vernunft vermag man gewissermaßen wie ein Außenstehender die eigenen Ansichten über die Welt zu betrachten und zu prüften.
Schon vor zweieinhalb Jahrtausenden schafften dies einige Philosophen so weitreichend, dass Pythagoras die Kugelform der Erde unterstellte und Aristarch behauptete, die Sonne stehe im Mittelpunkt des Planetensystems. Die Erde drehe sich um sie und zugleich um ihre eigene Achse. Eratosthenes berechnete sogar den Erdumfang ziemlich genau.«
»Was im Mittelalter wieder vergessen wurde.«
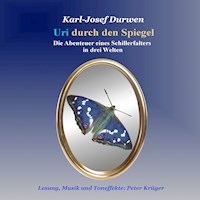













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














