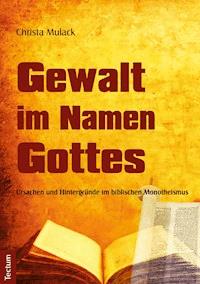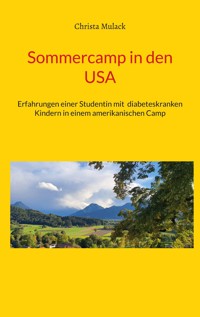
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Autorin erzählt in ausdrucksstarker Weise ihre Erlebnisse in einem amerikanischen Sommercamp in den USA, in dem Sie ihr dreimonatiges Praktikum als angehende Lehrerin im Laufe des Studiums absolvierte. Hierbei hat sie "autoritäre" Strukturen und nicht immer kinderförderliche Praktiken kennen gelernt, die dem Anspruch des Camps für diabeteskranke Kinder oftmals zuwider liefen. Sehr emotional und berührend beschreibt sie auch die einzelnen Kinder, die sie dort kennengelernt hat, und die aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten kamen. "Lesenswert und ans Herz gehend, ohne trivialen Nachgeschmack."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meine letzten Gedanken sind ein Dank, dass ich so vielen Frauen die Liebe, und den Drang zur Freiheit vermitteln durfte.
Den beiden wichtigsten Standbeinen im Leben von Frauen 4.5.2021
Christa hat diese Erlebnisse mit den Mädchen im Sommercamp in den USA in den 70er Jahren aufgeschrieben. Diese Art von restriktiven Camps hat es wirklich in den USA gegeben, und gibt sie vielleicht in dem „freien Amerika“ bis heute.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. Teil: Einweisung in die schöne neue Welt des Sommercamps
1. "Let's go!" - Auf nach Amerika
2. "Let' do this..." - Einweisung ins Camp
3. "Keep in line" - Zwischen Militär- und Sommer-Camp
4. "Here comes the spy." - Jim entlarvt
5. "That's your problem." - Mary und das Sportfest
6. "You're late.." - Verspätungen
7. "Get out of here!" - Kein Ort - nirgends
8. "No sugar!" - Druck der Zensur statt Zucker für den Tee
9. "Wrong food!" - Der große Betrug
10."Who cares?" - Unmenschlichkeit und Gleichgültigkeit
2. Teil: Schwarz und Weiß - Hand in Hand–
11. "Wie soll das nur gutgehen?" - Das große Schweigen
12. "Keine Post?" - Die große Trauer
13. "Ist sie nicht süß?" - Das Großreinemachen.
14. "Du kannst das nicht" - Julia übernimmt das Regiment
15. Verstehen ohne Worte
16. Wenn die Nacht zu Ende ist...
17. Debbie - das Gegenstück zu Julia
18, Abschied vom Camp
19. Das andere Amerika
20. Ausblick
Einleitung
Je älter wir werden, desto kostbarer wird jener Erinnerungsschatz, der bei uns bleiben durfte. Der vielleicht sogar gepflegt wurde, so dass er nicht verblasste, sondern sich immer lebendiger und konturenreicher zeigte, da er sich mit weiteren Erfahrungen auf die eine oder andere Weise zu verbinden verstand.
Aus dem bunten Spektrum von Erinnerungsfiguren habe ich für dieses Buch Julia ausgewählt - ein zehnjähriges Mädchen, das ich nicht länger als vier Wochen lang aus unmittelbarer Nähe erleben durfte, ohne dass es im Anschluss an diese Zeit zu weiteren Kontakten kam.
Julia war ein kleinwüchsiges Kind, das unvergessliche Eindrücke in meiner Seele hinterließ, die auch vierzig Jahre später noch erstaunlich lebendig sind und immer wieder vor mein inneres Auge treten.
Vielleicht sollte ich noch hinzufügen, dass sie ein schwarzes Mädchen war. aus der bittersten Armut der damaligen Bronx kommend und zudem so schwer zuckerkrank, dass sie an Wachstumsstörungen litt und ihr mit Sicherheit kein langes Leben beschert sein würde. Damals war sie in meiner Gruppe, die ich in einem amerikanischen Sommercamp für zuckerkranke Kinder vier Wochen lang betreute.
Dort gehörte ich während meiner Semesterferien einen Sommer lang zum pädagogisches Personal in der Funktion als Camp-Councelor - eine Bezeichnung, die ich der Einfachheit halber nachfolgend mit "CC" abkürzen werde.
Den Job hatte ich über eine studentische Organisation bekommen, die in Deutschland Sommerjobs in die Vereinigten Staaten von Amerika vermittelte. Als ich mich bewarb, lagen bereits mehrere Jahre Sprachstudien in England, Frankreich und Deutschland, wo ich zusätzlich ein zweijähriges Dolmetscher-Seminar besuchte, hinter mir. Da konnte mir Amerika nur recht sein.
Nach meiner Bewerbung wurde ich zu verschiedenen Testverfahren eingeladen und schließlich auch angenommen - ohne jedoch Einfluss auf die Wahl des Camps nehmen zu dürfen. Das fand ich nicht weiter schlimm, da es mir in erster Linie wichtig war, meinen angestrebten pädagogischen Beruf mit der Vervollkommnung meiner Sprachstudien zu verbinden. - Das Fernweh mit dem Drang in die Weite der Welt trugen des weiteren zur Annahme dieses Jobs bei - egal, wo ich hinkäme.
Nun war aber Julia nicht der einzige Grund, der mich zu diesem Buch bewog, sondern nur die Initialzündung. Den finalen Anstoß dazu gab mir die anhaltende Diskussion über den amerikanischen Geheimdienst NSA mit seinem weit gespannten Spitzelnetzwerk, das Freund und Feind gleichermaßen ausspioniert.
Erst im Zuge der zahlreichen Veröffentlichungen zu diesem Thema fielen mir Parallelen auf zu meinem Sommercamp, von denen ich vorher nichts wissen konnte.
Diese Parallelen lassen vermuten, dass die NSA weitaus tiefer in der amerikanischen Bevölkerung verankert ist als allgemein angenommen und ohne, dass es ihr selbst bewusst ist. Immerhin ist das Sommercamp ein fester Bestandteil der amerikanischen Kultur und von sehr unterschiedlicher Qualität und Ausrichtung.
Dies Buch soll jedoch nicht dazu dienen, meine Erfahrungen in unzulässiger Weise zu verallgemeinern - auch wenn ich von einigen Parallelen zu anderen Camps gehört habe. Dennoch reichen diese bei weitem nicht aus, um pauschale Vorwürfe gegen die Sommercamps zu erheben.
Es geht mir hier sowieso nicht um Vorwürfe, sondern lediglich um eine Beschreibung jener amerikanischen Wirklichkeit, mit der ich in jenen zwei Monaten in "meinem" Camp konfrontiert war. Eine Wirklichkeit, die zwar allem widersprach, was ich während meiner anschließenden Reise durch den amerikanischen Kontinent erlebte, die aber dennoch existierte und möglicherweise nicht einmal singulär ist. - Doch bedürfte sie einer genauen Analyse, die zu leisten eine Aufgabe von SoziologInnen und NSA-ExpertInnen wäre.
Mir geht es in diesem Buch daher ausschließlich um die beiden genannten Schwerpunkte, in denen zwei grundverschiedene Erinnerungsfiguren - Julia und das Camp – miteinander verschmolzen sind.
Den ersten und umfangreicheren Teil des Buches nimmt daher das Sommercamp als solches ein mit seinen problematischen Strukturen und Mechanismen, die für mich zunehmend an Bedeutung gewannen, je besser ich sie zu durchschauen vermochte.
Daher beschreibe ich minutiös, wie sich ein Puzzle allmählich zusammenfügte und ich zu begreifen begann, was sich hinter all den Widersprüchlichkeiten verbarg, denen ich im Camp und seinem Personal auf Schritt und Tritt begegnete, Dabei kamen mir allerdings auch Zufall und/oder Schicksal entgegen, als ich Insider des Camps kennenlernte, die bereit waren, mir von ihren Erfahrungen zu berichten und damit die meinen erweitern und ins rechte Licht zu rücken halfen. Auf dem Hintergrund dieser recht umfassenden Problematik spielt die erste Gruppe, die ich zu betreuen hatte, in diesem Buch eine recht untergeordnete Rolle; denn die Mädchen kamen in der damaligen Wirklichkeit in der Tat zu kurz. Ich war gedanklich dermaßen mit dem Camp beschäftigt, dass ich mich auf sie nicht so einlassen konnte, wie ich es gern getan hätte und wie es mir bei der zweiten Gruppe auch gelang.
Als ich sie übernahm, war ich nicht länger absorbiert mit dem Kennenlernen der Camp-Politik und konnte wesentlich souveräner mit den Camp-Regeln und den Mädchen umgehen. Erst dadurch konnte es zu jener emotionalen Tiefe kommen, die den Camp-Aufenthalt für mich und die Mädchen zu etwas ganz Besonderen werden ließ.
Damit komme ich zum zweite Schwerpunkt im zweiten Teil dieses Buches, der insbesondere auf Julia abhebt, auch wenn sie in keinem Zusammenhang steht mit dem Schwerpunktthema des ersten Teils. Vielmehr profitierte ihre Gruppe von meinen zuvor gemachten Erfahrungen, da ich sie nunmehr vor den negativen Folgen der Camp-Politik schützen konnte, auf die ich inzwischen hatte ich gelernt, mich einzustellen und mit ihr umzugehen.
Den Mittelpunkt bilden hier die Reaktions- und Verhaltensweisen Julias, von denen ich und die Gruppe fasziniert waren.
Trotz der Schwere ihrer Krankheit, trotz - oder gar wegen - ihrer Kleinwüchsigkeit, trotz des Umstands, dass sie die einzige Farbige mit der schlechtesten Schulbildung in der Gruppe war, gelang es ihr auf eine dermaßen natürliche und souveräne Art und Weise, ihre
Vorstellungen durchzusetzen, dass sie damit die anderen Mädchen und mich faszinierte, zutiefst beeindruckte und berührte.
Hinzu kam, dass wir im Camp auf ihr genaues Gegenstück stießen - auf ein blondes blasses Mädchen Namens Debbie, die unmittelbar neben Julia ihr Bett hatte und mir ebenfalls lebhaft in Erinnerung blieb.
Im Gegensatz zu Julia schrieb mir Debbie im Anschluss an das Camp mehrere Briefe, in denen sie mich immer wieder zu sich nach Hause einlud und mich dort sehnlichst erwartete.
Als mir vor einigen Jahren einer ihrer rührenden Briefe in die Hände fiel, der mit einem "I love you so much" endete und jahrzehntelang unbeachtet geblieben war, nahm ich per Internet Kontakt zu ihr auf, was schneller ging als gedacht, da ich Nachnamen und Adresse auf dem Briefumschlag fand, die mir weiterhalfen.
Wie ich erfahren konnte, arbeitete sie zwischenzeitlich als Investment-Bankerin in New York, obwohl ich sie als musisch und poetisch stark interessiert erlebt hatte.
Wir korrespondierten eine Weile per e-mail und ich erfuhr einiges über ihrem weiteren Lebensweg. - Sollte ich noch einmal nach New York kommen, wollen wir auf jeden Fall miteinander Essen gehen. - Doch das nur am Rande.
Abschließend möchte ich noch anmerken, dass ich in diesem Buch großen Wert auf Authentizität lege und nichts geschrieben habe, was sich nicht in diesem Kontext auch wirklich zugetragen hat. Das gilt im großen und ganzen auch für die Abfolge der Ereignisse, bei der ich aber möglicherweise hin und wieder improvisiert habe, da mir meine diesbezüglichen Notizen in der Zwischenzeit abhanden gekommen sind.
So ging ich bei Lücken von den inneren Zusammenhängen und ihrer Logik aus.
Ansonsten verbürge ich mich für die Faktizität der Ereignisse, an denen Fake-News keinen Anteil haben.
1. Teil: Einweisung in die schöne neue Welt des Sommercamps
1. "Let's go!" - Auf nach Amerika
Für meine Semesterferien hatte ich mich bei einer Studenten-Organisation für einen dreimonatigen Aufenthalt in den USA beworben. Zwei Monate lang würde ich als pädagogische Kraft - genannt Camp-Councelor (CC) - in einem Ferien-Lager arbeiten.
Anschließend hätte ich einen Monat zur freien Verfügung, um Land und Leute kennenzulernen.
Das Konzept sagte mir zu, denn mit dem Job im Camp könnte ich ein für mein Studium benötigtes Praktikum erwerben und dazu auch noch meine englischen Sprachkenntnisse um das Amerikanische erweitern.
Davor hatte ich bereits ein fünfjähriges Sprachstudium in England, Frankreich und Deutschland absolviert, so dass mir Amerika als gute Ergänzung erschien.
Nach einer ganztägigen Prüfung in einer nahegelegenen Großstadt erhielt ich eine Zusage, allerdings ohne zu erfahren, in welcher Art von Camp und an solchem Ort ich landen würde. Auch von der Altersgruppe, die ich betreuen würde erfuhr ich noch nichts. Das erschwerte meinee Vorbereitungen auf das Camp, mit denen ich am liebsten sofort begonnen hätte.
So beschränkte ich mich auf das Sammeln von Gruppenspielen für Kinder und Jugendliche sowie bilderreiches Informationsmaterial über Deutschland.
Dazu bekannte deutsche Lieder und Witze, die ich ins Englische übertrug. Denn bereits jetzt stand fest: Ich würde die einzige Deutsche im Camp sein; denn für diese Jobs bewarben sich Menschen aus aller Welt, die aber immer nur ein Drittel der Camp-Coucelors ausmachen durften.
Dass sich meine Art der Vorbereitung als völlig sinnlos herausstellen sollte, konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Sie zeigte mir im Nachhinein, dass ich mir völlig falsche Vorstellungen von diesem Job gemacht hatte: schlichtweg Täuschungen - auch aufgrund des Prospekts, auf den hin ich mich beworben hatte - denen unweigerlich Enttäuschungen folgen mussten. Doch sie sollten wettgemacht werden durch all das Erfreuliche, dass Amerika auch für mich barg.
Die ersten Tage dieser Reise in New York City waren natürlich aufregend, wozu meine Erwartungen einiges beitrugen. Denn die Stadt selber übte nicht die große Faszination auf mich aus, von der ich immer wieder gehört hatte. Ich kannte bereits viele Großstädte der Welt und empfand zum Beispiel die europäischen Großstädte als wesentlich attraktiver.
Nun konnte aber von einem wirklichen Kennenlernen dieser Stadt keine Rede sein. Doch hatten mir alle Fotos, die ich kannte im Vorfeld suggeriert, man würde sich dort eingeengt fühlen, da man immer nur einen kleinen Ausschnitt des Himmels sehen würde.
Erstaunlicherweise war das aber ganz und gar nicht der Fall. Denn auch hier fand die Sonne ihren Weg zu den Menschen. Gewiss, die Zeiträume waren kürzer als gewohnt. Doch wer merkt das schon?
Auch die Sauberkeit der Stadt erstaunte mich - wohl wissend, dass dies nur für die City galt und in vielen Stadtbezirken sicherlich anders war. Leider reichte die Zeit aber nicht für eine umfassende Besichtigung und schon gar nicht für ein Eintauchen in diese Stadt.
Als störend aber erlebte ich dagegen die ständig heulenden PolizeiAutos und Unfallwagen, die mit einem ohrenbetäubenden Lärm durch die Stadt rasten.
Gemessen daran schien in dem für uns gebuchten Jugend-Hotel eine wohltuende Stille zu herrschen. Hier würde ich also auf die "Jugend aus aller Welt" treffen, mit der es zu "einem lebendigen Austausch" kommen würde, wie es im Prospekt geheißen hatte. Auf ihn hatte ich mich besonders gefreut. Doch er fand weder im New Yorker Hotel noch später im Sommer-Camp statt.
Da wir alle in Einzelzimmer untergebracht waren und uns in der Gruppe nur zu festgelegten Besprechungen zusammenfanden, hatten wir kaum Gelegenheit uns näher kennenzulernen. Unsere jeweiligen Organisationen, die uns ins Land gebracht hatten, informierten uns über vertragliche und organisatorische Aspekte unseres Aufenthalts. Dabei ging es im Wesentlichen um Versicherungen, Krankheits- und Unfälle, Camp-Wechsel bei Unverträglichkeiten, aber auch vorzeitige Rückkehr, die eine Übernahme aller entstandenen Kosten wie Flug, Versicherung, Unterkunft, Organisationsaufwand etc. bedeuten würde.
Was uns aber am meisten interessierte, in welches Camp wir kommen würden, erfuhren wir erst kurz vor unserer Weiterfahrt dorthin.
Der Swimmingpool im obersten Stockwerk unseres Wolkenkratzer-Jugendhotels vermochte mich dagegen sehr zu begeistern. Allerdings nur bis zu der Erfahrung, dass er immer dann geschlossen war, wenn unser Zeitplan einen Besuch dort gestattet hätte. Außer, ich wäre bereit gewesen, mich noch vor dem Frühstück dort meine Runden zu drehen. Auf nüchternen Magen zu schwimmen war aber damals noch nicht mein Fall. - Das sollte sich erst später ändern.
Immer wieder musste ich mich also daran erinnern, dass ich schließlich nicht als Touristin unterwegs war, sondern als eine primär an einem Job Interessierte, auf den es sich vorzubereiten galt. - Doch nicht einmal das war bislang geschehen.
Erst am Vorabend unserer Weiterreise erfuhren wir, für welches Camp wir vorgesehen waren - eine Entscheidung, an der wir zu unserer Enttäuschung nicht beteiligt wurden. - Noch ahnte ich allerdings nicht, dass ich mich in den nächsten Wochen des Öfteren von Idealen, Träumen und Illusionen würde verabschieden müssen. Dabei konnte ich aber auch meinen Sinn schärfen für die Wirklichkeit - das heißt: für die auf mich einwerkenden Verhältnisse.
Nach drei Tagen war endlich klar, dass ich die nächsten zwei Monate in einem Camp für zuckerkranke Kinder verbringen würde. Es lag gut drei Autostunden nördlich von New York City in den "Catskill Mountains" - einer Hügel-Landschaft aus endlosen Waldgebieten und zahlreichen Seen, von denen einer zum Camp gehörte und einiges beitrug zur Attraktivität des Camps.
Er wurde auch mir zur Freude, als ich ihn nach zwei Tagen New York City bei der Einfahrt durch die Tore des Camps erblickte.
Meine Begeisterung wäre sicherlich noch größer gewesen, hätte ich schon jetzt gewusst, dass meine Hütte, in der ich die nächsten zwei Monate verbringen sollte, ihm genau gegenüber lag - in wenigen Schritten über den Rasen erreichbar. Sie wäre aber auch wieder gedämpft worden, hätte man mir gesagt, dass ich dort nie würde schwimmen können.
2. "Let' do this..." - Einweisung ins Camp
Das Camp bestand aus rund zwanzig Holzhütten auf Pfählen und einer vorgebauten Veranda mit Tisch und Bänken - dazwischen Bäume und Rasen. Es wirkte sehr idyllisch und ließ mein Herz höher schlagen, war es doch wesentlich kleiner, als ich es mir vorgestellt hatte. Hier würden in den nächsten zwei Monaten täglich zweihundert Kindern herumtollen, baden, schwimmen und sich bespritzen. So meine Vorstellung von prallem Kinderleben während der Sommerferien. Die meisten Sommercamps in Amerika waren wesentlich größer und boten bis zu zweitausend Kindern Raum. Ich war froh, hier gelandet zu sein.
Nach der Ankunft verlebten wir zunächst einmal drei sehr schöne Tage, in denen wir CCs uns ein wenig untereinander kennenlernen konnten. Dabei entstanden kleine Grüppchen, die enger miteinander arbeiteten und auch bei den Mahlzeiten zusammenblieben. Meine Gruppe bestand aus der Schottin Josy, der Französin Madeleine, dem Libanesen Fahir, dem Amerikaner Jim und der Amerikanerin Kimberley. Sie war bei allen gleichermaßen beliebt aufgrund ihrer außerordentlich freundlichen und hilfreichen Art.
Wir waren insgesamt 38 überwiegend weibliche CCs im Camp, von denen rund ein Drittel aus anderen Ländern kamen. Die Einheimischen bildeten also eine klare Mehrheit, was in unserer Gruppe jedoch nicht zum Ausdruck kam. Die meisten von ihnen blieben lieber unter sich und das sollte sich auch im weiteren Verlauf unserer Arbeit immer wieder zeigen. Zu ihnen schienen Kimberley und Jim aber nicht zu gehören.
Sie halfen uns bei Verständnisschwierigkeiten, da zum Beispiel Fakir und Madeleine mit dem Amerikanischen hin und wieder Probleme hatten. Ich war froh, einige Ausdrücke dazu zu lernen, die im Englischen nicht vorkamen. - Diese Form des Austauschs war mir äußerst angenehm. Dabei verpasste ich allerdings, auch die anderen CCs ein wenig kennenzulernen - Zumal wir uns ja auch bei den Mahlzeiten nicht unter die anderen mengten, was vielleicht besser gewesen wäre.
Einige der CCs litten selbst an Diabetes - unter ihnen auch Jim. Von ihnen hätte ich mir nähere Hinweise über die Bedeutung dieser Krankheit für das alltägliche Leben gewünscht. Doch das war nicht vorgesehen und wurde auch nicht für nötig erachtet. So war ich froh, Jim zwischendurch einige Fragen stellen zu können, der bereitwillig Auskunft gab.
Insgesamt aber lernten wir weniger über diese Krankheit als ich mir erhofft hatte. Wir erfuhren lediglich, dass das Camp über ein medizinisches Zentrum mit einer Fachärztin für Diabetes und einer Diät-Assistentin verfügte, die für jedes Kind den täglichen Kalorienbedarf errechnete , der weder über-noch unterschritten werden durfte.
Morgens und Abends würden wir die Kinder zum medizinischen Zentrum und gegebenenfalls auch wieder abholen. Später ergab sich hin und wieder die Gelegenheit, mit den anderen Ccs ins Gespräch zu kommen.
Die Idee eines Camps ausschließlich für zuckerkranke Kinder begeisterte mich von Anfang an. Je mehr ich dann jedoch in Kontakt kam mit den zum Teil haarsträubende Umsetzungspraktiken, desto mehr verwandelte sich meine Begeisterung in Empörung. -
Doch vorerst ließ ich mich noch blenden von dieser Idee und glaubte fest an das Camp-Credo: Hier lernen die Kinder, mit ihrer Krankheit in der rechten Weise umzugehen und sich angemessen zu ernähren und unkontrolliertem Essen ein Riegel vorschob wurde.
Daneben lernten sie, sich selbst die möglichst geringe zu haltende Menge an Insulin zu spritzen. Für beides warb das Camp mit großen Kampagnen, die sich an Kinder und Eltern ebenso wandten wie an SponsorInnen, von denen sein Bestand abhing.