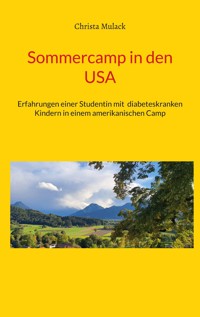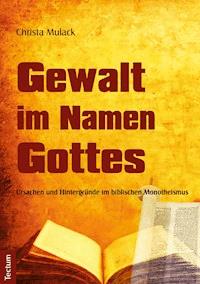
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Weltweites Entsetzen ruft die Zerstörung von Kulturgütern durch den "Islamischen Staat" einhellig hervor. Warum nur muss der fundamentalistische Islam so intolerant und barbarisch sein? Doch man vergisst dabei leicht, dass auch die Durchsetzung des Christentums einst mit der Vernichtung der antiken Kultur einherging. Christa Mulack spürt der religiösen Gewalt im Namen des Einen Gottes der Bibel nach, an der das alte Israel einst zerbrach und an der die Menschheit bis heute leidet. Sie beschreibt, wie die Israeliten im babylonischen Exil von einer fanatisierten Priesterschaft in den monotheistischen Glauben mit Hilfe von Drohungen und Schuldzuweisungen hineingezwungen wurden. Und die Verheißungen, mit denen sie gelockt wurden, haben sich bis heute nicht erfüllt.Mit dem Siegeszug des Monotheismus und seiner Heiligen Schrift wurde Gewalt zu einem festen Bestandteil der Religion. Zugleich wurde auch das Göttlich-Weibliche verdrängt, die bis dahin auch in Israel beheimateten und hoch verehrten Göttinnen Aschera und Astarte. Die Abwertung des Weiblichen hält bis heute an. Statt diesen Ur-Grund unserer Kultur permanent zu verdrängen, sollten wir ihn in unser kulturelles Gedächtnis ebenso wie in unser Bewusstsein integrieren. Nur so kann der Religion der Zahn der Barbarei gezogen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 676
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Christa Mulack
Gewalt im Namen Gottes
Christa Mulack
Gewalt im Namen Gottes
Ursachen und Hintergründe im biblischen Monotheismus
Tectum Verlag
Christa Mulack
Gewalt im Namen Gottes. Ursachen und Hintergründe im biblischen Monotheismus
© Tectum Verlag Marburg, 2016
ISBN: 978-3-8288-6337-8
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-3641-9 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlagabbildung: istockphoto.com © DNY59 (bearbeitet)
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind
im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
DANKSAGUNG
An dieser Stelle bedanke ich mich bei jenen Frauen, die mir eine große Hilfe waren mit ihren Ermutigungen und kritischen Rückmeldungen.
So danke ich in alphabetischer Reihenfolge
Helga Beck, die mit ihrem ausdauernden Korrekturlesen, ihren kritischen Anmerkungen, Verbesserungsvorschlägen und positiven Rückmeldungen eine ständige Stütze und Ermutigung zum Weitermachen war.
Rosemarie Crahay, die das Buch von Anfang an begleitet hat, mir bei der Titelsuche geholfen hat mit ihren originellen Vorschlägen und mich auf wichtige Bücher aufmerksam gemacht und mir das eine oder andere sogar zugesandt hat.
Dr. Cornelia Giese, die immer wieder bereit war, sich diverse Textversionen anzuhören und mir mit ihren kritischen Verständnisfragen half, bessere sprachliche Lösungen zu finden und mich – wo nötig – zur Arbeit antrieb.
Erika Hoffmann, die sich immer wieder nach dem Fortgang des Buches erkundigte und mich bei Erlahmung meiner Schaffensfreude mit ihrem starken Interesse an einer möglichst baldigen Lektüre des Buches zur Weiterarbeit drängte.
Gisela Lässing, die mich mit ihrer begeisterten Bereitschaft zum Korrekturlesen einiger Kapitel mit ihrem Sachverstand, ihren kritischen Fragen sowie ihren Ergänzungs- und Verbesserungsvorschlägen über Wochen unterstützt hat.
Dagmar Margotsdotter, die mich vor einigen Jahren mit den Aufsätzen von Otto Gross bekannt machte und mir damit die Abfassung des Kapitels 12 in dieser erhellenden Form ermöglichte.
INHALT
Einführung
Die Frage nach Gott
Erkenntnis leitende Interessen des Buches
Der Mann als Leidtragender des Monotheismus – eine religionspsychologische Untersuchung
Biblische Texte und Kulturen jenseits der Gewalt
TEIL I: GRUNDLAGEN UND WESEN DES BIBLISCHEN MONOTHEISMUS
Vorbemerkungen
Im Zeichen der Göttin – Monotheismus als Kulturbruch und Bedeutungsverlust
Kapitel 1: Zum Wahrheitsgehalt biblischer Texte
Archäologen klären auf
Wer waren die Leviten?
Kapitel 2: Die biblischen Propagandisten religiöser Gewalt
Die Jahwe-allein-Bewegung
Die „Josijanische Reform“
Kapitel 3: Der Monotheismus – eine Religion der Gewalt
Jan Assmanns Monotheismus-Kritik
Die Folgen monotheistischer Gewalt für das Volk
Monotheistische Verwirrungspolitik
Einige Folgen des biblischen Glaubens für Israel heute
Kapitel 4: Jahwe als Ehemann – Aufbruch in eine frauenfeindliche Symbolsprache
Amos und Hosea – zwei Propheten im Vergleich
Die Welt des Hosea – Ein Perspektivwechsel
Die Welt der Gomer
Das Hohelied der Liebe
Der geistige Wandel des Hosea
Ist Gott etwa kein Mann?
Kapitel 5: Das Gottesbild der Jahwe-allein-Bewegung
Einleitende Bemerkungen
Jahwe – ein verzehrendes Feuer und seine Folgen
Das verzehrende Feuer Jahwes im Atomzeitalter
Die positive Alternative in Vergangenheit und Zukunft
Kapitel 6: Weiblicher Widerstand gegen den Monotheismus
Vorbemerkungen
Der Kampf gegen Frauen in Machtpositionen
Maacha – die Königsmutter von Juda
Isebel – Königin des Nordens und Prototyp des Bösen
Flucht nach Ägypten und Entführung des leidenden Propheten
Begegnung mit der Himmelskönigin Ägyptens
Jahwe als Widerspruch zur Leben bewahrenden Göttin
TEIL II: DAS BABYLONISCHE EXIL ALS HISTORISCHER DURCHBRUCH DES MONOTHEISMUS
Kapitel 7: Abschied von der Glaubensfreiheit
Monotheismus als Kulturbruch
Der Exilprophet Ezechiel als Erfinder des religiösen Pogroms
Ezechiel: Prophet der Mitleidlosigkeit – auch gegen sich selbst
Die Frau als Repräsentantin des Bösen
Babylon – Freiheit statt Gefangenschaft
Der Bund Jahwes mit „seinem“ Volk
Sabbatgebot
Beschneidungsgebot
Abschließendes Fazit
Kapitel 8: Am Ende des Exils: Exklusiver Monotheismus
Die Situation am Ende des Exils
Die politische Lage zum Ende des Exils
Der persische Herrscher im Blick der Jahwe-Eiferer
Ein heidnischer Herrscher als „Gesandter Jahwes“?
Prophetische Hybris als Wurzel des exklusiven Monotheismus
Die Anmaßung der Entscheidung über Leben und Tod anderer
Kapitel 9: Nach dem Exil – Beginn einer Heilszeit?
Die große Enttäuschung
Prophetischer Umgang mit der neuen Problemlage
Tritojesaja – Apostel der Gerechtigkeit
Haggai – die große Tempellüge
Sacharja – Prophetenmord im Tempel
Der zweite Tempel – ein Prachtbau?
Maleachi – und der Frust am Jahwe-Kult
Umgang mit dem Mischehenverbot
Maleachi
Esra
Nehemia
Kapitel 10: Jahwes Eifer als Motor des religiösen Terrors
Rück- und Überblick
Widerstand gegen Jahwe allein
Aufstand der Makkabäer
Von der göttlichen zur politischen Diktatur
Der Kampf der Zeloten
Diaspora-Aufstände
Bis zur bitteren Neige – der Bar-Kochba-Aufstand
Die „Erfüllung der Schrift“
TEIL III: PSYCHOLOGISCHER EXKURS UND MYTHOLOGISCHE PARALLELEN
Kapitel 11: Vom Vater verletzte Priestersöhne als Wegbereiter einer kranken Gesellschaft
Das Problem: „Jahwe“ als Macht- und Gewaltvirus
Äußerungen der beschädigten Männer-Seele
Pädagogik als Theologie
Der vergöttlichte Vater als destruktive Kraft in der Psyche des Sohnes
Kapitel 12: Das Patriarchat als Verursacher psychischer Störungen
Die Botschaft des Unbewussten: Zurück zu den Anfängen
Die freie Frau als Grundbedingung kollektiver Befreiung
Die unerkannten Grundbedürfnisse des Menschen
Der Konflikt des Eigenen mit dem Fremden
Geschlechterverhältnisse in Gewaltstrukturen und ihre sado-masochistische Umsetzung
Von der Psychologie des Unbewussten zur Philosophie der Revolution
Kapitel 13: Der Einbruch der Vaterreligion und die Verkehrung der Wirklichkeit
Vorbemerkungen
Stationen des Umbruchs: Mythos und Naturordnung
Wandlung der Mutter-Tochter-Beziehung
Beginn der Vater-Tochter-Beziehung
„Es gibt auch ohne Mutter Vaterschaft“ – Der bedeutendste Rechtsstreit der Antike
Wandlung des Frauenbildes am Beispiel der Erinnyen
Wenn Erinnerung und Wahrheit auf der Strecke bleiben
Klytaimnestra und Agamemnon
Männlicher Gebärneid und die Bedeutung der Mutter
Kapitel 14: Vom Niedergang der Kultur
Das Grundproblem
Katastrophen als Vergeltungsakte
Die Allgegenwart der Geschlechterfrage
Glaube als Vertrauensverlust
Glaube als Hindernis auf dem Weg zur Wahrheit
Was Frauen und Männer lernen müssen
TEIL IV: JENSEITS DER GEWALT
Vorbemerkungen
Kapitel 15: Biblische Lehren jenseits der Gewalt
Das Buch Jona und sein Anliegen
Kritik am Jahwe-allein-Propheten und seinem Gottesbild
Der „wahre“ Gott widerspricht dem Propheten
Zusammenfassung
Die verschwundene Weisheit
Kapitel 16: Die Priorität des Weiblichen im Tao-te-king
Leiden an patriarchaler Unwahrhaftigkeit
Das TAO als weiblicher Urgrund allen Seins
Die weibliche Symbolwelt im Tao-te-king
a.)Der Urschoß als Gefäß
b.)Das Wasser
c.)Weiblich und männlich
Kapitel 17: Die Ur-Religion der Steinzeit
Vorbemerkungen
1.Anatolien – Land der Mütter und Göttinnen (James Mellaart)
Catal Höyük – eine weibliche Kultur des Friedens
Die Frau als Schöpferin und Erhalterin des Lebens
Leben – Tod – Wiedergeburt
Weibliche Dominanz und männliche Herrschaft
Religiöser Glaube ohne Blutopfer
2.Göttin-Kultur in Alt-Europa und die Kurganvölker (Marija Gimbutas)
Götter zuerst
Erfahrungen einer profilierten Anthropologin
Echte Mythen lügen nicht
Die Sprache der Göttin verstehen lernen
Kapitel 18: Weshalb wir das mythische Denken brauchen
Was bedeutet der monotheistische Kulturbruch?
Diente die Liquidierung des Mythos der Aufklärung?
Mythen als Verstehenshilfe und Quellen der Kraft
Der Frevel des Eresychthon – Ein Mythos
Trug der „Geist der Vernunft“ den Sieg davon?
Eine Wissenschaft der Vernunft
Literaturverzeichnis
EINFÜHRUNG
Entweder wollen die Götter die Ungerechtigkeit
in der Welt abschaffen und können es nicht
– dann sind sie schwach;
oder sie können es und wollen es nicht
– dann sind sie schlecht;
oder sie können es nicht und wollen es nicht
– dann sind sie schwach und schlecht;
oder sie können es und wollen es
– warum tun sie es dann nicht?
Epikur 1985, 51
Die Frage nach Gott
Seit Jahrhunderten gibt es unterschiedliche Varianten von „Gottesbeweisen“ – doch haben sie allesamt nicht das gebracht, weshalb sie erbracht wurden: den Nachweis, dass Gott existiert. Das ist allerdings kein Grund für Atheisten, sich die Hände zu reiben und ins Fäustchen zu lachen; denn auch der Atheismus war in dieser Hinsicht nicht minder erfolglos.
Inzwischen steht nämlich fest: Weder die Existenz Gottes noch seine Nicht-Existenz lassen sich empirisch „beweisen“. Die Frage nach dem Göttlichen ist somit endgültig dem Bereich der Empirie entzogen. Was bleibt, ist die philosophische Frage nach Sinn und Unsinn des Gottesglaubens, wogegen sich Theologen ruhig verwahren mögen.
Weltanschauungsfragen lassen sich nun einmal nicht beweisen, sondern lediglich gut oder schlecht begründen. – Damit hat sich diese Form der Gottesfrage erledigt und ist auch für das vorliegende Buch nicht weiter von Bedeutung.
Wenn hier von „Gott“ die Rede ist, so handelt es sich nicht um „das Göttliche an sich“, das sich so gern in theologische Sonntagsreden einschleicht, sondern ausschließlich um den monotheistischen Gott Jahwe der hebräischen Bibel bzw. des Alten Testaments. Sein Name wird als so heilig angesehen, dass er nicht ausgesprochen werden darf und an dessen Stelle der Begriff Adonai gesetzt wird: der HERR.
Allein dieser HERR – ein durch und durch männlicher Gott – ist demnach Gegenstand der ersten drei Teile dieses Buches. Ein Gott, der allein aus der Bibel spricht und immer wieder durch die Mühlen der Theologie gedreht wurde, bis er auch den Philosophen noch etwas zu sagen hatte.
In diesem Buch geht es nun darum, die biblischen Texte selber von diesem Gott reden zu lassen und die Theologen, Kommentatoren und Religionsgeschichtler nur dann zu konsultieren, wenn sie zu einem besseren Verständnis bestimmter Texte beitragen können, was leider nicht immer der Fall ist.
Trotz ihrer hin und wieder durchaus auch erhellenden Kommentare scheint sie die Frage nach der Existenz Gottes nicht weiter zu berühren, sind sie doch förmlich gezwungen, an ihr festzuhalten, und sie bestätigen samt und sonders die Existenz dieses Gottes, setzen ihn stillschweigend voraus oder tun zumindest so – müssen so tun? – als ob sie es täten.
Erkenntnis leitende Interessen des Buches
Die Frage, wie Theologen das durchhalten, nachdem sie doch wissen – und zwar spätestens durch die neuere archäologische Forschung –, dass der von ihnen einst verkündete „HERR der Geschichte“ mit dieser nicht das Geringste zu tun hat, diese Frage habe ich als studierte Theologin mir häufig gestellt. Denn eines ist klar: Die so genannten „Geschichts“bücher der Bibel berichten nichts seltener als historische Ereignisse, die diesen Namen verdienen: Der berühmte Exodus aus Ägypten fand nie statt, ein jüdisches Volk als Fronarbeiter in den Händen eines tyrannischen Pharao ist somit hinfällig und auch einen Mose als „Mann Gottes“ und Gegenspieler Pharaos, der das „von Gott erwählte Volk“ aus der „Sklaverei“ in die „Freiheit“ führte, hat es nie gegeben. All dies ist das wohlkalkulierte Produkt der Phantasie seiner Verfasser, die ihn als Autoritätsperson aufbauten, um sich selbst hinter ihm verschanzen zu können.
Warum also ein Buch, das sich mit jenem Glauben befasst – dem Monotheismus –, dessen Gott dem Machtkalkül einer priesterlichen Verfassergruppe entsprungen zu sein scheint, deren Wahrheitsbedürfnis weit hinter ihrer Machtgier zurückstand?
Nun, nachdem die Frage nach der Existenz Gottes zur Irrelevanz verdammt ist, erscheint mir eine Untersuchung der „Rede von Gott“ umso bedeutsamer, denn erst eine solche vermag echte Aufklärung zu bringen, die mit einer simplen Negation Gottes schlichtweg nicht zu haben ist.
Nachfolgend lege ich daher die wesentlichen erkenntnisleitenden Interessen dar, die mich zur Abfassung dieses Buches veranlasst haben:
1. Im Angesicht des islamistischen Terrors, der weltweit seine brutalen Mordaktionen mit Tötungsbefehlen aus dem Koran rechtfertigt, muss der jüdisch-christliche Westen zur Kenntnis nehmen, dass sich nicht nur diese Tötungsbefehle in letzter Konsequenz auf die Bibel zurückführen lassen, aus der Mohammed erkennbar vieles übernommen hat. Auch dem im religiösen Weltbild der Islamisten so überdeutlichen Freund-Feind-Denken wurde schon von bestimmten Verfassern der Bibel ein fester Platz in der Religion zugewiesen.
Die islamistische Männer-Clique mit ihrem Anführer Al Bagdadi – einem promovierten Islamwissenschaftler – schreckt vor gar nichts zurück. Nicht einmal vor der Tötung ehemaliger Freunde und Verwandter. – Und sie weist damit wiederum deutliche Parallelen auf zum Denken und Handeln einer levitischen Kerngruppe biblischer Verfasser, die mit ihren ordensähnlich organisierten levitischen Hilfstrupps in Judäa den Glauben an Jahwe allein am Ende des 7. vorchristlichen Jahrhunderts mit denselben Methoden durchsetzen wollten, mit denen heutige Islamisten gegen „Ungläubige“ vorgehen (vgl. Kapitel 2).
Zerstörungs- und Tötungsbereitschaft sind ebenso wie Distanz zu Freunden und Familie auffällige Symptome beider Reiche der „Gotteseiferer“. Leider scheinen heutige Theologen diese brisanten Analogien nicht zu bemerken oder sehen zu wollen.
2. Der zweite Grund, der eine genauere Untersuchung biblischer Gottesrede als dringend notwendig erscheinen lässt, liegt in jenem Monotheismus-Diskurs, der seit nunmehr knapp zwei Jahrzehnten öffentlich geführt wird. Ausgelöst und in Gang gehalten von dem Ägyptologen und Altertumsforscher Jan Assmann mit seinen Büchern zur „mosaischen Entscheidung“ (Ma'at 1990; Das kulturelle Gedächtnis 1992; Moses der Ägypter 1998), führte er zu starken Differenzen mit Theologen, die Assmanns Behauptung schroff zurückwiesen, mit dem Monotheismus sei es zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte zu religiös motivierter Gewalt gekommen auf der Grundlage eines männlichen Eiferns für den einen „wahren“ Gott Jahwe. Statt auf dieses äußerst gewalthaltige religiöse Eifertum einzugehen, das viele Bücher der Bibel unleugbar durchzieht, wird lediglich abgewiegelt, relativiert (z. B. Rendtorff in: Assmann 2003, 204) oder ausgewichen mit Sätzen wie: „Die Friedfertigkeit des Polytheismus wird überschätzt“, (Zenger in: Assmann, 203, 215) sowie durch Ablenkung von der biblischen Gewalt auf jene „des christlichen und islamischen Monotheismus“ (ebd., 218) oder ein Ausweichen auf die apologetische Frage: „Monotheismus als Sündenbock?“ (Koch in: Assmann 2003, 221ff.).
Diese drei Beispiele stehen für zahlreiche unbefriedigende Reaktionen auf die durchaus konstruktiv gemeinten Verweise Assmanns auf jene gewalthaltigen Texte der Bibel, die mich am Ende veranlasst haben, meine Untersuchungen auf das Thema religiös motivierter Gewalt zu konzentrieren. Zumal diese Texte den wenigsten jüdisch oder christlich Gläubigen bekannt sein dürften und folglich auch nicht kritisch reflektiert und schließlich als „göttliche Befehle“ abgelehnt werden können. Eine öffentliche Distanzierung von ihnen hat daher auch nie stattgefunden, wäre aber eine Voraussetzung dafür, um dem heutigen Judentum und Islam in angemessener Weise begegnen zu können. Statt sich diesem Thema zu stellen, bedient man sich vorschnell des absurden Vorwurfs des Antisemitismus. Wer sich aber das gebotene „Zurück zu den (gemeinsamen) Anfängen“ erspart, verschlimmert lediglich den religiösen Dissens.
3. Ein dritter Grund liegt in dem von jüdischer und christlicher Seite immer wieder zu hörenden Argument, mit dem biblischen Monotheismus sei überhaupt erst die Ethik in die Religion eingezogen, die einen enormen geistigen Fortschritt gegenüber polytheistischen Religionen gebracht habe. Regelmäßig wird dabei auf die Abschaffung des Menschenopfers als besonderes Verdienst des Monotheismus verwiesen. Dass aber die Durchsetzung des Monotheismus nach Aussagen der Bibel mit der Abschlachtung von Menschen einherging und von den Verfassern gleich mehrfach gefordert wurde, ignoriert man geflissentlich. – Auch darüber wollen meine Untersuchungen aufklären. Ganz abgesehen davon, dass die Opferung der Tochter Jephtas an Jahwe als Dank für dessen Sieg über die Feinde, der ihm die Herrschaft verschaffte, geflissentlich übergangen wird, sollte auch nicht vergessen werden, dass Jahwe immerhin noch von Abraham die Bereitschaft zum Sohnesopfer forderte als Beleg dafür, dass er Jahwe mehr liebe als seinen Sohn Isaak.
Das Thema göttlicher Eifersucht durchzieht die ganze Bibel und bestimmt als zentrales Thema die Eiferer des HERRN bis heute. Es ist ein Thema des Monotheismus ebenso wie der Monogamie. Auf diesen Zusammenhang verweise ich mehrfach – ein Thema männlicher Gewalt, die bis heute regelmäßig ganze Familien auslöscht. Auch steht eine Antwort auf die Frage noch aus, welches Licht das Erfordernis der Opferung Jesu am Kreuz auf den biblischen Gott wirft. Eine nachösterliche Erfindung offenbar des zunächst Jesus feindlichen Pharisäers Paulus, der davon ausging, dass es zur Vergebung der Sünden das Opfer eines Unschuldigen bedürfe, da Sünden offenbar nicht ohne ein solches vergeben werden können.
4. Als vierten Grund nenne ich die in Bibel und Theologie unbeantwortet gebliebene Frage nach der Entstehung und Verbreitung des biblischen Monotheismus in einem Volk, das sich nachweislich bis zur Mitte des 6. vorchristlichen Jahrhunderts zur Verehrung von Göttern wie El, Jahwe und Baal an der Seite von Göttinnen wie Aschera und Astarte bekannte, was als Faktum dokumentiert ist. Selbst in der Bibel lassen sich zahlreiche Zeugnisse dafür finden, dass sich sowohl der Norden wie auch der Süden des Landes Jahrhunderte lang gegen die Übernahme der Verehrung nur eines Gottes vehement und anhaltend zur Wehr setzte. – Grund genug für die Verfasser, über das Zustandekommen des monotheistischen Glaubens im Volk zu schweigen, was aber nicht bedeutet, dass sich darüber nichts herausfinden ließe. Theologen verweisen an dieser Stelle gern auf das babylonische Exil als Entstehungsort des monotheistischen Glaubens, ohne allerdings näheren Umstände darzulegen. Da er dort aber mit Sicherheit nicht vom Himmel gefallen ist, wurden die Texte besonders auf diese Frage hin abgeklopft. Dabei bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass sich ein kleiner Teil des judäischen Volkes unter dem Eindruck der furchtbaren Umstände der Deportation im babylonischen Exil diesen neuen Glauben hat aufzwingen lassen (ausführlich dazu Kapitel 7). Für diese These habe ich eine Reihe von Indizien nicht nur aus der Zeit des Exils, sondern auch aus der nachexilischen Epoche zusammengetragen.
5. Der fünfte Grund liegt in der Unmöglichkeit, sich auf der Grundlage theologischer Aussagen ein genaues Bild zu machen über die hier aufgeworfenen Probleme. Immer wieder musste ich erstaunt feststellen, dass Theologen auch noch die gewalttätigsten Texte irgendwie zu rechtfertigen suchten und Jahwes Beschlüsse vielfach mit seiner unhinterfragbaren Allmacht und der „erziehungsbedürftigen“ Halsstarrigkeit des jüdischen Volkes begründeten, das einfach nicht hören wollte. Das wahre Ausmaß an geistiger Vergewaltigung, das die Einführung des Monotheismus im Exil und danach mit sich brachte, lässt sich aber nur ermitteln, wenn wir uns die Texte im biblischen Zusammenhang genauer ansehen und durch die Jahrhunderte hindurch verfolgen. Mit diesem Anliegen weitete sich das Thema jedoch stärker aus als ursprünglich geplant. Andererseits wurde dabei aber auch erst der durchgängige Widerstand deutlich, den das Volk – einmal im Griff des Monotheismus gefangen – immer wieder an den Tag legte und sich nach anderen religiösen Optionen umsah (siehe Kapitel 9 und 10).
6. Der sechste Grund ergab sich erst im Verlauf meiner Recherchen, die mir überhaupt erst eröffneten, wie gering der historische Wahrheitsgehalt biblischer Texte zu veranschlagen ist (siehe Kapitel 1 und die archäologische Forschung). Erst jetzt kam es zur Frage nach der Motivation der biblischen Verfasser. Was hatte sie veranlasst, eine solche Fülle an Lügentexten in „historischem“ Gewand aufzuzeichnen, wenn sie mit deren Hilfe die Menschen doch nur in die Irre führen wollten? Welche Zwecke verfolgten sie mit einer solchen Fülle an leerer Symbolik? Um welche Art von Manipulation der Menschen ging es dabei? Und weshalb bestanden Theologen darauf, biblische Texte von anderen Mythenbildungen abzugrenzen und von einem „Gott der Geschichte“ zu reden, der so viel höher angesiedelt wurde als all die Naturgottheiten jener Zeit? Handelte es sich nicht vielmehr um einen erlogenen Gott, der mit historischen Gegebenheiten nur selten etwas zu tun hatte? Auf all diese Fragen erhoffte ich mir Antworten durch gründlichere Recherchen – und ich meine, sie am Ende auch gefunden zu haben. Wobei den Leserinnen und Lesern dieses Buches ein eigenes Urteil darüber unbenommen bleibt.
7. Als letzten Grund möchte ich den menschheitsgeschichtlich wohl bedeutsamsten – von einer männlichen Theologie aber regelmäßig ignorierten – Aspekt der Frauenfeindlichkeit nennen als einen der wichtigsten Gründe für die Durchforstung so vieler Texte. Besonders in der Metaphorik der biblischen Propheten kommt es immer wieder zu Obszönitäten und überbordenden Gewaltphantasien, die sich gegen Frauen als Töchter, Ehefrauen oder selbstbewusste Aristokratinnen richten. An ihnen entzündet sich immer wieder ein tiefsitzender – durchaus erklärlicher – Frauenhass (s. insbesondere Kapitel 46 u. 7), der hinter diesem wohl stärksten Kulturbruch der Menschheitsgeschichte erkennbar wird.
Das übermächtige Weibliche stand dem Jahrhunderte währenden Versuch einer Reduzierung des Göttlichen auf eine einzige männliche Kraft im Wege und musste mit allen Mitteln beseitigt werden. Es war zu fest in den Seelen der Menschen verankert, als dass den Monotheismus-Fanatikern ein rascher Erfolg hätte sicher sein können.
Hinzu kam jene Evidenz weiblicher Transzendenz in Gestalt von Liebes- und Muttergöttinnen, die dem männlichen Gott allein zu keiner Zeit beschieden war. Dazu bedurfte es einer langwierigen Entfremdungsarbeit – zu Lasten der Frauen und der weiblichen Dimensionen des Lebens, die nachhaltig diffamiert wurden.
Es war ein äußerst schwieriger und langwieriger Prozess, da der männliche Gott dem Anspruch Seiner Einzigartigkeit in keiner Weise gerecht zu werden vermochte und er es daher schwer hatte, die Menschen zu beeindrucken und von ihnen als verehrungswürdig erachtet zu werden, während den Göttinnen eine solche Verehrung zu jeder Zeit sicher war. – Ein für die Übernahme des neuen Glaubens in der Tat hinderliches Faktum, das einen eifersüchtigen Jahwe und seine Verfasserclique, die jenen zu etablieren suchte, in Rage bringen musste.
Der „Sieg“ des Monotheismus aber sollte das Gesicht der Religion komplett verändern, bedeutete er doch zuallererst einen Bruch mit der Jahrhunderte alten Tradition des Volkes, begleitet von jenem Gefühl der Untreue gegenüber den von den Menschen so sehr geliebten kultischen Traditionen im Namen ihrer Göttin, die die Gotteseiferer schamlos ausnutzten und sie auf Jahwe hin umdeuteten.
Der „Sieg“ bedeutete aber auch eine Ablösung von der Wirklichkeit dieser Welt und dem neuen religiösen System, das einen männlichen Gott zur Grundlage aller Schöpfung erklärt, obwohl doch bis dahin immerhin weltweit Göttinnen und Götter als Grundlagen des Lebens anerkannt und verehrt wurden. Hinzu kam, dass nunmehr die vorrangig weiblichen, Leben schenkenden Kräfte auch noch diffamiert, für „unrein“ erklärt und in stark intellektualisierter – und nicht etwa „vergeistigter“ – Form auf den biblischen Jahwe übertragen wurden. Mit diesem Schritt in die Verabsolutierung des Männlichen ging zudem eine Martialisierung der Religion einher, die für die Einführung der Gewalt als festen Bestandteil des Monotheismus verantwortlich war. Fortan standen nun nicht mehr Lebensprozesse im Mittelpunkt des kultischen Lebens (siehe Kapitel 4), sondern Befehls- und Gehorsamsstrukturen, bei denen es um die Erfüllung und Einhaltung von Gesetzen, Regeln sowie Speise- und Reinheitsvorschriften ging, in denen Männer den Frauen sogar Vorschriften machten über ihren Umgang mit Menstruation, Gebären und die Zeiten danach – eine Unverfrorenheit sondergleichen.
Hinweise auf diesen Zusammenhang zwischen der Verdrängung des Weiblichen und der Zunahme von Gewalt durchziehen fast alle Kapitel dieses Buches. Sie lassen sich bis heute unschwer in allen drei monotheistischen Religionen nachweisen – ebenso wie das männliche Ignorieren dieses Aspekts eines unipolaren Weltbildes.
Belegen lässt sich dieser Zusammenhang aber auch innerbiblisch, ging doch der stärkste und eindeutigste Widerstand gegen den Monotheismus von Frauen aus, die die Gewalthaltigkeit des neuen Glaubens bereits im 6. vorchristlichen Jahrhundert beim Namen nannten.
Ihr diesbezüglicher Widerstand aber war nicht etwa gegen Männer gerichtet, sondern wurde mit ihnen erfolgreich durchgezogen. Gemeinsam hielten sie der Göttin die Treue statt „Jahwe allein“ (siehe Kapitel 6).
Der Mann als Leidtragender des Monotheismus – eine religionspsychologische Untersuchung
Im dritten Teil des Buches enthält das Kapitel 11 zunächst eine religionspsychologische Untersuchung der leidvollen Folgen des Monotheismus für die kindliche Seele von drei priesterlichen Propheten – den anfänglichen Opfern und dann auch Trägern – dieses neuen Glaubens. Sie waren bereits in früher Kindheit in besonderer Weise betroffen von den nunmehr aufkommenden Befehls- und Gehorsamsstrukturen, die einen Vater-Sohn-Konflikt von gravierender Bedeutung verursachten, den es zuvor in dieser Vehemenz wohl kaum auf breiter Ebene gegeben haben dürfte.
Erhellend sind hier die sogenannten „Klagelieder des Jeremia“, die in einem Kapitel auf einen solchen Konflikt verweisen. Hier greife ich auf die Untersuchungen von Alice Miller zurück, die in diesem Text Zeugnisse einer tragischen kindlichen Wehrlosigkeit dem Vater gegenüber erkennt, die sich dann im Erwachsenenalter in einen Konflikt mit Jahwe verwandelt, da eine Auseinandersetzung mit dem Vater nicht möglich war. Hier liegt die Quelle späterer Ausbrüche der meisten Propheten von Zorn und Zerstörungswahn gegen das „ungehorsame Volk“, das sie als Kind gegenüber dem Vater selbst einmal darstellten.
Im Anschluss daran folgt eine Auseinandersetzung mit der pädagogischen Literatur überwiegend von Theologen des 18. und 19. Jahrhunderts, in der dieser Vater-Sohn-Konflikt auf der Grundlage der biblischen Pädagogik wiederum konstelliert wird. Es sind erschreckende Zeugnisse eines väterlichen Sadismus jener irdischen Stellvertreter des biblischen Gottes, der nicht nur keine anderen Götter neben sich duldet, sondern auch keine Widerworte, ja, nicht einmal körperlich-seelische Regungen des Kindes, die den väterlichen Vorgaben widersprechen.
Bereits im 18. Jahrhunderts entstand so ein ausgeklügeltes Manipulationssystem, das zugleich die Unkenntlichmachung väterlicher Gewalthandlungen in der Seele des Kindes bewirkte. Es weist bereits weitreichende psychologische Erkenntnisse auf, lange bevor es eine psychologische Wissenschaft gab.
Im zweiten Teil des 11. Kapitels stelle ich einen besonders gut recherchierten Vater-Sohn-Konflikt dar, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Seele eines erwachsenen Sohnes jenes Dr. Schreber aufbrach, der in Deutschland als leuchtendes Vater-Vorbild an medizinischem und pädagogischem Sachverstand galt. Dies nicht zuletzt auch aufgrund der von ihm initiierten „Schreber-Gärten“, die bis heute existieren, und dessen grausam-frommen Erziehungsmethoden nicht einmal ein Sigmund Freud auf die Schliche kam.
Hier hat der amerikanische Psychiater Morton Schatzman hervorragende Arbeit geleistet mit seinem Buch Die Angst vor dem Vater in dem er die Zusammenhänge zwischen dem einstigen väterlichen Verhalten und den später auftretenden Störungen des hochintelligenten Sohnes aufzeigt, der zwar als „verrückt“ galt, vor dem Hintergrund der erfahrenen Erziehung aber durchaus „normal“ reagierte. – Einer Erziehung, die bei seinem älterer Bruder immerhin zum Suizid führte. Der „verrückte“ Schreber-Sohn fühlte sich fast permanent von „Gott“ angestrahlt, belästigt und „erwählt“ und hat diesen Zustand selbst in einem Buch akribisch untersucht. Er schaffte es aber nicht, von Gott auf seinen Vater zu schließen und diesen als Urheber seiner gravierenden Probleme dingfest zu machen. – Hier zeigen sich auffallende Parallelen insbesondere zu dem gestörtesten aller Propheten – Ezechiel (= Hesekiel).
Solche religiös fundierten Vater-Sohn-Konflikte zeigen sich in allen drei monotheistischen Religionen in gleichbleibender Regelmäßigkeit.
Im Kapitel 12 geht es um eine allgemeinere Auseinandersetzung mit jener frühkindlichen „Beschneidungs“-Pädagogik, die gerade im 19. und 20. Jahrhundert fast jedes Kind – oftmals gleich nach der Geburt – den von männlichen Pädagogen ersonnenen Bedingungen aussetzte, zu denen ihnen die lebensnotwendige mütterliche Zuwendung und Nähe gewährt werden sollte.
Die von Müttern immerhin seit Jahrmillionen aus eigenem Antrieb heraus gewährte Nähe und Zuwendung geriet durch den Monotheismus in ein männlich-patriarchales Verteilersystem, das die Mütter und ihre Kinder gleichermaßen unter Druck setzte. Dies ist eine „Schwarze Pädagogik“, die letztendlich zum „Hitlerismus“ führte, in dem sich die geschädigten Kinder unter einem neuen autoritären „Vater“ und „Heilsbringer“ zusammenfanden, der ihre verletzten Seelen heilen sollte. Doch auch hier blieb es dabei, wie gewohnt seinen Befehlen zu lauschen – und zu gehorchen.
Psychologische Bezugspunkte sind in diesem Teil der Psychiater Otto Gross und die Ärztin und Anthropologin Jean Liedloff.
Beide stellen auf ihre Weise die Bedeutung der Mutter in den Vordergrund und kritisieren den entfremdeten Umgang mit Kindern in der patriarchalen (Gross) bzw. zivilisierten (Liedloff) Welt. Doch geht diese Kritik bei dem Psychiater Gross wesentlich weiter als bei Liedloff, verweist jener doch in großer Klarheit auf die fatale Verkehrtheit des patriarchalen Systems, das den mütterlichen Voraussetzungen für ihr Muttersein längst die Grundlage entzogen hat.
Mit Gross und Liedloff lockert sich die Konzentration auf den monotheistischen Kulturbruch in Erweiterung auf den patriarchalen Kulturbruch, der wesentlich früher anzusetzen ist.
Mit diesem erweiterten Blick beschreibt das nachfolgende Kapitel 13 das Phänomen des Austauschs der Mutter durch den Vater am Beispiel der antiken Tragödie der Orestie von Aischylos, die in dieser Hinsicht mit ihrem dritten Teil eine Schlüsselposition in der antiken Literatur einnimmt. Dass sie zudem noch heute als Grundlagentext westlicher Demokratien aufgefasst wird, stellt nicht gerade deren Mütterfreundlichkeit unter Beweis.
„Es gibt auch ohne Mutter Vaterschaft“ ertönt es darin also auch in Griechenland zeitgleich mit der Abfassung der bedeutendsten biblischen Texte im 6. vorchristlichen Jahrhundert, knapp 600 Jahre später gefolgt von dem Ausspruch des Apostels Paulus: „… es ist nicht der Mann aus der Frau, sondern die Frau aus dem Mann.“ – Musterbeispiele patriarchaler Verkehrung, die die Verkehrtheit des Systems begründeten.
Beide Verfasser beziehen sich auf den jeweiligen Mythos ihres Kulturraumes – gleichermaßen geprägt von jenem Gebärneid des Mannes, der auch Jahwe bereits gequält haben muss. Er drückt sich nach Erich Fromm noch in der modernen kapitalistischen Wirtschaft in einer überbordenden Produktion – meist sinnloser Güter – aus, die die Welt verschmutzen und die Ressourcen der Erde verschwenden, nur um die produktiven Fähigkeiten des Mannes unter Beweis zu stellen – auch wenn es sich dabei lediglich um tote Güter handelt.
Den 3. Teil des Buches beschließend, verweist Kapitel 14 auf einen modernen „Propheten des Untergangs“, den Anthropologen Robert Briffault, der eine ähnliche Kulturkritik übte wie sein Zeitgenosse Gross und einige Jahrzehnte nach ihm auch der mehrfach zitierte Fromm.
Während seiner Arbeit an dem berühmten zweibändigen Werk „The Mothers“ verfasste Briffault einen bemerkenswerten Aufsatz, der Gegenstand dieses Kapitels ist. Mit ihm erweitert sich der Blick ein weiteres Mal auf jenen patriarchalen Kulturbruch, der nach Briffault rund 6000 Jahre zurückliegt.
Und so geht er davon aus, dass die Ursachen der gravierenden Probleme wirtschaftlicher, ökologischer, kultureller, sozialer wie auch psychischer Art (in Deutschland lassen sich mittlerweile ein Drittel aller Krankmeldungen auf psychische Erkrankungen zurückführen) nicht erst mit der technologischen Entwicklung der modernen Industriegesellschaft entstanden sind, wie viele meinen, sondern bereits mit dem wesentlich früheren patriarchalen Kulturbruch.
Unsere heutige Problemlage sieht er folglich als eine Anhäufung von „Altlasten“, die die Menschheit seit Jahrtausenden vor sich herschiebt – bis an den Abgrund, auf den Briffault die Menschheit bereits vor einhundert Jahren zusteuern sah und mit dieser Sicht bis heute aktuell geblieben ist. Er begriff das patriarchale Kulturmodell als eine fatale Fehlentwicklung, als ein einziges Lügensystem, an dem die Menschheit immer stärker leidet und daran letztlich zugrunde gehen wird: „Wir zahlen für die Sünden unserer Väter und entrichten gegenwärtig die Geldstrafe für 6000 Jahre Unaufrichtigkeit“, durch die alles in Frage gestellt wird, was wir bislang geglaubt haben.
Das gilt insbesondere für unser religiöses Credo, der „Mensch“ (Mann) sei geschaffen worden, sich die Erde untertan zu machen und über alle Lebewesen zu herrschen. Eine Vorstellung, die bis heute den ganzen Wissenschaftsbetrieb ebenso wie die Ökonomie und andere Bereiche der Gesellschaft bestimmt, doch letztlich dem ersten Schöpfungsbericht der Bibel entstammt. Ihm verdanken wird jene „Freiheiten“, die der Realitätsferne des monotheistischen Glaubens entsprechen. Der durch sie verursachte Mangel an Rückbindung (re-ligio) an die Wirklichkeit irdischer Gegebenheiten und Bedingungen ist längst dabei, uns das Genick zu brechen – worin wohl die meisten Umwelt- und Klimaberichte einiggehen.
Biblische Texte und Kulturen jenseits der Gewalt
Um zu zeigen, dass es auch anders hätte gehen können bzw. auch anders gegangen ist, beschließe ich das Buch mit einen vierten Teil. Er beginnt im Kapitel 15 mit einem nochmaligen Blick auf die Bibel jenseits jener Gewalttexte, die den ersten und zweiten Teil des Buches bestimmen.
Diesmal verweise ich auf die Weisheitsliteratur, der ein vollkommen anderes Denken zugrunde liegt als wir es bisher kennenlernen konnten. Bezeichnenderweise kommt es aber nicht aus ohne die Wiedereinführung einer weiblich-transzendenten Gestalt – genannt Frau Weisheit.
Folglich geht es in der Weisheitsliteratur um die Wirklichkeit der Welt, um Lebensnähe, Mitgefühl und Menschenfreundlichkeit, die wir in den anderen Texten so schmerzlich vermissten.
Den Auftakt dieser Textreihe bildet das Buch Jona, das auch ohne Frau Weisheit aus guten Gründen dieser Literaturgattung zugeordnet wurde. Es handelt sich um ein Lehrstück, in dem ein nicht-eifernder Verfasser – möglicherweise auch eine Verfasserin – ein völlig anderes Gottesbild entwirft, das durch und durch weibliche Züge trägt. Es steht in einem auffallenden Kontrast zu der fiktiven Gestalt des Propheten Jona, der sich diesen Gott männlicher – strafend dreinfahrend – wünscht und ihm seine Nachsicht und Güte gegenüber den sündigen Menschen der Stadt Ninive zutiefst verübelt. Es handelt sich hier um eine relativ späte Propheten-Kritik einer Person, die das in der Bibel vorgefundene Jahwe-Bild vehement abgelehnt haben muss.
In der zweiten Hälfte dieses Kapitels werden Texte aus weisheitlichen Spruchsammlungen vorgestellt, in denen Jahwe – wenn überhaupt – nur noch eine recht marginale Rolle spielt. Sie kommen größtenteils auch ohne ihn aus und vermitteln uralte Lebensweisheiten, die nicht selten auf matriarchale Werthaltungen verweisen.
Im nachfolgenden Kapitel 16 stelle ich dann die detaillierteste Beschreibung des matriarchalen Weltbildes mit der dazugehörigen Ethik vor, die uns der chinesische Philosoph Laotse in seinem Tao-te-King hinterlassen hat – der wohl tiefgründigsten Philosophie, die wir kennen.
Laotse selbst ist in einer noch matriarchalen Sippe aufgewachsen, bevor er als Archivar an den kaiserlichen Hof kam. Er kannte demnach beide Gesellschaftsmodelle und beschreibt sein Leiden unter der Verkehrtheit des patriarchalen Systems, dem auch er nur den Untergang prophezeien kann.
Wie bereits der Titel des Buches erkennen lässt, dreht sich in seinem Buch alles um das TAO, jene Ur-Göttin, die in manchen Übersetzungen recht irreführend mit maskulinen Namen benannt wird, wie zum Beispiel „der Sinn“ oder auch „der Weg“, mit denen sie als Ur-Göttin sogleich wieder unkenntlich gemacht wurde.
Hier bildet Erwin Rousselle eine rühmliche Ausnahme, der zwar nicht die beste aller Übersetzungen vorgelegt hat, dafür aber in seine Übersetzungen des TAO-Begriffs ausschließlich weibliche Worte aufnimmt, wie zum Beispiel: „Mutter der zehntausend Wesen“ oder auch „Führerin des Alls“. Dazu vermittelt er in einem Anhang relativ ausführlich den matriarchalen Hintergrund dieser Weisheitslehre.
Im Kapitel 17 geht es um den wissenschaftlichen Nachweis matriarchaler Kulturen am Beispiel Anatoliens (James Mellaart) und Alt-Europas (Marija Gimbutas). Wenn beide auch nicht den Begriff Matriarchat verwenden, so liegt dies an dem vielfach konstruierten Missverständnis, es handle sich dabei um ein System der „Frauenherrschaft“. – Ein absurder Gedanke, da es eine solche in der Tat nie in einem größeren Rahmen gegeben hat. Damit wäre aber auch der Matriarchats-Begriff nicht korrekt wiedergegeben, bedeutet er doch nichts anderes, als dass die Mutter am Beginn allen Lebens wie auch jeder Sippe und Familie steht.
Erst später wurde das Wort „arché“ – ursprünglich: Anfang, zugrunde liegendes Prinzip – mit „Herrschaft“ übersetzt und dann in eine Epoche zurückprojiziert, in der Herrschaftsstrukturen gänzlich unbekannt waren.
Noch heute empfinden matriarchale Kulturen einen tiefen Abscheu gegenüber jedweder Herrschaft über Menschen. Sie ist ein echtes Patriarchatsphänomen und hat nichts mit der Frühzeit zu tun.
Autoren wie Uwe Wesel haben es sich in der Vergangenheit nur allzu leicht gemacht, das Matriarchat zu „widerlegen“, ohne auch nur die geringsten Nachforschungen angestellt zu haben, indem sie einfach die falsche Definition zugrunde legten. Wesels Argumentation schwirrt noch heute durch die Köpfe vieler Menschen und blockiert so wichtige Erkenntnisse, derer wir noch nie so dringend bedurften wie heute.
Insbesondere im zweiten Beitrag von Marija Gimbutas wird deutlich, was Religion einmal war und welch umfassendes Weltverständnis sie den Menschen von der sie umgebenden Wirklichkeit zu vermitteln vermochte. Von Geschehnissen, die sich tagtäglich und Nacht für Nacht in sich ewig wandelnden Zyklen und Rhythmen immer wieder neu ereigneten und das Leben der Menschen ordnend bestimmten.
In allem verehrten sie die weibliche Kraft der Göttin, die alles umfasste. Die auch das Männliche aus sich entließ, es stärkte und am Ende wieder zu sich nahm.
Alles enthaltend, in allem enthalten durchdrang sie alles und war in der Tat die allumfassende EINE – der wahre Monotheismus und damit das genaue Gegenstück zum exklusiven Monotheismus der Bibel.
Den Abschluss bildet mit Kapitel 18 ein Plädoyer für die Integration des mythischen Denkens, das nach wie vor vom dualistischen Entweder-Oder-Denken des Rationalismus verdeckt wird – einem Denken, das mit dem biblischen Monotheismus begann und es auf die Liquidierung des Mythos abgesehen hatte.
Anhand von drei mythischen Beispielen wird erläutert, worin der Wert eines aufgeklärten mythischen Bewusstseins besteht, das uns als vierte Bewusstseinsebene (nach der mythischen, magischen und rationalen) fehlt und das es nunmehr zu integrieren gilt.
Dabei greife ich zurück auf Jean Gebser, der dieses neue integrale Bewusstsein ausführlich beschrieben hat. Er kommt hier zu Wort mit seiner bedeutenden Unterscheidung zwischen einem männlichen Verstand, der versteht, und einer weiblichen Vernunft, die vernimmt.
Die vom Rationalismus vorgenommene Identifizierung von Verstand und Vernunft gilt es wieder rückgängig zu machen.
Als Beispiel für eine Wissenschaft der Vernunft, die dem integralen Bewusstsein gerecht wird, erläutere ich dann am Ende die von Lynn Margulis und James Lovelock Mitte der 1960er Jahre entwickelte Gaia-Hypothese, die den Mythos mit wissenschaftlichem Denken vereinigt. – Ein gelungenes Modell für einen respektvollen Umgang mit Mutter Erde.
TEIL I:
GRUNDLAGEN UND WESEN DES BIBLISCHEN MONOTHEISMUS
„Du wirst alle Völker vertilgen, die der HERR,
dein Gott, dir geben wird.“
„Dazu wird der HERR, dein Gott, Angst und
Schrecken unter sie senden, bis umgebracht
sein wird, was übrig ist und sich verbirgt vor
dir. Lass dir nicht grauen vor ihnen; denn der
HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, der
große und schreckliche Gott.“
Dtn 7,16 und 20f.
Vorbemerkungen
Religionsgeschichtlich müsste der Einbruch des monotheistischen Glaubens in die polytheistische Welt der Antike ein Kulturschock gewesen sein. Brach er doch mit allem, was den Menschen bis dahin heilig war, und leugnete ihr Weltbild, das ihnen Orientierung geboten hatte.
Zwischen dem Ende des -6. und dem Beginn des -3. Jahrhunderts stießen zwei einander ausschließende religiöse Positionen aufeinander: Im antiken Griechenland galt die Verehrung nur einer Gottheit als schlimmste Sünde – als Hybris. Mit der exklusiven Festlegung auf nur eine Gottheit konnte man das ganze Land ins Glück stürzen. Verweigerte man die Verehrung der anderer Gottheiten würde man ihren Zorn auf sich ziehen und sie würden solche Nicht-Beachtung möglicherweise rächen.
Um dies zu verhindern, stand ein Altar bereit, an dem für die „unbekannte Gottheit“ geopfert wurde, so dass niemand sich übergangen fühlen musste. – Eine Vorstellung, die nicht der religiösen Logik entbehrte.
Völlig anders argumentierten die Repräsentanten des biblischen Monotheismus, der im -6. Jahrhundert in Judäa Fuß fassen konnte und schon bald über die Grenzen des Landes hinaus bekannt wurde. Für die Vertreter dieser neuen Religion, die sich als Anti-Religion gerierte, galt es als Sakrileg, andere Gottheiten außer Jahwe zu verehren – wenn man auch am Beginn noch nicht deren Existenz leugnete.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!