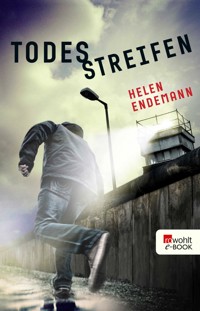4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wenn sich die Sommerhitze über das Kirchenland senkt … Der fesselnde Kriminalroman »Sommergrollen« von Helen Endemann jetzt als eBook bei dotbooks. Schon seit Generationen hat die wohlhabende Familie Dornbusch im kleinen Ort Sulzbach im Taunus das Sagen. Doch nun wird die dörfliche Ordnung erschüttert, als der Patriarch Heinrich Dornbusch zu Tode kommt. Niemand scheint echtes Interesse zu haben, das Verbrechen aufzuklären – außer dem idealistischen Pfarrer der Gemeinde. Henry weiß nur zu gut um das schwierige Verhältnis zwischen dem Toten und seinem Erben, der plötzlich alle Fäden in der Hand hält, um ein umstrittenes Bauprojekt zu verwirklichen. Aber würde Christian Dornbusch wirklich seinen eigenen Vater umbringen lassen? Als es in einer Gewitternacht zu einem weiteren Todesfall kommt, muss Henry zu seiner Bestürzung erkennen, dass der Mörder ihnen allen viel näher ist, als sie gedacht hätten – denn er kann nur aus der Mitte der Dorfgemeinschaft stammen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende Regio-Krimi »Sommergrollen« von Helen Endemann ist der Auftakt ihrer Reihe um den Dorfpfarrer Henry. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Schon seit Generationen hat die wohlhabende Familie Dornbusch im kleinen Ort Sulzbach im Taunus das Sagen. Doch nun wird die dörfliche Ordnung erschüttert, als der Patriarch Heinrich Dornbusch zu Tode kommt. Niemand scheint echtes Interesse zu haben, das Verbrechen aufzuklären – außer dem idealistischen Pfarrer der Gemeinde. Henry weiß nur zu gut um das schwierige Verhältnis zwischen dem Toten und seinem Erben, der plötzlich alle Fäden in der Hand hält, um ein umstrittenes Bauprojekt zu verwirklichen. Aber würde Christian Dornbusch wirklich seinen eigenen Vater umbringen lassen? Als es in einer Gewitternacht zu einem weiteren Todesfall kommt, muss Henry zu seiner Bestürzung erkennen, dass der Mörder ihnen allen viel näher ist, als sie gedacht hätten – denn er kann nur aus der Mitte der Dorfgemeinschaft stammen …
Über die Autorin:
Helen Endemann, geboren 1970 in Frankfurt am Main, studierte Jura in Passau, Helsinki und Heidelberg. Sie war 20 Jahre für verschiedene Unternehmen im Deutsche Bahn Konzern tätig und arbeitet heute als Rechtsanwältin. Ihr erstes Buch erschien 2013. Sie ist Mutter von drei Kindern und mit einem evangelischen Pfarrer verheiratet.
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre Krimi-Reihe rund um den Sulzbacher Pfarrer Henry: »Sommergrollen«, »Sterbeläuten« und »Totenklage«.
Die Website der Autorin: www.helenendemann.jimdofree.com
Die Autorin bei Facebook: www.facebook.com/Helen.Endemann
***
Aktualisierte eBook-Neuausgabe Mai 2022
Copyright © der Originalausgabe 2014 by Röschen Verlag, Johanna-Kirchner-Straße 20, D-60488 Frankfurt/Main
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/schankz, artpritsadee, Daniel J. Rao, Sina Ettmer Photography und AdobeStock/riebevonsehl
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-068-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Sommergrollen« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Helen Endemann
Sommergrollen
Ein Taunus-Krimi
dotbooks.
Kapitel 1
Wenn ich den Fuß aus deinem Haus setze, fällt die Sehnsucht über mich wie ein Mantel. Er hüllt mich ein und begleitet mich auf Schritt und Tritt. Er schmiegt sich an meine Haut, wenn ich gehe, wenn ich stehe, wenn ich sitze. Wenn ich mich abends ausziehe und schlafen lege, spüre ich noch seinen kühlen Stoff auf meiner Haut. Wenn ich morgens aufstehe, ist er schon um mich. Geduldig schaut er meinem Tagwerk zu, hört er mit, wenn ich Belanglosigkeiten austausche, mit belanglosen Menschen. Nichts dringt durch diesen Mantel in mein Inneres. Ich bewege mich inmitten von Menschen und bin doch ganz allein und denke nur an dich. Nur, wenn ich mit dir sein kann, fällt der Mantel von mir ab. Du kannst mich sehen, wie ich bin. Vor dir bin ich nackt. Du siehst mir bis ins Herz, viel weiter und tiefer, als ich selbst mich sehen kann. Und ich bin voller Scham, und doch kann ich nur in deiner Nähe ganz und gar ich sein, kann ich nur in deiner Nähe sein. Kann sonst nicht sein.
Auf einer Skala von eins bis zehn gab Henry dieser Beerdigung eine Drei. Er sah sich im barocken Schiff seiner Kirche um. Alle Bänke waren besetzt. Durch hohe Fenster schien die Sonne. Staubkörnchen tanzten in der Luft, vibrierten in den letzten Klängen der Orgel, die sich unter das Rascheln, Raunen und Flüstern in den Kirchenbänken mischten und verstummten. Eine Zehn bekamen die Kinder.
Henry stand auf und trat ans Rednerpult.
Neun bis sieben waren für junge Eltern, die kleine Kinder hinterließen, die dann blass und fassungslos vor Henry in der Bank saßen oder bei einem Babysitter zu Hause, damit ihnen der Horror erspart bliebe, den Sarg mit der Mutter oder dem Vater in der Erde verschwinden zu sehen.
Henry warf einen Blick auf seine Zettel, vergewisserte sich, dass sie alle da und in der richtigen Reihenfolge waren. Dann sah er auf und in die erwartungsvollen Gesichter der Trauergemeinde.
Sie leuchteten wie helle Flecken in einem Meer von schwarzen Anzügen, Blusen, Kostümen. Die volle Kirche stand im Widerspruch zur Zahl der Angehörigen, die der Verstorbene hinterließ: eine Schwester von 83 Jahren und einen erwachsenen Sohn, der abwesend war. Die Schwester, Bärbel Knapp, saß mit einem verkrumpelten Taschentuch in der Hand in der ersten Reihe, umringt von der »Friedhofs-Gang«. Zur Friedhofs-Gang gehörten außer Bärbel Knapp noch Lia Rinser, Gertrud Panke, Hans Schlesinger und Alfred Schröck, zusammen über vierhundert Jahre alt. Die fünf sah man täglich auf dem Friedhof zusammensitzen. Alle hatten Gräber, die sie besuchten und pflegten. Hinterher schwätzten sie miteinander. Sie waren außerdem treue Besucher von Henrys Beerdigungen. Heute freilich hätte sowieso keiner von ihnen es sich nehmen lassen, Bärbel dabei beizustehen, wie sie als einzige Hinterbliebene ihrem Bruder Heinrich das letzte Geleit gab. Die Gemeinde wurde still.
Von sechs abwärts war die Einteilung nicht mehr so einfach. Egal wie alt der Verstorbene war, die Menschen, die ihn liebten, waren immer traurig. Und wenn nicht, dann war das traurig.
»Wir haben uns heute versammelt, um von Heinrich Wolfgang Dornbusch Abschied zu nehmen, der am vergangenen Dienstag im Alter von 76 Jahren gestorben ist«, begann Henry seine Ansprache. Heinrich Dornbusch war bis zu seinem siebzigsten Lebensjahr Kirchenvorsteher in der evangelischen Kirchengemeinde in Sulzbach gewesen.
Er hatte dem Kreisbauernverband angehört und der Sulzbacher Gemeindevertretung.
Dornbuschs Engagement im Ort erklärte, warum die Trauerfeier so gut besucht war. Dornbusch war lange einer gewesen, an dem man in Sulzbach nicht vorbeikam. Er hatte kompromisslos seine Ansichten vertreten, häufig polarisiert, sich Freunde und Gegner gemacht; und Freunde wie Gegner waren heute gekommen.
Alle wollten den Abschied des alten Dornbusch aus dieser Welt miterleben. Ein Abschied, der manchen wie ein Abschied von einer ganzen Epoche schien. Von einer Zeit, in der man sich engagierte, in der Politik, im Verein. Einer Zeit, in der im Ort jeder jeden kannte. Es war ein Abschied, der auch Dornbuschs Gegner nicht kaltließ. Nicht dass Henry auf Feindschaften oder alte Streitigkeiten einging. Er bewegte sich, um Neutralität bedacht, in den Grenzen der allgemein bekannten Fakten. Über Persönliches sprach er nur knapp. Dass der Verstorbene zwei Ehefrauen und dann auch noch die eigene Tochter hatte zu Grabe tragen müssen.
Wovon Henry nicht sprach – was auch keinen etwas anging, gleichwohl jeder alteingesessene Sulzbacher wusste – war die Tatsache, dass der alte Dornbusch ein, gelinde gesagt, schwieriges Verhältnis zu seinen Kindern gehabt hatte. Die Tochter war gestorben, ohne dass es zu einer Versöhnung zwischen ihr und dem Vater gekommen war. Dass der Sohn nicht einmal zur Trauerfeier erschien, diente vielen als weiterer Beweis für den tiefen Bruch, der durch die Beziehung des Vaters zu seinen Kindern gegangen war. Aber solche Dinge gehörten nicht in eine Beerdigungsansprache.
Dabei waren es doch diese Dinge, die am Ende wichtig waren, dachte Henry plötzlich, nicht der Vereinsvorsitz hier und der Ehrentitel dort. Ging es nicht darum, das Leben des Verstorbenen mit Gottes Augen zu betrachten?
Henry wurde sich eines Raunens aus der Trauergemeinde bewusst. Er hatte wohl aufgehört zu sprechen. Verflixt, wann hatte er denn aufgehört? Er sah auf seine Zettel. Unmöglich zu sagen, wann und wo in seiner Ansprache er abgetaucht war. Immerhin war er schon beim letzten Blatt gewesen. Henry schwitzte unter seinem Talar. Unglaublich, wie stickig diese Kirche im Sommer werden konnte.
Wie hatte er sich so aus dem Konzept bringen lassen? Und das von einer Beerdigung, die auf der Henry’schen Härtegrad-Skala eine läppische Drei erreichte? Ein Mensch, der nach einem langen, erfüllten Leben starb. Die Angehörige traurig, aber nicht verzweifelt. Henry riss sich von den Blättern los und sah in die Gesichterflecken.
Was mussten sie von ihm halten? Erst stolperte er auf dem Dornbusch’schen Lebensweg entlang wie in einem Irrgarten, handelte die offiziellen Wegmarken ab, die man ihm erzählt hatte und die alle Anwesenden besser kannten als er. Nun hatte er den Faden ganz verloren. Bestenfalls hatten sie Mitleid mit ihm, schlimmstenfalls hielten sie ihn für einen Volltrottel. Ein Volltrottel, der seine Sterbefälle auf einer Skala von eins bis zehn sortierte. Gut, dass das wenigstens keiner wusste.
Henry beschloss, dass er alles gesagt hatte, was zu sagen war. Besser, die Rede hier zu beenden, als sich zu wiederholen oder etwas völlig Zusammenhangloses von sich zu geben.
»Den letzten Dingen können Worte oft nicht mehr gerecht werden. So wollen wir das Leben und das Sterben von Heinrich Wolfgang Dornbusch unserem Herrn Jesus Christus anbefehlen und um seinen Segen bitten«, schloss Henry seine Ansprache zum Erstaunen der Gemeinde.
»Na, was wird jetzt aus dem Heinrich seinen Äckern?«, sprach Egon Reichenbach aus, was alle dachten. Die Trauerfeier war überstanden. Im Alten Schulhaus, der Gaststätte auf dem Kirchplatz, schwitzten die Kuchenstücke mit den Gästen um die Wette. Wespen umschwirrten Kuchenstücke und Gäste. Junge Mädchen schleppten immer wieder schwere Thermoskannen mit dampfend heißem Kaffee an die Tische. Es war Juni und schon hochsommerlich warm. Am Stammtisch hatten sich die Sulzbacher Bauern zusammengefunden.
»Weiß der Kuckuck, was da jetzt draus wird«, sagte Holger Fitz, von den Alteingesessenen »der Tann-Fitz« genannt. Er betrieb seit Jahrzehnten eine Baumschule für Fichten und Tannen, die halb Sulzbach alljährlich mit Weihnachtsbäumen versorgte.
»Der Junior ist anscheints noch am Leben«, sagte Bolt, der – obwohl schon seit über fünfzig Jahren Landwirt in Sulzbach – ein Außenseiter in der Runde war, »der Pfarrer hat nur von der Tochter gesprochen, die tot ist.«
Darauf sagte niemand etwas. Die anderen Bauern schienen fast ein bisschen von Bolt wegzurücken. Das hatte man hier nicht gern, wenn die Zugezogenen sich in Dorfinterna einmischten, gar schmutzige Wäsche der Alteingesessenen in der Öffentlichkeit waschen wollten.
Dornbusch hatte in Sulzbach zuletzt zwei Äcker besessen, die er aber schon seit Jahren nicht mehr selbst bewirtschaftete. Die Äcker waren verpachtet. Dann war da noch ein großes Grundstück inmitten des Flickenteppichs, der den Sulzbacher Außenbezirk bildete. Auf dem Grundstück befand sich ein altes Lagerhaus, in dem Dornbusch früher seine landwirtschaftlichen Geräte und seine nicht unbeträchtlichen Ernteerzeugnisse zwischengelagert hatte. Nachdem Dornbusch aber einen Acker nach dem anderen als Bauland verkauft und den eigenen Betrieb schließlich eingestellt hatte, war die Halle nicht mehr genutzt worden und verfiel.
»Landwirtschaft wird der Junior mit den Grundstücken jedenfalls nicht betreiben«, meldete sich schließlich Anton Kirchner zu Wort, »so viel ist schon mal sicher.« Die anderen nickten zustimmend. Der Dornbusch-Junior war als junger Mann nach Amerika ausgewandert. Zwanzig Jahre war das sicher her. Der Alte hatte kein Händchen mit seinen Kindern gehabt, beide waren, so schnell sie konnten, ausgezogen und seitdem kaum mehr gesehen worden. Die Tochter war ja dann gestorben. Der Junior hatte es zu etwas gebracht. Er war, wie man munkelte, ein erfolgreicher Geschäftsmann. Mitte vierzig musste er wohl sein. Für die angrenzenden Nachbarn und für die, die wenig Land hatten und immer auf Pachtgrundstücke aus waren, war es von großem Interesse, was der Junior mit seinem Erbe vorhatte, wenn er denn Erbe war. Dem alten Dornbusch wäre es zuzutrauen gewesen, dass er den abtrünnigen Sohnemann enterbt hätte. Oder auch nicht.
»Mir kann´ s egal sein«, dachte Kirchner bei sich. Er hatte seine Schäflein im Trockenen mit den Doppelhaushälften, die er auf seinen ehemaligen Äckern bauen würde und für die er gerade die Baugenehmigung erhalten hatte. Sie würden in einer neu anzulegenden, ruhigen Stichstraße am Ortsrand stehen und malerisch über einen Hügel blicken, der sanft zum Sulzbach hin abfiel, an dessen Ufer sich Weiden mit ihrer zartgrünen Blätterpracht im Wind wiegten. Ein romantischer Glanz kam in Kirchners Augen. Teufel auch, er würde glatt selbst dort einziehen! Trotz der ländlichen Idylle waren es von den Häusern nur wenige Gehminuten in die Ortsmitte und zum S-Bahnhof, eine ideale Lage eben. Die Doppelhaushälften wollte er für 380.000 Euro das Stück, zuzüglich Maklergebühren, anbieten, und er war sich sicher, dass sie weggehen würden wie warme Semmeln. Der Vertrag mit der Baufirma aus dem Osten war auch schon unter Dach und Fach. Die Firma würde sämtliche Arbeiten koordinieren und die jeweils benötigten Arbeiter und Handwerker selbst mitbringen. Die armen Hunde würden jeden Montag aus Sachsen mit dem Bus kommen und die Woche über in den Baucontainern nächtigen, um freitags um zwei wieder in den Bus nach Hause zu steigen. Das war nicht nur billig, sondern garantierte Kirchner auch eine zügige Fertigstellung der Häuser, wie er hoffte. Vor Ort würde man freilich saure Gesichter machen, wenn herauskam, dass nicht ein Auftrag an die Handwerker am Ort gehen würde, das war klar. Aber das war die Bedingung des Sachsen gewesen. Und es war doch so: Die verwöhnten Bürschchen im Speckgürtel des Main- und Hoch-Taunus-Kreises konnte kein Geschäftsmann, der noch bei Trost war, bezahlen; jedenfalls nicht, wenn bei der Sache auch ein Gewinn herauskommen sollte. Kirchner zog sein Taschentuch aus der Hosentasche und wischte sich die Stirn. Sie würden sich schon wieder beruhigen.
Auf dem kurzen Weg vom Alten Schulhaus nach Hause traf Henry Thomas, den Küster und Hausmeister, der gerade die Kirche abschloss. Kirche, Pfarrhaus und Gemeindehaus standen in Sulzbach nahe beieinander, dazwischen lag ein großer Hof, in dessen Mitte eine große, wenn auch etwas ramponierte Platane stand. Im ersten Stock des Gemeindehauses war der evangelische Kindergarten. Der Hof wurde durch ein großes schmiedeeisernes Tor abgeschlossen. Hinter der Kirche, auf dem Gelände des ehemaligen Friedhofs, lag der Kindergartenspielplatz, beschattet von einer großen alten Kastanie, die noch nie eine ihrer stacheligen Früchte auf den Kopf eines Kindes hatte fallen lassen, obwohl die Dinger im Herbst mit lautem Ploppen herunterregneten. An den Spielplatz grenzte der Garten des Pfarrhauses, der von einer großen alten Mauer umgeben war, die vielleicht zur alten Stadtmauer gehörte. Thomas wohnte mit seinen Kindern im dritten Stock des Gemeindehauses. Kurze Arbeitswege hatten Thomas und Henry, und Henry wunderte sich, wie oft sie sich kreuzten, vor allem wenn Thomas das wollte. Oder wenn Henry gerade gar keine Lust dazu hatte.
»Alles klar?«, brummte Thomas.
»Wieso nicht?«, antwortete Henry.
»So, so.«
Henry ging erleichtert weiter. Thomas war eigen. Er hatte vor einigen Jahren seine Frau verloren und lebte seitdem allein mit seinen Kindern, Miriam und Samuel. Er ging nicht gerne aus und hatte im Verlauf der Jahre jeden Ehrgeiz verloren, Smalltalk zu machen. Er kam ohne Umschweife zur Sache. Henry war nicht selten überfordert, wenn er Thomas zwischen Tür und Angel oder eben zwischen Kirche und Pfarrhaus über das Ewige Leben, den Heiligen Geist oder die Sünde gegen denselben Rede und Antwort stehen sollte. Aber heute hatte er wohl nichts auf dem Herzen gehabt. Henry hängte seinen Talar über den Bügel. Gesangbuch und Bibel stellte er an ihren Platz ins Regal. Er betrachtete den abgegriffenen Einband des Gesangbuchs, das ihm seine Mutter zur Konfirmation geschenkt hatte. Hatte die Beerdigung ihn so aus dem Konzept gebracht, weil er an seine Eltern dachte? Am Wochenende war er mit Elisabeth und den Kindern in Münster zu Besuch bei ihnen gewesen. Sein Vater war 76, seine Mutter 74. Henry war darüber erschrocken, wie alt besonders sein Vater ausgesehen hatte. Es war nicht nur das Aussehen. Der Vater war immer sehr bestimmend gewesen. Er erwartete viel von seinen fünf Kindern, und Henry hatte nie ganz aufgehört, es seinem Vater recht machen zu wollen. Auch wenn er ihm nicht den Gefallen getan hatte und Arzt geworden war, wie der Vater es wollte. Vielleicht gerade deshalb? Die Meinung seines Vaters war Henry jedenfalls wichtig. Bei größeren Entscheidungen dachte er, was wohl der Vater dazu sagen würde. Aber diesmal … Der Vater wirkte still und zurückgezogen. Zu Henrys und Elisabeths Überlegungen, welches Auto ihre altersschwache Familienkutsche ersetzen sollte, hatte er nur die immer schmaler werdenden Schultern gezuckt. Henry werde das schon richtig entscheiden. So sehr er manches Mal unter dem Willen und der Dominanz seines Vaters gelitten hatte, das war Henry nun auch nicht recht. Er dachte daran, wie es sein musste, irgendwann keine Eltern mehr zu haben. Sein Platz in der Welt war doch gut und richtig, so wie es war. Dort waren die Eltern, hier war er, da die eigenen Kinder. Was, wenn die Eltern nicht mehr sein würden? Alles geriete aus dem Gleichgewicht. Henry sah auf die Zettel mit den Stichpunkten seiner Ansprache, die er nicht zu Ende gebracht hatte, und die nun durcheinander auf seinem Schreibtisch lagen. Er warf sie in den Papierkorb.
Markus und Lukas Steinhaus und Samuel Uhrig, der Sohn des Küsters und beste Freund der Zwillinge, machten am Nachmittag eine Radtour durch die Felder. Sie fuhren zu einem entfernten Spielplatz jenseits der Autobahn. Der Spielplatz lag idyllisch in einem Park, durch den der Sulzbach floss, wurde von den Jungen aber links liegen gelassen. Sie waren zu alt für Spielplätze. Aber am Bach wuchsen Weiden, auf denen die Jungen wie Affen herumkletterten. Danach war ihnen heiß und sie kühlten ihre nackten Füße und Waden im Bach. Da fiel ihnen auf, dass das Bachbett ganz offensichtlich einiger Korrekturen bedurfte, und Markus, Lukas und Samuel nahmen sich dessen an. Sie bauten Dämme und gruben mit bloßen Händen kleine Nebenarme und Auffangbecken.
Auf dem Rückweg durch den Tunnel unter der Autobahn spuckten sie in den einbetonierten Sulzbach und gruselten sich, während über ihnen die Autos hinwegdonnerten. Hier sollte mal jemand ermordet worden sein, ein Kind. Hatte jemand erzählt, den keiner mehr kannte. Im Bachbett hätte es gelegen, wollte Samuel wissen. Er hörte viele Geschichten, wenn er zum Kuchenessen an den Seniorennachmittagen ging, die sein Vater leitete. Nicht alle waren für Kinderohren gedacht.
Jetzt traten sie wieder in die Pedalen und sausten auf den asphaltierten Wegen zwischen Feldern entlang, die vergeblich golden in der Abendsonne leuchteten, denn für solche Dinge haben zehnjährige Jungen keinen Sinn. Vor ihnen tauchte das verfallene Lagerhaus des alten Dornbusch auf, der letzte Woche gestorben war. Dort machten die Jungen halt. Sie hatten das Haus in diesem Sommer als Spielplatz entdeckt. Es war ihnen schon Burg, Piratenschiff und Schmuggler-Hauptquartier gewesen, und damit waren die Möglichkeiten dieses Hauses längst noch nicht ausgeschöpft. Die Kinder ließen ihre Fahrräder ins Gras fallen und betraten die Halle im Erdgeschoss durch eine Türöffnung, der die Tür abhanden gekommen war. Innen war es deutlich kühler und roch ganz eigenartig, nach Gras oder Heu.
»Ob der Dornbusch jetzt hier spukt?«, fragte Lukas in die Stille des verlassenen Hauses hinein.
»Warum ausgerechnet hier?«, fragte Samuel zurück. »Er hat doch auch ein Haus im Ort.«
»Da hat er es aber als Gespenst nicht so gemütlich wie hier, mit den Spinnweben und dem Wind, der nachts durch die zerbrochenen Scheiben heult«, malte sich Markus das Spuken des alten Dornbusch genüsslich aus. »Also, ich würde jedenfalls hier spuken, wenn ich der Dornbusch wäre.«
»Guck mal, da hat wieder einer Feuer gemacht.« Samuel zeigte auf die Überreste eines kleinen Lagerfeuers auf dem nackten Steinboden der Halle. Da lag auch noch etwas Reisig und Zeitungspapier. Manchmal übernachteten Obdachlose im alten Lagerhaus, so wohl auch vor kurzem.
»Alter, wir machen uns einen Joint!«, rief Markus.
»Wie denn?«, fragte Samuel.
»Ja, mit der Zeitung hier und den Zweigen. Und mit Gras! Das heißt doch so: Gras rauchen«, sagte Markus.
»Das ist gefährlich«, sagte Lukas.
»Ja, wenn man es zur Gewohnheit werden lässt«, belehrte ihn Markus, »klar, dann wird man süchtig und magert ab und beklaut seine Freunde, und wenn man nicht mehr rauchen darf, bepinkelt und bekotzt man sich, das habe ich im Fernsehen gesehen. Aber wir probieren ja nur mal. Außerdem ist das sicher nicht das richtige Gras, das man braucht.«
Markus war schon dabei, ein Büschel Gras draußen auszureißen, und rollte ihn dann mit dem Reisig in einem Stück Zeitungspapier ein.
»Und womit willst du es anzünden?« Lukas war nicht von der Gras-Raucherei überzeugt, wusste aber, dass es wenig Sinn hatte, Markus einen Plan auszureden, wenn dieser mal in Fahrt war.
»Wir haben doch unsere Notration«, antwortete Markus. »Da sind auch Streichhölzer dabei.«
Die Jungen hatten einen kleinen Koffer mit überlebenswichtigen Dingen wie Keksen, Kompass, Wasser, Schleudern (gegen Feinde), Comics und eben Streichhölzern im Lagerhaus deponiert. Für den Fall, dass man mal ganz schnell fliehen und untertauchen musste. Der Koffer war oben in einer kleinen Kammer unter dem Dach versteckt, weil es dort dunkel war und man schwer hochkam. Markus fing schon an, die Treppe zum Obergeschoss hinaufzulaufen. Die anderen folgten ihm. Vom ersten Stock brauchte man eine Leiter, um in die Kammer zu klettern. Die hatten sie in der Halle gefunden, nach oben geschleppt und hinter einem Mauervorsprung versteckt. Sie war aus grobem, unbehandeltem Holz, irgendwer hatte jedes Mal einen Splitter, wenn sie sie benutzt hatten.
»Helft mal mit!«, rief Markus jetzt, und Lukas und Samuel packten mit an. Zu dritt trugen sie die Leiter an die Öffnung der Dachkammer und stellten sie dort auf. Schweigend kletterten sie nacheinander hoch. Die Öffnung war eigentlich nur eine Luke, deren Tür nach oben aufgeklappt und an einem Haken an der Decke aufgehängt wurde. Die Jungen stemmten sie gemeinsam auf und hängten den Riegel mit seiner Öse in den Haken ein. In der Kammer roch es nach warmem Holz. Markus griff sich den Koffer. Er setzte sich auf den staubigen Boden, auf dem auch die Kinder nur gebückt stehen konnten.
»Alles noch an seinem Platz«, stellte Markus zufrieden fest. Er holte die Streichhölzer heraus und zündete eins an.
»Willst du den Joint hier rauchen?«, fragte Samuel.
»Ja, wieso denn nicht?«, antwortete Markus. »Dann müssen wir nicht nachher die Schachtel wieder hier hochbringen und in den Koffer tun.«
»Und wenn dir schlecht wird und du nicht wieder nach unten klettern kannst?«, fragte Lukas.
»Dann müsst ihr mich tragen«, sagte Markus vergnügt. Er hielt das Streichholz an die gefüllte Zeitungsrolle, die ein bisschen anfing zu glühen und dann wieder ausging.
»Du musst dran ziehen«, sagte Samuel.
»Wie ziehen?«, fragte Markus.
»Ja, mit dem Mund, wie bei einer Zigarette halt, die Luft einatmen.«
Markus hielt den »Joint« an den Mund und zog daran. Sofort musste er husten. Es brannte entsetzlich in seinem Hals, und er warf den »Joint« zu Boden. Samuel sprang auf, stieß sich den Kopf an der Decke und trat auf den »Joint« ein. Plötzlich tat es einen Schlag und es wurde stockdunkel. Augenblicklich waren alle still, bis Markus wieder husten musste.
»Was ist passiert?«, fragte Samuel.
»Die Luke ist zugefallen«, sagte Lukas. So baufällig das alte Lagerhaus war, in diese Kammer drang durch keine Ritze Licht. Die Jungen tasteten sich zur Luke hin und versuchten, sie aufzudrücken. Sie bewegte sich nicht.
»Vielleicht klemmt sie«, sagte Samuel.
»Wir müssen alle drei, so fest wir können, drücken.« Markus hustete.
»Aber vorsichtig, sonst fallen wir raus, wenn sie plötzlich aufgeht«, warnte Lukas.
Sie stemmten sich zu dritt gegen die Luke, aber sie gab nicht nach.
»Was machen wir denn jetzt?«, fragte Lukas.
»Hat einer ein Handy mit?« Markus’ Stimme klang belegt, vielleicht vom Husten oder aus Angst.
»Nein«, kam es kleinlaut von Samuel und Lukas. Die Zwillinge besaßen kein Handy und Samuels lag auf seinem Schreibtisch im Kinderzimmer. Vater würde sauer sein, wenn Samuel zu spät nach Hause käme, er machte sich immer Sorgen.
»Mama wartet bestimmt schon auf uns«, sagte Lukas.
»Ja«, sagte Markus. »Leider hat sie keine Ahnung, wo wir sind.«
»Pst! Seid mal leise!« Samuel flüsterte.
»Was ist denn?« Lukas flüsterte jetzt auch. Markus hustete unterdrückt.
»Hört ihr das?«, fragte Samuel, »da ist jemand.«
Jetzt hörten Markus und Lukas die Schritte auch. Jemand kam die Treppe zum Obergeschoss hoch.
»Sollen wir rufen?«, flüsterte Lukas.
»Und wenn es ein Verbrecher ist?«, flüsterte Samuel zurück.
»Was denn für ein Verbrecher?« Markus hustete leise.
»Vielleicht hat er die Luke zugeworfen. Vielleicht hat er uns mit Absicht gefangen«, sagte Samuel.
»Dann weiß er auch, dass wir hier sind«, sagte Markus. »Los, wir rufen, das ist unsere einzige Chance.«
In diesem Moment hörten sie die Schritte ganz nahe herkommen und unmittelbar vor der Luke stehen bleiben. Etwas knirschte laut und im nächsten Moment wurde die Luke aufgerissen. Die Jungen schrien vor Schreck auf. Helles Licht drang in die Kammer, so dass der Mann zuerst nur als eine schwarze Gestalt im Licht zu sehen war.
»Was macht ihr denn hier?«, fragte er.
»Nix«, sagte Markus. »Wir spielen.«
»Mit dem Feuer«, stellte der Mann fest.
»Nein, wir …« Markus sah auf den ausgetretenen »Joint« und es fiel ihm nichts wirklich Ehrenrettendes ein, zumal man den Rauch auch noch ziemlich gut riechen konnte. Zum Glück musste er wieder husten und war am Weiterreden gehindert.
»Und jetzt?«, fragte der Mann, den sie mittlerweile besser sehen konnten. Er war nicht sehr groß, aber schlank und drahtig, trug Jeans und ein helles Hemd. Er hatte schwarze volle Haare. Sein Kinn war irgendwie eckig. Er sah ein bisschen aus wie ein Nussknacker.
»Jetzt wollen wir nach Hause gehen«, sagte Lukas vorsichtig.
»Das halte ich für eine gute Idee.« Der Mann drehte sich um und ging ihnen voran nach unten. Vor der Lagerhalle blieb er stehen und sah schweigend zu, wie die Jungen auf ihre Fahrräder stiegen und davonfuhren.
Henry zog sich das T-Shirt über den Kopf und starrte seinen entblößten Bauch an. Er hob den Kopf und sah sich um, ob die Leute ihn anstarrten und lachten oder ihm angewiderte Blicke zuwarfen. Sein Bauch war kalkweiß. Er war so weiß, als hätte ihn jemand mit der gleichen fluoreszierenden Leuchtfarbe angemalt, aus denen die Gummiskelette waren, die im Kinderzimmer seiner Söhne im Dunkeln leuchteten. Und ihn trotzdem nicht davor bewahrten, barfuß auf Legosteine zu treten, wenn er nach den Jungen sehen wollte.
Die anderen Schwimmbadbesucher zeigten sich unbeeindruckt von Henrys Bauch. Er lehnte sich beruhigt auf seinem Handtuch zurück und lag nun auf die Ellbogen gestützt auf dem Rücken. Vielleicht würde sich das Bauchproblem im Verlauf dieses Nachmittages schon etwas entschärfen, denn die Sonne strahlte unermüdlich vom blauen Sommerhimmel. Henrys andere Sorge hinsichtlich des Schwimmbadbesuchs hatte sich schon bald nach Betreten des übervollen Freibades in Luft aufgelöst. Da war es um die Badehose gegangen. Als Henry seiner Frau Elisabeth erzählt hatte, dass er am kommenden Samstag mit der Vater-Kind-Gruppe ins Schwimmbad gehen müsse, war diese ein paar Tage später mit einer neuen Badehose vom Einkaufen zurückgekommen. Mit einer Frauenbadehose, wie Henry meinte. Nicht dass er vorher geahnt hätte, dass es so etwas wie Frauenbadehosen gab – was trugen sie neuerdings denn oben?, fragte er sich. Aber es war ganz eindeutig: Die Hose war aus langem wallenden Stoff, der überall mit großen roten Blumen und grünen Blättern bedruckt war.
»So was ziehe ich nicht an!«, erklärte Henry.
»Und was ziehst du an?«, hatte Elisabeth gefragt.
»Meine alte Badehose, natürlich.«
»Die habe ich weggeworfen.« Elisabeth sah ihn mit diesem Blick an, der sagte, ich hab vier Kinder, drei Schulkinder und einen Mann.
»Warum?«
»Weil sie ein Loch hatte, wie du sehr wohl weißt.«
»Lieber ein Loch als Blumen …«, versuchte Henry noch zu argumentieren, aber es half ja nichts.
Schon auf dem Weg zu den Schwimmbecken stellte Henry dann teils verwundert, teils erleichtert fest, dass diese langen Blumenbadehosen keineswegs nur von wenigen eingeschüchterten, blassbäuchigen Ehemännern getragen wurden, für die man einen eigenen Bereich eingerichtet hatte, ähnlich einem Hunde- oder FKK-Strand. Nein, sie hingen so ziemlich an jedem männlichen Becken unter 25 herab, ja sie wurden vielleicht sogar besonders häufig von muskulösen, braungebrannten Sechzehnjährigen getragen, von denen Henry einige als ehemalige Konfirmanden wiedererkannte. Woher wusste Elisabeth solche Dinge?, fragte er sich.
Markus und Lukas und ihre sechsjährige Schwester Marlene wären auch gerne mit Henry ins Schwimmbad gegangen. Aber da hatte er sich durchgesetzt.
»Das ist dienstlich«, hatte er erklärt. »Ich bin dort mit meiner Vater-Kind-Gruppe und da kann ich mich nicht um euch kümmern.«
»Warum denn kümmern?«, die Zwillinge waren entrüstet. »Wir haben Silber. Du brauchst dich um gar nichts zu kümmern. Wir fahren mit dir hin, dann schwimmen wir, und du kannst einen auf Vater-Kind machen, nur dass du kein Kind hast, und am Ende fahren wir wieder mit dir nach Hause. Wenn du willst, dann tun wir so, als ob wir dich gar nicht kennen«, wollte Markus seinen Vater beruhigen.
»Ich will nicht, dass ihr so tut, als ob ihr mich nicht kennt«, erwiderte Henry. »Ich will aber auch nicht auf Marlene aufpassen, die gerade erst das Seepferdchen hat, und ich will nicht mit euch über Pommes und Eis am Kiosk streiten, ich will nicht gerufen werden, weil ihr mir einen Salto vom Dreier zeigen wollt, und ich will nicht über die Lautsprecheranlage hören, dass die Rutsche geschlossen wird, weil gewisse Zwillinge mit Namen Markus und Lukas mit ihren Freunden versucht haben, als Doppeldecker-Sandwich herunterzurutschen.«
»Das war ein Mal, Papa, du bist unfair«, sagte Lukas, »diesmal machen wir nix, wir schwören es.«
Henry war hart geblieben.
Er dachte daran, dass im selben Sommer auch jemand Geschirrspülmittel von oben in die Rutsche geschüttet hatte. Die weißen Wolken waren über ganz Bad Soden geflogen. Im Schwimmbad hatte es ausgesehen, als läge Schnee im Hochsommer. Die Täterschaft dieses Streichs war nicht aufgeklärt worden, obwohl selbst Paul, der Dorfpolizist, damit befasst worden war. Er hatte unter anderem im Rewe nachfragen müssen, ob die Kassiererinnen sich an auffällige Kunden erinnerten, die Geschirrspülmittel kauften. Sie hatten sich allerdings an ihre überarbeiteten Stirnen getippt, wie Paul erzählte. Henry wollte nicht glauben, dass seine Söhne etwas damit zu tun hatten, und Paul hatte ihm dies auch nie auf den Kopf zugesagt, er war sich aber bis heute nicht sicher.
Jetzt kam Lars Meinert mit seiner elfjährigen Tochter Larissa auf das Handtuchlager zu, das die Mitglieder der Gruppe um Henry herum gebildet hatten. Sie waren tropfnass. Larissa trainierte für Gold, und es fehlten ihr noch die fünfzehn Meter Streckentauchen, die schaffte sie noch nicht. Lars hatte mit ihr zusammen geübt. Jetzt warfen sie sich auf die Handtücher und Larissa rubbelte ihre nassen Haare trocken.
»Warum gehst du nicht ins Wasser?«, wollte sie von Henry wissen, »es ist toll!«
»Ich gehe vielleicht gleich mal«, log Henry. Er hasste es, zwischen Horden von Kindern im überfüllten Becken zu schwimmen.
Sie saßen einige Zeit schweigend da und genossen die warmen Sonnenstrahlen.
»Meine Eltern wollen sich scheiden lassen«, sagte Larissa.
Henry machte einen komischen Fiepton, als er Luft holte. Lars sah gequält zur Seite. Larissa sah die Männer herausfordernd an, bis sich Tränen in ihren Augen sammelten, und sie aufstand und weglief. Lars lief ihr hinterher. Henry sah, wie er sie in einiger Entfernung einholte und auf sie einredete. Er kam sich blöd vor, wie er so untätig auf seinem Handtuch sitzen blieb, aber er wusste wirklich nicht, was er in diesem Moment tun sollte. Er sah, wie Larissa den Arm ihres Vaters abschüttelte und sich von ihm abwendete. Lars redete noch eine Weile auf ihren Rücken ein. Dann kam er langsam zu Henry zurück. Larissa setzte sich auf eine Mauer.
Lars ließ sich auf seinem Handtuch nieder. »Tja, jetzt weißt du es.«
Henry hatte schon lange gewusst, dass Lars´ Beziehung mit seiner Frau schwierig war. Lars hatte ihm am Rande der Vater-Kind-Treffen, zu denen er seit mehr als einem Jahr mit Larissa kam, von seinen Eheproblemen erzählt. Henry seufzte. Er hatte sehr gehofft und gebetet, dass es nicht zu einer Scheidung kommen würde.
Tatsächlich waren die Vater-Kind-Treffen ein Stein des Anstoßes für Lars´ Frau Ariane gewesen, wie Henry von Lars wusste. Sie nannte sie albern. Ob Lars denn keine eigenen Ideen hätte, was er mit Larissa unternehmen könnte. Und warum die Mütter ausgeschlossen sein sollten. Ob Lars jetzt anfangen würde, in die Kirche zu rennen. Aber da war Lars standhaft geblieben. Er hatte nach einem Weg gesucht, seine Beziehung zu Larissa zu vertiefen. Er hatte nach einem Platz für sich in Larissas Leben gesucht und das war nicht einfach gewesen. Als Larissa noch ein Baby war, war Ariane ganz klar die wichtigste, ja einzige Bezugsperson für Larissa gewesen. Sie allein konnte stillen, sie allein konnte richtig wickeln und sie allein wusste, was dem Baby fehlte, wenn es schrie. Da kam Lars nicht rein und nicht ran. Er machte alles falsch, brachte das Baby zum Weinen, zog ihm die falschen Sachen an, rührte die Milch zu heiß, zu kalt, zu dick oder zu dünn an. Lars hatte Henry erzählt, wie er manchmal auf Zehenspitzen um das Bettchen des schlafenden Babys geschlichen war, es bewundert und sich danach gesehnt hatte, diesem Kind irgendetwas geben zu können, was seine Liebe wenigstens ansatzweise ausdrücken könnte. Und er hatte sich gefragt, ob er für immer nur ein Bewunderer aus der Ferne im Leben seines Kindes bleiben würde.
Erst als Larissa schon drei war und in den Kindergarten ging, konnte Lars ihr Herz auch für sich erobern, mit Späßen, damit, dass er sie auf seinen Schultern trug, ihr geduldig ein ums andere Mal ihr langweiliges Lieblingsbuch vorlas oder stundenlang nachts an ihrem Bett saß, wenn sie krank war.
Das waren alles in allem gute Zeiten gewesen, auch wenn Lars sich in den Tobe-, Schmuse- oder Albermomenten manchmal von Ariane beäugt fühlte, als – ja, wie denn? Er wusste es nicht. Aber Larissa wurde älter, selbständiger und erwachsener. Das Tragen auf den Schultern wurde unmöglich und die Albernheiten konnten nicht mehr alles richten. Da war Lars auf die Vater-Kind-Gruppe gekommen. Sie bot einen Rahmen, in dem er etwas mit Larissa unternehmen und erleben konnte. Larissa fand Spaß daran, auch weil es noch andere Kinder in ihrem Alter gab und mit den Vätern immer etwas los war. Dass es sich dabei um eine kirchliche Veranstaltung handelte, so hätte Lars damals sicher gesagt, störte ihn nicht. Heute konnte es sogar schon mal vorkommen, dass Lars und Larissa einen Sonntagsgottesdienst besuchten, wenn Henry besonders charismatisch dafür geworben hatte.
»Ariane und ich haben uns gestern wieder gestritten«, erklärte Lars jetzt. »Ariane ist ständig gereizt. Ich kann machen, was ich will, nichts ist ihr recht. Immer hat sie etwas auszusetzen, an jeder Kleinigkeit. Es hat mir einfach gereicht. Ich habe sie gefragt, ob es auch irgendetwas gibt, das sie an mir gut findet.« Lars hob den Kopf und sah nach Larissa, die sich auf der warmen Mauer auf den Bauch gelegt hatte. »Das hätte ich wohl nicht fragen sollen. Ariane hat mir ins Gesicht gesehen und nein gesagt. Ich finde nichts an dir gut.«
»Das ist eine krasse Aussage«, sagte Henry.
»Und dabei war sie gar nicht wütend. Sie war ganz ruhig. Sie hat es absolut ernst gemeint. Da habe ich es endlich kapiert, Henry. Es hat keinen Sinn mehr. Ich hab weiß Gott lange genug versucht, das schönzureden und zu –denken. Dachte, das ist eine Phase, das wird wieder. Und wenn wir nur durchhalten, bis Larissa älter ist und sich eine Trennung nicht mehr so zu Herzen nimmt. Aber so eine totale Absage an meine ganze Person? Damit kann ich nicht weitermachen. Keiner könnte das. - Aber das war nicht das Schlimmste«, fuhr Lars fort.
Henry sah ihn an. Was konnte denn jetzt noch kommen?
»Larissa stand in der Tür, als Ariane ihr Urteil über mich gefällt hat. Sie hat es im Originalton mitgehört.« Lars schwieg wieder einen Moment lang. »Als ich Larissa später Gute Nacht sagen wollte, hat sie mich gefragt, ob wir uns scheiden lassen. Ich musste ehrlich zu ihr sein.«
»Was meinst du, wer dieser Mann war, heute Nachmittag an der Lagerhalle?«, fragte Lukas. Es war später Abend und sie lagen in ihren Betten.
»Keine Ahnung.«
»Wie ein Penner sah er nicht aus«, meinte Lukas.
»Nee, dazu war er zu gut angezogen. Stank auch nicht.«
»Ich hab mich voll erschreckt, als der plötzlich die Luke aufgerissen hat.«
»Das war voll hart, Mann. Wie der Basilisk in der Kammer des Schreckens«, begeisterte sich Markus.
»Nee, eher wie die Schlange im letzten Teil, in dem Haus mit der alten Frau«, fand Lukas.
»Ja, das war auch krass.«
»Ob wir da jetzt nicht mehr spielen können?«, fragte Lukas.
»Wieso denn?«
»Na, wenn der Mann jetzt öfter dahin kommt?«
»Wieso sollte er?«
»Wieso war er denn heute da? Wenn er kein Penner ist.«
»Er hat uns ja auch gar nichts getan.«
»Nee, heute nicht.«
»Ach was, der kommt schon nicht wieder.« Markus drehte sich zur Wand und war schon bald eingeschlafen. Lukas hatte keine große Lust mehr, sobald wieder am Lagerhaus zu spielen. Er horchte auf die Grillen, die draußen zirpten. Seine Eltern redeten unten auf der Terrasse, aber er konnte nicht verstehen, was sie sagten.
»Wie war die Badehose?«, fragte Elisabeth.
Sie saßen auf den Stufen der Treppe, die von Henrys Arbeitszimmer auf die Terrasse führte. Die Stufen waren noch warm von der Sonne und die Luft war irgendwie weich und samtig. Hinter dem Kirschbaum schritt der Nachbarskater durchs Gras.
»Okay«, sagte Henry.
»Okay?« Elisabeth zog die Augenbrauen hoch.
»Sehr okay«, gab Henry zu.
»Keine Frauenbadehose?«
»Nein, kann man nicht sagen, keineswegs. Sie atmet Männlichkeit aus jeder ihrer schnell trocknenden Kunstfaserporen. Wenn ich auch nicht begreife, wieso.«
»Und wie war es sonst so im Schwimmbad?«
»Lars und seine Frau lassen sich scheiden. Larissa ist damit rausgeplatzt.«
»Oh«, sagte Elisabeth, »Mist.«
»Ja, traurig. Besonders für Larissa ist das schwer.«