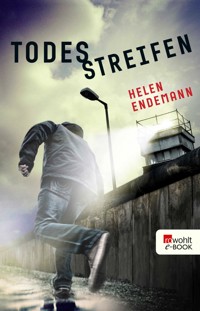4,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Pfarrer Henry
- Sprache: Deutsch
Wenn dunkle Wolken über den Kirchendächern aufziehen … Der fesselnde Kriminalroman »Sterbeläuten« von Helen Endemann jetzt als eBook bei dotbooks. Das beschauliche Sulzbach im Taunus: Zunächst vermutet niemand ein Verbrechen, als eine betagte Dame tot in ihrer Wohnung aufgefunden wird. Aber ist das geschätzte Gemeindemitglied wirklich friedlich entschlafen – oder das Opfer eines perfiden Spiels? Zudem sorgt eine rätselhafte Einbruchserie in Sulzbach für Unruhe … und nicht einmal die Kirche ist sicher! Nur Pfarrer Henry, der weiß, wie wertvoll die verschwundenen Akten in den falschen Händen sein können, erahnt die wahren Motive der Täter. Und er erkennt, dass dies nur die Vorboten eines niederträchtigen Angriffs sind, der mitten ins Herz der Kirchengemeinde zielt … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende Regio-Krimi »Sterbeläuten« von Helen Endemann ist der zweite Band ihrer Reihe um den Dorfpfarrer Henry, bei der alle Bände unabhängig voneinander gelesen werden können. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Das beschauliche Sulzbach im Taunus: Zunächst vermutet niemand ein Verbrechen, als eine betagte Dame tot in ihrer Wohnung aufgefunden wird. Aber ist das geschätzte Gemeindemitglied wirklich friedlich entschlafen – oder das Opfer eines perfiden Spiels? Zudem sorgt eine rätselhafte Einbruchserie in Sulzbach für Unruhe … und nicht einmal die Kirche ist sicher! Nur Pfarrer Henry, der weiß, wie wertvoll die verschwundenen Akten in den falschen Händen sein können, erahnt die wahren Motive der Täter. Und er erkennt, dass dies nur die Vorboten eines niederträchtigen Angriffs sind, der mitten ins Herz der Kirchengemeinde zielt …
Über die Autorin:
Helen Endemann, geboren 1970 in Frankfurt am Main, studierte Jura in Passau, Helsinki und Heidelberg. Sie war 20 Jahre für verschiedene Unternehmen im Deutsche Bahn Konzern tätig und arbeitet heute als Rechtsanwältin. Ihr erstes Buch erschien 2013. Sie ist Mutter von drei Kindern und mit einem evangelischen Pfarrer verheiratet.
Die Website der Autorin: www.helenendemann.jimdofree.com
Die Autorin bei Facebook: www.facebook.com/Helen.Endemann
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre Krimi-Reihe rund um den Sulzbacher Pfarrer Henry: »Sommergrollen«, »Sterbeläuten« und »Totenklage«.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2022
Copyright © der Originalausgabe 2013 by Röschen Verlag, Johanna-Kirchner-Straße 20, D-60488 Frankfurt/Main
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter shutterstock/Harald Lueder, Funny Solution Studio, Nigel Wallace, schankz
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-088-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Sterbeläuten« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Helen Endemann
Sterbeläuten
Ein Taunus-Krimi
dotbooks.
Prolog
Als alte Frau musste man auf der Hut sein. Vor allem, wenn man allein war. Die Zeitungen waren voll von Geschichten über Verbrecher und Betrüger, die sich ihre Opfer unter wehrlosen alten Menschen suchten. Ursel seufzte. Wie gut war es, dass sie nicht mehr allein lebte. Der Junge war nicht nur ein solider Untermieter. Seit er bei ihr wohnte, genoss sie ein ganz neues Ansehen in der Gemeinde. Ihre Freundinnen beneideten sie, auch wenn sie es nie zugeben würden. Ja, man konnte sogar sagen, etwas von seinem Glanz färbte auf sie ab, auf die alte, schrullige Ursel, Witwe schon seit zehn Jahren. Sie warf einen Blick auf das gerahmte Hochzeitsbild auf der Vitrine.
»Du hast es ja wieder so eilig gehabt.« Sie nickte dem fröhlich in die Kamera lächelnden schwarzweißen Bräutigam zu. »Fremde Leute muss man sich in die Wohnung holen, wenn der eigene Mann sich so früh aus dem Staub macht.«
Der Schwarzweiße lächelte tapfer. »Oder zu Staub wird.« Asche zu Asche, Staub zu Staub. Aber Ursel war am Leben und für ihr Alter noch recht fit. Allerdings hatte Dr. Brinkmann bei der letzten Untersuchung mehr Bewegung verordnet. Spazierengehen sollte sie. Vielleicht hatte er ja ein Abkommen mit der Chirurgie des Kreiskrankenhauses und bekam eine Provision, wenn sie sich beim Spazierengehen die Hüfte brach. Oder vielleicht war sein Sohn so ein Gangster, der alte Frauen bei ihrem täglichen Spaziergang überfiel. Spazierengehen kam für Ursel nicht infrage. Sie hatte sich einen Hometrainer bestellt.
Die Standuhr schlug zur vollen Stunde und der Klang zerriss die Stille der leeren Wohnung. Dämmerung war unversehens die Wände hochgekrochen und Ursel fröstelte. Ächzend stand sie auf. Dann wollen wir mal. Sie verließ das Wohnzimmer, betrat den Flur. Es war ihr, als verfolgten wachsame Augen ihre Schritte, aber das war Unsinn. Nur Gottfried, ihr schwarzweißer und lang verblichener Ehemann auf seinem Foto, konnte ihr hinterhergucken. Dennoch dieses Gefühl.
Auf dem Flur hielt sie inne und horchte, aber hinter der Tür des Jungen blieb es still. Er war wohl unterwegs. Vielleicht zeigte er seinem Freund den Ort. Dieser junge Mann – wie hieß er noch – Josef, Samuel? Ein biblischer Name war es, aber sie kam nicht mehr auf ihn. Jedenfalls, der war ja auch ganz reizend. So ein charmanter junger Mann. Ja, da würden ihre Freundinnen staunen, was sie auf ihre alten Tage erlebte. Das Haus voll junger Leute. Man musste eben offen bleiben. Jung im Kopf und im Herzen, das war sie, auch wenn sie jetzt partout nicht auf den Namen kam. Und sie würde zum Kuckuck auch fit bleiben. Wenn der Doktor wollte, dass sie sich bewegte, nun, dann würde sie trainieren.
Im Schlafzimmer war das Ehebett einem Einzelbett gewichen. Es hatte dem Hometrainer Platz gemacht, einem schwarzen Ungetüm mit zu vielen Knöpfen, das irritierende Alarmtöne von sich gab, wenn Ursel etwas Falsches einstellte. Der Junge hatte ihr zeigen müssen, wie das Ungetüm funktionierte. Die jungen Leute konnten mit den neumodischen Geräten umgehen, sie selbst war ein hoffnungsloser Fall. Ursel zog die Vorhänge vor Fenster und Terrassentür zu. Sie schaltete den Fernseher ein und bestieg das Ungetüm. Langsam setzte sie es mit Füßen und Armen in Gang. Im Fernsehen lief die dreitausendeinhundertfünfundzwanzigste Folge »Verbotene Liebe«.
Ursel kam bald in einen Rhythmus und Schweiß begann sich auf ihrer Stirn zu bilden. Die Kleine, die auch bei Doktor Lessing in »Ein Fall für Zwei« arbeitete, hatte Streit mit ihrem Freund. Oder war es eine andere Schauspielerin? Ursel blinzelte. Bevor sie den Hometrainer gekauft hatte, hatte sie keine Vorabendserien gesehen. So richtig kannte sie sich noch nicht in der Geschichte aus. Ihr Atem ging jetzt schwer, sie schnaufte. Heute war das Training anstrengender als sonst. Das Ungetüm wollte sich schneller bewegen als sie. Oder hatte sie gestern Abend ein Glas Wein zu viel getrunken und war deshalb heute nicht in Form? So erfrischend dieser Besuch war, er machte sie doch auch etwas nervös. Eine Anspannung hatte sich ihrer in den vergangenen Tagen bemächtigt, die sicher ganz unnötig und dumm war. Sie sah auf das Anzeigefeld, auf dem ein stilisiertes Herz pumpte und ein Zähler lief. Noch zehn Minuten.
Die Vorhänge machten eine kurze Bewegung und schaukelten sich dann wieder ein. Ursel richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Fernsehsendung. Irgendwer hatte ihr erzählt, dass Matula aufhören wollte. Er war ja auch schon fast siebzig. Und das als Privatdetektiv. Aber schade war es doch. Was dann wohl aus seiner Sekretärin wurde? Ursel hoffte, dass sie bald eine neue Stelle fand.
Der Zähler lief ab und das Ungetüm gab einen synthetischen Signalton von sich. Ursel stieg schwer atmend vom Hometrainer. Sie schaltete den Fernseher aus und die plötzliche Stille schien ihr etwas zuzurufen, klingelte in ihren Ohren. Sie setzte sich aufs Bett, um zu verschnaufen. Ihr war schwindelig.
Als der Mann durch die angelehnte Terrassentür trat, hatte die alte Frau die Augen geschlossen und atmete tief ein und aus. Als sie die Augen wieder öffnete, sah sie sich einem schwarzgekleideten Vermummten gegenüber, der ihr Kissen in den Händen hielt. Sie stieß einen Schrei aus, fasste sich an den Hals und rutschte langsam an der Bettkante schleifend zu Boden. Von dort starrte sie ihn mit vor Angst geweiteten Augen an, als sei sie unfähig zu sprechen oder sich zu bewegen. Der Mann blieb ruhig stehen und wartete. Ein Zucken durchfuhr den Körper der Frau. Sie röchelte. Ihr Kopf sank leicht zur Seite. Sie lag still. Der Mann wartete noch einen Augenblick, zog dann einen Handschuh aus, bevor er mit den Fingern ihren Hals berührte, um den Puls zu fühlen. Dann richtete er sich auf und legte das Kissen zurück aufs Bett, strich es glatt. Er hatte es gar nicht gebraucht. Das war gut. Und doch. Er registrierte einen Hauch von Enttäuschung, die ihn erstaunte.
Teil 1 Erster Advent
Kapitel 1
Erster Advent, zehn Grad plus, Nieselregen. Es war Weihnachtsmarkt in Sulzbach. Auf dem Kirchplatz standen Buden mit Adventskränzen, selbstgekochter Marmelade, selbstgebackenen Plätzchen, selbstgebastelten Lampen. Alle Laternen am Platz waren mit Sternen aus Tannenzweigen geschmückt. Auf der Bühne am Brunnen flötete eine Kindergruppe »Stille Nacht«. Es roch nach Glühwein. Henry nippte an einem Becher mit »Finnischem Punsch« vom evangelischen Kindergarten. Er stand mit seiner Frau Elisabeth und Thomas, dem Küster, unter dem Vordach der Kirche.
»Wer ist eigentlich der Mann, der da gerade an unserem Stand mithilft?«, fragte Elisabeth. »Der mit dem kurzen Ledermantel?«
»Keine Ahnung«, sagte Henry. Er war nur Pfarrer dieser Gemeinde. Er konnte unmöglich jeden kennen, der am Kirchenstand aushalf.
»Er heißt Clausen«, sagte Thomas, »Jakob Clausen.«
»Ich habe den Mann noch nie gesehen«, wunderte sich Elisabeth. Elisabeth konnte sich Gesichter und Namen gut merken und nach fünf Jahren in Sulzbach gab es kaum jemanden, den sie nicht mindestens schon mal gesehen hatte, jedenfalls niemanden aus dem Dunstkreis von Menschen, die es als Helfer auf den Weihnachtsmarkt verschlug. Henry beneidete sie um ihr Personengedächtnis.
»Er ist vor ein paar Wochen im Gemeindebüro aufgetaucht«, erzählte Thomas. »Ein Freund von Herrn Torat. Kommt aus Süddeutschland und ist vor kurzem hergezogen.«
Johannes Torat, Dekanats-Kirchenmusiker, war der Gemeinde seit dem Sommer mit einer Viertelstelle als Organist und Kantor beigegeben. Seine Einführung im Juni hatte allerhand Wirbel verursacht. Er war ein gutaussehender Mann Ende dreißig, charmant. Ein bisschen pompös, wie Henry fand, aber in der Gemeinde kam er gut an, vor allem bei den Frauen. Und nun hatte er anscheinend auch noch einen weiteren jungen Mann für die Gemeinde gewonnen, was ja leider nicht selbstverständlich war. Leute in diesem Alter traten eher aus der Kirche aus statt ein. Mit dem Beginn des Arbeitslebens wurde aus der oft gleichgültig geduldeten Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche eine schmerzhafte Bürde, monatlich schwarz auf weiß auf der Gehaltsabrechnung ablesbar.
»Und was will er bei uns?«, fragte Henry. Der Punsch schmeckte klebrig und zu süß. Henry sah sich um, in der Hoffnung, ihn unauffällig entsorgen zu können.
»Was ist denn das für eine Frage? Er sucht Anschluss«, sagte Thomas. »Ist doch naheliegend, sich einer Kirchengemeinde anzuschließen, wenn man in eine neue Stadt zieht.«
Thomas war fromm. Als Kind hatte er den Kindergottesdienst besucht, als Jugendlicher den CVJM und als junger Mann einen Hauskreis. Dort hatte er auch seine Frau kennengelernt, die vor sechs Jahren gestorben war. Wenn er einmal aus Sulzbach wegginge, würde er sich selbstverständlich in seinem neuen Wohnort eine christliche Gemeinde suchen und hoffen, dort neue Freunde zu finden.
»Wohnt er denn in Sulzbach?«, fragte Elisabeth.
»Nein, in Schwalbach«, antwortete Thomas. »Aber hier gefällt es ihm besser und er kennt ja auch den Herrn Torat.«
»Und jetzt hilft er beim Standdienst«, stellte Henry fest. Nicht nur ließ dieser sagenhafte Mann sich überhaupt blicken, er half auch noch mit. Vielleicht geschahen in Sulzbach neuerdings Wunder und er hatte es gar nicht bemerkt.
»Er hat sich eigentlich für den Besuchsdienst interessiert, deswegen hat Ilona ihn zu mir geschickt.« Thomas organisierte den Besuchsdienst der Gemeinde, eine Gruppe von Leuten, die ältere Menschen besuchten, die einsam waren und nicht mehr aus dem Haus gehen konnten.
»Aber?«, fragte Elisabeth.
»Na ja, du weißt doch, wie die alten Leutchen sind. Wenn da so ein junger Mann ankommt, den sie nicht kennen, da kriegen sie ja Angst. Ich hab ihm gesagt, er soll doch erst mal beim Gemeindebrief mithelfen. Dass die Leute ihn kennenlernen. Und Ilona hat ihn gleich für den Standdienst klargemacht.«
Es war nie leicht, die Dienste für den Weihnachtsmarkt zu besetzen, weil alle ehrenamtlichen Mitarbeiter noch mindestens in zwei weiteren Sulzbacher Vereinen aktiv waren, die ebenfalls auf ihre Mitarbeit zählten. Manche hetzten von einem Standdienst zum nächsten. Kein Wunder, dass die Sekretärin gleich zugeschlagen hatte.
Henry ging ein paar Schritte und kippte seinen Becher in die Büsche neben der Kirche. Solidarität mit dem evangelischen Kindergarten hin oder her. Nächstes Jahr würde er den Glühwein beim Deutsch-Französischen Freundeskreis kaufen.
***
»Okay, was haben wir?«
Kriminalhauptkommissar Röhrig trat in das Schlafzimmer der alten Dame und ließ seinen Blick über die Beamten von der Spurensicherung schweifen, die – wie er immer fand – in ihren unförmigen weißen Anzügen aussahen wie Zewa-Rollen, die eine Choreographie in Zeitlupe einübten. Er registrierte die Blümchentapete, das Einzelbett, den Fernseher, das Trainingsgerät, blieb etwas breitbeinig stehen und sah Leddig erwartungsvoll an.
Die Männer und Frauen der Spusi sahen kaum auf. Leddig, der Chef der Truppe, konnte Röhrig nicht leiden. Beim dritten Bier hatte Kollege Mertens Röhrig erzählt, dass Leddig ihn hinter seinem Rücken »Mike-die-Gelfrisur-Röhrig« nannte und einen »Cowboy«. Offensichtlich hatte Leddig seiner Truppe diese Meinung eingeimpft.
»Ursula Fromme, 79«, ließ sich Leddig schließlich herab. »Der Untermieter hat sie identifiziert. Ist vermutlich seit drei Stunden tot. Es gibt keine Anzeichen für Fremdeinwirkung.«
»Todesursache?« Röhrig beugte sich über die alte Frau, die in leicht gekrümmter Seitenlage vor ihrem Bett lag.
»Herzversagen. Kann viele Ursachen haben. Die Kleidung der Frau ist am Rücken und unter den Armen nass und riecht nach Schweiß. Ich schätze, sie war am Hometrainer zugange und hat es etwas übertrieben. Ist gar nicht so selten, dass in der Ruhe nach dem Training ein plötzlicher Herztod auftritt.«
»Einbruchspuren?« Röhrig hatte aus Fernsehkrimis gelernt, dass Einwortsätze absolut ausreichend waren.
»Keine.«
»Und was machen wir dann hier?« Röhrig machte eine den Tatort umfassende Geste. Es war ja nicht so, als hätte er keine anderen Fälle zu lösen. Im Gegenteil. Die Aktenstapel auf seinem Schreibtisch wuchsen ihm über seine Gelfrisur, wie Leddig es ausdrücken würde.
»Der Untermieter hat die Polizei gerufen. Die haben uns verständigt. Sie ja wohl auch. Wir waren halt früher hier.«
»Was soll denn das heißen?« Leddig wollte ihn ärgern und es gelang ihm auch.
Leddig zog die Plastikhandschuhe aus, die dabei ein schmatzendes Geräusch machten. »Das heißt, wir sind hier fertig und nehmen die alte Dame der guten Ordnung halber mit. Vielleicht finden wir bei der Obduktion mehr heraus.« Ohne die Polarforscherkapuze sah Leddig ganz passabel aus und er wusste es. »Sie könnten sich ja mal um den Untermieter kümmern«, schlug er Röhrig vor. »Er sitzt im Nebenzimmer und versucht, seinen Nervenzusammenbruch unter Kontrolle zu bringen.«
Leddig winkte sein Team mit sich und sie drängten sich an dem Kommissar vorbei. Röhrig hörte, wie er zwei Männer anwies, eine Bahre zu holen. Er betrachtete noch einige Zeit die Frau am Boden, schon um nicht den Eindruck zu erwecken, er bräuchte sich von Leddig sagen zu lassen, was er als Nächstes tun sollte. Dann machte er sich wiegenden Schrittes auf, den Untermieter zu suchen.
***
Der Gottesdienst ging dem Ende zu. Es war der erste Advent. Die Wintersonne tauchte den Altarraum in milchiges Licht. An den Verzierungen unter der ersten Empore hingen in gleichmäßigen Abständen kleine Strohsterne an roten Bändern. Ein großer Adventskranz schmückte den Chorraum.
Die Gemeinde nahm Platz, um das Orgelnachspiel im Sitzen zu hören. Kirchenmusik wurde in der evangelischen Kirchengemeinde Sulzbach großgeschrieben. Die Sulzbacher waren stolz auf ihre fast vierhundert Jahre alte Orgel. Selbstverständlich wurde das Orgelnachspiel in den Abkündigungen angesagt. Heute war es ein »Andante in D-Dur« von Mendelssohn-Bartholdy.
Elisabeth spielte gerne ein persönliches Spiel, das darin bestand, anhand des Orgelspiels zu erraten, wer Orgeldienst hatte. Denn von den Bänken im unteren Kirchenraum war der Organist nicht zu sehen, er wurde von dem Balkon der Empore verdeckt. Den Dienst an der Orgel teilten sich Sibylle und Stephanie Heinemann. Sie waren zwar keine Zwillingsschwestern, sahen sich aber so ähnlich, dass es Elisabeth schwer fiel, sie auseinanderzuhalten, wenn sie sie nicht beide gleichzeitig vor Augen hatte. Beide Schwestern waren Mitte dreißig, circa 170 cm groß, schlank. Sie hatten diesen Schneewittchen-Look: blasse Haut mit einer Neigung, leicht zu erröten, schulterlange dunkle Haare und schwarze lange Wimpern. Stephanie war Kirchenvorsteherin.
Neben den Schwestern konnte es natürlich auch noch Johannes Torat an der Orgel sein. Torat war ein B-Musiker, die Schwestern dagegen hatten nur das kirchenmusikalische Diplom C für nebenberufliche Organisten; eine Tatsache, auf die Torat großen Wert legte. Mithin war an einem ganz normalen Adventssonntag nicht davon auszugehen, dass Torat sich die Ehre gab, überlegte Elisabeth. Ihr fiel ein, dass er sowieso Urlaub hatte, Henry hatte es erwähnt.
Heute ließ die Auswahl des Orgelnachspiels keine Schlüsse auf die Person des Organisten zu, da es sich bei dem feierlichen und etwas melancholischen Stück sozusagen um ein kirchenmusikalisches Basic handelte, das zum Repertoire beider Schwestern gehören konnte. Gelegentlich konnte man die Eigenheiten der Organistinnen auch bei den Gemeindeliedern entdecken. Stephanie zum Beispiel hatte eine offensichtliche Abneigung gegen »Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr«. Diesen kirchenmusikalischen Gassenhauer spielte sie in einem Tempo, dass die Gemeinde Gefahr lief, beim Singen aus Sauerstoffmangel ohnmächtig zu werden. In diesem Gottesdienst hatten jedoch auch die Gemeindelieder keinen Aufschluss über die Person des Organisten gegeben und so zog Elisabeth mit den letzten Gottesdienstbesuchern aus der Kirche aus, ohne das Rätsel gelöst zu haben.
Beim Kirchenkaffee im benachbarten Gemeindehaus war Elisabeth dann sicher, dass es Sibylle war, die sich jetzt bei Thomas darüber beklagte, dass er die Kirche übermäßig heizte. Das schade der Orgel; ein Dauerzankapfel zwischen ihr und Thomas. Über Sibylles Kopf fing Elisabeth Thomas’ Blick auf. Er verdrehte leicht die Augen. Mit Stephanie verstand er sich besser. Das lag wohl daran, dass sie Humor hatte und kein Theater wegen der Orgel machte. Außerdem war sie hübsch, überlegte Elisabeth, aber das war Sibylle auch, sie sahen sich ja so ähnlich. Aber ähnlich war eben nicht gleich, und Thomas kam es anscheinend auf die inneren Werte an.
Die Tür des Gemeindesaals sprang auf und knallte krachend gegen einen Tisch, auf dem der Gemeindebrief und andere Blättchen auslagen. Markus und Lukas, Elisabeths und Henrys Söhne, stürmten herein, mit Samuel, dem Küstersohn, im Schlepptau. Das sorgte für einige hochgezogene Augenbrauen unter den Anwesenden, was die Jungs nicht bemerkten.
»Was gibt’s für Kuchen?«, rief Lukas.
Bald waren etliche Stücke Marmorkuchen und Kekse heruntergeschlungen und ihre Überreste zierten das Parkett.
Da kann ich mir mit dem Mittagessen ja noch Zeit lassen, dachte Elisabeth.
»Was gibt’s zum Mittagessen?«, schrie Lukas wie aufs Stichwort, er hatte offensichtlich großes Interesse am Speiseplan für diesen Tag.
»Kann Samuel bei uns essen?«, rief Markus. »Bitte, Mama!«
»Ja, bitte, bitte, Mama«, fiel Lukas ein.
Elisabeth sah Thomas fragend an.
»Du kannst uns nicht jeden Sonntag einladen, ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen.« Thomas sah peinlich berührt aus. »Außerdem habe ich tolle Raviolidosen gekauft, mit denen kannst du gar nicht mithalten.«
Als Elisabeth und Henry vor fünf Jahren nach Sulzbach gekommen waren, hatten die Pfarrerskinder sich in Lichtgeschwindigkeit mit den Küsterkindern Samuel und dessen großer Schwester Miriam angefreundet und auch Henry und Elisabeth verstanden sich bald gut mit Thomas. Er hatte zwar seine Eigenheiten und ging nicht gern unter Leute, aber die Arbeit mit Henry und die Freundschaft der Kinder hatten das Eis schnell gebrochen.
»Ach, Unsinn!«, sagte Henry, der dazugekommen war. »Klar kocht Elisabeth scheußlich, aber in guter Gesellschaft kann man das aushalten.«
***
»Bitte hol mir Kartoffeln aus dem Keller«, bat Elisabeth Markus zuhause. »Mach die Schüssel hier ganz voll. Und zwei Gläser Würstchen.«
»Ich komme mit«, rief Samuel. Das Pfarrhaus war ein Quell immer neuer Wunder für alle Kinder, die die Zwillinge und deren sechsjährige Schwester Marlene besuchten. So viele Zimmer. Ein riesiger Dachboden, in dem man herumklettern und von oben in zwei kleine, unbewohnte Kammern hinunterschauen konnte. Und der Keller. Ein richtiges Gewölbe mit mehreren Räumen unter der ganzen Fläche des großen Hauses. Die besondere Attraktion darin war ein echter Luftschutzkeller aus dem Zweiten Weltkrieg, eine kleine Kammer im hinteren Winkel des Kellers mit einer stählernen Tür.
»Ich wette, hier gibt’s einen Geheimgang rüber zur Kirche«, mutmaßte Samuel, der sich eifrig umsah, während Markus die Schüssel mit Kartoffeln füllte.
»Klar, wie in Illuminati.«
»Nee, echt!«, rief Samuel. »Für den Pfarrer und seine Familie, zum Flüchten in die Kirche bei einem Angriff durch die Gegenreformatoren oder Hugenotten.«
»Oder Klingonen«, sagte Markus.
Samuel trat gegen die Mauersteine, um zu prüfen, ob es hinter ihnen hohl wäre. »Hier müssen wir uns mal in Ruhe umsehen, mit Werkzeug.«
»Ja, aber nicht jetzt, wo Mama auf die Kartoffeln wartet.«
Markus lieferte Kartoffeln und Würstchen ab und ging mit Samuel ins Jungenzimmer hinauf. »Weißt du, wo wir uns auch dringend mal umsehen sollten?«, sagte er. »Im Glockenturm.«
»Ja«, stimmte Samuel zu, »unbedingt. Aber das ist nicht so einfach. Vater hat es uns verboten. Wegen den schlüpfrigen Treppen.« Er verdrehte die Augen. »Und wegen den Schleiereulen, weil wir die stören.«
»Sicher, wenn wir laut polternd die schlüpfrigen Treppen runterfallen.«
»Wir müssen es heimlich machen«, sagte Samuel.
»Was müsst ihr heimlich machen?« Marlene kam aus ihrem Zimmer und baute sich vor den Jungen auf.
»Dir Regenwürmer ins Bett legen, weil du so neugierig bist«, antwortete Markus.
»Du bist gemein!« Marlenes Augen füllten sich zuverlässig mit Tränen. Markus war sicher, dass sie das auf Knopfdruck konnte.
»Nein, Mann, jetzt heul nicht, ich hab doch nur ’nen Witz gemacht«, beschwichtigte er seine Schwester schnell. Nicht, dass sie zu Mama lief und petzte. »Wir sagen es dir, wenn es so weit ist, vielleicht kannst du ja Schmiere für uns stehen«, fügte er hinzu und sah nervös rüber zu Samuel, der hinter Marlenes Rücken herumtanzte und mit beiden Zeigefingern an seine Stirn tippte. Marlene war jedenfalls einigermaßen besänftigt.
»Aber ihr macht nichts richtig Schlimmes?«, vergewisserte sie sich, »nicht, dass Gott wieder eine Sintflut schickt oder Mama vier Wochen Fernsehverbot erteilt.«
»Mann, Marlene, er hat gesagt, er schickt keine mehr. Und schon gar nicht wegen uns«, erklärte Markus entnervt. Fernsehverbot musste man einkalkulieren, sonst konnte man ja gar nichts mehr unternehmen.
»Da wäre ich mir nicht so sicher«, klang es von der Treppe. Es war Miriam, Samuels dreizehnjährige Schwester. Markus starrte Miriam an und wurde rot.
»Elisabeth sagt, wir sollen zum Essen kommen«, sagte Miriam.
»Isst du auch mit uns? Juhu!« Marlene lief auf Miriam zu und umarmte sie.
Miriam war bei allen Pfarrerskindern sehr beliebt. Sie hatte Unmengen schwarzer Korkenzieherlocken, ihre blauen Augen strahlten meistens fröhlich und sie hatte in den vergangenen Wochen so eine Art Busen bekommen, wie Markus bemerkt hatte. Miriam trainierte zur gleichen Zeit Leichtathletik wie die Jungen und lief ihnen allen meilenweit davon. Das brachte ihr eine Menge Respekt ein. Außerdem war sie lustig und verpfiff nie jemanden. Jetzt nahm sie Marlene huckepack auf den Rücken und trug sie die Treppen hinunter. Markus und die anderen folgten ihr in die Küche, wo die Kinder aßen.
Elisabeth, Henry und Thomas zogen sich mit ihren Tellern ins Esszimmer zurück. Sie setzten sich an den Esstisch und genossen die Möglichkeit, ein vernünftiges Gespräch unter Erwachsenen zu führen, indem sie schweigend aßen. Aus der Küche drang lautes Gejohle. Elisabeth stand auf, um etwas zu trinken zu holen. Als sie die Tür öffnete, sah sie Markus auf seinem Stuhl stehen. In seinen Ohren steckten Wiener Würstchen. Alle Kinder lachten.
»Ja spinnst du denn total?«, schimpfte Elisabeth. »Setz dich sofort wieder hin. Was musst du hier so einen Kasper machen?«
Sie kehrte mit einer Flasche Sprudelwasser ins Esszimmer zurück.
»Was war denn?«, wollte Henry wissen.
»Markus führt sich auf wie ein Depp«, antwortete Elisabeth. »Steht auf dem Stuhl und hat Würstchen in den Ohren stecken.«
Die Männer lachten.
»Arme Miriam«, sagte Elisabeth, »der können wir eigentlich nicht mehr zumuten, mit diesen Knallköpfen zu essen.«
»Glaub mir, die isst viel lieber mit den Knallköpfen als mit uns Scheintoten«, beruhigte sie Thomas.
»Kaffee?«, fragte Henry nach dem Essen. »Ich koche einen Kaffee, der die Scheintoten aufweckt«, versprach er und betrat unerschrocken die Küche. Dort erwartete ihn ein Bild, mit dem er nicht gerechnet hatte: Miriam räumte die dreckigen Teller in die Spülmaschine. Und Markus half mit.
***
Antoni kniete in der Kirchenbank und senkte den Kopf. Er hieß das Gefühl der harten Bank unter seinen Knien willkommen und wäre gerne die ganze Nacht auf Knien in der Kirche geblieben, als Zeichen seiner Reue. Er fühlte sich wie ein Verräter. Die alte Frau Heinemann und ihre Töchter waren in den vergangenen Monaten zu einer zweiten Familie für Antoni geworden. Seine deutsche Familie, wie er sie für sich nannte. Was er jetzt vorhatte, ja schon begonnen hatte, fühlte sich ganz und gar falsch an. Es war, als hätte er zwei Gesichter, das eine, dass er der Familie zeigte, die ihm vertraute, und das andere, mit dem er eben diese Menschen verriet und im Stich ließ. Aber letztlich hatte er keine Wahl. Letztlich ist sich jeder selbst der Nächste, dachte er; und er dachte auch an seine alten Eltern, die von ihrer Rente nicht annähernd leben konnten. Er dachte an seine Schwester. Alicja hatte zwei Kinder zuhause in Polen und kam jede Woche für vier Tage zum Putzen nach Deutschland. An diesen vier Tagen putzte sie bis zum Umfallen, zwölf Stunden am Tag. Sie übernachtete dann bei Antoni in dessen Zwei-Zimmer-Wohnung in Schwalbach. Was, wenn er die Miete nicht mehr zahlen konnte?
Pfarrer Herrmann blickte sorgenvoll auf den gesenkten Kopf des Polen. Er kannte ihn. Es war der junge Mann, der Frau Heinemann in ihren schweren letzten Monaten pflegte. Die Familie hielt große Stücke auf ihn. Aber irgendetwas schien dem Mann Sorgen zu bereiten. Auch für einen gläubigen polnischen Katholiken war es doch sicher nicht Pflicht, an einem Tag Vorabend-, Früh- und Spätmesse zu besuchen? Herrmann nahm sich vor, den Mann im Anschluss an die Messe anzusprechen. Aber als die Messe zu Ende und der Pfarrer aus der Kirche ausgezogen war, musste der Pole die Kirche schon verlassen haben. Pfarrer Herrmann konnte ihn nirgends sehen. Suchend blickte er in die kalte Nacht. Sein Blick fiel auf den mit einer Lichterkette geschmückten Baum auf der Grünfläche, die die Kirche von der Hauptstraße trennte. Die Lichterkette ließ den Baum aussehen, als habe er eine Duschhaube auf der Krone. Das würde er in seinem Gemeindevorstand aber nicht laut sagen.
***
»Guten Morgen«, sagte Henry mit dem Ton eines Lehrers, der seine Klasse betritt und ein Chaos vorfindet. Zwei Köpfe fuhren herum. Ilona, die Sekretärin der Kirchengemeinde, saß am PC, neben ihr stand ein Mann. Er hatte ihr über die Schulter gesehen, als Henry das Büro durch die Tür betrat, die es von seinem Arbeitszimmer trennte.
»Guten Morgen, Henry.« Ilona hatte rote Flecken im Gesicht. »Äh, kennst du Jakob Clausen?«
Der Mann, den Henry jetzt als den Weihnachtsmarkt-Helfer erkannte, lächelte gewinnend und streckte Henry die Hand hin: »Jakob Clausen, freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Pfarrer!«
Henry schüttelte seine Hand.
»Jakob hilft neuerdings mit im Gemeindebriefteam.« Die Flecken verblassten zusehends. »Er ist IT-Spezialist.« Jetzt schwang bereits Stolz in Ilonas Stimme. Seht her, ich habe uns einen IT-Spezialisten an Land gezogen, sollte die Nachricht an Henry lauten.
»Wo arbeiten Sie denn?«, fragte Henry.
»Kleine Firma in Frankfurt«, sagte Clausen. »Wir konzipieren maßgeschneiderte IT-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Ich bin immer neugierig, wie Unternehmen sich organisieren, welche IT-Lösungen sie haben, ob sie mit Netzwerken arbeiten. Eine Kirchengemeinde ist ja im Grunde auch ein kleines oder mittelständisches Unternehmen.«
So wie Clausen erwartungsvoll grinste, hatte Henry das Gefühl, er sollte sich jetzt geschmeichelt fühlen. »Ja«, sagte er. »Ich muss mal was kopieren«, und drehte sich zum Kopierer.
»Gut, ich komme dann Donnerstagnachmittag zum Sortieren und Austeilen des Gemeindebriefs«, sagte Clausen zu Ilona.
»Verflixter Mist!«, fluchte Henry. Der Kopierer warf eifrig Papiere aus. »Wo breche ich das denn ab?« Henrys Augen flogen hektisch über das Display und die viel zu vielen winzigen Knöpfe.
»Darf ich mal?« Clausen beugte sich über den Apparat. Er drückte einen Knopf. Der Kopierer warf noch zwei Seiten aus, auf denen Henrys Weihnachts-Dankesschreiben an die ehrenamtlichen Mitarbeiter in mikroskopisch kleiner Schrift rechts oben in der Ecke des DIN-A-4-Blattes gerade noch zu erkennen war.
»Wieso macht der eigentlich nie, was ich will?«
»Der Output kann immer nur so gut sein wie der Input«, sagte Clausen und lächelte Henry verschwörerisch an. Henry hatte Mühe, ihn nicht anzuknurren. Clausen drückte noch ein paar Knöpfe. »Das Format war auf 75-prozentige Verkleinerung eingestellt. Jetzt müsste es wieder okay sein.«
»Wer macht denn so was?« Henry näherte sich widerwillig dem Kopierer und legte den Brief erneut auf. Jetzt lächelten Ilona und dieser Clausen sich verschwörerisch an. Sie brauchten gar nicht zu denken, er sähe das nicht.
»Wie viele Exemplare?«, fragte Clausen.
»Das kann ich schon«, wehrte Henry ab. Er suchte die Einstellung für die Exemplare und wählte die Anzahl aus.
»Na, dann noch einen angenehmen Tag allerseits!« Clausen deutete eine Verbeugung in Ilonas Richtung an und verließ das Büro.
»Du warst aber nicht so richtig nett zu Herrn Clausen.« Ilona sah Henry missbilligend an. »Da haben wir mal ein neues Gemeindeglied und du benimmst dich so.«
»Wie denn, ›so‹?«, fragte Henry, der genau wusste, was sie meinte. »Ist er denn Mitglied unserer Gemeinde?«, hakte er nach, um abzulenken.
»Nein, er wohnt ja in Schwalbach. Aber er ist ein ehrenamtlicher Mitarbeiter. Und hilft beim Gemeindebrief. Vielleicht lässt er sich noch umgemeinden. Wenn du ihn nicht vergraulst.«
»Jetzt übertreib nicht. War ich so schlimm?«
»Ja. Du hast übrigens eine Beerdigung. Liegt in deinem Fach.«
»Och, nee.«
»Ja, rücksichtslos von den Leuten, mitten im Advent zu sterben«, sagte Ilona und wandte sich ihrem Bildschirm zu.
***
Röhrig holte sich einen grauenhaft bitteren Kaffee in einem deprimierenden braunen Plastikbecher aus dem Automaten im Polizeirevier und setzte sich auf eine Bank vorm Haus. Nach der Obduktion brauchte er ein bisschen frische Luft, bevor er hoch in sein Büro ging.
Die Obduktion hatte rein gar nichts ergeben. Ursula Fromme war für ihr Alter ganz gut in Form gewesen. Eine leichte Herzschwäche, die einerseits altersgemäß war, aber andererseits nicht zwingend zu einem Herzversagen nach körperlicher Anstrengung führen musste. An ihrem Körper waren keine Spuren von Fremdeinwirkung gewesen. Keine Medikamente oder Gifte, aber hierfür hätte es auch Hinweise geben müssen, sie konnten schließlich nicht alles testen.
Röhrig nahm einen Schluck von der Kaffeebrühe. Das war der reinste Giftmüll. Die Untersuchung der Wohnung hatte auch nichts gebracht. Kein gewaltsames Eindringen. Es gab natürlich jede Menge Fingerabdrücke, die weder zum Opfer oder zu ihrem Untermieter gehörten, aber die waren durch die Datenbank gelaufen, ohne Ergebnis. Außerdem waren sie nur im Wohnzimmer gefunden worden, nicht im Schlafzimmer. Besucher oder Handwerker, man konnte nicht jeden von Frau Frommes Bekannten und Kontakten auf Fingerabdrücke überprüfen und selbst wenn man es tat, würde es doch nur darauf hinauslaufen, dass diese Personen sich aus völlig nachvollziehbaren Gründen in der Wohnung aufgehalten hatten.
Der Untermieter hatte unter Schock gestanden und jetzt wollte er nichts wie raus aus der Wohnung. Röhrig hatte keinen Grund, ihn festzuhalten, denn er hatte ein wasserdichtes Alibi. Für Röhrigs Geschmack verhielt er sich etwas hysterisch. Aber so tickten die Menschen eben, vor allem wenn sie nicht so oft mit dem Tod Berührung hatten. Dann machte ihnen ein Todesfall Angst, als könnte er ansteckend sein. Röhrig hatte den Untermieter noch mal gründlich auf Herz und Nieren geprüft. Außer dass dieser ein nervöses Wrack war und den Eindruck vermittelte, dass Frau Fromme irgendwie ihre Pflichten als Vermieterin missachtet hatte, indem sie einfach so in ihrer eigenen Wohnung gestorben war, hatte Röhrig nichts Verdächtiges an ihm feststellen können.
Alle unerledigten Fälle, die sich auf Röhrigs Schreibtisch stapelten, schrien danach, die Akte Fromme zu schließen. Es musste ja nicht immer ein Verbrechen passiert sein. Manchmal starben die Leute halt, vor allem wenn sie so alt waren wie Frau Fromme.
***
Vom Flugzeug aus hatte die Stadt mit den zwei Flüssen schön ausgesehen, aber Maté musste blinzeln und ein paar Tränen wegwischen. Die Polizisten hatten ihn begleitetet und warteten mit ihm, während er seine Reisetasche von der Gepäckausgabe holte. Am Zoll wünschten sie ihm »viel Glück«, was ihm nicht so höhnisch vorkam, wie man meinen könnte. Wahrscheinlich meinten sie es sogar ehrlich. Dann verschwanden sie, zurück nach Deutschland, und ließen ihn allein. Er stand mit seiner Tasche in der Ankunftshalle des Belgrader Flughafens und hatte Angst, wie er noch nie in seinem Leben Angst gehabt hatte. Er war allein in einer Stadt, in der er keinen Menschen kannte. In einem Land, dessen Sprache er nicht sprach und das laut Geburtsurkunde seine Heimat war, in die man ihn abgeschoben hatte. Die Tasche in seiner Hand fing an zu zittern, weil seine Hand zitterte. Er sog Luft durch einen Spalt seiner zusammengepressten Lippen ein und befahl seiner Hand, ruhig zu werden. Dann sah er sich um und ging schließlich auf ein Plakat zu, das wie ein Busfahrplan aussah. Er starrte auf Schriftzeichen, die russisch aussahen. Sicher gab es auch einen Plan auf Englisch. Die Schilder, die er auf seinem Weg vom Flugzeug gesehen hatte, waren in lesbarer Schrift gewesen und sogar ins Englische übersetzt. Er musste nur ein bisschen suchen. Aber Maté spürte, wie sein Hals eng wurde und er Panik bekam. Er drehte sich zurück zur Halle, als könnte er den Polizisten noch zurufen: »Wartet! Ich kann die Schrift hier nicht lesen. Ich spreche die Sprache nicht. Ich muss zurück nach Deutschland!«
Die Polizisten waren natürlich längst weg. Er drehte sich weiter und sah nach draußen. Er machte einige Schritte auf den Ausgang zu und lief einem Fluggast hinterher, der mit seinem Koffer durch die Glastüren ging. Draußen schien eine gleißende Sonne, und Maté taumelte wieder einen Schritt zurück, blieb mitten im Ausgang stehen. Ein Mann stieß ihn an, der mit einer Frau zusammen aus der Halle nach draußen ging. Maté machte einige Schritte nach vorne, kehrte um und ging wieder in die Halle, wo er ratlos stehen blieb.
»Zigarette?« Er fuhr herum. Ein mittelgroßer dunkelblonder Mann in braunem Mantel hielt ihm ein Päckchen Zigaretten hin. Irgendeine Ostmarke, die er noch nie gesehen hatte.
»Danke.« Maté war tatsächlich so dankbar, einfach nur, weil der Mann Deutsch sprach, dass er ihm am liebsten die Hand geküsst hätte.
»Wir müssen rausgehen«, sagte der Mann und deutete nach draußen. »Hier drinnen darf man neuerdings nicht mehr rauchen.« Er verdrehte die Augen und legte ganz leicht und nur für einen Moment die Hand auf Matés Schulter. Sie gingen die paar Schritte nach draußen. Dort zündete der Mann Matés Zigarette an und dann seine. »Zum ersten Mal in Belgrad?«
Maté nickte und blies Rauch aus.
»Geschäftlich oder privat?« Der Mann grinste, als sei das ein Witz, so als spielte er einen Einwanderungsbeamten.
»Privat, glaube ich. Ich bin abgeschoben worden.«
»Oha.« Der Mann ließ langsam Rauch aus seinem Mund entweichen. »Aus Deutschland?«
»Ja.«
»Und jetzt? Wo gehst du jetzt hin? Hast du Verwandte?«
Maté schüttelte den Kopf. »Ich hab niemanden. Ich weiß nicht, wohin ich gehen kann.«
Der Mann nickte, als hätte er diese Antwort erwartet. »Ich bin Joska«, sagte er und streckte Maté die Hand hin. »Fahren wir ein bisschen.«
Teil 2 Zweiter Advent
Kapitel 2
Henry hasste Streit. Streit mit seiner Frau. Streit in der Gemeinde. Sogar Streit in Fernsehtalkshows. Der Streit als reinigendes Gewitter – dieses Bild hatte ihm noch nie eingeleuchtet. Es schien nicht eitel Sonne nach einem Streit. Gefühle wurden verletzt, Selbstvertrauen beschädigt. Unbeschwertheit war eine langsam wachsende Pflanze.
»Und wenn sie aus dem Baum der Erkenntnis geschnitzt sind«, hörte er seine Frau von draußen, »ich will sie nicht im Chorraum haben!«
Elisabeths Stimme war laut und klang wütend. Henry vernahm auch etwas Panik in ihrer Stimme, die ihr Gesprächspartner aber wahrscheinlich nicht als solche erkennen würde. Mit wem stritt sie nur? Henry stand im Talar in der Tür, Predigt und Gesangbuch in der Hand. Er war auf dem Weg in die Kirche. Vorsichtig lugte er aus der Haustür nach draußen, von wo er Elisabeth gehört hatte. Sie stand mit Thomas auf dem Pfarrhof.
»Jetzt sei doch vernünftig, Elisabeth«, hörte er Thomas sagen.
Oh, gar nicht gut, dachte Henry. Da geht sie erst recht in die Luft, wenn sie sich bevormundet fühlt.
»Der Baum, den der Tann-Fitz uns gespendet hat, ist riesig. Da passen die Krippenfiguren nicht daneben. Sie müssen auf die linke Seite vom Altar.«
»Und wo soll deiner Meinung nach mein Krippenspiel stattfinden? Hinter dem Altar?«
»Ihr könnt vor dem Altar sein«, sagte Thomas. »Da sieht man euch eh am besten.«
»Thomas, wir sind keine One-Man-Show! Wir brauchen den ganzen Platz rechts, links und vor dem Altar.«
Henry sah auf die Uhr. Fünf vor zehn. Thomas müsste längst die Glocken läuten.
»Ich hab es dir doch erklärt. Die Krippenfiguren müssen links stehen.«
»Ich pfeife auf deine Krippenfiguren! Ich habe Kinder aus Fleisch und Blut, die ein Stück aufführen, und Eltern, die das sehen wollen und nicht ein paar Holzpuppen.«
»Elisabeth, wie oft noch: handgeschnitzte Zedernholzfiguren aus Bethlehem …«
Henry räusperte sich und trat aus der Tür, die er dann geräuschvoll ins Schloss fallen ließ. Thomas und Elisabeth standen sich in einer Haltung gegenüber, die Henry an kämpfende Vogelstrauße erinnerte, die er vor Jahren im Opelzoo gesehen hatte.
»Ja, dann wollen wir mal«, sagte er, die Vogelstrauße breit anlächelnd und wies mit dem Kopf zur Kirche. Kirchenvorsteher Hirzig stand vor dem Hoftor und ruderte mit den Armen. Er unterbrach das Rudern und tippte mit dem Zeigefinger, nein mit dem ganzen Arm, auf seine Armbanduhr. Dann ruderte er wieder. Henry nickte ihm zu. Elisabeth und Thomas warfen sich einen letzten bitteren Blick zu und setzten sich in Bewegung. Henry schritt hinter ihnen her. Das würde ja ein besinnlicher Adventsgottesdienst werden.
Während Henry im Fürbittgebet für die Verstorbenen, deren Angehörige und die ganze schwierige Welt betete, wartete Thomas darauf, das Vater-Unser-Läuten einzuschalten. Ihm war nicht zum Beten zumute. Er wusste, dass es keinen Sinn hatte, sich in frommen Gebeten zu ergehen, solange er sauer auf Elisabeth war.
»Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt«, hatte Jesus gelehrt. Es war nur so, dass Thomas überhaupt nicht einsah, Elisabeth ihre Engstirnigkeit zu vergeben. Sie dachte, dass immer alles nach ihrem Kopf gehen müsste. Und wenn nicht, lief sie zu Henry und bearbeitete ihn so lange, bis sie ihren Willen bekam. Aber diesmal würde Thomas nicht klein beigeben. Außerdem konnte man nur jemandem vergeben, der um Vergebung bat, und danach hatte Elisabeth weiß Gott nicht ausgesehen. Henry räusperte sich ins Mikrophon. Thomas schreckte auf und drückte den Knopf des elektrischen Läutwerks. Die Lautsprecher fingen an zu knacken, bis sie von den Glocken übertönt wurden.
Elisabeth fühlte sich niedergedrückt. Sie hätte nicht sagen sollen, dass sie auf die Krippenfiguren pfiff, die Thomas so am Herzen lagen. Das war ihr rausgerutscht. Sie verstand, dass ihn das gekränkt hatte. Aber er musste doch einsehen, dass diese blöde Krippe völlig zweitrangig war im Vergleich zu ihrem Krippenspiel. Der Krippenspielgottesdienst war für viele evangelische Kinder in Sulzbach der einzige Gottesdienst im Jahr, den sie überhaupt besuchten. Das Krippenspiel brachte ihnen die Weihnachtsgeschichte nahe und ließ sie die Geschenke wenigstens für eine Stunde an Heiligabend vergessen.
Wenn man sich die Zahl der Kirchenaustritte und die Altersstruktur der Gottesdienstbesucher ansieht, müssten wir für jedes Kind, das den Gottesdienst besuchen will, einen roten Teppich ausrollen, dachte Elisabeth. Kinder waren wichtiger als Holzfiguren. Auch wenn sie aus balsamiertem Zedernholz waren.
***
Beim Kirchenkaffee stellte Elisabeth sich an den Tisch, an dem Stephanie ihren Kaffee trank.
»Wo ist Sibylle?«, fragte sie.
Stephanies Miene wurde besorgt. »Sie ist bei Mutter geblieben. Es geht ihr immer schlechter. Sie isst gar nichts mehr und schläft fast nur noch. Wir lassen sie jetzt gar nicht mehr allein«, erklärte sie. »Antoni hat ja sonntags frei.«