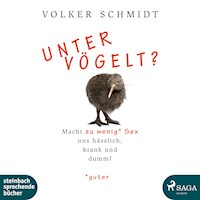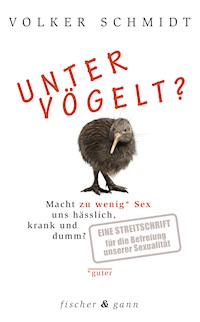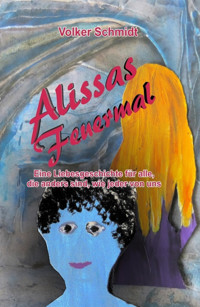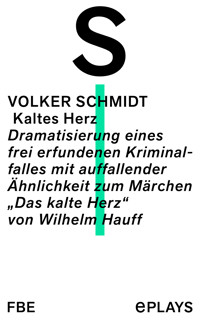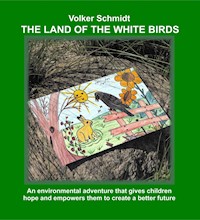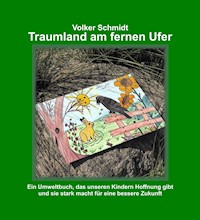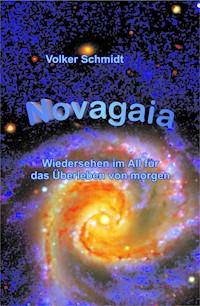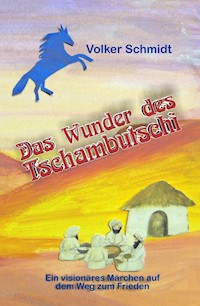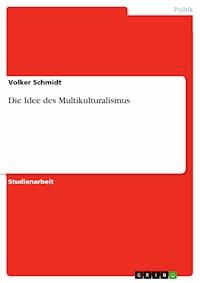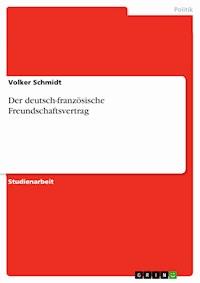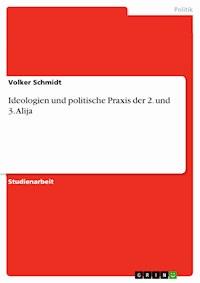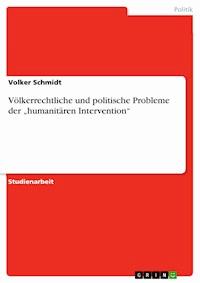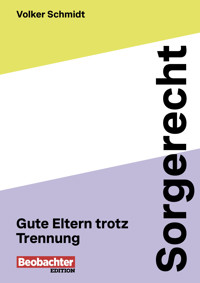
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Beobachter-Edition
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Pocket Reihe
- Sprache: Deutsch
Seit dem 1. Juli 2014 ist das gemeinsame Sorgerecht in der Schweiz die Regel. Eltern, die sich trennen oder nicht verheiratet sind, teilen die elterliche Verantwortung für ihr Kind. Dies erfordert Kompromissbereitschaft und Sozialkompetenz, um das Wohl des Kindes zu wahren. Das Sorgerecht regelt nicht nur die Rechte, sondern auch die Pflichten der Eltern, die gemeinsam Entscheidungen zu Themen wie Bildung, Religion, Gesundheit und Finanzen treffen müssen. Diese Herausforderungen und potenziellen Konflikte behandelt der Beobachter-Ratgeber, um Eltern bei der Übernahme der Verantwortung für ihr gemeinsames Kind zu unterstützen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
3., vollständig überarbeitete Auflage, 2024
© 2017 Beobachter-Edition, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
www.beobachter.ch
Herausgeber: Der Schweizerische Beobachter, Zürich
Lektorat: Käthi Zeugin
Reihengestaltung und Umschlag: Frau Federer GmbH
Satz: Frau Federer GmbH
Herstellung: Bruno Bächtold
Druck: CPI Books GmbH, Ulm
ISBN 978-3-03875-535-7
Zufrieden mit den Beobachter-Ratgebern? Bewerten Sie unsere Ratgeber-Bücher im Shop:
www.beobachter.ch/buchshop
Mit dem Beobachter online in Kontakt:
www.facebook.com/beobachtermagazin
www.twitter.com/BeobachterRat
www.instagram.com/beobachteredition
Für meine Töchter
Der Autor
Volker Schmidt ist forensischer Kinder- und Jugendpsychiater. Als sachverständiger Gutachter hat er täglich mit Familien zu tun, bei denen Fragen zu Sorgerecht, Obhut, Kontaktrecht, Kinderschutz etc. geklärt werden müssen. Er berät Gerichte sowie Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden.
Inhalt
Vorwort 12
1 Wenn Eltern auseinandergehen 15
Gemeinsam Eltern sein – darauf kommt es an 16
Modernes Gesetz zum Wohl der Kinder 17
Der Einfluss der Rollenverteilung 18
Fair streiten, den Kindern zuliebe 19
Eine lohnende Herausforderung 20
Sorgerecht, Obhut, Kontakt – der rechtliche Rahmen 21
Wer hat die elterliche Sorge? 21
Gemeinsame elterliche Sorge – der Normalfall 24
Obhut – das Kind bei sich haben 26
Aufenthaltsbestimmungsrecht und Wohnsitz 27
Wechsel des Wohnsitzes 28
Betreuungsanteile und Kontaktrecht 30
Erwerbstätigkeit und Unterhaltszahlungen 32
Zentrale Begriffe: Kindeswohl und Erziehungsfähigkeit 34
Kindeswohl – was heisst das? 35
Gefährdung des Kindeswohls 36
Was tun, wenn Sie vermuten, dass das Kindeswohl gefährdet ist? 38
Kindesschutzmassnahmen der Kesb 40
Erziehungsfähigkeit – was ist das? 45
Einfühlen in die Perspektive des Kindes 46
Ein Gesinnungswandel ist gefragt 49
Gesinnungswandel bei den Müttern 51
Gesinnungswandel bei den Vätern 52
Gesinnungswandel bei Gerichten, Behörden und Anwälten 53
Gesinnungswandel in der Gesellschaft 54
In Kürze «Wenn Eltern auseinandergehen» 55
2 Das Kind im Fokus 57
Was bedeuten Trennung und Scheidung für die Kinder? 58
Die Folgen für die Kinder 59
Je stärker der Elternkonflikt, desto grösser die Folgen für die Kinder 61
Abwesende Väter 62
Die Rolle des Geschlechts 63
Altersabhängige Reaktionen 64
Auswirkungen auf die Zukunft 64
Es gibt auch positive Scheidungsfolgen 66
Die Betreuung aufteilen: Wohnmodelle 68
Traditionelles Wohnmodell – immer noch die Regel 68
Alternierende Obhut und Wechselmodell 69
Nestmodell – selten, aber prüfenswert 74
Gemeinsame Betreuung – das brauchen Ihre Kinder 77
Kontinuität und Stabilität 78
Emotionale Bindungen und Beziehungen 79
Kindeswille – Ihr Kind darf mitreden 80
Besonnenheit und Flexibilität sind gefragt 84
Das Kontaktrecht 87
So funktioniert das Kontaktrecht – einige Regeln 88
So ermöglichen Sie Ihrem Kind gute Kontakte 91
Kontakte mit Ihrem Baby 93
Kontakte mit Kleinkindern und Vorschulkindern 97
Kontakte mit Schulkindern und Jugendlichen 99
Was braucht mein Kind an Unterstützung? 101
Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit 101
Verstehen mit Kinderbüchern und im Spiel 103
Fördern Sie die Stärken Ihres Kindes 105
Bewältigungsstrategien der Kinder verstehen und unterstützen 106
Die Geschwisterbeziehung fördern 108
Kümmern Sie sich um Ihr eigenes Wohlbefinden 110
Wenn Ihr Kind Therapie braucht 110
Kontaktprobleme und Kontaktverweigerung 114
Kinder im Loyalitätskonflikt 116
«Parental Alienation Syndrome» – viel diskutiert und umstritten 119
Wie wirken sich Kontaktprobleme auf das Kind aus? 120
Begleitete Kontakte und Übergaben – Hilfe in verfahrenen Situationen 121
Erinnerungskontakte 124
Wenn die Kontakte dem Kind schaden 125
Vorwurf des sexuellen Übergriffs 129
In Kürze «Das Kind im Fokus» 133
3 Die Eltern im Fokus 135
Trennung und Scheidung aus der Sicht der Eltern 136
Die traditionelle Rollenverteilung und ihre Folgen 137
Egalitäre Rollenverteilung 141
Die gemeinsame elterliche Sorge eröffnet Chancen 143
Konflikte zwischen den Eltern 147
Achten Sie auf Ihre Streitkultur 147
Lösungsmöglichkeiten bei Konflikten 149
Bedürfnisse und Wünsche des Kindes einbeziehen 154
Hochkonflikthafte Eltern – was heisst das? 156
Der Konflikt als Dauerzustand 157
Parallele Elternschaft 158
Wenn Eltern psychisch krank sind 161
Wie kommen Kinder mit psychisch kranken Eltern zurecht? 162
Falsche Behauptungen 164
In Kürze «Die Eltern im Fokus» 165
4 Die Rolle des Umfelds 167
Grosseltern, weitere Bezugspersonen und die Schule 168
Die Rolle von Grosseltern, Gotte und Götti 169
Was können Grosseltern und andere Bezugspersonen beitragen? 169
Schule, Freunde und Hobbys 171
Neue Partnerin, neuer Partner 173
Die Stief- oder Patchworkfamilie 173
Aufgaben in der Patchworkfamilie 175
Die Rolle des Stiefvaters 177
Die Rolle der Stiefmutter 179
Stiefkinder adoptieren 183
Die Perspektive der Kinder 183
Die Regenbogenfamilie 186
So gelingen neue Partnerschaften mit Kindern 187
In Kürze «Die Rolle des Umfelds» 189
Anhang 191
Nützliche Links und Adressen 192
Literatur 197
Vorwort
«Sorgerecht» – die komplett überarbeitete, dritte Auflage des Beobachter-Ratgebers – wendet sich an Eltern, die in der schwierigen Übergangsphase einer Trennung Unterstützung und Orientierung suchen. Er ist aber genauso lesenswert für alle, die beruflich oder privat mit Familien zu tun haben, die sich in Trennung oder Scheidung befinden.
Es gelingt dem Autor in besonderer Weise, die komplexen psychologischen Hintergründe einer Trennung und die damit verbundenen Herausforderungen auf verständliche Art darzustellen. Er verliert dabei nie die Hauptprotagonisten, nämlich die Eltern und die Kinder, aus dem Blick. Auch liefert er, gut dosiert, die rechtlichen Rahmenbedingungen, macht juristische Begriffe verständlich und zeigt ihr Zusammenspiel mit den psychologischen Gegebenheiten. So entsteht ein ganzheitliches Bild, das ähnlich einem Kompass Orientierung im Trennungsgeschehen vermittelt.
Der Autor hält ein Plädoyer für eine komplementäre Kinderbetreuung und eine gemeinsam getragene elterliche Verantwortung vor und nach einer Trennung und spricht so den Kindern aus dem Herzen. Mit der Darstellung möglicher Betreuungsmodelle für Kinder unterschiedlichen Alters gibt er den Eltern Hinweise für ihre eigene Regelung.
Auseinandersetzungen sind ein Bestandteil vieler Trennungen und Scheidungen – der Autor appelliert in empathischer und zugleich aufrüttelnder Art an die Eltern, ihre Konflikte im Interesse der Kinder einvernehmlich zu lösen. Er zeigt auf, wie sie die Kinder und deren Wünsche bei der Lösungsfindung einbeziehen können und sollen. Auch die Situation der Stief- oder Patchworkfamilien wird einfühlsam dargelegt – mit allen Chancen und Herausforderungen für die Beteiligten.
Das Buch macht Eltern Mut und gibt ihnen praktische Hilfen, damit sie ihre Kinder in dieser Übergangszeit so gut wie möglich unterstützen können, ohne die eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Viele Familien werden darin wertvolle Unterstützung für ihre erfolgreiche Bewältigung der Entwicklungsaufgaben rund um eine Trennung oder Scheidung finden.
Dr. phil. Dipl. Psychologe Joachim Schreiner
Psychologischer Klinikleiter der UPK Basel,
Fachstelle Familienrecht
April 2024
Gemeinsam Eltern sein – darauf kommt es an
Kinder haben ein Recht auf beide Eltern. Seit dem 1. Juli 2014 ist dieses Recht mit der gemeinsamen elterlichen Sorge auch gesetzlich festgehalten. Sie als Eltern können sich also trennen oder scheiden lassen, doch Sie bleiben weiterhin gemeinsam für Ihre Kinder verantwortlich.
Nur in eng begrenzten Ausnahmefällen wird das Sorgerecht einem Elternteil allein zugeteilt, die gemeinsame elterliche Sorge ist die Regel. Diese Rechtsprechung ist ein Signal dafür, dass die Verantwortung für ein Kind etwas Wertvolles und Dauerhaftes ist – ein Recht und eine Verpflichtung, die uns Eltern nicht nur zugemutet, sondern auch zugetraut werden.
Das ist vielversprechend – birgt aber auch Konfliktpotenzial. Damit die Rechtsprechung im Alltag umgesetzt werden kann, braucht es Kompromissbereitschaft und Vernunft. Denn eines gilt nach wie vor: Die elterliche Sorge dient in allererster Linie dem Wohl Ihrer Kinder.
Die gemeinsame elterliche Sorge ist seit dem 1. Juli 2014 als Regel gesetzlich festgehalten.
Modernes Gesetz zum Wohl der Kinder
Das aktuelle Gesetz holt nach, was sich in der Schweiz und in vielen europäischen Ländern seit Jahren abgezeichnet hat: die stärkere Fokussierung auf das Wohl des Kindes und den Trend zur Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Gleichzeitig zeigt sich aber im Alltag, dass die gemeinsame elterliche Sorge die traditionelle Rollenverteilung zwischen Vater und Mutter, die meist schon während der Ehe gelebt wird, nicht aufbricht. Dabei spielen zum einen hartnäckig verankerte Denkmuster eine Rolle, zum Beispiel: «Mit einem 100-Prozent-Arbeitspensum bin ich ein ganzer Mann, mit 50 Prozent eine halbe Portion.» Zum andern kommen finanzielle Zwänge hinzu: Viele Paare entscheiden sich letztlich für eine traditionelle Rollenverteilung, weil der Mann mehr verdient als die Frau.
HINWEIS | Gesellschaftliche Forderung Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – das wäre eine wichtige Voraussetzung für ein funktionierendes gemeinsames Sorgerecht.
Sich verantwortungsvoll um den Nachwuchs zu kümmern, ist für Eltern eine der sinnstiftendsten und tiefgründigsten Aufgaben, aber auch eine der anstrengendsten. Sie durchdringt uns, lässt uns über uns selbst hinauswachsen, kann unsere Welt aber auch manchmal ins Wanken bringen. Gemeinsam sind wir als Sorgeberechtigte für unsere Kinder liebevoller Begleiter, verantwortliche Beschützerin, wohlwollender Förderer, gesetzliche Vertreterin – Eltern eben.
Der Einfluss der Rollenverteilung
Wie Sie Ihre Kinder umsorgen und erziehen, bleibt Ihnen überlassen. Auch wie Sie als Frau und Mann Ihre Rollen als Eltern definieren und aufteilen, ist Ihre Sache. Das gemeinsame Sorgerecht kommt in der öffentlichen Diskussion vor allem im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung vor. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille.
HINWEIS | Gemeinsame Sorge von Anfang an Die gemeinsame elterliche Sorge beginnt mit der Geburt Ihrer Tochter, Ihres Sohnes – nicht erst, wenn Sie als Eltern auseinandergehen.
Wenn Sie als Eltern nicht schon während Ihres Zusammenlebens die Kinder gemeinsam umsorgen, dann wird es nach einer konfliktreichen Trennung nicht einfacher. Betrachten Sie diesen Ratgeber daher nicht nur unter dem Blickwinkel von Trennung und Scheidung. Leben Sie den Gedanken der gemeinsamen elterlichen Verantwortung ab der Geburt Ihrer Kinder. Es geht um die innere Haltung von Ihnen beiden, dass Sie in gegenseitigem Respekt die Verantwortung für Ihre Kinder gemeinsam tragen. Dadurch können Sie sich gegenseitig entlasten, die Entwicklung Ihrer Kinder fördern – und nicht zuletzt schwierigen Situationen vorbeugen, sollte es zu einer Trennung oder Scheidung kommen.
Fair streiten, den Kindern zuliebe
Gestritten wird nicht weniger – trotz gemeinsamer elterlicher Sorge. Für die Entwicklung Ihres Kindes ist nicht die Trennung oder die Scheidung per se belastend, es ist das Konfliktniveau zwischen Ihnen als Eltern während des Auseinandergehens und danach.
HINWEIS | Möglichst kein Elternstreit Eine konflikt-arme Beziehung zwischen den Eltern – so eine wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis – ist ein Schutzfaktor für die gesunde Entwicklung eines Kindes nach einer Trennung oder Scheidung.
Doch nur zu oft arten Trennungen und Scheidungen in regelrechte «Kleinkriege» um die Kinder aus. Mit dem gemeinsamen Sorgerecht sind nicht nur Sie als Mutter oder Vater aufgefordert, im Streit nach konstruktiven Lösungen zu suchen, sondern genauso ein neuer Partner sowie eine Anwältin und die ganze «Streitbewirtschaftungsindustrie», die sich in das Hickhack hineinziehen lässt und dabei oft viel Geld verdient.
TIPP | Das Kind ins Zentrum stellen Versetzen Sie sich immer wieder in die Lebenswelt Ihrer Tochter, Ihres Sohnes. Stellen Sie trotz der eigenen Wut und der Verletzungen die Bedürfnisse und Interessen der Kinder in den Mittelpunkt Ihrer Überlegungen und Ihres Handelns – auch wenn dies allenfalls bedeutet, dass Sie die eigenen Bedürfnisse und Emotionen zurückstellen müssen.
Kinder brauchen psychisch stabile Eltern. Sie schaden Ihrem Kind, wenn Sie den anderen Elternteil abwerten, bekämpfen und unter Druck setzen. Dann geht es nicht ums Kindeswohl, sondern um Ihr eigenes Bedürfnis, Ihre eigene Wut (mehr zum Thema Streitkultur lesen Sie auf Seite 147).
Eine lohnende Herausforderung
Die elterliche Sorge dient vorrangig dem Wohl des Kindes. Damit sie gelingt, sind Kompromissbereitschaft und Vernunft notwendig. In diesem Ratgeber finden Sie zahlreiche Informationen, Tipps und Beispiele, die Ihnen helfen sollen, die gemeinsame elterliche Sorge in Ihrem Alltag so zu leben, dass es Ihnen und Ihren Kindern gut geht. Beherzigen Sie davon, so viel Sie können – für Ihre eigene Familie sowie für nachfolgende Generationen.
Es wäre naiv zu denken, dass der für die gemeinsame elterliche Sorge so wichtige gesellschaftliche Gesinnungswandel über Nacht passiert. Er ist eingebettet in die laufende, übergeordnete Genderdiskussion, in der wir unsere Geschlechterrollen überdenken und neu definieren dürfen. Dabei müssen wir stets das Wohl unserer Kinder im Fokus behalten. Das ist eine Herausforderung, keine Frage. Doch: «Nicht weil die Dinge so schwierig sind, wagen wir sie nicht, sondern weil wir sie nicht wagen, sind sie so schwierig.» (Seneca, römischer Philosoph, 4 v. Chr. bis 65 n. Chr.)
Die gemeinsame elterliche Sorge ist eine Herausforderung, die anzupacken sich lohnt.
Sorgerecht, Obhut, Kontakt – der rechtliche Rahmen
Elterliche Sorge, Obhut, Aufenthaltsbestimmungsrecht, Wohnsitz, Betreuung und Kontaktrecht. Fällt es auch Ihnen bisweilen schwer, im Dschungel dieser Begriffe den Überblick zu behalten? Dann werden Ihnen die folgenden Definitionen weiterhelfen.
Die Meinung ist nicht, dass Sie die Fragen rund um Ihre Kinder mit dem Gesetzbuch in der Hand regeln. Aber ein Grundwissen hilft Ihnen, eine Lösung zu finden, die standhält.
Wer hat die elterliche Sorge?
Die elterliche Sorge wird umgangssprachlich auch als Sorgerecht bezeichnet. Der Begriff steht für die Pflege, die Erziehung und die gesetzliche Vertretung des Kindes. Auch das Bestimmen über seinen Aufenthaltsort, seine religiöse Erziehung und die Verwaltung seines Vermögens gehören dazu. Hier einige Themen der elterlichen Sorge:
Welchen Kindergarten, welche Schule besucht unser Kind?
Soll es Nachhilfe- oder Stützunterricht bekommen?
Welche religiöse Erziehung soll es erhalten?
Wie ist der Sohn medizinisch zu behandeln? Soll die Tochter geimpft werden?
Darf die Tochter mit der Freundin in die Sportferien?
Darf der Sohn ein Auslandssemester absolvieren?
Welche berufliche Ausbildung können wir unserem Kind ermöglichen?
Wie verwalten wir das Geld unseres Kindes? Was darf es selbst entscheiden?
Wollen wir für unser Kind einen Pass beantragen?
HINWEIS | Aufenthaltsort Das gemeinsame Sorgerecht beinhaltet auch das Recht, den Aufenthaltsort der Kinder zu bestimmen (mehr dazu auf Seite 27).
Die Handhabung und Zuteilung des Sorgerechts hängt davon ab, ob Sie als Eltern miteinander verheiratet sind oder nicht.
Miteinander verheiratete Eltern
Sind Sie als Eltern verheiratet, steht Ihnen die elterliche Sorge gemeinsam zu. Kommt es später zu einer richterlichen Trennung oder einer Scheidung, belässt das Gericht die elterliche Sorge in der Regel bei Ihnen beiden. Falls es zum Schutz des Kindes notwendig ist, kann die elterliche Sorge ausnahmsweise auch nur einem Elternteil zugeteilt werden (siehe Seite 25).
Sollten sich die Verhältnisse zu einem späteren Zeitpunkt ändern, kann der Vater oder die Mutter eine Änderung des Urteils beantragen. Sind sich dann beide Eltern über die neue Regelung einig, ist die Kesb dafür zuständig. Sind sich die Eltern nicht einig, entscheidet das Zivilgericht.
Nicht miteinander verheiratete Eltern
Sind Sie als Eltern nicht miteinander verheiratet, steht das Sorgerecht vorerst der Mutter allein zu (Art. 298a Abs. 5 ZGB). Gleichzeitig mit der Vaterschaftserklärung können Sie aber beim Zivilstandsamt erklären, dass Sie gemeinsam die elterliche Sorge für Ihr Kind haben wollen. Wenn Sie die gemeinsame Erklärung zu einem späteren Zeitpunkt einreichen – zum Beispiel erst, wenn Sie sich trennen –, ist dafür die Kesb am Wohnsitz des Kindes zuständig.
Mit Ihrer Erklärung bestätigen Sie, dass Sie gemeinsam die Verantwortung für Ihr Kind übernehmen und sich über die folgenden Fragen geeinigt haben:
Aufenthaltsort
Obhut und Betreuungsverantwortung
Betreuungsanteile
Persönlicher Verkehr / Besuchsrecht
Unterhaltsbeitrag für das Kind
TIPP | Schriftlich festhalten Es ist von Vorteil, wenn Sie Ihre Abmachungen schriftlich festlegen. Die Vereinbarung über den Unterhalt des Kindes muss von der Kesb genehmigt werden, sonst ist der Unterhalt nicht einklagbar. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich beim Sozialdienst oder bei der Kesb beraten lassen.
Weigert sich die Mutter, die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, kann der Vater die Kesb am Wohnsitz des Kindes anrufen. Die Behörde verfügt die gemeinsame elterliche Sorge – ausser es sei zur Wahrung des Kindeswohls nötig, an der alleinigen elterlichen Sorge der Mutter festzuhalten oder die elterliche Sorge allein dem Vater zu übertragen.
Gemeinsame elterliche Sorge – der Normalfall
«Die Kinder stehen, solange sie minderjährig sind, unter der gemeinsamen elterlichen Sorge von Vater und Mutter.» So der Grundsatz von Artikel 296 ZGB. Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes und soll nur in Ausnahmefällen einem Elternteil allein zugeteilt werden.
Damit die gemeinsame elterliche Sorge auch nach einer Trennung im Alltag gelingt, müssen folgende Punkte gewährleistet sein:
Verlässliche Regelung der Kinderbetreuung (siehe Seite 68 und 77) oder des Kontaktrechts (siehe Seite 87)
Einbinden der Kinder in die Entscheidungen, natürlich ihrem Alter entsprechend
Möglichkeit für die Kinder, frei und unbeschwert von Erlebnissen beim und mit dem anderen Elternteil erzählen zu dürfen
Gegenseitige Information der Eltern über wichtige Belange
Wahrnehmen der Erziehungsverantwortung auch durch den getrennt lebenden Elternteil
Was heisst Ausnahmefall?
Ein Ausnahmefall liegt dann vor, wenn das Kindeswohl verlangt, dass die elterliche Sorge einem Elternteil allein zugeteilt wird (Art. 298 Abs. 1 ZGB). Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn der andere Elternteil gewalttätig, psychisch krank oder schwer drogenabhängig ist – wenn er also ausserstande ist, die elterliche Sorge verantwortungsvoll auszuüben.
Auch verheirateten Eltern kann aus solchen Gründen die elterliche Sorge entzogen werden (Art. 311 ZGB). Dies passiert aber ausgesprochen selten. Denn vorher gibt es verschiedene mildere Kindesschutzmassnahmen, die ergriffen werden können (siehe Seite 40).
HINWEIS | Zuständige Stelle Ob genügend schwerwiegende Gründe für den Entzug der elterlichen Sorge bestehen, entscheidet bei einer Scheidung das Gericht und im Fall von unverheirateten Eltern die Kesb.
Und wie sieht es bei Eltern aus, die nach einer Trennung oder Scheidung endlos miteinander streiten? Dazu entschied das Bundesgericht Ende August 2015: «Auch ein schwerwiegender elterlicher Dauerkonflikt oder die anhaltende Kommunikationsunfähigkeit können eine Alleinzuteilung des Sorgerechts gebieten, wenn sich der Mangel negativ auf das Kindeswohl auswirkt und von einer Alleinzuteilung eine Verbesserung erwartet werden kann.» Erforderlich sei aber in jedem Fall, dass der Konflikt oder die gestörte Kommunikation erheblich sei und andauere. Bestehe ein schwerwiegender Konflikt nur zu einem Thema, etwa zur religiösen Erziehung oder in schulischen Fragen, müsse geprüft werden, ob es nicht genüge, die Entscheidungsbefugnis nur in diesem Bereich einem Elternteil zuzuweisen. Die Alleinzuteilung des elterlichen Sorgerechts müsse eine eng begrenzte Ausnahme bleiben (BGE 141 III 472).
Obhut – das Kind bei sich haben
Die elterliche Obhut ist die Befugnis, zusammen mit dem Kind in einer häuslichen Gemeinschaft zu leben und sich um seine alltäglichen Belange zu kümmern.
Wohnt das Kind ganz oder überwiegend bei einem Elternteil, hat dieser die alleinige Obhut.
Wenn das Kind mehr oder weniger gleich häufig bei Vater und Mutter wohnt, spricht man von alternierender oder geteilter Obhut. In diesem Fall müssen die Eltern festlegen, welches der Wohnsitz des Kindes ist und wie sie die Betreuung konkret ausgestalten wollen (siehe Seite 68).
Abgesehen vom Festlegen des Wohnsitzes bedeutet «elterliche Obhut» faktisch nichts anderes als Betreuungsverantwortung.
Die Begriffe «Obhut» und «elterliche Sorge» sind nicht miteinander zu verwechseln. Auch wenn die Mutter oder der Vater die Obhut allein innehat, können Sie als Eltern das Sorgerecht miteinander ausüben. Das heisst, dass Sie wichtige Entscheidungen für Ihr Kind auch dann gemeinsam treffen, wenn es ganz oder überwiegend bei einem von Ihnen wohnt. Bei alltäglichen Angelegenheiten hingegen (Ernährung, Kleidung, Freizeitgestaltung etc.) kann derjenige Elternteil, bei dem sich das Kind gerade aufhält, allein entscheiden.
Elterliche Sorge und Obhut
Aufenthaltsbestimmungsrecht und Wohnsitz
Die elterliche Sorge schliesst das Recht mit ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Wenn Sie als Eltern sich nicht einigen können, bei wem die Kinder wohnen sollen, wird die Kesb oder das Gericht die Obhut einem von Ihnen zuteilen.
Und wo hat Ihr Kind seinen Wohnsitz?
Leben Sie als Eltern zusammen, ist alles klar: Der Wohnsitz des Kindes ist bei Ihnen beiden.
Ebenso klar ist die Situation, wenn die elterliche Sorge ausnahmsweise einem Elternteil allein zugesprochen wurde. Der Wohnsitz des Kindes ist bei ihm.
Wenn Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht nicht zusammenwohnen, haben die Kinder ihren gesetzlichen Wohnsitz bei demjenigen Elternteil, der sie mehrheitlich betreut.
Auch bei alternierender Obhut darf das Kind nur einen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 2 ZGB) – einerseits wegen des Schulorts, andererseits aus steuerrechtlichen Gründen (welcher Elternteil darf die Alimente abziehen?) und wegen der Zuständigkeit der Behörden (welches Sozial- oder Jugendamt ist für das Kind zuständig?). Die Eltern müssen entscheiden, welches dieser offizielle Wohnsitz des Kindes ist.