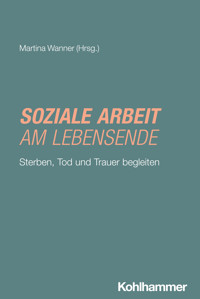
Soziale Arbeit am Lebensende E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Sterben und Tod gehören zu den Erfahrungstatsachen, mit denen Soziale Arbeit stets konfrontiert ist. Neben anderen Professionellen beispielsweise in der Medizin, der Pflege oder der Seelsorge können Sozialarbeitende in Situationen am Lebensende wichtige Ansprechpersonen sein, indem sie Betroffene und Angehörige unterstützen, beraten und begleiten. Fachlich fundiert und fallorientiert verknüpft das Buch die Thematik mit einschlägigen Konzepten der Sozialen Arbeit und geht auf deren Arbeitsfelder und Zielgruppen ein. Zudem werden rechtliche ebenso wie ethische Aspekte beleuchtet und methodische Ansätze für sozialarbeiterisches Handeln vorgestellt. Auf diese Weise wird es Fachkräften ermöglicht, einen professionellen Umgang mit Sterben, Tod und Trauer zu finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort zur Reihe
Zu diesem Buch
1 Einleitung
1.1 Mitten im Leben – Sterben, Tod und Trauer
1.2 Mitten im Leben – Soziale Arbeit in der Konfrontation mit Sterben, Tod und Trauer
2 Gezähmter Tod und selbstbestimmtes Sterben – der Umgang mit dem Lebensende im Wandel der Zeit
3 Der sozialarbeiterische Blick auf Sterben, Tod und Trauer: Lebensweltorientierung und Lebensbewältigung
3.1 Sozialarbeiterische Fallarbeit
3.2 Lebensweltorientierung und Lebensbewältigung
3.3 Erste Bezugnahme: Lebensweltorientierung
3.3.1 Grundlagen
3.3.2 Der gelingendere Alltag
3.4 Zweite Bezugnahme: Lebensbewältigung
3.4.1 Grundlagen
3.4.2 Soziale Arbeit und Lebensbewältigung
4 Soziale Arbeit in der Konfrontation mit Sterben, Tod und Trauer
4.1 Die Umsetzung des sozialarbeiterischen Blicks: Sozialarbeiterisches Handeln
4.2 Nähe und Distanz in der Sozialen Arbeit
4.3 Die Bedeutung von Selbstreflexion
5 Sterben, Tod und Trauer in ausgewählten Kontexten Sozialer Arbeit
5.1 Verlust und Trauer in den Hilfen zur Erziehung
5.1.1 Bewältigung der Trauer
5.1.2 Verlustsensible Handlungsoptionen in den Hilfen zur Erziehung
5.1.3 Ausblick
5.2 Sterben, Tod und Trauer – Überlegungen zum Gemeinwesen und zur Gemeinwesenarbeit
5.2.1 Kontextbestimmung Gemeinschaften und Gemeinwesen
5.2.2 Das Gemeinwesen als Ressource im Fall von Familie Weber
5.2.3 Resümee
5.3 Sozialarbeiterische Beratung im Kontext von Sterben, Tod und Trauer
5.4 Sterben, Tod und Trauer in der Sozialpsychiatrie
5.4.1 Suizidalität und Suizide
5.4.2 Tötungen bei verminderter Schuldfähigkeit – Maßregelvollzug und forensische Nachsorge
5.4.3 »Normale« Sterbefälle
5.4.4 Das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten
5.4.5 Herausforderungen für die sozialpsychiatrische Arbeit
5.4.6 Schlussbemerkung
5.5 Sterben, Tod und Trauer in der Wohnungsnotfallhilfe
Schlussbemerkung
5.6 Lebensweltorientierung und Lebensbewältigung in der ambulanten und stationären Hospizarbeit
5.6.1 Kerngedanken der Lebensweltorientierung und -bewältigung für weitere Überlegungen in Hospizarbeit und Palliative Care
5.6.2 Lebensweltorientierung und Lebensbewältigung in Hospizarbeit und Palliative Care
5.6.3 Rahmenaspekte in Hospizarbeit und Palliative Care zur Verwirklichung von Konzepten der Sozialen Arbeit
5.6.4 Fazit
5.7 Palliative Care in stationären Altenhilfeeinrichtungen – Perspektiverweiterung durch die Profession der Sozialen Arbeit
5.8 Exkurs Suizid
6 Die Bedeutsamkeit ethischer Reflexion und ethisch gut begründeter Entscheidungen in der Palliative-Care-Begleitung
6.1 Die Bedeutsamkeit mehrerer Perspektiven und der interprofessionellen Zusammenarbeit im Kontext ethisch komplexer Fragestellungen
6.2 Die Bedeutsamkeit ethischer Reflexion und ethisch begründeter Entscheidungsfindung im Kontext ethisch komplexer Fragestellungen
7 Rechtliche Grundlagen der Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Sterbehilfe
7.1 Einwilligungsfähigkeit
7.2 Der zur Entscheidung Berechtigte
7.2.1 Ehegattenvertretungsrecht, § 1358 BGB
7.2.2 Vorsorgevollmacht
7.2.3 Genehmigungserfordernisse
7.3 Patientenverfügung
7.3.1 Definition
7.3.2 Form
7.3.3 Bindungswirkung
7.3.4 Genehmigungserfordernisse
7.3.5 Verbote
7.3.6 Widerruf
7.4 Sterbehilfe
7.4.1 Definitionen
7.4.2 Direkte aktive Sterbehilfe
7.4.3 Indirekte Sterbehilfe
7.4.4 Passive Sterbehilfe
7.4.5 Beihilfe zum Suizid
8 Trauer
8.1 Trauer als Verlusterfahrung
8.2 Erklärungsmodelle für Trauer
8.3 Ist Trauer eine Krankheit?
8.4 Exkurs: Kinder und Trauer
8.5 Soziale Arbeit in der Trauerbegleitung
9 Das Problem der Vertröstung – Eine Skizze zur Kritik normativer Selbstbestimmungsversuche Sozialer Arbeit
9.1 Der Sozialstaat als normativer Bezugspunkt Sozialer Arbeit
9.2 Trost ...
9.3 ... oder Vertröstung?
9.4 Schluss
10 Über Sterben, Tod und Trauer hinaus – Denkanstöße für die Soziale Arbeit
Autor:innen
Grundwissen Soziale Arbeit
Begründet von Rudolf Bieker
Herausgegeben von Michael Domes
Das gesamte Grundwissen der Sozialen Arbeit in einer Reihe: theoretisch fundiert, immer mit Blick auf die Arbeitspraxis, verständlich dargestellt und lernfreundlich gestaltet – für mehr Wissen im Studium und mehr Können im Beruf.
Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Bände der Reihe finden Sie unter:
https://shop.kohlhammer.de/grundwissen-soziale-arbeit
Die Herausgeberin
Martina Wanner ist Diplom-Pädagogin und Professorin für Methoden und Arbeitsformen Sozialer Arbeit an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Sie leitet den Studiengang »Soziale Arbeit im Gesundheitswesen«. Ihre Forschungsschwerpunkte sind: Soziale Arbeit und Gesundheit; Sterben, Tod und Trauer; Alter, Altern, Pflegebedürftigkeit; Ethik und Soziale Arbeit.
Martina Wanner (Hrsg.)
Soziale Arbeit am Lebensende
Sterben, Tod und Trauer begleiten
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-037246-7
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-037247-4epub: ISBN 978-3-17-037248-1
Vorwort zur Reihe
Liebe Leser:innen,
die Idee zu der Reihe Grundwissen Soziale Arbeit, als deren Herausgeber ich ab dem 51. Band, in der Nachfolge von Prof. Dr. Rudolf Bieker, fungiere, ist vor dem Hintergrund der bildungspolitisch veränderten Rahmenbedingungen im Zuge der Bologna-Reform entstanden.
Band 1 »Soziale Arbeit studieren« bildete den Auftakt, der nach und nach erscheinenden Bände, deren Gemeinsamkeit ist, das für Sozialarbeiter:innen und Sozialpädagog:innen bedeutsame Grundwissen sukzessive abzubilden. Dabei ist dreierlei zu beachten:
Grundwissen meint mehr als »reine Theorie«. Es umfasst, unabhängig vom je spezifischen Gegenstand, neben Wissen auch immer Aspekte des Könnens und der Haltung als Bestandteile sozialarbeiterischer/sozialpädagogischer Professionalität.
Grundwissen hat eine gewisse zeitlose Komponente. Grundwissen ist zugleich aber nicht etwas Statisches, das ein für alle Mal festgelegt ist. Das Grundwissen Sozialer Arbeit verändert sich in Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, politischen oder wissenschaftlichen Entwicklungen bzw. Rahmenbedingungen, so wie sich auch die professionelle Praxis Sozialer Arbeit verändert.
Grundwissen bietet für die Leser:innen eine Orientierung. Es dient als Navigationsinstrument für Soziale Arbeit, die, wie der Vorstand der DGSA 2024 festgehalten hat, wahrlich »ein komplexes Themenfeld« ist. Und wie bei einem solchen Gerät üblich: Es gibt immer mehrere Wege, ans Ziel zu kommen. Blind zu folgen bzw. zu vertrauen, ist nur bedingt eine hilfreiche Strategie. Das Navi ist eine – (ge-)wichtige – Komponente, die aber nur im Zusammenspiel mit dem eigenen Denken (der Fachkraft) und dem Kontext (Gesellschaft und Adressat:innen) ihre Wirkung entfalten kann.
Die Bände der Reihe zeichnen sich durch ihre Lesefreundlichkeit, auch für das Selbststudium Studierender, besonders aus – oder, wie es der verstorbene C. W. Müller in einem Interview auf die Frage nach Kritik an seiner fachlichen Positionierung auf den Punkt gebracht hat: »Ich will auch allgemein gut verständlich sein und bleiben. Das ist kein Widerspruch zur Wissenschaftlichkeit.« Die Autor:innen verpflichten sich diesem übergeordneten Ziel auf unterschiedliche Weise: eine Begrenzung der Stoffmenge auf einen überschaubaren Umfang, Verständlichkeit der Sprache, Theorie-Praxis-Bezüge, (weiterführende) Literaturhinweise und Anschaulichkeit durch Gestaltungselemente, wie Graphiken, Hervorhebungen oder Schaukästen. Jeder Band bietet in sich abgeschlossen eine grundlegende Einführung in das jeweilige Themenfeld.
Im Fokus steht dabei immer, welche professionellen (Handlungs-)Kompetenzen ausgebildet werden können bzw. welche Bedeutung das jeweilige Thema/Themenfeld für die professionelle Praxis Sozialer Arbeit hat.
Die Bände verstehen sich als Einladung, sich auf (neues) wissenschaftliches Wissen einzulassen und die Themen kritisch weiterzudenken, um so auf dem Weg der eigenen Professionalitätsentwicklung weitere Schritte zu gehen. Oder wie es Alice Salomon schon 1932 formuliert hat: »Wir lernen ja nicht da, wo wir feststellen, daß der andere alles ebenso macht wie wir, sondern wir lernen, wenn er es anders macht. Denn das allein führt uns zur Selbstbesinnung, zur Selbstkritik und daraus erwächst lebendiges Leben, lebendiger Geist, lebendige Formkraft«.
Prof. Dr. Michael Domes, Nürnberg
Zu diesem Buch
Sterben, Tod und Trauer sind Phänomene, mit denen sich viele Menschen nicht gerne beschäftigen. Sie zählen zu den dunklen Seiten des Lebens und führen zu nachhaltigen Erschütterungen. Sie durchwirken Alltag und Lebenswelt und stellen hohe Anforderungen an die Lebensbewältigung – in manchen Fällen können sie zur »Grenzsituation par excellence« (Streckeisen 1994, 232) werden.
In einer solchen Situation sind Menschen häufig auf Hilfe angewiesen. Diese Hilfe kann ihnen auch Soziale Arbeit bieten, indem sie zur (Wieder-)Herstellung abhanden gekommener Handlungsfähigkeit beiträgt und den Alltag und die Lebenswelt stabilisiert. Und so sind Professionelle der Sozialen Arbeit selbst auch immer wieder mit Sterben, Tod und Trauer konfrontiert – und dies längst nicht nur in Handlungsfeldern, die gemeinhin eine größere Nähe dazu aufzuweisen scheinen, wie Krankenhäuser, Altenhilfeeinrichtungen oder Hospize. Auch sozialarbeiterische Bereiche, die scheinbar wenig damit zu tun haben, sind betroffen.
Um Professionelle im Umgang mit der Thematik zu unterstützen, sollen die Themen Sterben, Tod und Trauer im vorliegenden Lehrbuch mit einem dezidiert »sozialarbeiterischen Blick« betrachtet werden. Hierfür werden die Konzepte der Lebensweltorientierung und der Lebensbewältigung, die stark mit den Arbeiten von Hans Thiersch und Lothar Böhnisch verknüpft sind, auf die Thematik bezogen. Verschiedene Arbeitsfelder Sozialer Arbeit werden explizit herausgegriffen und dargestellt. Auch weitere Themen wie Trauer oder rechtliche Grundlagen werden aus diesem Blickwinkel heraus diskutiert. Um besser zu veranschaulichen, was es für Menschen bedeutet, mit Sterben, Tod und Trauer konfrontiert zu sein, wird im Buch eine fallorientierte Perspektive eingenommen. An verschiedenen Stellen werden Fälle aufgegriffen und dargestellt. Einerseits soll somit die Lebenswirklichkeit von Menschen einbezogen werden. Andererseits weist die Fallorientierung über den einzelnen Fall hinaus, weil beispielhaft allgemeine Kenntnisse und Wissen vermittelt werden. Ziel dieses Lehrbuchs ist es, Anregungen und Orientierung für das sozialarbeiterische Handeln in diesem Feld zu geben.
Damit kann der Thematik die dunkle Seite nicht genommen werden. Aber es ist möglich, diese dunkle Seite ein wenig auszuleuchten.
Mein Dank gilt dem Begründer der Reihe, Herrn Rudolf Bieker, der das Buchprojekt jederzeit voller Wohlwollen und mit viel Geduld begleitet hat. Auch Ulrike Stöhrer und Annika Färber möchte ich besonders erwähnen. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei den Autorinnen und Autoren, die an diesem Buch mitgewirkt haben und bereit waren, sich auf die besonderen Anforderungen einzulassen. Und zuletzt möchte ich mich bei Hans Thiersch für seine beständige Unterstützung bedanken und dafür, dass er mir immer als Diskussionspartner zur Seite stand. Mit wem könnte man über diese so existenzielle Thematik besser nachsinnen? So mancher Gedanke und so manche Idee entwickelten sich in unserem Austausch.
Tübingen, im Januar 2025
Martina Wanner
1 Einleitung
Martina Wanner
T Das erwartet Sie in diesem Kapitel
Auch wenn Sterben, Tod und Trauer zum Leben gehören, so fällt der Umgang mit dieser Thematik nicht leicht. Im folgenden Kapitel zeigt sich, wie grundlegend Sterben, Tod und Trauer unser Leben und unseren Alltag durchwirken und erschüttern können (▸ Kap. 1.1). Soziale Arbeit, die Menschen in dieser schwierigen Situation unterstützen möchte, muss einen »sozialarbeiterischen Blickwinkel« einnehmen. Ein solcher Blickwinkel wurde in der bisherigen fachlichen Diskussion nur ungenügend herausgearbeitet (▸ Kap. 1.2).
1.1 Mitten im Leben – Sterben, Tod und Trauer
Rainer Maria Rilke hat das Gedicht »Schluszstück« verfasst, das weithin bekannt ist. Es gilt als Sinnspruch, als Aphorismus und findet sich in vielen Sammlungen, auf die Menschen zurückgreifen, die bei Trauerfällen auf der Suche nach tröstenden Worten sind, mithilfe derer man Anteilnahme formulieren kann.
Der Tod ist groß.Wir sind die Seinenlachenden Munds.Wenn wir uns mitten im Leben meinen,wagt er zu weinenmitten in uns.(Rilke 2006, 357)
Doch werfen wir einen genaueren Blick auf Rilkes Worte. Spenden sie tatsächlich Trost? In erster Linie richtet sich Rilke an die Lebenden. Genauer gesagt besonders an diejenigen, die sich »lachenden Munds« »mitten im Leben« wähnen und dabei die Größe des Todes vergessen. Dabei ist dieser Tod mitten unter uns. Er erschüttert uns nachhaltig, er wagt »zu weinen mitten in uns«. Jeder und jede kennt eine Geschichte wie die folgende.
Eine persönliche Geschichte
Es war ein grauer Herbsttag um die Mittagszeit, die Vorlesung hatte ich soeben beendet. Da kam ein junger Student auf mich zu, der gerade erst sein Studium an der Hochschule begonnen hatte. Er fragte mich, ob ich einen Moment Zeit hätte, er müsse mir als seiner zuständigen Studiengangsleiterin etwas mitteilen. Ich nickte und so begann er zu berichten, er habe ein Rezidiv. Schon vor drei Jahren sei er an Leukämie erkrankt. Damals habe er sich sehr lange in Behandlung befunden. Neben anderen Therapien, die er erhalten habe, seien ihm auch die Stammzellen eines Familienmitglieds transplantiert worden. Nun aber sei der Krebs zurückgekehrt, diese Nachricht habe er vor wenigen Tagen erhalten. Innerlich zuckte ich zusammen, hoffte aber, dass mir äußerlich nichts anzumerken war. Rezidiv. Mir war bewusst, was diese Nachricht im Zusammenhang mit einer Leukämieerkrankung bedeutet, schließlich war ich selbst fast zehn Jahre lang beruflich für eine gemeinnützige Organisation tätig gewesen, die Freiwillige vermittelt, die bereit sind, Stammzellen für eine erkrankte Person zu spenden. In dieser Zeit musste ich immer wieder miterleben, wie vermeintlich geheilte Personen berichteten, sie hätten ein Rezidiv. Nicht immer, aber oft gab es keinen glücklichen Ausgang.
Dies behielt ich für mich. Ich sprach dem Studenten Mut zu und versicherte ihm meine Unterstützung hinsichtlich der Organisation seines Studiums. Die Behandlung, die ihm bevorstand, so viel wurde deutlich, sollte lang und kräftezehrend werden.
Die folgende Zeit war geprägt vom ständigen Auf und Ab. Gute und schlechte Nachrichten wechselten sich ab; im Laufe der Zeit gewannen die schlechten Nachrichten die Oberhand. Der junge Student kämpfte sich zunächst tapfer durch seine Therapie. Mich beeindruckten sein Lebenswille und sein Kämpfergeist. Trotz der ungemeinen Belastungen kam es für ihn nie in Frage, sein Studium auszusetzen oder gar zu beenden. Dieses war ihm ausgesprochen wichtig, er wollte Sozialarbeiter werden, dafür hatte er sich nach seiner letzten Erkrankung bewusst entschieden. Die Termine für seine Behandlungen legte er in die Abendstunden, um tagsüber an der Hochschule sein zu können. Nur wenn ihn alles zu sehr beutelte, blieb er zu Hause. Mit vielen Studieninhalten setzte er sich aktiv auseinander. Selten kam es vor, dass er sich nicht an Vorlesungen und Seminaren beteiligte. Gerade für die Schwierigkeiten und Herausforderungen, mit den Menschen konfrontiert sind, erwies er eine feine Wahrnehmung. Ungerechtigkeiten ärgerten ihn und forderten ihn heraus. Anderen gegenüber war er sehr hilfsbereit. Das studentische Leben genoss er in vollen Zügen, er knüpfte viele Freundschaften. Hier fand er Personen, die ihm eine große Stütze waren, mit denen er sich über seine verzweifelte Lage austauschen konnte. Dass ihm die Schwere seiner Erkrankung bewusst war, wurde mir durch viele Gespräche deutlich, die ich mit ihm geführt habe. Dennoch hatte der junge Student die Gabe, andere meist über die Schwere seines Schicksals hinwegzutäuschen. Immer zeigte er sich optimistisch.
Als verschiedene Behandlungen nicht mehr weiterhalfen, wurde klar, dass er erneut transplantiert werden musste. Diesen Eingriff, dem er sich knapp zweieinhalb Jahre, nachdem er mir das erste Mal von seinem Rezidiv berichtet hatte, unterzog, überlebte er nicht. Der junge Student starb an einem Frühlingstag.
Zurück blieben viele tief erschütterte Menschen: seine Familie, die Sohn, Bruder, Enkelsohn, Neffe, Cousin verloren hatten, seine Lebensgefährtin und deren kleine Tochter, der nun Partner und Vaterersatz fehlten, seine Freundinnen und Freunde, seine Kommilitoninnen und Kommilitonen, denen er sehr ans Herz gewachsen war. Auch mich ließ sein Tod traurig zurück. Ich fragte mich, ob wir ihn genug unterstützt hatten und ihm genügend zur Seite gestanden sind.
An der Hochschule führten wir eine Gedenkfeier für ihn durch. Diese Feier organisierten maßgeblich seine Freunde. Wir erinnerten uns gemeinsam an den jungen Studenten, an seinen Humor, seine Geselligkeit, seine Herzlichkeit, seine Verlässlichkeit, seinen Lebenswillen, seinen Kampfgeist. Die Beerdigung, die in seiner weit entfernten Heimatstadt stattfand, war sehr bewegend. Der junge Student hatte Ablauf und Lieder selbst gestaltet. Eines der von ihm gewählten Lieder enthielt die Botschaft, mit Glück, Freude und einem Lächeln im Blick an ihn zu denken und dabei die Schönheit des Lebens zu genießen – wohlwissend, dass es vergeht.
Menschen sterben täglich: Der Tod trifft alte und schwerkranke Menschen am Ende eines langen Leidenswegs, trifft Eltern nach dem entsetzlichen Tod ihres Kindes – sei es durch Fehl- oder Frühgeburt, durch Krankheit, Unfall oder gar Suizid –, trifft Menschen in prekären Lebenssituationen – im Fall von Wohnungs- oder gar Obdachlosigkeit, Drogen- oder Alkoholabhängigkeit oder einfach nur Armut – häufig früher, trifft Menschen, die in der Brutalität und Härte von Krieg und kriegsähnlichen Zuständen leben. Das Sterben erfolgt langsam und allmählich oder plötzlich und schnell. Mal können Menschen versuchen, sich darauf einzustellen, mal nicht. Mal entscheiden sich Menschen bewusst dafür, meist jedoch nicht. Und im Laufe unseres Lebens werden auch wir selbst dem Tod einmal gegenüberstehen. Rilke mahnt uns, diese Tatsache nicht zu vergessen.
Mit Sterben, Tod und Trauer erfahren wir die dunklen Seiten unseres Lebens. Der Tod, so meint Norbert Elias, hat keine tiefere Bedeutung, er »verbirgt kein Geheimnis. Er öffnet keine Tür. Er ist das Ende eines Menschen« (Elias 1982, 100). Menschen stehen dem häufig fassungslos gegenüber und können den Sinn nicht verstehen. Denn welcher Sinn soll sich hinter dem Tod von Menschen verbergen – von jungen ebenso wie von alten? Warum musste der Student sterben, der mitten im Leben stand und so große Pläne für sein Leben hatte? Wie kaum ein anderer führt uns Leo Tolstoi in seiner Erzählung »Der Tod des Iwan Iljitsch« die Sinnlosigkeit des Todes vor Augen. Der Protagonist, Iwan Iljitsch Golowin, ein 45-jähriger Gerichtsangestellter, empfindet eines Tages starke Schmerzen, deren Ursprung ungeklärt bleibt. Sein Leiden verschlimmert sich stetig und absorbiert mehr und mehr seine Aufmerksamkeit. Schließlich wird es zu seinem ausschließlichen Lebensinhalt. In diesem Zustand stellt sich Iwan Iljitsch die Frage nach dem Sinn des Lebens:
»Er weinte über seine Hilflosigkeit, über seine entsetzliche Einsamkeit, über die Grausamkeit der Menschen, über die Grausamkeit Gottes, und er weinte auch über Gottes Abwesenheit. ›Warum hast du mir all das angetan? Warum hast du mich dahin gebracht? Warum, warum nur quälst du mich so entsetzlich? ...‹ Er erwartete freilich keine Antwort auf diese Fragen und weinte auch darüber, dass es keine Antwort gab und nichts geben konnte. Die Schmerzen wurden aufs Neue stärker« (Tolstoi 2022, 77 f.).
Iwan Iljitsch zieht eine negative Bilanz: »›Ja, was soll denn das? Und warum? Das kann doch nicht sein! Es kann doch nicht sein, dass das Leben so sinnlos und widerlich ist? Wenn es aber wirklich so sinnlos und widerlich ist, warum dann sterben und unter Leiden sterben?‹« (ebd., 79). Auch Fragen nach der eigenen Verantwortung, auch nach Schuld tauchen auf. Dabei beziehen sich diese nicht selten auf das eigene Handeln: »Ich bin schuldig, ich habe falsch oder schlecht gehandelt, meine Taten können nicht gerechtfertigt werden« (Macho 2014, 17). Im Angesicht von Sterben, Tod und Trauer stellen sich Fragen, was im Leben falsch, oder was richtig gemacht wurde. Hätte besser anders gehandelt werden sollen? Welche Alternativen hätten bestanden? Auch Iwan Iljitsch fragt sich: »Vielleicht jedoch habe ich nicht so gelebt, wie es sich gehört hat?« (Tolstoi 2022, 80). Eine negative Lebensbilanz kann ausgesprochen belastend und bedrückend sein.
Seit den Zeiten der Aufklärung trösten uns – wenn wir ehrlich sind – keine metaphysischen Weisheiten mehr über die Grausamkeiten von Sterben, Tod und Trauer hinweg. Dies gilt zumindest für die meisten von uns, wenn auch nicht für alle. »Vorstellungen, Bilder (...), die über den Tod hinaus reichen, sind verblasst; sie haben eine reale, die Gefühle und Gedanken bestimmende Kraft, sie sind, wo sie benutzt werden, eher Sprachfiguren, um überhaupt etwas zu sagen, wo Vorstellung und Sprache fehlen« (Thiersch 2009, 213 f.). Riten, Floskeln oder gar die Nutzung neuer technischer Möglichkeiten wie beispielsweise der Kryonik (Krüger 2022, 27 ff.) entpuppen sich als Fluchtbewegungen, die die große metaphysische Ratlosigkeit nicht überdecken können. Auch andere Vorstellungen, die uns das Nachdenken über Sterben, Tod und Trauer angenehmer machen, mögen nicht über diese Ratlosigkeit hinwegtäuschen. Ein Beispiel hierfür mag die »Death Positive«-Bewegung sein, die uns ermahnt, mit dem Wissen über die eigene Sterblichkeit jeden einzelnen Tag bewusster zu erleben (Doughty 2015/2019). Apps wie »WeCroak« oder »iWish« unterstützten dabei und senden täglich mehrfach Nachrichten, um an die eigene Sterblichkeit zu erinnern, oder präsentieren Ideen für Aktivitäten, die man auf jeden Fall noch erleben sollte, bevor man tot ist. Auch erscheint beispielsweise die Idee des »natürlichen Todes« fraglich, denn sie impliziert »die Vorstellung eines sanften Erlöschens nach erfülltem Leben, eines Todes aus Altersschwäche ohne Schmerzen und ohne Dramatik des Abbruchs« (Macho 1987, 33 f.). Sterben, Tod und Trauer werden »zur sanften Natur« (ebd., 46) verklärt. Das Leben lehrt uns, dass es oft, vielleicht sogar meist anders ist.
Im Zuge der Aufklärung gerät auch der Glaube von vielen Menschen an ihre eigene Unsterblichkeit ins Wanken, dieser ist »aus dem Hoffnungsraum (der) Menschen verschwunden« (ebd., 116). Seither schwebt die Endgültigkeit des Todes über uns. Diese ist für uns nur schwer vorstellbar – gerade, wenn wir sie auf uns selbst beziehen. »In der Vorstellung meines eigenen Todes müsse ich von mir als dem Subjekt dieser Vorstellung abstrahieren können« (Macho 1987, 32) – ein paradoxes Unterfangen. Auch Leo Tolstoi greift diese Paradoxie auf:
»Iwan Iljitsch sah, dass er sterben müsse, und war in ununterbrochener Verzweiflung. In der Tiefe der Seele wusste Iwan Iljitsch, dass er sterben müsse, aber er hatte sich nicht nur nicht an diesen Gedanken gewöhnt, sondern begriff ihn einfach nicht und konnte ihn nicht begreifen. Jenes bekannte Beispiel für Syllogismen, das er in der Logik von Kiesewetter gelernt hatte: Cajus ist ein Mensch, alle Menschen sind sterblich, also ist auch Cajus sterblich, war ihm sein ganzes Leben hindurch rechtmäßigerweise lediglich als auf Cajus anwendbar vorgekommen, keinesfalls aber auf ihn, Iwan Iljitsch, selber. Jenes war der Mensch Cajus, der Mensch überhaupt, und für dieses war das Gesetz völlig gerechtfertigt; er indes war nicht Cajus und ebenso wenig der Mensch an sich, sondern er war ein Wesen völlig für sich und völlig von anderen verschieden; er war der Wanja. (...) Cajus, der war in der Tat sterblich, und wenn er starb, so war es ganz in Ordnung; ich dagegen, ich, Wanja, ich, Iwan Iljitsch, mit all meinen Gefühlen und Gedanken – bei mir es nun einmal eine ganz andere Sache. Und es kann ja gar nicht sein, dass auch ich sterben muss. Das wäre zu entsetzlich« (Tolstoi 2022, 56 f.).
Martin Heidegger spricht in diesem Zusammenhang von der »Geworfenheit in den Tod« (Heidegger 1957, 251). Ein Zustand, der die »Angst zur Grundbefindlichkeit des Menschen überhaupt« (Bloch 1985, 124) macht. In den Augen Erst Blochs wäre »Verzweiflung« (ebd., 125) jedoch die bessere Wortwahl, trifft Verzweiflung in seinen Augen den Gemütszustand der »Erwartung eines Negativen, an dem keinerlei Zweifel mehr statthat« (ebd., 126).
So durchwirken Sterben, Tod und Trauer den Alltag und die Lebenswelt der Menschen und beeinflussen diese. Der Raum wird beengt, das Leben spielt sich häufig im kleinsten Umfeld ab. Die Wahrnehmung von Zeit ändert sich, da die normalen Abläufe des Alltags aufbrechen. Von der hektischen Betriebsamkeit, die diesen so oft kennzeichnet, ist kaum etwas zu bemerken. Die Menschen scheinen wie »aus der Zeit gefallen«, Sterben, Tod und Trauer geben dem Leben einen neuen Takt vor. Auch die sozialen Bezüge bleiben nicht die alten. Menschen ziehen sich zurück, sind mehr und mehr allein. Bei Menschen, die sich im Sterben befinden, verändert sich der Leib, körperliche Abbauprozesse sind bemerkbar. So werden die – scheinbaren – Gewissheiten und Selbstverständlichkeiten durchbrochen, Routinen und Pragmatismus geraten ins Wanken. Dies stellt hohe Anforderungen an die Lebensbewältigung der Menschen, erfahren sie sich doch als schwach, abhängig, ohnmächtig und hilflos. Sie geraten aus dem Gleichgewicht, das Zusammenspiel von Selbstwert, sozialer Anerkennung und Selbstwirksamkeit ist in hohem Maße gefährdet und kritisch (Böhnisch 2023b, 27). Und all diese Entwicklungen betreffen nicht nur diejenigen, die sterben. Familienmitglieder, weitere Angehörige, Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kommiliton:innen bleiben nicht nur als Trauernde zurück – auch für sie stellen sich Fragen nach Sinn, Verantwortung und Schuld oder die Frage danach, wie es in ihrem Leben ohne die verstorbene Person weitergehen mag. Auch deren Alltag und Lebenswelt werden erschüttert, auch deren Lebensbewältigung gerät ins Wanken.
Hier sind Menschen auf Hilfe angewiesen. Diese erhalten sie meist von anderen Menschen. Doch auch Soziale Arbeit kann eingreifen, zielt sie »auf die Unterstützung in den pragmatischen Anforderungen der Alltagsbewältigung und auf die Inszenierung und Stabilisierung der Lebenswelt in verlässlichen, belastbaren Strukturen« (Thiersch 2009, 218). Sie steht bei der (Wieder-)Herstellung verschüttgegangener Handlungsfähigkeit bei. In diesem Buch wird erkundet, wie Soziale Arbeit Menschen in der Konfrontation mit Sterben, Tod und Trauer unterstützen kann. Irvin Yalom, ein renommierter US-amerikanischer Psychotherapeut, drückt es zum Schluss seines Buches »Unzertrennlich«, das er gemeinsam mit seiner Frau Marilyn Yalom, mit der er 65 Jahre lang verheiratet war, zu schreiben begonnen hatte und allein beenden musste, weil Marilyn ihrer Krebserkrankung erlag, so aus:
»Ich werde unser Buch mit den unvergesslichen Eröffnungsworten von Nabokovs Autobiographie beenden: ›Die Wiege schaukelt über einem Abgrund, und der platte Menschenverstand sagt uns, dass unser Leben nur ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Dunkels ist.‹ Dieses Bild lässt einen taumeln und beruhigt einen zugleich. Ich lehne mich zurück auf meinen Stuhl, schließe meine Augen und finde Trost« (Yalom/Yalom 2021, 300).
Sehr häufig blickt Soziale Arbeit gemeinsam mit Menschen in ihrem Alltag und in ihrer Lebenswelt über den Abgrund von Sterben, Tod und Trauer. Und dennoch kann sie diesen Lichtspalt füllen und gestalten.
1.2 Mitten im Leben – Soziale Arbeit in der Konfrontation mit Sterben, Tod und Trauer
Um bei diesem Bild zu bleiben: Sterben, Tod und Trauer gehören zu unserem Leben dazu, häufig stehen Menschen an diesem Abgrund. Und so sind auch Professionelle der Sozialen Arbeit, die Menschen begleiten, immer wieder damit konfrontiert. In verschiedenen Handlungsfeldern, einerlei ob ambulant, teilstationär oder stationär – also lebensweltunterstützend, lebensweltergänzend oder lebensweltersetzend (Thole 2011, 28) – beraten und betreuen sie schwerkranke, alte und sterbende Menschen und deren Angehörige und gehen auf deren Bedürfnisse ein. Auch in Handlungsfeldern, die scheinbar wenig damit zu tun haben, kommen Sterben, Tod und Trauer immer wieder vor.
Doch hat Soziale Arbeit häufig einen schwierigen Stand. In medizinischen, pflegerischen, palliativen oder hospizlichen Handlungsfeldern beispielsweise sind Professionelle nicht alleine. Auch Vertreter:innen anderer Berufsgruppen – allen voran Mediziner:innen, Pflegepersonal, Psycholog:innen, Therapeut:innen oder Seelsorger:innen bieten in diesen Settings Unterstützung an. In dem multiprofessionellen Gefüge ist die Soziale Arbeit »die vielleicht am meisten unterschätzte Profession« (Borasio 2021, 15) und mehr ein Anhängsel (ebd.). Sie hat damit zu kämpfen, wahrgenommen zu werden und integraler Bestandteil der Versorgungsstrukturen zu sein (Pankofer 2021, 35; Student/Mühlum/Student 2020, 20).
Dabei sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen der stationären und ambulanten Hospiz- und Palliativversorgung durch den § 39a SGB V abgesteckt. Die darauf aufbauenden Rahmenvereinbarungen des GKV-Spitzenverbands, die dieser u. a. mit großen deutschen Wohlfahrtsverbänden und den Interessenverbänden aus dem Feld der hospizlichen und palliativen Versorgung geschlossen hat, sehen im stationären Hospiz den Einsatz von »psychosozialen Fachkräften« vor und benennen hierunter beispielsweise auch Sozialarbeiter:innen und Sozialpädagog:innen (Rahmenvereinbarung – stationär 2017, 10). Dagegen ist im ambulanten Hospizdienst ganz allgemein eine Fachkraft gefordert, die auch eine »Hochschul- bzw. Fachhochschulausbildung aus dem Bereich (...) Sozialpädagogik, Sozialarbeit« (Rahmenvereinbarung – ambulant 2022) vorweisen kann (Rahmenvereinbarung – ambulant 2022, 7; ▸ Kap. 5.6.3). In Palliativstationen von Kliniken sieht die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin vor, dass neben der Medizin und Pflege auch »weitere Therapiebereiche« (Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin 2007, 1) abgedeckt werden – u. a. durch »Sozialarbeit/Sozialpädagogik« (ebd.). So bleibt der Einbezug der Sozialen Arbeit insgesamt eine Kann-, aber keine Mussleistung. In der Konsequenz verfügt längst nicht jedes Hospiz über Professionelle der Sozialen Arbeit, sondern nur etwa jedes zweite. Im ambulanten Bereich, in welchem Professionelle der Sozialen Arbeit oft als Koordinator:innen tätig sind, ist die Anforderung der Beratung so allgemein gefasst, dass es schwer fällt, ein eigenes Kompetenzprofil auszuweisen. Und in Palliativstationen wird das Angebot der Sozialen Arbeit de facto meist durch den allgemeinen Kliniksozialdienst abgedeckt (Wasner 2021, 68).
Nicht nur die Tätigkeit in medizinischen, pflegerischen, palliativen und hospizlichen Handlungsfeldern stellt Professionelle der Sozialen Arbeit vor Herausforderungen. In verschiedenen anderen Handlungsfeldern sind sie ebenfalls immer wieder mit Sterben, Tod und Trauer konfrontiert, denn im Laufe ihres Lebens stehen Menschen immer wieder an diesem Abgrund. Hinzu kommt, dass auch Professionelle selbst davon betroffen sind. Viele – wenn nicht gar alle – haben eigene Erfahrungen damit gemacht und selbst über den Abgrund geblickt. Die persönliche Auseinandersetzung ist prägend für den Umgang. Dennoch erscheint eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik in der Sozialen Arbeit nur selten zu erfolgen.
Wirft man einen Blick in die Fachliteratur, so ist festzustellen, dass die Soziale Arbeit in medizinischen, pflegerischen, hospizlichen oder palliativen Handlungsfeldern häufig in einem sehr allgemeinen Sinne auf diese Versorgungsformen bezogen wird. So werden Anforderungen, Aufgaben und Arbeitsfelder zwar ausführlich dargestellt und beleuchtet; detailliertere Bezüge oder systematische Abstimmungen zwischen den Themen Sterben, Tod und Trauer und den (theoretischen) Diskursen innerhalb der Sozialen Arbeit werden eher angedeutet als ausgearbeitet. So sind Professionelle der Sozialen Arbeit in diesen Arbeits- und Handlungsfeldern »häufig ohne fachliche Rückbindung an die zentralen Themen der Sozialen Arbeit auf sich gestellt, wenn es gilt, einen Handlungsbereich zu definieren« (Krüger 2017, 144). Aus diesem Grund greifen sie auch eher auf Wissensbestände und Konzeptionen anderer Disziplinen zurück (ebd.). Die Frage danach, welchen Beitrag die Soziale Arbeit nun genau leisten kann, bleibt somit schwammig. Gleichzeitig wird den Themen Sterben, Tod und Trauer im disziplinären Diskurs der Sozialen Arbeit wenig Beachtung geschenkt, sie sind weithin Randthemen, die keine gewichtige Stellung einnehmen. Deutlich wird dies beispielsweise, wenn ein Blick auf die Arbeit mit alten Menschen geworfen wird. Gerade hier müssen die Themen Sterben, Tod und Trauer einbezogen werden, da zunehmend Familienmitglieder, Freunde und Bekannte versterben und der Tod für die Menschen näher rückt.
Und so scheinen die beiden Perspektiven in einer allgemeinen Bedeutungslosigkeit eher nebeneinander als miteinander zu existieren: In den medizinischen, pflegerischen, palliativen und hospizlichen Arbeitsfelder fehlt es an einem klaren Profil Sozialer Arbeit und zum Teil werden sozialarbeiterische Aufgaben von anderen Professionen übernommen. Aus den disziplinären Diskursen ergeben sich gleichzeitig kaum Ideen, wie sich Soziale Arbeit konkret auf das Feld und die Themen Sterben, Tod und Trauer beziehen ließe. Was nun Ursache und was Wirkung der Schieflage sein mag, sei einmal dahingestellt.
Dieses Lamento soll nicht weiter verfolgt werden, sondern in diesem Lehrbuch soll unter Berufung auf Thomas Rauschenbach ein anderer Weg eingeschlagen werden. Ursprünglich als Kritik an einer Sozialen Arbeit formuliert, die sich in ihrer Selbstsicht zu sehr auf die methodische Seite des Handelns reduziert hatte, forderte dieser die Entwicklung eines »sozialpädagogischen Blicks«. Diesen sozialpädagogischen Blick verstand er bereits in den 1990er Jahren als »Chiffre für ein im Detail noch nicht ausbuchstabiertes Wissens- und Handlungssystem«, das seine eigene Logik hat und sich von anderen Wissens- und Handlungssystemen unterscheidet (Rauschenbach 1993, 8). Deswegen soll diese von Rauschenbach entworfene Chiffre in leicht veränderter Form aufgegriffen und danach gefragt werden, was denn einen »sozialarbeiterischen Blick« in diesem Feld kennzeichnet. Welche spezielle Perspektive können Professionelle der Sozialen Arbeit hier einnehmen, welchen Beitrag können sie in diesem Feld leisten, was ist kennzeichnend für ein sozialarbeiterisches Wissens- und Handlungssystem, das Menschen in ihrer Lebenswelt und in ihrem Alltag begleitet, wenn sie am Abgrund von Sterben, Tod und Trauer stehen? Wie kann sie den Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Dunkels gestalten – um beim Bild zu bleiben, das Irvin Yalom aufgegriffen hat? Das vorliegende Lehrbuch soll bisher bestehende Perspektiven erweitern und neue Impulse geben.
Für die Einnahme eines solchen sozialarbeiterischen Blicks wurden die Konzepte der Lebensweltorientierung und der Lebensbewältigung ausgewählt, die stark mit den Arbeiten von Hans Thiersch und Lothar Böhnisch verknüpft sind. Diese beiden Konzepte, die den Alltag mit all seinen Schwierigkeiten und Ambivalenzen und die zentrale Bedeutung von Bewältigung in den Mittelpunkt rücken, erweisen sich in besonderem Maße als geeignet, um sie auf die Arbeit in einer »Grenzsituation par excellence« (Streckeisen 1994, 232) zu beziehen und Impulse für die professionelle Soziale Arbeit zu gewinnen. Auch Thierschs Überlegungen zum »gelingenderen Alltag« bieten zentrale Bezugspunkte (Student/Mühlum/Student 2020, 21). Um die dargelegten Inhalte besser nachvollziehbar zu machen und um eine Verknüpfung der beiden Konzepte und der Praxis zu erreichen, wird im Folgenden immer wieder auf Fallbeispiele zurückgegriffen. Auf diese Weise soll das Handeln im Hinblick auf Sterben, Tod und Trauer fachlich fundiert und systematisch mit den theoretischen Diskursen in der Sozialen Arbeit verbunden werden. Diese Themen sollen aus ihrer Randständigkeit geholt und gleichzeitig im professionellen und fachlichen Diskurs platziert werden. Dies ist auch für die Soziale Arbeit grundlegend, deren gewichtige Aufgabe es in den nächsten Jahren sein wird, sich damit weit stärker als bisher zu beschäftigen.
Im Folgenden wird zunächst auf den gesellschaftlichen Umgang mit Tod und Sterben eingegangen (▸ Kap. 2), um danach den sozialarbeiterischen Blick auf die Thematik zu schärfen (▸ Kap. 3). Hierfür wird mithilfe der Fallarbeit auf die Konzepte der Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch und der Lebensbewältigung nach Lothar Böhnisch Bezug genommen. Dabei wird die Besonderheit dieses sozialarbeiterischen Blicks weiter herausgearbeitet (▸ Kap. 4) und auf einige ausgewählte Arbeits- und Handlungsfelder Sozialer Arbeit bezogen (▸ Kap. 5). Auf die Bedeutung der ethischen Entscheidungsfindung wird ebenso hingewiesen (▸ Kap. 6) wie auf die rechtlichen Grundlagen (▸ Kap. 7). Im Anschluss daran wird der Thematik der Trauer weiter nachgegangen (▸ Kap. 6). Die Frage danach, ob die Soziale Arbeit eine tröstende Profession sein kann, schließt hierbei den Kreis (▸ Kap. 9). Am Ende dieses Buches soll ein Ausblick gewagt werden (▸ Kap. 10).
Gut zu wissen – gut zu merken
Peter Noll, ein renommierter Strafrechtsprofessor aus Zürich, erfährt im Dezember 1981, dass er unheilbar an Blasenkrebs erkrankt ist. Eine – womöglich lebensverlängernde – Behandlung lehnt er ab. In den bewegenden Aufzeichnungen, die er zehn Monate lang bis zu seinem Tod führt, setzt er sich intensiv mit Sterben, Tod und Trauer auseinander. Er schreibt: »Natürlich wissen wir alle, dass wir sterben müssen, und doch tun wir so, als hätte das Leben kein Ende, als würde die Situation des Todes immer nur andere betreffen. (...) Niemand kann uns mehr nehmen als das Leben und das wird uns ohnehin genommen« (Noll 2005, 116). Sterben, Tod und Trauer betreffen uns alle, sie durchwirken unsere Lebenswelt und unseren Alltag. Professionelle in der Sozialen Arbeit sind – neben ihrer persönlichen Auseinandersetzung mit der Thematik – besonders herausgefordert, sich fachlich damit zu beschäftigen. Ein lebenswelt- und lebensbewältigungsorientierter Umgang, wie er in den folgenden Kapiteln entwickelt wird, kann hierbei Unterstützung bieten.
Zum Weiterlesen
Noll, Peter (2005): Diktate über Sterben und Tod. Mit der Totenrede von Max Frisch. München: Pendo.
Rilke, Rainer M. (2006): Die Gedichte. Rilkes lyrisches Werk in einem Band. Frankfurt/M.: Insel.
Tolstoi, Leo (2022): Der Tod des Iwan Iljitsch. Stuttgart: Reclam.
Yalom, Irvin D./Yalom, Marilyn (2021): Unzertrennlich. Über den Tod und das Leben. München: btb.
Literatur
Bloch, Ernst (1985): Das Prinzip Hoffnung. Kapitel 1 – 32. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Böhnisch, Lothar (2023): Sozialpädagogik der Lebensalter. 8. Aufl. Weinheim: Beltz Juventa.
Borasio, Gian D. (2021): Geleitwort zur 1. Auflage. In: Wasner, Maria/Pankofer, Sabine (Hrsg.): Soziale Arbeit in Palliative Care. 2., überarb. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, S. 15 f.
Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (Hrsg.) (2007): Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) zur Personalbesetzung auf Palliativstationen. Online: URL: https://www.dgpalliativmedizin.de/images/stories/Empfehlung_zur_Personalbesetzung_auf_Palliativstationen_2007.pdf (01. 11. 2023).
Doughty, Caitlin (2015): Smoke Gets in Your Eyes. Other Lessons from the Crematory. New York: Norton & Company.
Doughty, Caitlin (2019): From Here to Eternity. Travelling the World to Find the Good Death. London: Orion Publishing Group.
Elias, Norbert (1982): Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Heidegger, Martin (1957): Sein und Zeit. 8. Aufl. Tübingen: Max Niemeyer.
Krüger, Tim (2017): Sterben und Tod. Kernthemen Sozialer Arbeit. Würzburg: Ergon.
Krüger, Tim (2022): Trauer und Soziale Arbeit. Professionell mit Verlust und Trost umgehen. Stuttgart: Kohlhammer.
Macho, Thomas H. (1987): Todesmetaphern. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Macho, Thomas H. (2014): Bonds: Fesseln der Zeit. In: Macho, Thomas H. (Hrsg.): Bonds. Schuld, Schulden und andere Verbindlichkeiten. München: Wilhelm Fink, S. 11 – 26.
Noll, Peter (2005): Diktate über Sterben und Tod. Mit der Totenrede von Max Frisch. München: Pendo.
Pankofer, Sabine (2021): Soziale Arbeit – ein unverzichtbarer Bestandteil von Palliative Care? In: Wasner, Maria/Pankofer, Sabine (Hrsg.): Soziale Arbeit in Palliative Care. 2., überarb. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, S. 33 – 44.
Rahmenvereinbarung ambulant (2022): Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 2 Satz 8 SGB V zu den Voraussetzungen der Förderung sowie zu Inhalt, Qualität und Umfang der ambulanten Hospizarbeit für Erwachsene vom 03. 09. 2002, i. d. F. vom 21. 11. 2022. Online: URL: https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/hospiz_palliativversorgung/20221121_Rahmenvereinbarung_Erw_39a_Abs.2_Satz_8_SGB_V.pdf (23. 03. 2024).
Rahmenvereinbarung stationär (2017): Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 1 Satz 4 SGB V über Art und Umfang sowie Sicherung der Qualität der stationären Hospizversorgung vom 13. 03. 1998, i. d. F. vom 31. 03. 2017. Online: URL: https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/hospiz_palliativversorgung/20170331_Rahmenvereinbarung_nach__39a_Abs_1_Satz_4_stationaere_Hospize.pdf (23. 03. 2024).
Rauschenbach, Thomas (1993): Zur Einführung. In: Rauschenbach, Thomas/Ortmann, Friedrich/Karsten, Maria-Eleonora (Hrsg.): Der sozialpädagogische Blick: lebensweltorientierte Methoden in der sozialen Arbeit. Weinheim: Juventa, S. 7 – 10.
Rilke, Rainer M. (2006): Die Gedichte. Rilkes lyrisches Werk in einem Band. Frankfurt/M.: Insel.
Streckeisen, Ursula (1994): Doing Death. In: Hitzler, Ronald/Honer, Anne/Maeder, Christoph (Hrsg.): Expertenwissen. Die institutionalisierte Kompetenz zur Konstruktion von Wirklichkeit. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 232 – 246.
Student, Johann-Christoph/Mühlum, Albert/Student, Ute (2020): Soziale Arbeit in Hospiz und Palliative Care. 4. Aufl. München: Reinhardt.
Thiersch, Hans (2009): Schwierige Balance. Über Grenzen, Gefühle und berufsbiographische Erfahrungen. Weinheim: Juventa.
Thole, Werner (2011): Die Soziale Arbeit – Praxis, Theorie, Forschung und Ausbildung. In: Thole, Werner (Hrsg.): Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch. 4. Aufl. Wiesbaden: VS, S. 19 – 70.
Tolstoi, Leo (2022): Der Tod des Iwan Iljitsch. Stuttgart: Reclam.
Wasner, Maria (2021): Aktuelle Situation in Deutschland. In: Wasner, Maria/Pankofer, Sabine (Hrsg.): Soziale Arbeit in Palliative Care. 2., überarb. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, S. 66 – 78.
Yalom, Irvin D./Yalom, Marilyn (2021): Unzertrennlich. Über den Tod und das Leben. München: btb.
2 Gezähmter Tod und selbstbestimmtes Sterben – der Umgang mit dem Lebensende im Wandel der Zeit
Kathrin Sahlmüller
T Das erwartet Sie in diesem Kapitel
Dieses Kapitel gibt einen Einblick in Vorstellungen unserer Gesellschaft vom »guten Sterben«, über die Entstehung und gesellschaftliche Bedingtheit solcher Bilder und über aktuelle Herausforderungen und Utopien für die Zukunft im Umgang mit Tod und Sterben.
An wen denken wir, wenn wir uns einen sterbenden Menschen vorstellen? An einen alten Menschen, der sich, ruhig und lebenssatt, von seiner versammelten Familie verabschiedet? An eine Patientin auf der Intensivstation, umgeben von Hektik und lauten Apparaten? An einen vor sich hin dämmernden Demenzkranken? An ein Opfer von Unfall oder Gewalt? Manche dieser Bilder fühlen sich für uns »richtiger« an: der Tod als natürliches Ereignis, vielleicht sogar als Erlösung. Andere Bilder wirken falsch und ungerecht. Besonders das Sterben junger Menschen erscheint uns unnatürlich. Naturgegeben erscheint den meisten allein der Tod am Ende eines langen Lebens. Und in unserer Gesellschaft sterben ja tatsächlich die allermeisten Menschen im (hohen) Alter, der Tod von jungen Menschen oder sogar Kindern gilt als tragischer Sonderfall.
Diese Verteilung der Sterblichkeit im menschlichen Lebenslauf ist relativ neu. In den vorindustriellen Gesellschaften war der Tod etwas, das überwiegend Neugeborene, Säuglinge und kleine Kinder betraf (Kellehear 2017, 12; Schäfer 2015, 157): Schweden richtete im Jahr 1749 als erstes Land ein Amt für Bevölkerungsstatistik ein und so zeigen Daten aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, dass mehr als 35 % der lebend geborenen Kinder vor ihrem fünften Geburtstag verstorben sind (Deaton 2015, 69). Die Zahlen gleichen sich für alle vorindustriellen Gesellschaften; Volk und Atkinson ermitteln im Vergleich von über 43 verschiedenen historischen Gesellschaften eine durchschnittliche Säuglingssterblichkeit von 26,9 % und eine Kindersterblichkeit von 46,2 %: »From the pre-Columbian Americas, to Ancient Rome, to medieval Japan, to the European Renaissance, roughly a quarter of infants died before their first birthdays and half failed to survive to adulthood« (Volk/Atkinson 2013, 184). Diese hohe Sterblichkeit am Anfang des Lebens ist auch der Grund für die niedrige Lebenserwartung in den vorindustriellen Gesellschaften. Wenn beispielsweise im Schweden des späten 18. Jahrhunderts die durchschnittliche Lebenserwartung bei Anfang bis Mitte 30 Jahren lag, so heißt das nicht, dass die Menschen in der Regel mit 35 Jahren verstarben, sondern dass viele Menschen mit 35 Jahren bereits verstorben waren – und zwar überwiegend in ihren ersten fünf Lebensjahren. Wer diese gefährlichen ersten Jahre überlebte, konnte durchaus alt werden – so hatte ein 80-jähriger Schwede im Jahr 1751 ein niedrigeres Sterberisiko als ein neugeborenes Kind zur selben Zeit (Deaton 2015, 69).
Die Hauptursache für die hohe Kindersterblichkeit, aber auch für den größten Teil der Todesfälle im Erwachsenenalter waren Infektionskrankheiten (Schäfer 2015, 158). Eine Aufstellung von Todesursachen im London des 17. Jahrhunderts zeigt, dass 100 Todesfällen 56-mal »Infektionskrankheiten und Durchfälle«, 21-mal »Schwangerschaftskomplikationen, Säuglings- und Kindersterblichkeit«, fünfmal Herzerkrankungen, zwei Fälle von Unterernährung sowie in 16 Fällen »andere Ursachen«, wie beispielsweise Unfälle, zugrunde lagen (Omran 2005, 740).
Diese Verteilung der Todesursachen änderte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts. Die Sterberate aufgrund von Epidemien und anderen Infektionskrankheiten begann zu sinken, generell gingen Infektionskrankheiten wie Cholera und Typhus durch verbesserte Hygienemaßnahmen wie die Einführung von Kanalisation in Städten und eine bessere Trinkwasserversorgung langsam zurück, und es wurden mit der Einführung der Kuhpockenimpfung erste Erfolge in der Krankheitsbekämpfung durch Impfungen erzielt (ebd., 66; Schäfer 2015, 161 f.). Um das Jahr 1900 lag die durchschnittliche Lebenserwartung weltweit bei etwa 30 Jahren, in Deutschland bei rund 43 Jahren, und stieg im Verlauf des 20. Jahrhunderts stetig an, auf heute über 80 Jahre in Deutschland und etwa 70 Jahre im weltweiten Durchschnitt (Sütterlin 2017, 5 ff.). Zurückzuführen ist der Anstieg der Lebenserwartung zunächst auch hier größtenteils auf den weiterhin signifikanten Rückgang der Säuglings- und Kindersterblichkeit an Infektionskrankheiten. Im 20. Jahrhundert wurde schließlich auch die Sterblichkeit der Erwachsenen durch Krankheiten und riskante Arbeits- und Lebensbedingungen geringer (ebd., 4) und die Ernährungssicherheit verbesserte sich stetig durch Entwicklungen in der Landwirtschaft und neue Möglichkeiten zur Konservierung von Lebensmitteln.
Heute haben vor allem in Ländern mit hohem und mittlerem Einkommen die sogenannten nichtübertragbaren Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes, chronische Atemwegserkrankungen und Demenzerkrankungen die Infektionskrankheiten als vorherrschende Todesursache abgelöst. Sie machen in Ländern mit hohem Einkommen mittlerweile fast 90 % der Sterbefälle aus (Sallnow/Smith/Ahmedzai et al. 2022, 843). Diese Entwicklung beschreibt Abdel Omran 1971 in seinem Modell des Epidemiologischen Übergangs (Omran 2005, 731 ff.). Auch in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen nimmt die Anzahl der Menschen zu, die an nicht-übertragbaren Krankheiten sterben, auch wenn hier die Infektionskrankheiten immer noch eine sehr große Rolle spielen (Sallnow/Smith/Ahmedzai et al. 2022, 842 f.).
Der Übergang der Todesursachen hin zu den nichtübertragbaren und degenerativen Krankheiten veränderte auch die Art und Weise, wie die Menschen sterben (Greiner 2023, 38 ff.; Kellehear 2017, 21). Im Zeitalter der Epidemien und Infektionskrankheiten kam der Tod in der Regel schnell zu den Menschen – durch schwere Verletzungen oder Infekte, denen sie wenig entgegenzusetzen hatten. Zwischen dem Sich-bewusst-Werden, an der Verletzung, dem Fieber oder dem vereiterten Zahn sterben zu müssen und dem tatsächlichen Tod lag oft nur eine kurze Zeitspanne. Solche akuten Erkrankungen und Verletzungen können heute meist behandelt werden und sind so, zumindest in den Gesellschaften mit hohem und mittlerem Einkommen, in der Regel selten tödlich. In diesen Ländern sterben die Menschen hauptsächlich an Krankheiten, die einen anderen Verlauf nehmen: Sie können typischerweise nicht geheilt, aber durch medizinische Behandlungen oder Lebensstiländerungen in Schach gehalten werden. Erkrankte können mitunter noch viele Jahre mit einer chronischen Erkrankung leben – und oftmals nicht nur mit einer Erkrankung: »If they did not kill you soon, yet other diseases would join them so that instead of living and dying with one disease you might actually live with and have to manage several« (Kellehear 2017, 12).
Multimorbidität wird in einer alternden Gesellschaft zu einer Normalität, ein solchermaßen erkrankter Mensch leidet oft nicht an einer, sondern an mehreren lebensbedrohlichen oder lebenslimitierenden Erkrankungen gleichzeitig. Diese immer größere Normalität verlängerter Sterbeverläufe durch chronische Erkrankungen führte zu einem »neue(n) Bedarf an Sinnstiftung (...). Mit dem Anwachsen der Zeit, die der oder die Einzelne hatte, um sich auf das Ende des eigenen Lebens vorzubereiten, stieg auch der Bedarf, Antworten auf all jene Fragen und Probleme zu finden, die damit einhergingen« (Greiner 2023, 566), zumal traditionelle Sinngebungsinstanzen oft an Akzeptanz verloren haben und nach neuen gesucht wird.
Ab welchem Zeitpunkt im Verlauf einer chronischen, zum Tode führenden Krankheit betrachten wir Betroffene als sterbend, ab wann betrachtet er oder sie sich selbst als sterbend? Beginnt der Sterbeprozess mit dem Einsetzen der Krankheit oder mit Diagnosestellung, mit dem Einstellen kurativer Behandlung oder mit dem schrittweisen Nachlassen der körperlichen Funktionen? Ein Mensch mit lebenslimitierender chronischer Erkrankung nimmt sich selbst häufig nicht als sterbend wahr, solange er die lebensverlängernden Optionen der Medizin noch nutzen kann. Und wenn die Betroffenen sich, oft erst recht spät in ihrem Krankheitsverlauf, als Sterbende wahrnehmen, sind es ebenfalls die Angebote der Medizin, experimentelle Therapien und Heilversuche oder die Angebote der Palliativmedizin, auf die sie hilfesuchend zurückgreifen. Auch der ärztlich assistierte Suizid kann bei genauerer Betrachtung als medizinische Dienstleistung angesehen werden. Greiner bestimmt als »Arbeitsdefinition« das Sterben als »die Phase des Übergangs zum Tod (...), womit konkret der Zeitraum am Ende des menschlichen Lebens gemeint ist, in dem ein Schwerkranker keine Aussicht auf Heilung mehr hat« (Greiner 2023, 6). Kellehear stellt weniger den medizinischen Aspekt als »Blick von außen« in den Mittelpunkt seiner Definition, sondern das Moment des Sich-bewusst-Werdens über die eigene Situation: »For most people, dying is an alteration of identity based on the knowledge that they will die very soon (...), it is the personal acknowledgement of incurable disease, advanced age or an execution date, that defines the dying experience« (Kellehear 2017, 16). Der soziologische Blick stellt den sozialen Charakter des Sterbeprozesses in den Vordergrund. Ein sterbender Mensch wird in seinem sozialen Kontext »sterbend gemacht« – d. h. er oder sie wird von sich selbst und seinem bzw. ihrem Umfeld als sterbender Mensch angesehen und behandelt:
»Im Kern stellt Sterben auf einen umfassenden Ausgliederungsprozess aus der alltäglichen Lebenswelt, bestehend aus Familie, Freunden und Bekannten etc., in eine andere Wirklichkeit ab. (...) Damit macht die betreffende Gemeinschaft deutlich, dass eines ihrer Mitglieder sie unwiederbringlich verlassen wird und die noch weiterlebenden Mitglieder den Übergang in eine neue Alltagswirklichkeit ohne diesen dann nicht mehr lebenden Anderen bewältigen müssen« (Stadelbacher/Schneider 2021, 13).
Der medizinische Fortschritt, der heute ein längeres Überleben ermöglicht, führt zu sozialen Konsequenzen für die Betroffenen (Kellehear 2017, 13 f.): Sterben dauert nicht Stunden oder Tage, sondern erstreckt sich über Monate oder manchmal Jahre, in deren Verlauf die sterbenden Menschen zunächst oft noch in ihren gewohnten sozialen Bezügen eingebunden sind, vielleicht noch arbeiten gehen und versuchen, ihren gewohnten Alltag so gut es geht aufrechtzuerhalten. Um die Krankheit(en) und ihre Folgen bewältigen zu können, richten sie oft ihre Lebensweise auf ein Kämpfen gegen die Erkrankung aus. So wie chronische Erkrankungen von Patient:innen in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsversorger:innen gemanagt werden müssen, wird auch das Sterben selbst immer mehr als eine »co-production of medical services and their consumers« wahrgenommen (Kellehear 2017, 14; auch Sallnow/Smith/Ahmedzai et al. 2022, 856). Eine längere zeitliche Dauer von Sterbeprozessen lässt mehr Gestaltbarkeit zu: »Der Tod wird nicht bloß passiv erlitten, sondern gerät als ›Leben mit dem Sterben‹ zu einer Arbeit, die der Sterbende selbst leistet« (Streeck 2016, 37).
Diese Entwicklung, in der die Selbstbestimmung der Sterbenden über den eigenen Sterbeprozess immer mehr in den Vordergrund rückt, skizziert der Historiker Philippe Ariès. Er bezeichnet den oben aufgeführten allgegenwärtigen, zumeist schnell eintretenden Tod in der Zeit vor dem epidemiologischen Übergang als »gezähmten Tod« (Ariès 1991, 42). Gezähmt deshalb, weil die Menschen auf den Tod vorbereitet waren; er war in das tägliche Leben integriert und hatte eine sichtbare Präsenz in der Gesellschaft. Gleichzeitig war er »abgeschwächt und kaum fühlbar« (Ariès 1991, 42), er wurde nicht als abstraktes Konzept problematisiert:
»Es gibt zwei Arten, nicht an den Tod zu denken: die unsere, die unserer technizistischen Zivilisation, die den Tod verbannt und mit einem Verbot belegt; und die der traditionellen Gesellschaften, die nicht Verweigerung ist, sondern die Unmöglichkeit, ihn mit Nachdruck zu bedenken, weil er ganz nahe und vertrauter Bestandteil des Alltagslebens ist« (Ariès 1991, 34)
– etwa so, wie man die eigene Nase nicht wahrnimmt, obwohl die Augen sie sehen, weil das Gehirn sie ausblendet. In diesem Zeitalter des gezähmten Todes war die Religion die leitende Instanz, sie stellte dem oder der Sterbenden wie den Zurückbleibenden Rituale, Verhaltensmuster und Trost bereit. In Europa wurden Sterben und Tod bis ins späte 18. Jahrhundert als »sozial-theologisch-philosophisches Phänomen« wahrgenommen, und nicht etwa primär als ein Gegenstand von Medizin und Biologie (Krüger 2017, 27). Folgerichtig lag die Sorge um die Sterbenden nicht bei den Ärzten, zumal ihre Anzahl gering und ihre Kunst nur für wenige erschwinglich war (Thieme 2018, 129), sondern bei der Familie und bei den religiösen Experten. Der Tod galt nämlich als Schwelle zwischen dem diesseitigen, oft kurzen und elenden Leben und einem Jenseits, in welchem die Seele, im Paradies oder in der Hölle, ewig weiterleben würde. Ein plötzlicher, unvorbereiteter Tod galt als großes Unglück, denn das diesseitige Leben, und vor allem die Zeit unmittelbar vor dem Tod, musste als Vorbereitung auf das zukünftige jenseitige Leben genutzt werden. Das ganze irdische Leben wurde so zur Vorbereitung auf das Sterben, und ein Mensch starb dann einen guten Tod, wenn dieser für ihn die Schwelle zum Paradies, nicht zur Hölle, werden konnte. Die Bemühungen der Sterbenden und ihres Umfeldes waren so auf den Zustand ihrer Seele gerichtet, nicht den ihres Körpers – körperliches Leiden war oft unvermeidbar und konnte kaum gelindert werden.
Zwar waren schon in der Antike Schmerz- und Betäubungsmittel bekannt, wurden jedoch, wohl auch aus Angst vor Nebenwirkungen und falscher Anwendung, nicht häufig eingesetzt, und so konnten die Ärzte in vielen Fällen nicht mehr tun, als das Leid ihrer Patient:innen mit auszuhalten (Schäfer 2015, 117 f.). Eine Deutung der leidvollen körperlichen Symptome der Sterbenden als religiös sinnvoll und Ausdruck von Buße und Askese konnte entlastend wirken und dem Leid einen Sinn verleihen. Das Sterben und die Trauer der Hinterbliebenen waren keine Privatangelegenheit, sondern fanden, wenn möglich, in Gemeinschaft statt: »Der Sterbende, seine Angehörigen und die Personen des näheren Umfeldes bilden eine Gruppe, die sich zusammenfindet, wenn sich der Tod ankündigt und ihn als Gruppe erträgt« (Hoffmann 2010, 21).
Dieses Bild vom gezähmten Tod ist für Ariès Mitte des 20. Jahrhunderts in sein Gegenteil verkehrt worden, er ist zum »verwilderten Tod« geworden (Ariès 1991, 377 ff.; Krüger 2017, 49 ff.). Der Arzt ist an die Stelle des Priesters an das Bett des oder der Sterbenden getreten, der Tod »galt (...) nicht mehr als spirituelle Passage, sondern als natürlicher Vorgang« (Streeck 2019, 34). Er konnte besiegt oder zumindest verzögert werden. Trat er letztlich, nach Ausschöpfung aller medizinischen Möglichkeiten, doch ein, so wurde dies als Niederlage erlebt. Das Sterben geschah nicht mehr im Kreis der Familie, sondern in der Regel isoliert im Krankenhaus (Greiner 2023, 48 ff.). Die Sterbenden wie auch die Trauernden hatten den »Rückhalt in der Gruppe« (Hoffmann, 2010, 21) verloren; Sterben, Tod und Trauer waren von einer öffentlichen zu einer höchst privaten Angelegenheit geworden. Da die Sterbenden über ihren Zustand oft nicht aufgeklärt wurden, weil die Vorstellung herrschte, dass dies ihren Zustand nur verschlimmern würde, konnten sie sich nicht auf ihr Sterben vorbereiten (Greiner 2023, 127 f.; Streeck 2016, 35), und die Erwartung, die von ihrem Umfeld an sie gestellt wurden, war vor allem »die Forderung, ›Fassung und Ausgeglichenheit‹ zu bewahren und mit Würde den Tod zu erwarten (...) Erwartungen, die sich auf die Patientenrolle beziehen« (Göckenjan 2008, 3480; Hoffmann 2010, 23). Sterbende wurden also vor allem als Patient:innen gesehen, die alle Möglichkeiten ausschöpfen sollten, die die Medizin ihnen bot, und ihr Sterben sollte möglichst diskret, rasch und schmerzlos vor sich gehen (Ariès 1991, 474 ff.; Streeck 2016, 35). Das Bild vom Tod als natürlichem Endpunkt des irdischen Lebens trat hinter ein Bild zurück, in dem der Tod als Kontrollverlust und Scheitern im Kampf gegen prinzipiell behandelbare Todesursachen wahrgenommen wurde (Hoffmann 2010, 24). Hofmann fasst Ariès' Beschreibung des »ins Gegenteil verkehrten Todes« so zusammen:
»Die Weisen des Umgangs mit Tod und Sterben, die sich über nahezu zwei Jahrtausende tradiert haben, geraten mit dem Verschwinden des Todes aus der Alltagswirklichkeit in Vergessenheit. In den Krankenhäusern wird der Sterbende nach Maßgabe medizinisch professioneller Standards behandelt und das heißt, es wird nicht ausgesprochen, dass er ein Sterbender ist, sondern ihm wird die Rolle des zu behandelnden und behandelbaren Patienten übergestülpt. Im Krankenhaus aus dem Kreise seiner Nächsten entfernt und über seinen Zustand nicht aufgeklärt, beschreibt Ariès den am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts sterbenden Menschen als einsam und um seinen Tod betrogen« (Hoffmann 2010, 25).
Auch wenn die These von einer »Tabuisierung« des Todes im 20. Jahrhundert, die u. a. Ariès vertrat, schon bald hinterfragt wurde (Greiner 2023, 77 ff.; Krüger 2017, 57), entfaltete sie doch als kulturkritischer Appell eine weitreichende Wirkung – sei es als Kritik am »Verlust religiöser Bindungen und traditioneller Wertvorstellungen« (Greiner 2023, 74) oder als Kritik an der »neue(n) gesellschaftliche(n) Orientierung auf Konsum, Leistung und Jugendlichkeit« (ebd.).
Vor dem Hintergrund des solcherart kritisierten modernen, medizinisch bestimmten Bildes vom Tod und seiner empfundenen Tabuisierung im Bewusstsein der Menschen, oder vielmehr der Ambivalenz seiner gleichzeitig »starke(n) Thematisierung in Kunst und Kultur und Verdrängung im Alltäglichen« (Krüger 2017, 58), erfuhr das ausgehende 20. Jahrhundert im Kontext einer gesellschaftlichen Atmosphäre die von Individualisierung, Wertewandel, dem Aufkommen neuer sozialer Bewegungen und einem gesteigerten Bewusstsein für persönliche Freiheiten und Selbstbestimmung geprägt war, ein »Revival des Todes«, die Entstehung eines »neo-modernen« Todesbildes (Walter 1994, 47; zit. in Streeck 2016, 36). Die Behandlungs- und Deutungsmacht der Ärzt:innen wurde zunehmend hinterfragt, und mehr Selbstbestimmung und Eigenverantwortung auch für schwerkranken Patient:innen gefordert (Greiner 2023, 437). Das neue Paradigma stellte die Sterbenden mit ihren »individuellen Wünschen und Bedürfnissen« ins Zentrum (Streeck 2016, 35 f.): »Nicht mehr ein Priester oder Arzt (gibt vor), wie das Lebensende zu verlaufen hat, sondern der Kranke bestimmt, wie er sich sein Sterben vorstellt.« Bewegungen wie das »natural death movement« betonten die Selbstbestimmung der Betroffenen, lehnten medizinische Interventionen am Lebensende ab und ermutigten die Menschen, ihren eigenen Sterbeprozess selbst zu planen. »Death awareness« und »death education« haben zum Ziel, Einstellungen und Haltungen zu Sterben, Tod und Trauer zu reflektieren und zu verändern (Greiner 2023, 133; Krüger 2017, 67 ff.). Das hier entwickelte Bild vom »guten Tod« – reflektiert, selbstbestimmt und »low-tech« – wurde für Neue Soziale Bewegungen sowohl im Hospiz- und Palliativbereich – mit Elisabeth Kübler-Ross in den USA und Cicely Saunders in Großbritannien als wegweisende Persönlichkeiten – als auch im Bereich der Sterbehilfe prägend (Greiner 2023, 133).
Die »Sterbeideale« dieser beiden Strömungen, die der Hospiz- und Palliativbewegung sowie die der Sterbehilfe-Organisationen, sind heute in unserer Gesellschaft am weitesten verbreitet (Streeck 2016, 39). Beide Bewegungen teilen einen medizinkritischen Ansatz, prangern unzureichende Behandlung von Schmerzen und anderen belastenden Symptomen im Sterbeprozess an, lehnen lebensverlängernde Maßnahmen um jeden Preis ab, betonen das Ideal eines Sterbens außerhalb von Institutionen und eines individuellen, selbstbestimmten und würdevollen Lebensendes (Greiner 2023, 439, 501; Streeck 2019, 246 f.). Zwar sind Würde und Selbstbestimmung sehr offene Begriffe, die von jedem Menschen individuell mit Bedeutung gefüllt werden, »stets jedoch drehten sie sich um die Wahrung der Autonomie und Individualität von Sterbenden, deren fortwährende soziale Einbindung und eine angemessene Kommunikation mit ihnen« (Greiner 2023, 578).
In der Sterbehilfe-Bewegung ist die Idee der Selbstbestimmung so zentral, dass der Begriff »selbstbestimmtes Sterben« mehr und mehr zum »Synonym für den assistierten Suizid« wird (Streeck 2019, 243). Selbstbestimmt soll vor allem der Zeitpunkt des Sterbens sein, um »die Unvorhersehbarkeiten des Krankheits- und Sterbeverlaufs« minimieren und so in größtmöglichem Maße die Kontrolle über das verbleibende Leben und dessen Ende behalten zu können (Streeck 2016, 43): Der assistierte Suizid





























