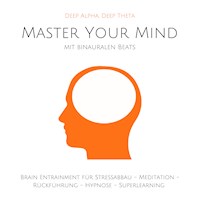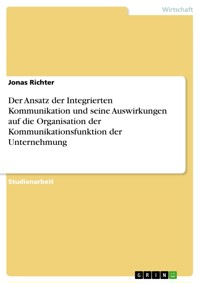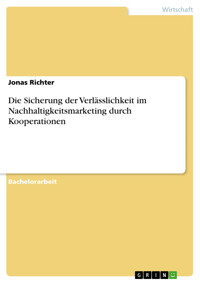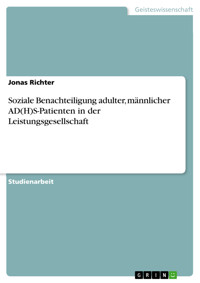
Soziale Benachteiligung adulter, männlicher AD(H)S-Patienten in der Leistungsgesellschaft E-Book
Jonas Richter
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Soziale Arbeit / Sozialarbeit, Note: 1,0, Evangelische Hochschule Darmstadt, ehem. Evangelische Fachhochschule Darmstadt (Fachbereich Soziale Arbeit), Veranstaltung: Soziale Ausschließung und Partizipation: Staat - Gesellschaft -Soziale Arbeit, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Aufmerksamkeitsdefizit(hyperaktivitäts)störung bei Erwachsenen ist ein aktuell diskutiertes Thema in den Medien. Die ursprüngliche Kinderkrankheit wird immer häufiger auch rückwirkend bei Erwachsenen diagonstiziert. Mit einer Prävalenz von 3,1% (vgl. Krause und Krause 2014, S. 15 nach Fayyad et. al. 2007) in Deutschland ist AD(H)S im Erwachsenenalter keine Ausnahme mehr. Oft zeigen sich die Symptome erst in schwierigen Lebenssituationen und die Betroffenen begeben sich in therapeutische Behandlung. Arbeitsplatzverlust, Ehescheidung oder kriminelle Auffälligkeit können Auslöser sein um nach Gründen für erschwerte Lebensbedingungen zu suchen. Die gesellschaftlichen Umstände, Leistungs- und Normanforderungen führen oft zu Zurückweisung der Betroffenen. Besonders verstärkt werden diese Erwartungen durch die geschlechterspezifischen Rollenbilder, denen entsprochen werden muss um gesellschaftlich anerkannt zu sein. Deshalb möchte ich mich in der vorliegenden Arbeit folgender Frage widmen: Inwieweit sind männliche, adulte AD(H)S-Patienten in einer kapitalistischen Gesellschaft von sozialen Benachteiligungs- und Ausschließungsprozessen betroffen? Besonders möchte ich auf die Anforderungen der an Wirtschaftlichkeit und Leistung orientierten Gesellschaft eingehen und erforschen welche Faktoren des männlichen Rollenbildes und der AD(H)S-Symptomatik zum Ausschluss von gesellschaftlichen Ressourcen führen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsbestimmung
2.1 Soziale Ausschließung
2.2 Normalität und Abweichung
2.3 Gesundheit und Krankheit
2.4 ADS und ADHS
2.4.1 Definition und Nomenklatur
2.4.2 Diagnoseverfahren und Symptomatik
2.4.3 Soziales Phänomen oder genetische Veranlagung
2.4.4 Therapie
2.5 Cognition-Enhancement
2.6 Leistung
3. Männliche Geschlechterrolle und AD(H)S
3.1 Rollenerwartungen
3.2 Geschlechterrolle im Widerspruch zur AD(H)S-Symptomatik
3.3 Fehlende Selbstfürsorge bei männlichen AD(H)S-Patienten
3.4 Die neue Männlichkeit
4. Ausschluss durch Krankheit
4.1 Selbstverantwortung und Gesundheit als Norm
4.2 Krankheit auf dem Arbeitsmarkt
4.3 Medikamentöse Lösungsstrategien
5. Sozioökonomische Aspekte der AD(H)S
6. Hochbegabung und Kreativität bei AD(H)S
7. Fazit
Literaturverzeichnis:
1. Einleitung
Die Aufmerksamkeitsdefizit(hyperaktivitäts)störung bei Erwachsenen ist ein aktuell diskutiertes Thema in den Medien.[1] Die ursprüngliche Kinderkrankheit wird immer häufiger auch rückwirkend bei Erwachsenen diagonstiziert. Mit einer Prävalenz von 3,1% (vgl. Krause und Krause 2014, S. 15 nach Fayyad et. al. 2007) in Deutschland ist AD(H)S im Erwachsenenalter keine Ausnahme mehr. Oft zeigen sich die Symptome erst in schwierigen Lebenssituationen und die Betroffenen begeben sich in therapeutische Behandlung. Arbeitsplatzverlust, Ehescheidung oder kriminelle Auffälligkeit können Auslöser sein um nach Gründen für erschwerte Lebensbedingungen zu suchen. Die gesellschaftlichen Umstände, Leistungs- und Normanforderungen führen oft zu Zurückweisung der Betroffenen. Besonders verstärkt werden diese Erwartungen durch die geschlechterspezifischen Rollenbilder, denen entsprochen werden muss um gesellschaftlich anerkannt zu sein.
Deshalb möchte ich mich in der vorliegenden Arbeit folgender Frage widmen:
Inwieweit sind männliche, adulte AD(H)S-Patienten in einer kapitalistischen Gesellschaft von sozialen Benachteiligungs- und Ausschließungsprozessen betroffen?
Besonders möchte ich auf die Anforderungen der an Wirtschaftlichkeit und Leistung orientierten Gesellschaft eingehen und erforschen welche Faktoren des männlichen Rollenbildes und der AD(H)S-Symptomatik zum Ausschluss von gesellschaftlichen Ressourcen führen können.
2. Begriffsbestimmung
2.1 Soziale Ausschließung
Erstmals wurde der Begriff Soziale Ausschließung[2] auf einer UNESCO-Armutskonferenz im Jahr 1964 verwendet. Dabei wurde Sozialer Ausschluss als ein Phänomen von ausgrenzender Armutskultur gesehen, war stark mit dem Begriff der Armut verknüpft und wurde als beschönigender Begriff für eben diese benutzt. Armut und damit auch Sozialer Ausschluss wurden in der politischen Debatte noch vorwiegend als selbstverschuldetes Problem angesehen. Der Staat hatte dabei weniger die Aufgabe Sozialen Ausschluss zu vermeiden als die Disziplin und Arbeitsmoral zu bewahren. Um Soziale Ausschließung als strukturelles Problem ansehen zu können, musste besagtes Problem so weit verbreitet sein, dass ein Selbstverschulden als einzige Ursache ausgeschlossen werden konnte (vgl. Steinert, 2000 S.7ff.). In den Sozialwissenschaften wurde der Begriff durch Luhmann's 1994 verfassten Aufsatz über „Inklusion und Exklusion“ etabliert. Darin erörtert er, dass ein Ausschluss immer auch mit einer Zugehörigkeit zu einem anderen System verbunden sei und Inklusion und Exklusion keine Gegenteiligen Begriffe sind (vgl. Steinert 2000, S.9 und 15). Damit lässt sich eine Abstufung von sozialem Ausschluss feststellen. Steinert nennt dabei neben der „wirtschaftliche[n, Anm. des Verfassers] Ausschließung“ auch „politisch-administrative“ die „soziale“ und „sozial-administrative“ Ausschließung (Steinert 2000, S. 9). Soziale Ausschliessung wird also als mehrdimensionales, mehr strukturell als personell bedingtes Problem definiert und die Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen als Lösungsansatz betrachtet. Vorraussetzung für sozialen Ausschluss ist vor allem die Kategorisierung von Menschen oder Gruppen und der Konflikt von Teilhabe an gesellschaftlich erzeugten Gütern (vgl. Steinert 2000, S. 17). Insbesondere möchte ich mich in dieser Arbeit mit der Kategorien gesund und krank beschäftigen. Auch, inwieweit die Befindlichkeit in einer dieser Kategorien selbstverschuldet, unverschuldet oder strukturell bedingt ist, ist im Folgenden zu diskutieren.
2.2 Normalität und Abweichung