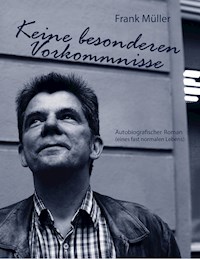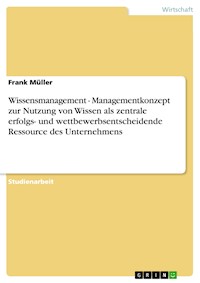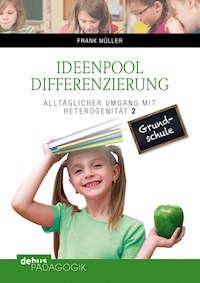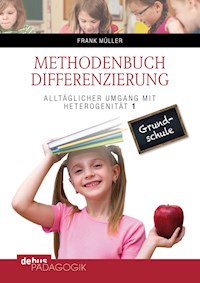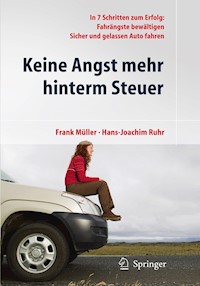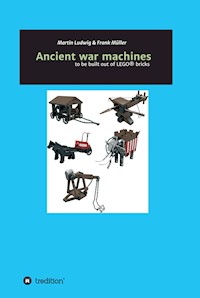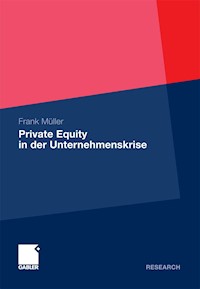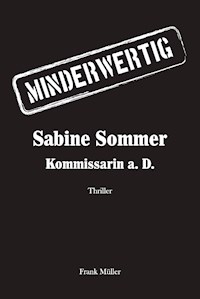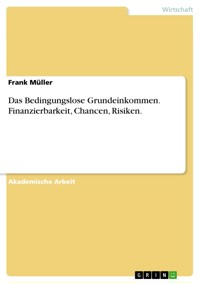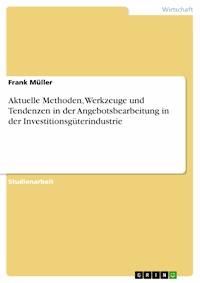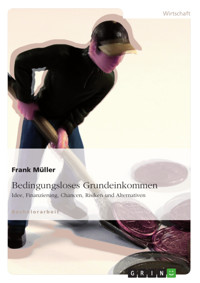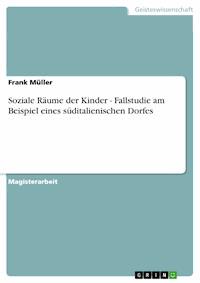
Soziale Räume der Kinder - Fallstudie am Beispiel eines süditalienischen Dorfes E-Book
Frank Müller
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2000 im Fachbereich Soziologie - Kinder und Jugend, Note: sehr gut, Universität Bremen (Kulturwissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Idee zur vorliegenden Magisterarbeit entstand in einem Projekt des Studiengangs Kulturwissenschaft der Universität Bremen zum Thema: "Familie und Kindheit in Süditalien, Wandlungen des Familienlebens in einer süditalienischen Tourismusregion". Die Arbeit präsentiert nun die Resultate meiner zweimonatigen Feldforschung im süditalienischen Dorf Furore an der Costiera Amalfitana (Region Kampanien). Die Forschung wurde in Zusammenarbeit mit der Universität "La Sapienza" in Rom und dem "Centro Universitario per i Beni Culturali" in Ravello durchgeführt. Zwölf Studierende aus Bremen und sechs aus Rom beteiligten sich an dem Projekt und verteilten sich auf insgesamt zehn Orte an der Costiera. Mein Forschungsfeld war das Dorf Furore. Die Familie Ferraioli nahm mich im Februar und März 1996 für sechs Wochen als Gast in ihrem Haus auf, wodurch ich die Möglichkeit hatte, das Familienleben kennenzulernen und den Kinderalltag im Ort zu beobachten. Eine Präsentation der Ergebnisse fand zum einen in Form einer Fotoausstellung statt, die in Ravello (Oktober 1996) und Bremen (März 1997) gezeigt wurde. Zum anderen stellten die Teilnehmer des Projekts Ausschnitte aus den entstandenen Arbeiten dem interessierten Publikum im Rahmen eines zweitägigen Seminars im Centro Universitario in Ravello vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2003
Ähnliche
Page 1
Page 4
1. Einleitung
Die Idee zur vorliegenden Magisterarbeit entstand in einem Projekt des Studiengangs Kulturwissenschaft der Universität Bremen zum Thema: "Familie und Kindheit in Süditalien, Wandlungen des Familienlebens in einer süditalienischen Tourismusregion".1Die Arbeit präsentiert nun die Resultate meiner zweimonatigen Feldforschung im süditalienischen Dorf Furore an der Costiera Amalfitana (Region Kampanien).
Die Forschung wurde in Zusammenarbeit mit der Universität "La Sapienza" in Rom und dem "Centro Universitario per i Beni Culturali" in Ravello durchgeführt. Zwölf Studierende aus Bremen und sechs aus Rom beteiligten sich an dem Projekt und verteilten sich auf insgesamt zehn Orte an der Costiera. Mein Forschungsfeld war das Dorf Furore. Die Familie Ferraioli nahm mich im Februar und März 1996 für sechs Wochen als Gast in ihrem Haus auf, wodurch ich die Möglichkeit hatte, das Familienleben kennenzulernen und den Kinderalltag im Ort zu beobachten.
Eine Präsentation der Ergebnisse fand zum einen in Form einer Fotoausstellung statt, die in Ravello (Oktober 1996) und Bremen (März 1997) gezeigt wurde.2Zum anderen stellten die Teilnehmer des Projekts Ausschnitte aus den entstandenen Arbeiten dem interessierten Publikum im Rahmen eines zweitägigen Seminars im Centro Universitario in Ravello vor.
1.1 Thema und Fragestellung
Das Thema Kindheit ist in den letzten beiden Jahrzehnten immer mehr in den Mittelpunkt wissenschaftlicher Untersuchungen gerückt. Der akademische Diskurs fokussiert dabei den Wandel des Phänomens Kindheit in den als post-oder spätmodern bezeichneten Gesellschaften (Berg 1991; Hengst 1985, 1990, 1991; Zeiher 1989, 1991; Zinnecker 1990; De Bois-Reymond 1994, Zeiher/Büchner/Zinnecker 1996). An dieser aktuellen Diskussion in den Sozial-und Kulturwissenschaften wollten wir uns beteiligen, indem wir den Blick auf die sozialen Räume der Kinder richteten. Die Veränderungen dieser Räume, ihre Zusammensetzung aus verschiedenen kulturellen Elementen und die
1 Der italienische Titel der Forschung lautete: "Influenza dell' incontro di diverse culture sul patrimonio culturale in una regione turistica (Costiera Amalfitana). Analisi delle modificazioni nelle strutture e negli usi della famiglia e dell' infanzia, con referimento agli spazi abitativi."
2 Der Titel der Ausstellung lautete:"Eine Geographie der Kindheit - Momentaufnahmen süditalienischer Kindheit".
Page 5
Bedeutungen, mit denen Orte und Plätze besetzt werden, sollten an einem konkreten Beispiel analysiert werden. Die Darstellung des Kinderalltags und seiner räumlichen Ausformung wird in vielen Arbeiten zum Thema Kindheit vernachlässigt. Die Veröffentlichungen über Kindheit beständen, so die Kritik von Pamela Reynolds (1989:1), im wesentlichen aus Verallgemeinerungen. Zudem mangele es an einer Perspektive, die Kinder als aktive Produzenten ihrer eigenen Kultur wahrnimmt und ihre Sichtweise zu verstehen sucht (vgl. Dracklé 1996). Angeregt durch diese Kritik, wurde das Thema innerhalb des Projekts mittels einer ethnologischen Feldforschung untersucht. Ein Vorteil dieser qualitativen empirischen Methode ist die Möglichkeit, die Beschreibungen konkreter Situationen des Alltagslebens zum Ausgangspunkt der theoretischen Überlegungen zu machen und die Perspektive der untersuchten Gruppe in die Analyse miteinzubeziehen. Peter Bräunlein und Andrea Lauser (1994) bestätigen für den Bereich einer Anthropologie der Kindheit einen großen Nachholbedarf an Arbeiten, die sich dieser Perspektive annehmen.3
Ziel des Projektes war es, ein aktuelles Thema mit der Methode der Ethnologie in einem Gebiet zu untersuchen, das man als ein klassisches Feld der europäischen Ethnologie bezeichnen kann.
Als Forschungsfeld für die Untersuchung bot sich die Costiera Amalfitana aus mehreren Gründen an: Die südlich von Neapel gelegene Halbinsel ist Teil Süditaliens, einer Region, d ie häufig als ökonomisch rückständig und als kulturell in Tradtionen verhaftet beschrieben worden ist (vgl. Gribaudi 1996). Darüber hinaus ist die Costiera eine berühmte Tourismusregion, in der die lokalen Traditionen in einen engen Kontakt zu globalen kulturellen Elementen treten, die durch den internationalen Tourismus befördert werden. Die Situierung der Forschung in einer Region, in der ein rapider Wandel von einer agraischen zu einer modernen Dienstleitungsgesellschaft stattgefunden hat, erschien uns als besonders reizvoll.
Einen weiteren Anstoß, eine Forschung über Familie und Kindheit gerade in Süditalien durchzuführen, gab der wissenschaftliche Diskurs, der in der Vergangenheit von Gegensätzlichkeiten geprägt war. Den
Romantisierungstendenzen in einigen Arbeiten (z. B. Schitteck 1979, van Hentig 1975) stehen Studien gegenüber, die die ökonomische und politische Marginalisierung des Südens insbesondere auf die Strukturiertheit der süditalienischen Familie zurückführen. So ist etwa in der einflußreichen Arbeit von Edward Banfield (1967) die Rede vom "amoralischen Familiarismus".
3 Ebenso van de Loo/Reinhard 1993.
Page 6
Das Thema wurde innerhalb des Projekts anhand von zwei Fragenkomplexen bearbeitet, die ich für meine Magisterarbeit übernommen habe. In einem ersten Schritt wird nach den Orten, Plätzen und Räumen der Kinder gefragt: Welche privaten und öffentlichen Institutionen bieten Raum für die Kinder? Wie sieht die Infrastruktur für die Kinder in Furore aus, und welche sozialen Situationen finden in den verschiedenen Räumen statt? Lassen sich auch in Süditalien die für den Norden Europas beschriebenen Tendenzen der 'Individualisierung' (Zinnecker 1990) und 'Verinselung' (Zeiher 1989) der Kindheitsräume beobachten oder steht die Familienorientierung im Vordergrund? Gibt es auch dort immer mehr spezialisierte Angebote für Kinder oder handelt es sich eher um funktionsdiffuse Plätze, die von den Kindern als Spiel-Räume genutzt werden?
Die zweite Fragestellung zielt auf die Verknüpfungen zwischen den lokalen und globalen kulturellen Elementen in den Kindheitsräumen: Welche Verbindungen und Verschränkungen zwischen der lokalen Tradition und einer globalen Kinderkultur lassen sich in den Kinderräumen beobachten, und welche sozialen Folgen haben diese Kombinationen? Eine romantisierende Sichtweise würde die Gefährdung lokaler Traditionen und Werte im Zuge der Modernisierung und Globalisierung im süditalienischen Untersuchungsgebiet in den Mittelpunkt rücken. Die vorliegende Arbeit versucht sich in einer pragmatischeren Analyse. Das Globale wird dem Lokalen nicht polarisierend gegenübergesetzt, sondern es sollen die kulturellen Synthesen und Neuschöpfungen, die sich im Alltagsleben der Kinder herstellen, untersucht werden. Dabei wird davon ausgegangen, daß eine zunehmende zeitliche und räumliche Vernetzung der lokalen Schauplätze mit einer globalen "Weltkultur" stattfindet, so daß kaum mehr allein von geographischen Räumen gesprochen werden kann, die eine bestimmte, klar abgegrenzte Kultur beinhalten (vgl. Kearny 1995, Hannerz 1995, Breitenbach/Zukrigel 1995, Appadurai 1990).
Die Fragestellung läßt sich folgendermaßen zusammenfassen: Wo finden sich die sozialen Räume der Kinder, aus welchen Elementen (global/lokal) sind sie zusammengesetzt? Wie sind die sozialen Beziehungen und Situationen in diesen Räumen strukturiert, und welche Veränderungen haben die Kindheitsräume in den letzten Jahren erfahren?
1.2 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit ist in zwei größere Abschnitte gegliedert. Im ersten werden der theoretische Rahmen und die Methoden der Untersuchung vorgestellt.
Page 7
Im ersten Kapitel dieses Abschnitts beschäftigte ich mich mit dem Konzept des sozialen Raums. Die Fragestellung der Untersuchung wird theoretisch eingefaßt und erläutert. Anschließend referiere ich Ergebnisse der
kulturwissenschaftlichen Kindheitsforschung. Ausgehend von den 'Vorläufern' dieser Forschungsrichtung konzentriere ich mich dabei auf die Themen Kinderräume und Medienkonsum, da sich insbesondere im Bereich der Medien die Verknüpfungen zu einer globalen Kinderkultur herstellen. Das letzte Kapitel dieses Abschnitts schildert die bei der Feldforschung angewandten Methoden und problematisiert die Besonderheiten einer Forschung mit Kindern. Der zweite Abschnitt der Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Feldforschung. Zu Beginn stelle ich das Dorf Furore vor, um anschließend im Kapitel 'Kinderräume in der Familie' das von mir beobachtete Leben einer Großfamilie und die sozialen Situationen und Räume der dort lebenden Kinder zu beschreiben. Die Beobachtung eines Tagesablaufs der siebenjährigen Luisa dient dann als 'roter Faden', um die Institutionen Schule, Vorschule, den Katechismusunterricht und die öffentlichen Räume der Kinder zu schildern. Im letzten Kapitel widme ich mich dem Fußballspiel der Kinder. An diesem Beispiel sollen die genannten Fragestellungen vertieft werden. Die Räume dieses Spiels werden beschrieben und die Bedeutungen dieses sozialen Phänomens für die sekundäre Sozialisierung besonders der Jungen werden herausgestellt. Während meines Aufenthalts in Furore konnte ich beobachten, daß eine große Anzahl der Kinderräume durch dieses Spiel geprägt waren. Am Phänomen Fußball lassen sich die Verbindungen lokaler Gegebenheiten mit den meist medial vermittelten nationalen und globalen Ereignissen in den sozialen Räumen der Kinder aufzeigen.
2.Konzepte des sozialen Raumes
Zu Beginn der Arbeit werde ich den theoretischen Rahmen für die oben gestellten Fragen skizzieren. Konzepte zum sozialen Raum finden sich in einer Vielzahl soziologischer und ethnologischer Arbeiten, da Raum neben der Zeit eine Grundvoraussetzung sozialen Handelns ist.
Im folgenden sollen die verschiedenen Dimensionen, die ein Raum als sozialer Raum hat, in drei aufeinander aufbauenden Schritten nachgezeichnet werde. Zuerst wird der Zusammenhang zwischen dem physischen Raum und den handelnden Personen geschildert, dabei beziehe ich mich auf Überlegungen, die auch in der Kindheitsforschung angewandt werden (Muchow 1935, Zeiher 1989). Anschließend wird nach den Veränderungen sozialer Räume im Zuge
Page 8
der Globalisierung gefragt (Giddens 1996, Morley 1997) und abschließend wird das Verhältnis zwischen dem sozialen Raum und der kulturellen Identität einer Gemeinschaft problematisiert (Hall 1994 a, b; Halbwachs 1967).
2.1 Die Beziehungen zwischen dem physischen Raum und den Personen
Raum bezeichnet in erster Hinsicht eine dreidimensionale physische Gegebenheit. Erst wenn Menschen in ihm agieren, soziales Handeln stattfindet, interpersonelle Beziehungen eingegangen werden, wird er zu einem sozialen Raum. Zwischen den Individuen und ihren Handlungsräumen besteht eine enge Beziehung. Martha Muchow (1935), die als erste die Kategorie Raum bei der Beschreibung des Kinderlebens in einer Großstadt verwandte, bezeichnete in ihrer Studie diese 'Lebensräume'4als 'personale Welt', die erst im Wechselspiel zwischen Person und Umwelt entsteht (ebd: 71). Zwischen den physischen Gegebenheiten und den Interessen der handelnden Personen entwickelt sich eine Relation mit dialektischen Merkmalen. So beeinflußt zum einen der physische Raum die Möglichkeiten des Handelns, zum anderen bestimmen die Interessen der handelnden Individuen das Geschehen in einem sozialen Raum. Zudem sind die Räume oft erst von Menschen geschaffen oder zumindest bearbeitet. Dies gilt im besonderen Maße für den untersuchten Ort Furore. Der größte Teil der 'bewohnbaren' Flächen wurde der naturgegebenen Landschaft mit viel Mühe abgerungen. Wohnhäuser, Straßen, Parkplätze und Gärten sind in die stark abfallende Landschaft integriert. Das begrenzte Angebot von ebenen Flächen ist mit großer Kreativität erweitert worden. Den so entstandenen Gebäuden und Plätzen wurde von den Erbauern häufig eine bestimmte Funktion zugedacht. Die Nutzung dieser Räumlichkeiten kann aber durchaus vielschichtig sein. Der Kirchenvorplatz in Furore ist a m Sonntagmorgen vor der Messe Treffpunkt der Kirchgänger, die hier ihre Beziehungen pflegen, Informationen austauschen und Verabredungen treffen. Der gleiche Schauplatz wird zu einem anderen Zeitpunkt zum sozialen Raum der Kinder, die sich dort zum Spielen versammeln. Verschiedene Gruppen besetzen vorübergehend ein und denselben Ort mit unterschiedlichen Interessen. Die Subjekte bleiben hier trotz einer vorgegebenen Räumlichkeit mit
4 Der Begriff 'Lebensraum' steht bei Martha Muchow in keinem Zusammenhang mit dem nationalsozialistisch geprägten Begriff, der zur ideologischen Rechtfertigung der Überfälle auf Polen und die Sowjetunion benutzt wurde. Der Soziologe Jürgen Zinnecker (1998: 5), der die Studie Muchows 1978 und 1998 neu veröffentlichte, vermutet, daß der Begriff Lebensraum im Zusammenhang mit dem Ersterscheinungsjahr eine Auseinandersetzung mit der Studie über lange Zeit verhindert hat.
Page 9
'eingeschriebener' Funktion die kreativen Akteure, die das Geschehen an einem Schauplatz bestimmen. Die Kirchentür wird zum Fußballtor.
Die architektonischen Ausgestaltungen und die Ausstattungen der Räume beeinflussen die dort möglichen Handlungen und Beziehungen besonders dann, wenn es sich um hochspezialisierte Räume handelt. Die Kindheitsforscherin Helga Zeiher (1994: 353) formuliert diesen Zusammenhang so:
"Räumliche Gegebenheiten stellen Möglichkeiten und Grenzen für das Tun dar. In den Einteilungen, Abgrenzungen und Entfernungen, in den Ausstattungen und Zuordnungen der r äumlichen Welt sind soziale Verhältnisse verfestigt."
Zeiher entwickelte ihr Raumkonzept insbesondere für den städtischen Raum. Moderne Großstädte zeichnen sich durch einen hohen Grad der Spezialisierung des Raumangebotes aus. Die Handlungen werden dort v iel mehr von der Ausgestaltung des Raumes bestimmt, als dies in ländlichen Gebieten der Fall ist, wo es mehr funktionsdiffuse Räume gibt, die eher mit unterschiedlichen Interessen verschiedener sozialer Gruppen besetzt werden können. Bei der Untersuchung der Kinderräume wird der Blick darauf gerichtet, ob die Räume speziell für Kinder ausgestattet sind oder ob es sich bei den Kinderräumen eher um funktionsdiffuse Plätze und Örtlichkeiten handelt. Um diese Unterscheidung begrifflich zu fassen, bietet sich e ine Überlegung Hermann Bausingers (1987:16) an, die dieser für den Begriff Kinderkultur eingeführt hat. Bausinger unterscheidet zwischen der 'KulturfürKinder', d.h. von Erwachsenen speziell für Kinder angebotene Kinderkultur, und der 'KulturderKinder', die diese unabhängig von Erwachsenen schaffen. Parallel dazu kann zwischen den 'RäumenfürKinder', d.h. von den Erwachsenen speziell für Kinder zur Verfügung gestellte Räumlichkeiten, und den 'RäumenderKinder', d.h. Plätze und Orte, die Kinder mit ihren Interessen besetzen, differenziert werden. Für die Beschreibung der Kinderräume in Furore ist diese Perspektive interessant, da es wegen der allgemeinen Begrenztheit der Flächen nur wenige speziell für Kinder ausgestattete Räume gibt. Es ist ein Ziel dieser Arbeit zu beobachten, mit welchen Strategien die Kinder sich ihre Spiel-Räume sichern.5
Mit Bezug auf Maurice Halbwachs (1967) möchte ich eine weitere wichtige Dimension des architektonisch ausgestalteten Raums ansprechen. In diesen
5 Mitunter ist es aber nicht möglich, einen Raum genau zuzuordnen. Zum Beispiel ist es nicht zu entscheiden, ob es sich im familiären Umfeld, um Räume der Kinder oder um Räume für Kinder handelt, da die Grenzen hier fließend sind.
Page 10
Räumen werden die Geschichte und die Tradition einer Gemeinschaft repräsentiert. Halbwachs unterstreicht die Bedeutung der emotiven Qualitäten, mit denen die räumliche Umgebung besetzt werden, für die Identität und die Kontinuität sozialer Gruppen. Die Strukturen eines Ortes, mit dem eine Gruppe in konstanter Beziehung steht und auf den sie kreativ einwirkt, präge sich in die Vorstellung der dort Lebenden ein, und so werde Kontinuität und Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft erzeugt. Soziale Räume stehen somit in einer engen Beziehung zu der dort ausgebildeten kulturellen Identität. Die Beziehung zwischen lokalem Schauplatz, handelndem Subjekt und dessen kultureller Identität hat sich unter den Bedingungen der Globalisierung verändert. Hierauf werde ich nun genauer eingehen.
2.2 Die Veränderung sozialer Räume im Prozeß der Globalisierung
Der englische Soziologe Anthony Giddens beschreibt als eine Konsequenz der Moderne6die Ablösung der sozialen Handlungen vom lokalen Schauplatz. Soziales Handeln sei nicht mehr ausschließlich an einen Ort gebunden.
"In vormodernen Gesellschaften fallen Raum und Ort weitgehend zusammen, weil die räumliche Dimensionen des gesellschaftlichen Lebens für den größten Teil der Bevölkerung und in den meisten Hinsichten von der 'Anwesenheit' bestimmt werden: an einen Schauplatz gebundene Tätigkeiten sind vorherrschend." (Giddens 1996:30)