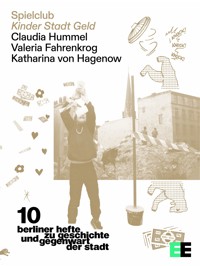
Spielclub. Kinder Stadt Geld E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EECLECTIC
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Berliner Hefte zu Geschichte und Gegenwart der Stadt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Von 1969 bis 1971 entwickelte eine Arbeitsgruppe der neuen Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK) eine kapitalismuskritische Spielform für und mit Kindern der Arbeiterklasse. Über mehrere Monate hinweg errichteten Künstler*innen gemeinsam mit jungen Bewohner*innen des Kulmer Kiezes in Berlin-Schöneberg eine Alternative zu den Versprechungen der Spielwarenindustrie. Im sogenannten Spielklub entstand eine Spielstadt, in der die Mechanismen kapitalistischen Wirtschaftens erfahren und dadurch durchschaubar werden sollten. Im Winter 2019/20 wurde das Prinzip unter dem Namen Spielclub Oranienstraße 25 in der nGbK reaktiviert. Schulklassen verbrachten hier Spieltage zu Stadtentwicklungsthemen, wie beispielsweise der Mietenpolitik und Fragen der Teilhabe an gesellschaftlichen Veränderungen. Die Macht des Geldes spielte dabei immer eine Rolle. „Was hat die Hotelbesitzerin gemeinsam mit der Bürgermeisterin vor?“, Wem gehört die Brache?“, „Was fehlt unserer Straße?“ und „Lässt sich das Spiel im Spielclub gewinnen?“ lauteten einige Fragen der Kinder. Dieses Heft verortet den historischen Spielklub sowohl in der Ideengeschichte selbstverwalteter Kinderrepubliken als auch im Kontext künstlerisch-aktivistischer Projekte der 1970er Jahre. Spielclub. Kinder Stadt Geld. reflektiert das Verhältnis von Kindern und Künstler*innen, Spiel und Wirklichkeit und zeigt die Unterschiede der mit 50 Jahren Abstand realisierten Projekte. Das E-Book wird durch einen Filmausschnitt zur Spielstadt im Märkischen Viertel, ei-ner temporären Erweiterung des Schöneberger Spielklubs vom Juni 1971, sowie durch zwei Audiobeiträge ergänzt. Produziert anlässlich des Projekts Spielclub Oranienstraße 25, nGbK, 2019/20
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Berliner Hefte zu Geschichte und Gegenwart der Stadt #10
Spielclub. Kinder Stadt Geld
Claudia Hummel, Valeria Fahrenkrog, Katharina von Hagenow (Hg.)
Von 1969 bis 1971 entwickelte eine Arbeitsgruppe der neuen Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK) eine kapitalismuskritische Spielform für und mit Kindern der Arbeiterklasse. Über mehrere Monate hinweg errichteten Künstler*innen gemeinsam mit jungen Bewohner*innen des Kulmer Kiezes in Berlin-Schöneberg eine Alternative zu den Versprechungen der Spielwarenindustrie. Im sogenannten Spielklub entstand eine Spielstadt, in der die Mechanismen kapitalistischen Wirtschaftens erfahren und dadurch durchschaubar werden sollten.
Im Winter 2019/20 wurde das Prinzip unter dem Namen Spielclub Oranienstraße 25 in der nGbK reaktiviert. Nun spielten Berliner Schulklassen in einem Nachbau der Kreuzberger Oranienstraße um die Stadt. Im Vordergrund stand die Beschäftigung mit aktuellen Stadtentwicklungsfragen, wie beispielsweise die Mietenpolitik oder die Teilhabe an gesellschaftlichen Veränderungen. Die Macht des Geldes spielte dabei immer eine Rolle.
„Was hat die Hotelbesitzerin gemeinsam mit der Bürgermeisterin vor?“, Wem gehört die Brache?“, „Was fehlt unserer Straße?“ und „Lässt sich das Spiel im Spielclub gewinnen?“ lauteten einige Fragen der Kinder.
Dieses Heft verortet den historischen Spielklub sowohl in der Ideengeschichte selbstverwalteter Kinderrepubliken als auch im Kontext künstlerisch-aktivistischer Projekte der 1970er Jahre. Die Ereignisse im Spielclub Oranienstraße 25 werden vorgestellt und von den beteiligten Spielleiter*innen rückblickend reflektiert.
Abb. 1
Berliner Hefte zu Geschichte und Gegenwart der Stadt #10
Spielclub. Kinder Stadt Geld
Claudia Hummel
Spielclub. Eine Ideengeschichte
ABCD
Klaus Böllhoff / AG Spielumwelt
Spielorte in Schöneberg 1970
Zusammengestellt von Valeria Fahrenkrog
Katja Reichard
Wandernde Kameras
Operative Medienpraxis, Projektarbeit
und kollektive Organisierung im Berliner
Märkischen Viertel der 1970er Jahre
Katharina von Hagenow
SPIELCLUB ORANIENSTRASSE 25
Vivian Chan
LÄSST SICH DAS SPIEL IM SPIELCLUB GEWINNEN?
Ximena Gutiérrez Toro
„WAS FEHLT UNSERER STRASSE?“
Zsófia Puszt
DIE REALITÄT DER ALTEN DAME
Christina Harles
DER SPIELCLUB ALS VISIONARY FICTION
Bibliografie
Abb. 2
SPIELCLUB. EINE IDEENGESCHICHTE
Claudia Hummel
A
Von November 2019 bis Januar 2020 fand in der neuen Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK) der Spielclub Oranienstraße 25 statt. Kinder und Jugendliche spielten dort in einer Spielstraße mit Spielgeld um die Stadt – so, wie es auch schon Kinder in einem Spielklub 1970 in der Kulmer Straße 20a in Berlin-Schöneberg getan haben. Beide Spielclubs1 lassen sich in einer Ideengeschichte lesen, die politische wie pädagogische Intentionen verfolgte und immer wieder zu künstlerisch-performativen Mitteln griff. Für uns war diese Form der künstlerisch-edukativen Arbeit im Winter 2019/20 faszinierend neu. Im vorliegenden Heft reflektieren wir unseren Spielclub und die Geschichte, in der dieser damit steht.
Die Ideengeschichte beginnt möglicherweise 1911 in Warschaus jüdischem Waisenhaus Dom-Sierot. In der von dem Pädagogen Janusz Korczak geleiteten Institution gab es ein Kinderparlament, ein Kameradschaftsgericht, in dem Kinder wie Erwachsene angeklagt werden konnten, und eine eigene Zeitung.
Fünf Jahre später wird in Omaha in Nebraska, USA die bis heute existierende Boys Town von dem katholischen Priester E. J. Flanagan gegründet. Bekannt wurde die Stätte1938 durch den Spielfilm Boys Town, der auf Deutsch unter dem Titel Teufelskerle lief.
Die lettische Regisseurin Asja Lācis entwickelt in der russischen Stadt Orel von 1918 bis 1919 ein Kindertheater für und mit Straßenkindern. Die Kinder waren für Kulissen, Kostüme, Texte und Figurenentwicklung in dem Theater selbst verantwortlich. Walter Benjamin schrieb 1924, von Lācis Arbeitsweisen begeistert, das Programm eines proletarischen Kindertheaters. Der Text zirkulierte ab 1969 als unautorisierter Reprint in der Kinderladenbewegung und erschien 1971 im Buch Revolutionär im Beruf. Berichte über proletarisches Theater, über Meyerhold, Brecht, Benjamin und Piscator der Literaturwissenschaftlerin Hildegard Brenner.
Im Wiener Stadtbezirk Alsergrund wurde die Idee einer gewaltfreien und demokratischen Erziehung von der ehrenamtlich im Arbeiterverein Kinderfreunde tätigen und bürgerlichen Hermine Weinreb weiterverfolgt. Während des Ersten Weltkriegs organisierte sie 1915 auf eigene Kosten eine Sommererholungsaktion für Wiener Arbeiterkinder. Ziel war es, den Kindern Bewegung an der frischen Luft und gehaltvolle Ernährung zu geben, da Tuberkulose, Unterernährung und schlechte Wohnbedingungen das Leben der Kinder erschwerten. Aus ähnlichen Gründen organisierte 1919 im österreichischen Gmünd der Arbeiterverein Kinderfreunde mit Unterstützung der US-amerikanischen Kinderhilfsaktion American Relief Administration für ca. 1.400 Wiener Kinder in zwei Durchgängen ein mehrwöchiges Sommercamp. Dieses fand in einer verlassenen Barackenstadt statt, die während des Ersten Weltkriegs geflüchtete Menschen beherbergte. Hermine Weinrebs Erziehungsvorstellungen setzte in Gmünd Otto Felix Kanitz um. Das Lager war in mehrere Kindergemeinden aufgeteilt, die sich in Selbstverwaltung organisierten. In der späteren pädagogischen Reflexion wurde dieses Sommercamp als erste Kinderrepublik Europas bezeichnet.
Eine Schulkommune namens Dostojewski (SchKID) bestand in Pedrograd von 1920 bis 1925. Sie bot Straßenkindern nach der Oktober-Revolution und einem Bürgerkrieg mit Hungersnot einen Unterschlupf. Die Kinder verwalteten sich dort von einem Lehrerpaar unterstützt selbst. Basierend auf diesen Erfahrungen erschien in der Sowjetunion 1927 ein teilweise autobiografischer Erziehungsroman von Leonid Pantelejew und Grigorij Georgijewitsch Belych. Der Verlag der Jugendinternationale Berlin publizierte diesen als Republik der Strolche 1929 auf Deutsch.
Über 2.000 Kinder kamen 1927 in Kiel für die Kinderrepublik Seekamp, die erste ihrer Art in Deutschland, zusammen. Die von den Kindern errichtete Zeltstadt war in mehrere Dörfer aufgeteilt. Erwachsene Begleiter*innen wurden als „Helfer“ bezeichnet. Ziele der Kinderrepublik waren Demokratiebildung und Selbstorganisation. Es gab ein Lagerparlament, eine Lagerzeitung und ein Lagergericht. Als größtes Ereignis wurde eine Friedenskundgebung genannt, bei der die Dorfgemeinschaften nach einem Festzug an den Überresten eines Forts eine Flagge mit der Aufschrift „Nie wieder Krieg“ hissten. Die Kinderrepublik Seekamp wurde von der Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde, einer Teilgruppe der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik mit über 200.000 Mitgliedern, organisiert. Die Arbeitsgemeinschaft wollte durch Demokratiebildung und Hygieneerziehung der Verelendung der Kinder entgegenwirken. Die in drei Altersgruppen zwischen acht und vierzehn Jahren aufgeteilten Kindergruppen nannten sich Falken. Ihr Mentor war der Berliner Stadtschulrat und Bildungsreformer Kurt Löwenstein. Die Roten Falken (die Jugendgruppen unter den Falken) organisierten in den darauffolgenden Jahren in Üdersee, in Lübeck und anderen Teilen Deutschlands, Österreich, Dänemark und der Schweiz weitere Kinderrepubliken. Die Ästhetik und Naturverbundenheit der Kinderrepubliken und deren Jugendverbänden wurden dann von den Nationalsozialist*innen gekapert und zerstört.
Im Konzentrationslager Terezin / Theresienstadt gab es, durch den Roman Republik der Strolche inspiriert,von 1942 bis 1944 die Republik Škid, eine Kinderrepublik mit circa fünfzig 13 bis 15-jährigen Jungen. Ermutigt von ihrem Erzieher Valtr Eisinger (1913–1945), der ihnen die Inhalte des Romans vermittelte, bauten die Jungen eine Selbstverwaltung auf. Viele von ihnen trugen dazu bei, das handgeschriebene literarische MagazinVedem herauszugeben. Ungefähr 15 Jungen überlebten das Konzentrationslager.
1945 gründete 70 Kilometer von Rom entfernt der in den Vatikan entsandte irische Geistliche Monsignore John Patrick Carroll-Abbing zusammen mit Don Antonio Rivolta die Kinderrepublik von Civitavecchia: La Repubblica dei Ragazzi. In dieser lebten zunächst circa 200 Jungen, in erster Linie Kriegswaisen. Das pädagogische Programm basierte auf Selbstverwaltung und Selbstversorgung. Mit den Meriten hatte das Dorf sogar eine eigene Währung.
In Budapest existierte sechs Jahre die selbstverwaltete Kinderrepublik Gaudiopolis (Stadt der Freude). Vom lutherischen Geistlichen Gábor Sztehlo 1945 in einer besetzten Villa ins Leben gerufen und sich später auf weitere leerstehende Häuser ausbreitend, lebten dort Kriegswaisenkinder. Sie gaben sich eine Verfassung, eine Währung, eine Zeitung, etablierten eine eigene Polizei und ernannten Richter für ein Gericht. Mädchen waren von der Selbstverwaltung ausgeschlossen. Zum Erwerb des Lebensunterhalts der Kinder gab es Handwerksbetriebe. Es war auch erlaubt, zu betteln und zu stehlen. Ein selbst angelegter Fußballplatz wurde selbst bespielt oder an andere vermietet. Franciska Zólyom kuratierte 2018 in der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig die Ausstellung Gaudiopolis – Versuch einer guten Gesellschaft. Die Ausstellung stellte auch andere hier genannte Kinderrepubliken vor.
Der katholische Priester Jesús Silva Méndez gründete 1957 die spanische Kinderrepublik Bemposta. In der vondenKindern selbstverwalteten ‚Stadt‘ lebten und arbeiteten bis zu 2.000 Jungen. Diese waren entweder Waisen oder deren Eltern übertrugen das Erziehungsrecht mit dem Einverständnis der Kinder auf den Pater. In Bemposta gab es eine Schule und verschiedene Produktionsstätten. Deren Erzeugnisse wurden weltweit verkauft. Durch den KinderzirkusMuchachos, der international tourte, wurden die Aktivitäten von Bemposta bekannt und sichtbar. Die Spielklub-Künstler*innen der Kulmer Straße hatten von der Kinderrepublik Bemposta gehört. Zwei von ihnen besuchten eine Muchachos-Vorführung bei einem Gastspiel in Berlin und reisten nach ihrer eigenen Spielklubzeit 1973 selbst nach Bemposta.
Im Herbst 1968 verwandelte der dänische Künstler Palle Nielsen das Museum für Moderne Kunst (Moderna Museet) in Stockholm unter dem Titel Modellen. En modell för ett kvalitativt samhälle (dt.: Das Modell. Ein Modell für eine qualitative Gesellschaft)in einen großen Abenteuerspielraum für Kinder. Die schwedische Gruppe Aktion Samtal (dt: Aktion Dialog) hatte Nielsen hierzu eingeladen. Modellen bestand aus in den Raum eingebauten Holzstrukturen, in denen geklettert, getobt, gebaut, gemalt und auch Theater gespielt werden konnte. Zentrales Element der Installation war ein Sprungbad aus Schaumgummistücken. Der Künstler wollte zeigen, wie Kinder spielen, wenn sie dazu die aus seiner Perspektive besten Bedingungen haben. Eine begleitende Forschung untersuchte Momente spontaner Zusammenarbeit unter den Kindern.
Modellen war Teil der von 1968 bis 1978 existierenden Aktion Samtal. Die Gruppe forderte alternative Spielplätze in verschiedenen Stadtteilen Stockholms. Dabei betrieb die Gruppe auch selbst Bauspielplätze. Einmal demontierten sie gemeinsam mit Bewohner*innen in einem Stockholmer Stadtteil die Zäune zwischen benachbarten Innenhöfen der Wohnblöcke und schufen damit einen neuen Kinderspielraum.
Auf das Projekt Modellen und die Aktion Samtal wurde vielfach Bezug genommen. 2009 griff der Kurator Lars Bang Larsen im Museum für zeitgenössische Kunst in Barcelona (MACBA) Nielsens Projekt auf, reinszenierte es und publizierte dazu. 2014 wurde Modellen zehn Monate lang vom Arken Museum in Dänemark wiederaufgeführt. In Stockholm forscht die Gruppe Action Archiv (Helena Mattsson, Meike Schalk und Sara Brolund de Carvalho) weiterhin zu den Aktionen der Gruppe. Der Künstler Mats Eriksson Dunér produzierte 2020 einen Dokumentarfilm aus Archivmaterialien und Interviews mit den Initiator*innen von Aktion Samtal.
Kunstpädagog*innen aus München und Nürnberg gründeten 1968 KEKS (Kunst, Erziehung, Kybernetik und Systemtheorie; in manchen Schriften auch Kunst, Erziehung, Kybernetik und Soziologie). In den folgenden zwei Jahren führten die Mitglieder mit Schulkindern kunstpädagogische Aktionen in Nürnberg durch, die den städtischen Raum in seiner Ordnungsstruktur derart provozierten, dass mitunter die Polizei einschritt. Zuvor hatte KEKS einen Aktionsraum in der Stadt eingerichtet, in dem Kinder experimentell mit unterschiedlichen Materialien und durch Rollenspiele agieren konnten. Aktion war bei KEKS Methode. Einige der Künstler*innen des Spielklubs Kulmer Straße 20a hatten Kontakte zu KEKS. Es wird von einem Besuch des KEKS-Mitglieds Wolfgang Zacharias im Spielklub erzählt.
Abb. 3, 4 Blicke in den Spielklub 1971.
Die Arbeitsgruppe Spielumwelt sucht ihr Konzept2
Am 8. September 1969 traf sich die von den Künstler*innen Göta Tellesch und Gernot Bubenik initiierte Arbeitsgruppe Kinderspielzeug der NGBK3, die sich später AG Spielumwelt nannte, zum ersten Mal.4 Die AG bestand aus bildenden und darstellenden Künstler*innen, Psycholog*innen, Soziolog*innen, Eltern, Mitarbeiter*innen aus Kinder- und Schülerläden und Pädagog*innen,5 die ein Interesse an der künstlerischen Arbeit im „Sozialisationsbereich“6 teilten. In den ersten AG-Sitzungen im September/Oktober 1969 wurden aktuelle pädagogische Literatur, Berichte über Kinderläden und Erfahrungsberichte von Eltern über den Umgang ihrer Kinder mit industriell gefertigtem und mit improvisiertem, der realen Umwelt entnommenen Spielzeug diskutiert. Die AG Kinderspielzeugstrebte die Untersuchung von gegenwärtigen Kinderspielwelten (darunter Spielplätze wie Kinderläden), Kinderspielzeugen und Kinderbüchern an. Der Fokus verschob sich nach wenigen Monaten auf die Einrichtung einer gemeinsam mit Kindern entwickelten Spielumwelt.
Der dafür benötigte Raum in einem Berliner Arbeiterviertel wurde schnell gefunden: Bereits im Herbst 1970 konnte im 4. Stock des 3. Hinterhofgebäudes der Kulmer Straße 20a in Berlin-Schöneberg eine ehemalige Fabriketage mit einer Fläche von 380 qm für 750 DM im Monat angemietet werden. Verschiedene Künstler*innen der AG,7 manche davon noch Studierende, und eine Psychologin begleiteten die Entwicklung des Aktionsraumes – schließlich ging es auch um eine teilnehmende Beobachtung am Spielgeschehen der Kinder. Es galt herauszufinden, inwiefern Kinder im Spiel und über das Medium Spielzeug etwas über die gesellschaftliche Umwelt erlernen. Die Erfahrungswelt der Kinder, so die These, sei durch die Trennung von Leben und Arbeit auf die „mütterliche Umwelt“ eingeengt. Den Kindern sollten vielmehr „Funktionszusammenhänge“ der realen Umgebung vermittelt werden.8
In den 1970er Jahren formulierte sich eine ansatzweise marxistischeSpielzeugkritik, die aus einer Kritik an der kapitalistischen Warenwelt und der Segregation durch die Klassengesellschaft entstand. „Spielzeug ist für das Kind ein Mittel zur Erlernung der gesellschaftlichen Umwelt“9 schrieben die Mitglieder der AG Kinderspielzeug in ihrem Projektantrag zur Hauptversammlung der NGBK. Die Arbeitsgruppe wollte demzufolge Kinderspielzeug und Kinderbücher erstellen, mit denen „vor allem die soziale Intelligenz, die Gruppenkommunikation, die Überwindung des Egozentrismus und Narzißmus, Kreativität und Sensibilisierung der sinnlichen, geistigen und emotionalen Potenzen beim Kind gefördert werden sollen. Das entwickelte Spielzeug und die Kinderbücher mit Modellcharakter sollten zusammen mit einer kritischen Demonstration des auf dem Markt befindlichen Spielzeugs in einer Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.“ 10
Die Pädagogin Donata Elschenbroich erforschte zu jener Zeit Spielzeug und zeigte, dass in Spielobjekten unterschiedliche gesellschaftliche Rollenerwartungen an das Kind mitformuliert wurden; etwa bei Puppenhäusern, mit denen Kinder die gesellschaftlichen Rollen von der Hausherrin bis zur Dienstbotin einüben konnten. Sie schrieb zum Verhältnis von Klasse und Spielzeug bei Kindern der Mittelschicht und der Arbeiterfamilien:
Wenn innerhalb des Spielzeugs, das Arbeiterkindern am nächsten ist, die Spielgegenstände überwiegen, die man nur konsumieren kann, liegt das nicht nur daran, daß mittelständisches Spielzeug zum Selbstproduzieren – wie Lego, Plasticant, Holzbausteine, Technikkästen – teurer [ist] als Lutschketten und Heulrohre. Die Wohnverhältnisse selbst verbieten solch ‚konzentrationsförderndes Spielzeug‘, es ist einfach kein Platz da; was die Kinder produziert haben, kann doch nicht stehenbleiben.11
Abb. 5 Spielzeugforschung der AG Spielumwelt.
1975 arbeiteten Peter Möbius, Mitgründer des Hoffmanns Comic Teaters und Mitglied der NGBK-AG Spielumwelt, und Donata Elschenbroich an der Ausstellung Spielzeug – und wozu es gebraucht wird12 im Internationalen Designzentrum Berlin (IDZ) mit. In dieser „Ausstellung für Erwachsene“13 wurde beispielhaft die Frage gestellt, inwieweit das Angebot von Puppen oder Kriegsspielzeug bis hin zum sogenannten Billigspielzeug die Kinder von den Erwachsenen isoliert und das Warenangebot den Kindern überhaupt Liebe, Besitz, Selbstbewusstsein ersetzen und die Bewältigung von Konflikten ermöglichen kann.14
Gezeigt wurden alternative Vorschläge zur illusionsversprechenden Spielzeugindustrie, die sich den Möglichkeiten des ‚realen‘ Handelns von Kindern in ihrer Spielumwelt widmeten.
Kinderals Gesellschaftsgruppe erhielten mit der Studentenbewegung der späten 1960er Jahre in der linken Öffentlichkeit West-Berlins und der Bundesrepublik Deutschland eine neue Aufmerksamkeit. Diese verband sich mit der Idee, durch eine Veränderung in der Erziehung der Kinder auch eine Veränderung in der Gesellschaft zu ermöglichen. Selbstentfaltung, Selbstbewusstsein und eine Befreiung von herkömmlichen Vorstellungen von Kindheit, die Kinder als unfertige Menschen deklassieren und einengen, sollte mit antiautoritären Erziehungsformen ermöglicht werden. Die zu entwickelnden Konzepte sollten mitverhindern, dass die Gesellschaft in autoritäre Strukturen, wie jene des Nationalsozialismus, zurückfällt. Parallel zur antiautoritären Pädagogik wurde eine auf Ansätze der 1920er Jahre aufbauende sozialistische Pädagogik diskutiert. Kinder, und vor allem diejenigen aus proletarischen Familien, waren die Hoffnungsträger*innen einer besseren Zukunft.
Zur neuen Aufmerksamkeit für Kinder und der Arbeit an einem linken pädagogischen Projekt wurde in der Folge vielfältig publiziert. Zunächst zirkulierten in Kinderläden pädagogische und auch psychologische Schriften als unautorisierte Reprints. Bald darauf erschienen ganze Buchreihen in Verlagen wie dem März Verlag,15 dem Rowohlt Verlag (rororo)16 oder dem Basis Verlag in Berlin.17 Auch die aus der Zeit der Studentenrevolten resultierende Monatszeitschrift Kursbuch18 widmete sich 1973 in der Ausgabe Nummer 34 dem Thema ‚Kinder‘, unter anderem mit einem Text der amerikanischen Schriftstellerin und Radikalfeministin Shulamith Firestone.19 In einem historischen Rückgriff formulierte die Autorin, wie das Konstrukt ‚Kindheit‘ dazu führe, Kinder von der Welt der Erwachsenen abzuspalten. Sie forderte die Befreiung der Kinder und der Frauen aus den autoritären, patriarchalen Verhältnissen. Was sich damals radikal progressiv las, erscheint heute aufgrund der weißen Perspektive und dem inhärenten binären Geschlechterdenken kritisch. Die Befreiung der Kinder von erwachsenen Zwängen und rückschrittlichen Vorstellungen von Kindern gestand den Kindern auch eine Sexualität zu. Eine ‚Befreiung‘, die von Erwachsenen zum Schaden der Kinder auch ausgenutzt wurde.
In der Kursbuch-Ausgabe beschrieben die Spielklub-Künstler*innen vom Hoffmanns Comic Teater mit ihrem Text Kinderkultur die Zwänge und Gefahren einer „diktierten Wirklichkeit“20 von Kindern in der kapitalistischen Gesellschaft.21 Peter Möbius zeichnete als ‚Kursbogen‘22 ein Schaubild mit dem Titel Die Vorstellungswelt des Kindes von Wirklichkeit und Schein. Auf dem Boden des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Ausgebildet und gewachsen. Es zeigt den von Superhelden-Comicblasen flankierten Traum eines Kindes, welches durch Schule und Beruf zu Geld und Reichtum kommt. Superman trägt die Kugel der Macht und die Buchstaben des Wortes ‚Zukunft‘ bilden die blinkenden Säulen eines Zirkuszeltes aus Geldscheinen.
Macht kaputt, was euch kaputt macht!
Wir sind das Bauvolk der kommenden Welt
Wir sind der Sämann, die Saat und das Feld.
Wir sind die Schnitter der kommenden Mahd,
Wir sind die Zukunft und wir sind die Tat!23
Trotz Peter Möbius’ ambivalent gestalteten Wortes Zukunft im Plakat über die Kindheit zwischen massenmedialer Scheinwelt und staatlicher Hierarchie in der Bundesrepublik Deutschland gab es 1970 noch eine Zukunft, die sich aus einer gesellschaftskritischen Perspektive gestalten ließ. Diese These formulierte auch die 2016 vom Wiener Büro trafo.K kuratierte Ausstellung Die 70-er. Damals war Zukunft.24 Sie zeigte am Beispiel von Österreich die gesellschaftlichen Bewegungen und Kämpfe der Zeit. Viele davon verliefen parallel zu jenen in der Bundesrepublik. Arbeit und Bildung für alle!,Nur die Freiheit stillt den Durst!,





























