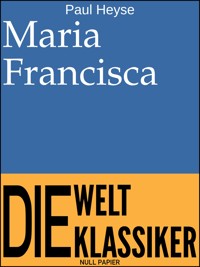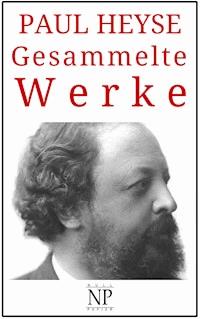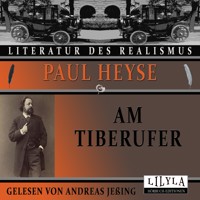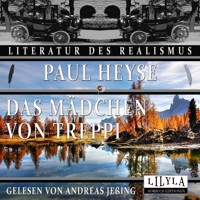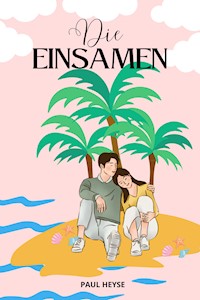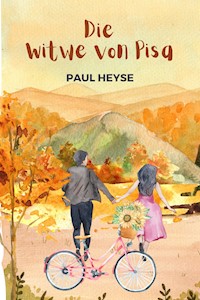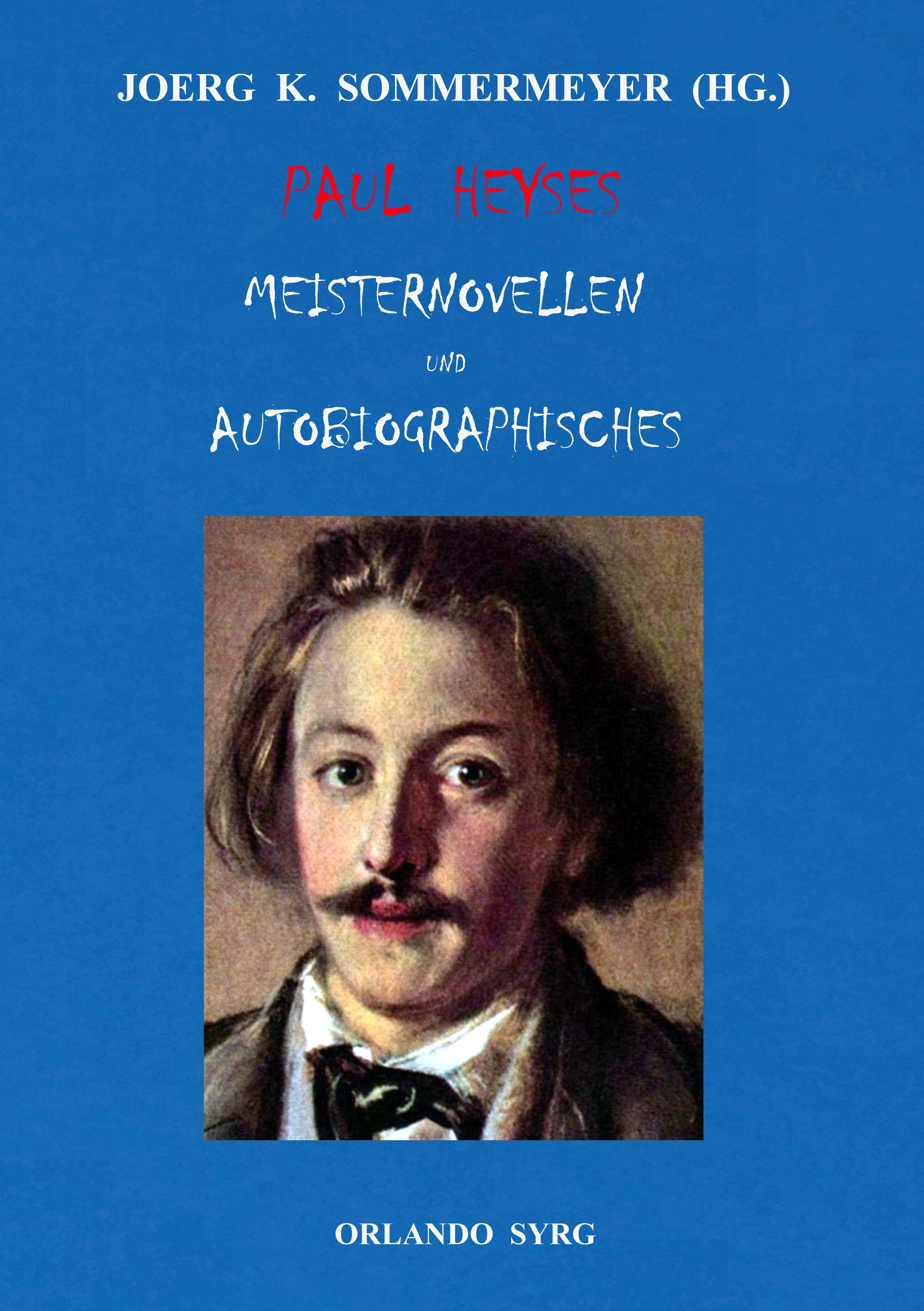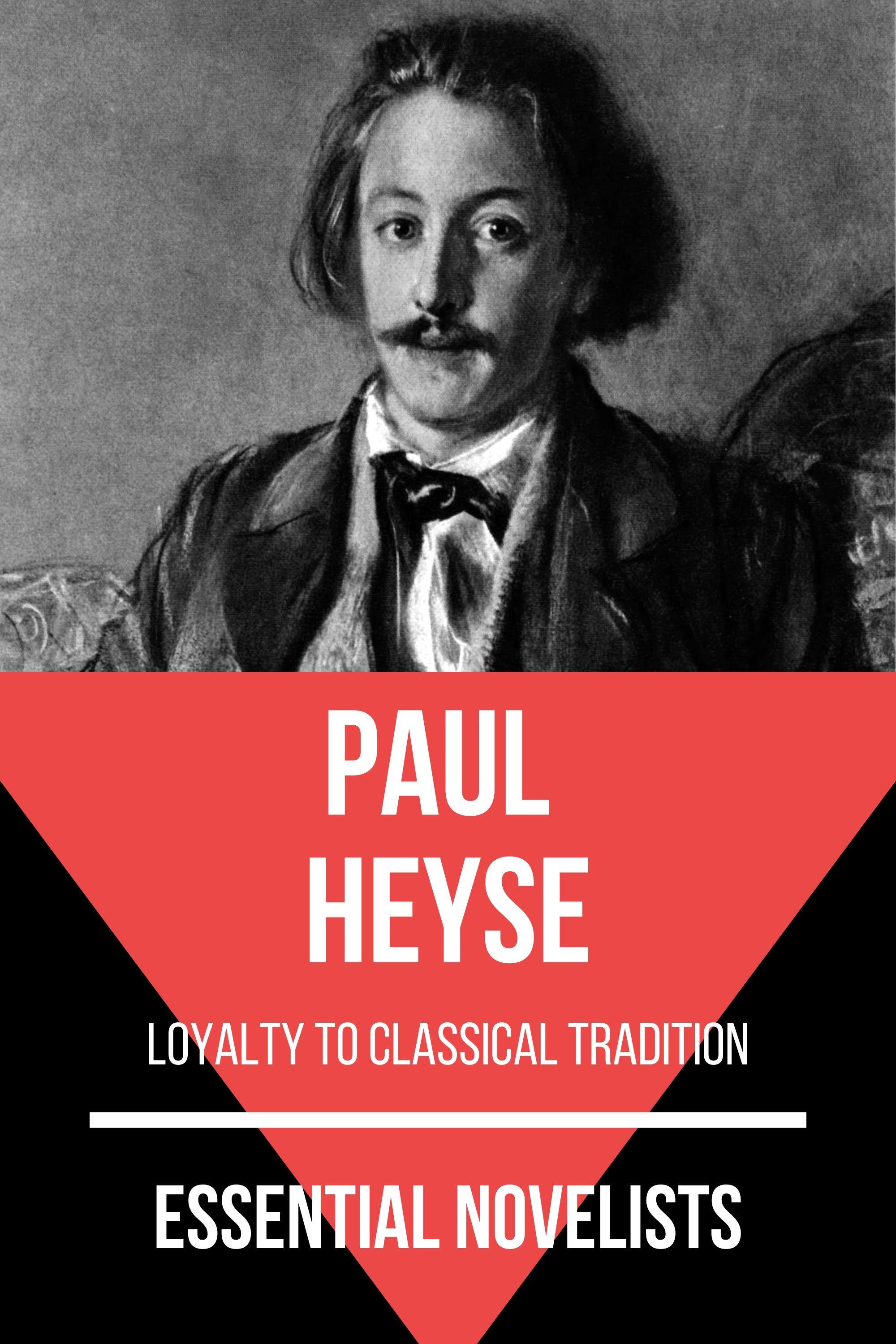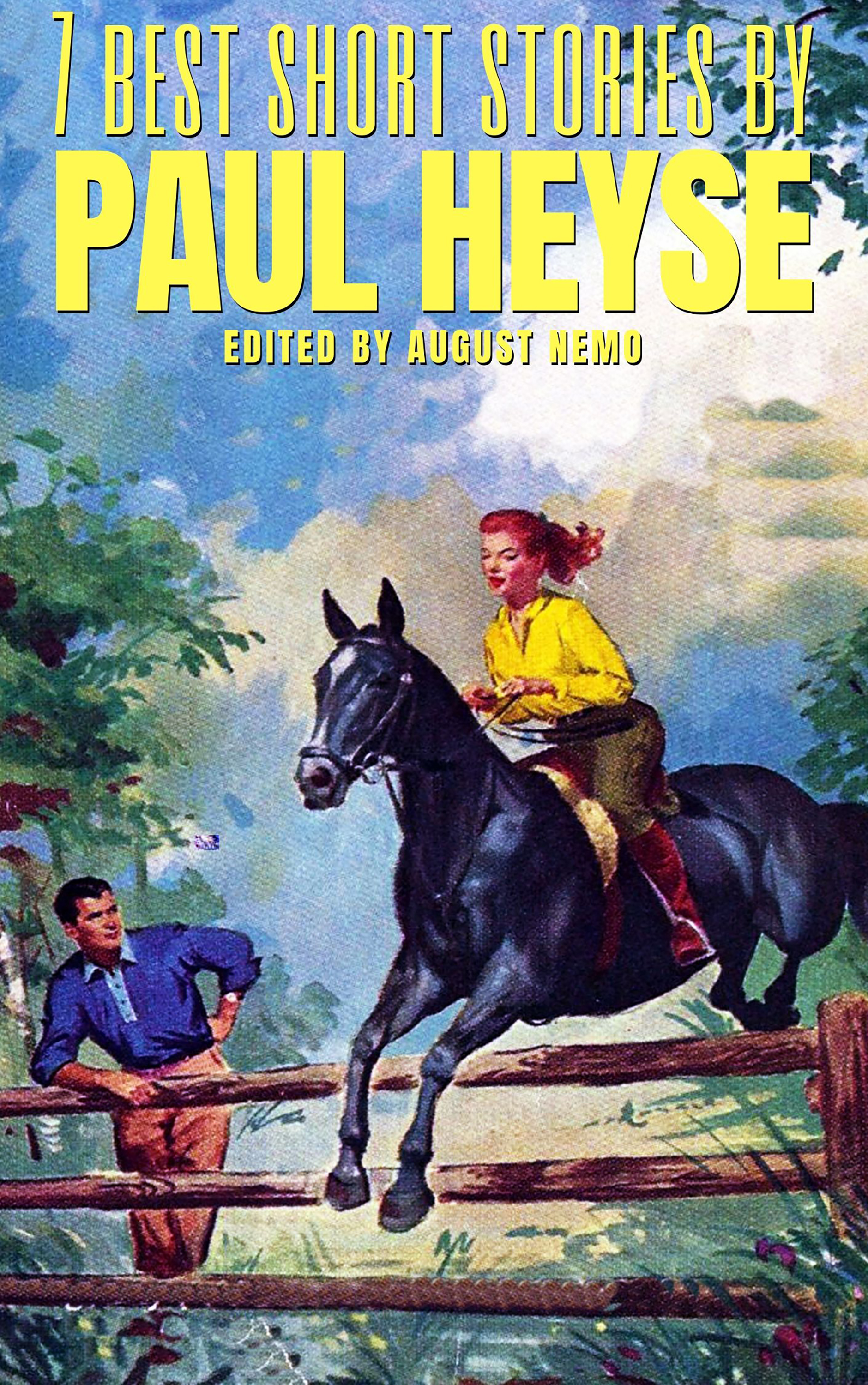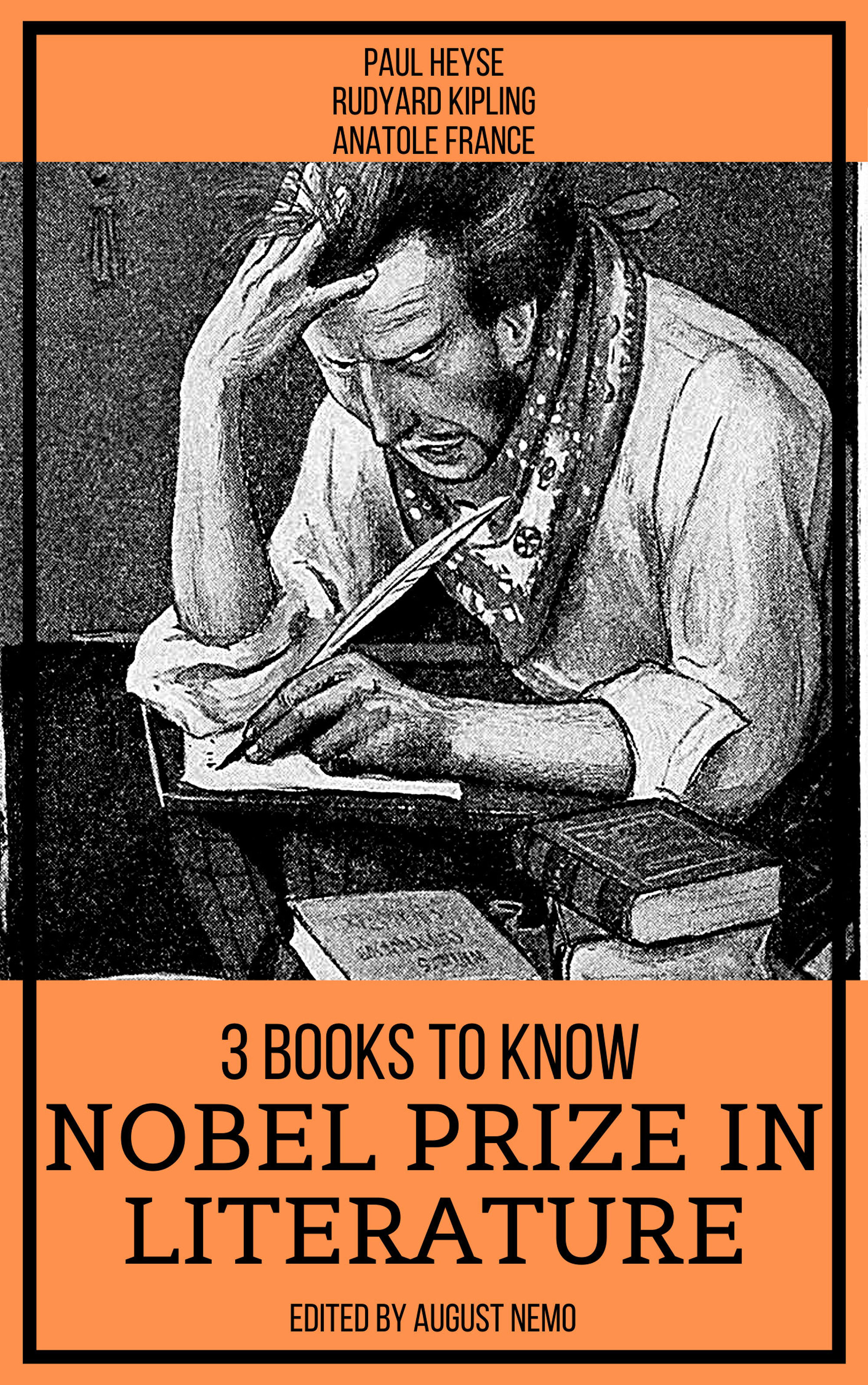Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Paul Johann Ludwig von Heyse (15.03.1830–02.04.1914) war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer. Neben vielen Gedichten schuf er rund 180 Novellen, acht Romane und 68 Dramen. Heyse ist bekannt für die "Breite seiner Produktion". Der einflussreiche Münchner "Dichterfürst" unterhielt zahlreiche – nicht nur literarische – Freundschaften und war auch als Gastgeber über die Grenzen seiner Münchner Heimat hinaus berühmt. 1890 glaubte Theodor Fontane, dass Heyse seiner Ära den Namen "geben würde und ein Heysesches Zeitalter" dem Goethes folgen würde. Als erster deutscher Belletristikautor erhielt Heyse 1910 den Nobelpreis für Literatur. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Heyse
Spielmannslegende
Eine mittelalterliche Novelle
Paul Heyse
Spielmannslegende
Eine mittelalterliche Novelle
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962811-91-4
null-papier.de/angebote
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Spielmannslegende
Zuerst 1883 unter dem Titel Siechentrost erschienen
An einem hellen Frühlingstage des Jahres 1375 ritt ein junger Mensch, dessen Aufzug und Gebärde schon von weitem verriet, dass er guter Leute Kind war, das Lahntal entlang, immer dem Fluss entgegen, der seine olivengrünen Wellen vom schmelzenden Schnee geschwellt, hastig, aber lautlos dem Rhein zuwälzte. Die Wälder, die hier im Hochsommer als eine dunkle Wildnis die Straße am Ufer einsäumten, trugen noch das erste junge Grün und waren von überlautem Gesang nistender Vögel erfüllt, den dann und wann das Schellengeklirr und Peitschenknallen vorbeiziehender Kärrner übertönten. Denn Handel und Wandel, die über den Winter geruht, hatten sich dieses Pfades seit Wochen wieder bemächtigt und führten die Güter und Waren aus dem inneren Lande der großen Wasserstraße zu, die Ladungen der Rheinschiffe dagegen eintauschend.
So ging es in diesen schattigen Gründen und Waldschluchten vor einem halben Jahrtausend lustiger zu, als heutzutage, wo aller Menschen- und Warenverkehr sich in die stummen, dumpfen Eisenbahnzüge zusammendrängt. Auch auf dem Gesicht des einsamen Reiters, obwohl er der Umgebung wenig achtete und den Zuruf der Begegnenden nur mit einem stummen Kopfnicken erwiderte, lag während der langen Stunden immer der gleiche Ausdruck einer fröhlichen Hoffnung, den nur zuweilen ein Schatten von Ungeduld trübte, wenn sein starkes flandrisches Pferdchen in ein gar zu lässiges Schlendern verfiel, oder gar am Rande des Weges stehen blieb, um ein Maul voll frischer Maikräuter abzurupfen. Es war ihm aber nicht zu verargen, da sein Herr, seit sie die Brücke von Diez überschritten, ihm nicht die kleinste Rast erlaubt hatte. Als sie nun aber an die Stelle kamen, wo das hochumschlossene enge Tal sich plötzlich auftut und der Blick über das sanft gewellte, von Äckern und Wiesen durchgrünte Gebiet der schönen Stadt Limburg schweifen darf, hielt auch der Reiter unwillkürlich die Zügel an, stand wie eine Bildsäule kerzengerade in den Steigbügeln auf und staunte nach der fernen Wundererscheinung hinüber. Denn im glühendsten Abendlicht hob die herrliche Stiftskirche zum heiligen Georg ihre sieben Türme in die reinen Lüfte empor, und da es ein Samstag war, klang das abendliche Geläut so vollstimmig ihm entgegen, dass das Innerste seiner Brust davon erschüttert wurde.
Zwei Jahre lang hatte er diese Klänge nicht mehr vernommen, außer im Traum des Heimwehs, und in mancher kleinmütigen und einsamen Stunde daran verzweifelt, dass er sie jemals wieder hören würde. Nun überwältigte ihn die Erfüllung seiner sehnlichsten Wünsche, dass er der Tränen sich nicht erwehren konnte.
Wenn die Seinigen, zumal sein strenger Herr Vater, ihn so gesehen hätten, würden sie wohl den Kopf geschüttelt und gesagt haben, dass der junge Gänserich, der über den Rhein geflogen, als Gigak wieder heimgekehrt sei. Er war von Kind auf wegen seiner nachdenklichen und absonderlichen Gemütsart oft und hart gescholten worden, und der Vater, ein stattlicher und fester Mann, seines Gewerbes ein Tuchhändler und Wamsschneider, hatte sich so manches Mal bitter darüber beklagt, dass man seinen Buben in der Wiege vertauscht und einen mondsüchtigen Prinzen statt des derben Kaufmannssohnes untergeschoben haben müsse. Statt sich mit den anderen Knaben in Feld und Wald und auf den Wällen der alten Feste zu tummeln, liebte er es schon als kleines Kind, sich in einen verborgenen Winkel zu verkriechen, dort seinen Träumen nachzuhängen, oder, als er eben einige Schulweisheit eingezogen, sich in irgendein altes Sagen- oder Liederbuch zu vertiefen, das ihm ein freundlicher Pfaffe aus der Stiftsbücherei geliehen hatte. Da er nun eines Tages das Geschäft des Vaters erben und mit seinem einzigen Bruder, der etliche Jahre jünger war, den Kredit des Hauses Eschenauer erhalten und mehren sollte, bekümmerte sein weltabgewandtes Wesen, die geringe Freude an Geld und Gut und der Hang zu ganz unfruchtbarem Sinnen und Brüten den wackeren Kaufherrn je länger je mehr, zumal er sich sonst über seinen Gerhard nicht zu beklagen hatte. Denn dieser versah in dem väterlichen Geschäft jeden Dienst, der ihm aufgetragen ward, auf das Pünktlichste, freilich ohne eigenen Trieb und Ehrgeiz, und war auch in allem übrigen ein musterhafter Jüngling und liebevoller Sohn, der mit seinen sanften Sitten und dem ernsten Blick seiner braunen Augen bei allen Freunden und Nachbarn des Hauses wohlgelitten war.
Auch unter seinen Altersgenossen hatte er keinen Feind, und viele, die ihm herzlich zugetan waren. Denn er war kein Spielverderber oder Moralist, drängte seine Weisheit oder die heimliche Geringschätzung so mancher Jugendlustbarkeit niemand auf und hielt sich, wo es darauf ankam, in Schimpf und Ernst seinen Mann zu stehen, so tapfer und unerschrocken, dass man seine beschaulichen Neigungen nicht aus einem Mangel an Mut oder Männlichkeit erklären konnte; sondern, nachdem man sich müde gespottet und gemerkt hatte, wie wenig Eindruck das Höhnen wegen seiner Möncherei und Büchernarrheit auf ihn machte, ließ man ihm diese seine Schwäche hingehen und betrachtete ihn sogar mit heimlichem Respekt ihretwegen. Es kam damals in der Stadt, die von trefflichen Grafen aus dem Isenburg-Limburgischen Hause bevogtet wurde und die ritterlichen Herren aus den benachbarten Burgen und Schlössern oft zu Gast hatte, auch unter der jungen Bürgerschaft ein streitbarer und hochstrebender Sinn in Schwang, alsodass die jungen Kaufleute nicht nur ihre Pferde mit silberbeschlagenem Zeug versehen ließen, sondern in zierlicher ritterlicher Kleidung und schönen Waffen viel Aufwand machten, dies alles nicht bloß zum Schein, sondern um in eigenen Turnieren, Ringstechen und Lanzenrennen ihre Kraft und Gewandtheit zu zeigen. Auch hierin stand der junge Gerhard Eschenauer hinter niemand zurück, immerhin mit einer nachlässigen und zerstreuten Manier, sodass ihn keiner der Preise, die er gewonnen, sonderlich zu freuen schien. Und niemals im Getümmel dieser fröhlichen Feste leuchteten seine Augen so hell, als wenn er im Wald oder am buschigen Stromufer lag, ein pergamentenes Büchlein in der Hand, in welchem Lieder der Minnesänger oder Sprüche weiser Meister verzeichnet waren.
Dass diese Gleichgültigkeit gegen alle Weltlust durchaus nicht einer verstohlenen Blödigkeit entsprang, wurde nun eines Tages noch viel deutlicher offenbar, als der wunderliche Geselle sich in das schönste Mädchengesicht der Stadt vergaffte und unverzüglich zuerst bei ihr selbst, dann aber auch bei ihrer Familie um sie warb. Es war dies die sechzehnjährige Tochter eines der angesehensten Bürger, Anselm Rode genannt, in dessen Geschlecht seit Menschengedenken das Schöffenamt erblich war, zu neuen Ehren gebracht durch den jetzigen Träger desselben, der in einem wichtigen Rechtsstreit der adeligen Herren mit der Stadtgemeinde einen unangefochtenen Schiedsspruch getan und insbesondere auch bei dem Grafen Johann, dem gegenwärtigen Herrn und Hüter der Stadt, das größte Ansehen genoss. Da ihm seine eigene Gattin im Wochenbett gestorben war, nach dem Ausspruch der Ärzte nur darum, weil sie zu jung in die Ehe getreten, hatte er sich gelobt, sein Töchterchen Imagina vor dem gleichen Schicksal zu bewahren und vor ihrem vollendeten achtzehnten Jahre sie keinem Gatten zu verbinden. Das Jüngferchen, obwohl es schon zu sechzehn Jahren die Kinderschuhe längst vertreten hatte und mit seiner voll aufgeblühten Gestalt es mancher jungen Frau hätte zuvortun können, war dennoch über den väterlichen Entschluss nicht ungehalten, selbst nachdem sie dem sehr verliebten jungen Gerhard Eschenauer ihr Herz und ihre Treue verlobt hatte. Denn dieses kleine Herz ward von etwas kühlem Blut durchströmt, und nichts auf der weiten Welt schien ihr vorläufig wichtiger und erfreulicher, als das Bewusstsein, dass sie um ihres feinen Madonnengesichts, ihrer schönen Haare von einer leuchtenden Bernsteinfarbe, ihrer zierlichen Hände und Füße willen von alt und jung als ein Wunderbild angegafft wurde und, wo sie erschien, mit einem Lächeln, bei dem sie nicht das geringste dachte, die ernsthaftesten Männer wie die windigsten Gecken bezauberte.
Ihr Vater merkte wohl, wie sein Kind eine gefährliche Straße wandelte, und nichts war ihm erwünschter, als dass gerade der sinnige, ernste Gerhard sich leidenschaftlich um sie bewarb. In seiner Zucht, hoffte er, werde aus dem rings umschmeichelten und umkosten Püppchen eine wackere und pflichttreue Hausfrau werden, abgesehen von dem Wohlstande des Hauses, in welches das junge Weib eintreten sollte. Er gab auch seinerseits seinen Segen zu dieser Verlobung, nur bestand er auf einem Aufschub der Hochzeit um volle zwei Jahre. Und da es nicht wohlgetan erschien, dass die beiden Liebesleute die lange Frist in so großer Nähe durchharren sollten, war Vater Eschenauer auf den Ausweg verfallen, seinen Sohn auf Reisen zu schicken, da er sich für dessen Weltläufigkeit, Erwerbs- und Geschäftssinn viel davon versprach, wenn er in den flandrischen, englischen und nordfranzösischen Handelsplätzen bei den Geschäftsfreunden des Hauses einkehrte und die Macht und den Glanz weitverzweigter Handelsverbindungen würdigen lernte.
Diesem väterlichen Willen hatte der gehorsame Sohn sich ohne alle Einrede gefügt, obwohl es ihm hart ankam, sich von seiner schönen jungen Braut auf so lange Zeit zu trennen. Die bitterliche Entbehrung konnte ihm nicht einmal durch häufige Briefe erleichtert werden, da das junge Kind keine geschickte Schreiberin war, überhaupt keinerlei Künste verstand, als die sich auf den Schmuck und Aufputz ihrer zierlichen Person bezogen. Er selbst schrieb ihr, so oft sich eine sichere Gelegenheit ergab, berichtete ihr von den fremdem Städten und Ländern, die er durchzog, ihren Sitten und Trachten, den wechselnden Abenteuern, die er bestand, und dem immer unwandelbaren Zustande seines eigenen Herzens. Dass er auch im übrigen derselbe blieb und für alle anderen Dinge in der Fremde offenere Augen hatte als für sein eigenes Gewerbe, sodass ihm die großen Teppichwirkereien in Gent und Brügge so wenig ein Wort der Bewunderung ablockten, wie die Magazine der Londoner Tuchhändler, konnte sich Herr Hinrich Eschenauer, wenn er die Briefe des Sohnes seiner guten Frau vorlas, nicht verhehlen. Sie aber, die diesen Sohn immer besonders geliebt hatte, nahm ihn mit seiner Jugend in Schutz und tröstete den Vater, dass es wohl anders kommen werde, wenn er erst ein angesehener Bürger sein und selbst für Weib und Kind zu sorgen haben werde.
Nun war endlich die Wartezeit verstrichen, und der junge Weltwanderer hatte den Tag seiner Heimkehr in einem letzten Briefe den Seinigen angezeigt. Aber von Ungeduld gespornt, war er um eine ganze Tagesreise früher an das Ziel seiner Sehnsüchte gelangt, und da nun auf einmal das Bild des hohen Münsters und die Dächer und Turmzinnen der daneben anfragenden Burg, die er tausendmal in seinen Träumen geschaut, ihn so friedlich in der Abendsonne ansahen, löste sich die lange Spannung seines Gemütes in einem jähen Tränenstrom, dem er eine Weile den Lauf ließ. Als der Nebel vor seinen Augen gewichen war, standen auch die hohen Türme grau und unfestlich in der silbernen Abendluft, und auf einmal überfiel ihn ein wunderliches Bangen, als ob ihn zu Hause nicht alles so glückselig anlachen würde, wie es in der Fremde ihm beständig vorgeschwebt. Mit einem leichten Ruck der Zügel setzte er sein Pferd wieder in Bewegung und legte die letzte Strecke Weges so zögernd zurück, dass er an dem alten Stadttor erst anlangte, als es eben geschlossen und die schwere Zugbrücke emporgewunden werden sollte.