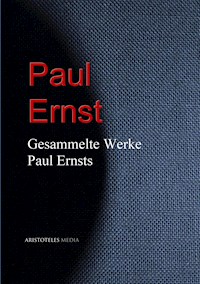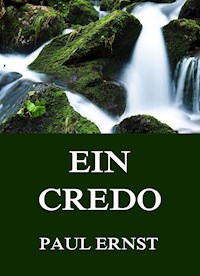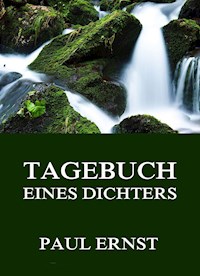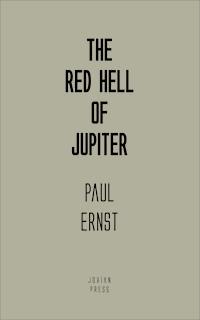Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reese Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Man werfe dem Dichter dieser Geschichten nicht ein, daß er ein Romantiker ist. Er ist ein Mann der Gegenwart. Aber er ist auch ein Dichter; und ein jeder Dichter ist abhängig von den technischen Gesetzen seiner Form. Niemand kann leugnen, daß nach jahrhundertelanger Unterdrückung das Gaunertum in der Gegenwart endlich zur Herrschaft gekommen ist. Pietrino würde heute ein Warenhaus begründen oder eine Zeitung, eine Partei; er würde sein Vaterland demokratisieren und Abgeordneter, Minister, Staatsmann oder Herrscher werden; Lange Rübe erfände eine neue Metaphysik, schüfe eine neue Kunst, stiftete eine neue Religion, erlöste die Welt; und beide schrieben ihren Namen mit ehernen Zügen auf die Tafel, auf welcher die großen Geister der Menschheit verzeichnet werden, von welcher die Namen der angestammten Herrscher, der Matta und Brava, längst verschwunden sind. Aber was bedeutete das für den Novellisten? Für den Novellisten wären sie wertlos geworden, sie wären langweilig, sie erlebten Tragödien. Man hält diesen letzten Satz vielleicht bloß für einen Witz. Er ist Wahrheit; ich habe nicht gesagt, daß man diese Tragödien dichten könnte; nein, das könnte man nicht, denn Lange Rübe und Pietrino sind Lustspielfiguren. Meine Geschichten spielen also in Rom um das Jahr sechzehnhundert. Es ist ja manches gegen die Zeit und den Ort zu sagen, aber das mögen andere Leute tun; ich bin Dichter, und habe keine andere moralische Verpflichtung, als mir die Technik meiner Kunst auferlegt; und so darf ich denn sogar erklären: ich liebe Lange Rübe und Pietrino, Colomba und Tromba. Ich bin Dichter und habe keinen wissenschaftlichen Ehrgeiz. Man erzählt mir, daß der Weltkrieg eine große Menge von Privatdozenten der Staatswissenschaften veranlaßt hat, über das letzte Wesen der bürgerlichen Gesellschaft nachzudenken. Ich habe es gefunden und will es ihnen zu wissenschaftlicher Darstellung verraten: Es besteht darin, daß Lustspielfiguren Tragödien erleben." (aus: Vorrede)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Ernst
Spitzbubengeschichten
Reese Verlag
Vorrede
Man werfe dem Dichter dieser Geschichten nicht ein, daß er ein Romantiker ist. Er ist ein Mann der Gegenwart.
Aber er ist auch ein Dichter; und ein jeder Dichter ist abhängig von den technischen Gesetzen seiner Form.
Niemand kann leugnen, daß nach jahrhundertelanger Unterdrückung das Gaunertum in der Gegenwart endlich zur Herrschaft gekommen ist. Pietrino würde heute ein Warenhaus begründen oder eine Zeitung, eine Partei; er würde sein Vaterland demokratisieren und Abgeordneter, Minister, Staatsmann oder Herrscher werden; Lange Rübe erfände eine neue Metaphysik, schüfe eine neue Kunst, stiftete eine neue Religion, erlöste die Welt; und beide schrieben ihren Namen mit ehernen Zügen auf die Tafel, auf welcher die großen Geister der Menschheit verzeichnet werden, von welcher die Namen der angestammten Herrscher, der Matta und Brava, längst verschwunden sind.
Aber was bedeutete das für den Novellisten? Für den Novellisten wären sie wertlos geworden, sie wären langweilig, sie erlebten Tragödien.
Man hält diesen letzten Satz vielleicht bloß für einen Witz. Er ist Wahrheit; ich habe nicht gesagt, daß man diese Tragödien dichten könnte; nein, das könnte man nicht, denn Lange Rübe und Pietrino sind Lustspielfiguren. Meine Geschichten spielen also in Rom um das Jahr sechzehnhundert. Es ist ja manches gegen die Zeit und den Ort zu sagen, aber das mögen andere Leute tun; ich bin Dichter, und habe keine andere moralische Verpflichtung, als mir die Technik meiner Kunst auferlegt; und so darf ich denn sogar erklären: ich liebe Lange Rübe und Pietrino, Colomba und Tromba.
Die Briefe des Seligen
Lange Rübe hatte in Rom einen Hauptschlag vorbereitet; leider mißglückte der durch die Torheit eines Frauenzimmers.
Er hatte die Bekanntschaft einer vornehmen kinderlosen Witwe gemacht, welche in dem Alter war, das man heute das gefährliche nennt. Natürlich hatte er der Dame nicht mitgeteilt, was sein eigentlicher Beruf ist; er hatte mit schwermütiger Miene von Unglücksfällen in der Familie gesprochen, von politischen Verfolgungen, von Überzeugungen, auf deren Altar man sein Lebensglück zum Opfer bringe; und diese Andeutungen hatten der Witwe genügt, um ihr Geschick ihm anzuvertrauen, denn wahrscheinlich sagte sie sich, daß Lange Rübe erst fünfundzwanzig Jahre alt war, schlank und groß gewachsen, eine angenehme Gesichtsbildung und kühne Augen hatte. Da ihre Familie natürlich gegen eine neue Heirat gewesen wäre, so hatte sie mit Lange Rübe eine heimliche Flucht verabredet. Lange Rübe hatte einen Wagen vor Porta Salaria bestellt, ihr Zeit und Ort genau angegeben und ihr aufgetragen, sie solle das Kostbarste, das sie habe, mitbringen. Zur bestimmten Zeit war die Dame ohne jede Verspätung wirklich gekommen und hatte Lange Rübe ein großes Paket übergeben; da Lange Rübe das Paket gleich bekam, so brauchte er die Dame nicht mitzunehmen; er hatte sich allein in den Wagen gesetzt und war abgefahren, indessen die erstaunte Dame wieder nach Rom hinein hatte gehen müssen, wo sie sich dann bei ihrem Neffen bitter über Lange Rübe beklagte.
Als er aber das Paket geöffnet, da hatte er in einem kostbaren Kästchen nicht etwa Geld und Schmuck gefunden, sondern nur die Liebesbriefe des verstorbenen Gatten der Dame. Man kann sich denken, daß das ein Verlust für ihn gewesen war; denn zwei Wochen lang hatte er immer an der Dame gearbeitet und nichts anderes verdient, hatte Unkosten für Blumen, einen feinen Anzug, zuletzt noch für den Wagen gehabt, den er hatte vorher bezahlen müssen, weil der Wagenverleiher ihn kannte; und nun waren die wertlosen Briefe das ganze Ergebnis.
Er hatte das Paket wieder zugeschnürt und in kurzer Zeit, wenn auch nicht gerade einen neuen Plan, so doch den Anfang zu einem solchen ins Auge gefaßt. Wagen und Wechselpferde waren bis Neapel bezahlt; er hatte einen sehr feinen und teuern Anzug auf dem Leibe und einen, wenn auch nur mit Steinen angefüllten, großen Koffer auf dem Rückteil des Wagens auf geschnallt, dann noch das kostbare Kästchen im Wagen; so hatte er denn beschlossen, nach Neapel weiterzufahren, dort angemessen aufzutreten und zu sehen, was das Glück ihm zuführen werde. Das hatte er getan und sitzt nun in dem vornehmsten Gasthaus Neapels in einem schönen Zimmer.
Messer Molinari, der Polizeihauptmann von Neapel, unterhält natürlich eine sehr enge Verbindung mit der Kamorra, und man kann eigentlich sagen, daß er selber Kamorrist ist. Aber, wie man weiß, kommen da oft Konflikte der Pflichten. Er hatte nicht anders gekonnt, als eine der hervorragendsten Personen der Kamorra festzunehmen; begreiflicherweise sehen die Genossen eine solche Notwendigkeit nie ein, denn im Grunde ist es ihnen ja gleichgültig, ob der Polizeihauptmann sein Amt verliert, weil sie sich mit seinem Nachfolger ja auch schon vertragen werden. Kurz und gut, die Kamorra hat geschworen, den geopferten Genossen, denn er wurde gehängt, an Messer Molinari zu rächen, und Messer Molinari ist natürlich in tausend Ängsten. Das dient zur Erklärung dafür, daß Lange Rübe ungestört in Neapel arbeiten kann, denn unter gewöhnlichen Verhältnissen würde es sich die Kamorra ja schön verbitten, wenn ein fremder Gauner in Neapel Geschäfte machen wollte. Die Kamorra begünstigt sein Vorhaben sogar. Ein Herr, den Lange Rübe nicht kennt, besucht ihn auf seinem Zimmer und erkundigt sich vorsichtig, ob er vielleicht der erwartete Geheiminspektor der Polizei sei, der bei allen Beamten Nachsuchungen halten soll, und bringt Lange Rübe dadurch auf einen Gedanken; und dem Messer Molinari wird von Freunden mitgeteilt, ein Geheiminspektor sei gekommen, welcher da und da wohne und schon geäußert habe, den Hauptmann Molinari werde er besonders aufs Korn nehmen.
Man kann sich denken, daß die Sorgen wegen der Mißstimmung der Kamorra und wegen des Inspektors den guten Messer Molinari, der gewöhnlich heiter und aufgeräumt ist, recht nachdenklich machen. Die schöne Colomba, seine Tochter, bemerkt seine trübe Stimmung und sucht ihn zu trösten. Die schöne Colomba ist eine gewandte Person und hat ihrem Vater schon oft geholfen, und es gibt Leute, welche sie für klüger halten wie den Vater.
Die schöne Colomba also tröstet den Messer Molinari und erforscht seine Bekümmernisse; wie er ihr alles erzählt hat, denkt sie eine Weile nach, und dann erklärt sie: »Mit der Kamorra mußt du allein fertig werden; sie bezahlt dir übrigens wenig genug; du hast Familie und mußt an die Zukunft deiner Kinder denken, aber den Inspektor will ich auf mich nehmen.« Der Inspektor war Messer Molinaris größte Sorge gewesen, denn die Kamorra braucht ihn schließlich ebenso, wie er sie; und so überläßt er es denn erfreut seiner Tochter, wie sie den Inspektor behandeln will.
Also die schöne Colomba macht sich auf den Weg und besucht Lange Rübe in seinem Gasthof.
Lange Rübe stellt den Inspektor mit großem Anstand vor und findet sich schnell in die Lage mit der schönen Colomba. Er findet sich zu schnell. Frauen haben einen Scharfblick, der uns Männern oft abgeht; Colomba merkt bald, daß Lange Rübe viel zu klug ist, um ein Beamter zu sein. Wir wollen nicht Einzelheiten aus ihrem Gespräch geben, denn die schöne Colomba ist wirklich schön, und Lange Rübe ist ein stattlicher junger Mann, in den sich ein kluges junges Mädchen ohne Vorurteile schon verlieben kann. Kurz und gut, Colomba ging um zu fangen und fängt sich selber, indem sie sich in Lange Rübe bis über ihre beiden reizenden Öhrchen verliebt; Lange Rübe hat nicht mehr nötig, ihr gegenüber die Täuschung aufrecht zu erhalten, und wie sie ihn lachend fragt, erzählt er ihr, wodurch er nach Neapel gekommen ist. Er hat wirklich nicht mehr nötig, ihr zu mißtrauen; denn der Leser wird zwar denken, daß die schöne Colomba zu manchem entschlossen gewesen sein mag, als sie Lange Rübe aufsuchte, und daß auch die stärksten Beweise ihrer Liebe doch nicht jedes Mißtrauen bei Lange Rübe verbannen dürfen; aber er kann sicher sein, daß Lange Rübe ein Menschenkenner ist und genau weiß, die schöne Colomba ist aus dem Lager ihres Vaters in das seinige übergegangen.
Es ist ja wohl keiner von ihnen die erste Liebe des anderen. Aber Colomba fragt Lange Rübe: »Du liebst mich doch, nicht wahr? Wenn du mich einmal nicht mehr liebst, dann mußt du es mir gleich sagen. Ich werde dir keine Vorwürfe machen. Ich will dir dann auch nicht zur Last fallen. Aber jetzt liebst du mich, nicht wahr? Solange du mir nichts sagst, liebst du mich.« Lange Rübe schweigt, wischt sich die Augen und sagt endlich: »Ja, du bist eine anstellige Person, mit dir kann ein vernünftiger Mann schon etwas werden.«
Nun besprechen sie die nächste Zukunft, denn die fernere ist ihnen ja gleichgültig. Lange Rübe würde ganz gern in Neapel bleiben, aber die schöne Colomba schüttelt den Kopf. Die Kamorra nimmt ihn nicht auf. In Neapel herrscht der engherzigste Geist, den man sich denken kann. Nein, sie können nicht in Neapel bleiben; aber sie wird ihm nach Rom folgen.
Hier taucht nun die Frage auf, woher die beiden das Geld für die Reise nehmen werden. Aber während sie das überlegen und besprechen, ist für das Geld schon gesorgt.
Die Dame in Rom, welche mit Lange Rübe fliehen wollte, hat, wie wir wissen, ihrem Neffen ihr Leid geklagt. Der Neffe, welcher sich sagt, daß die Tante doch einmal ein Testament machen wird, stimmt in ihre Verwünschungen gegen den räuberischen Geliebten ein. Da dieser ein Unwürdiger ist, so hat ihn die Tante natürlich aus ihrem Herzen verstoßen; aber die Briefe ihres verstorbenen Gatten muß sie wieder haben, welche der Mensch ihr so schändlich geraubt hat, die Briefe, welche ihr einziger Trost in den langen Jahren ihrer Witwenzeit gewesen sind, welche sie an den edelsten, begabtesten Mann erinnern, der ihr und der Menschheit leider allzufrüh entrissen wurde. Der Neffe verspricht, sein Möglichstes zu tun; sie ist bereit, alle Kosten zu tragen; der Neffe macht den Kutscher ausfindig, erfährt Namen und Geschichte des Liebhabers, ergötzt seine Freunde, indem er ihnen alles mit einigen künstlerischen Ausschmückungen erzählt, und geht dann zum Polizeihauptmann Tromba und läßt durch ihn bekanntmachen, wer Lange Rübe gefangen nehme, der erhalte von ihm tausend Skudi.
Tausend Skudi sind eine schöne Summe, und so hat sich denn auch in Neapel unter den Häschern schnell die Nachricht verbreitet, daß auf Lange Rübe tausend Skudi gesetzt sind. Die schöne Colomba erfährt es von ihrem Vater, der aufgeregt im Zimmer auf- und abgeht und sagt: »Das Glück wird natürlich wieder ein anderer haben! Tausend Skudi! Ich könnte meinen Adel erneuern lassen, wenn ich sie bekäme. Ich könnte mir ein Haus kaufen. Ich könnte mir Pferd und Wagen halten. Colomba könnte einen Advokaten heiraten. Tausend Skudi! Aber für den Messer Molinari sind keine tausend Skudi. Sorgen, Kummer, Leiden, das ist für den Messer Molinari. Er hat dem Staate treu gedient. Was hat er davon? Die tausend Skudi bekommt ein anderer.«
Colomba hat einen Plan gefaßt und bespricht ihn mit Lange Rübe. Dann geht sie zu ihrem Vater und teilt ihm mit, daß er die tausend Skudi verdient hat: der Inspektor ist der Gesuchte, sie hat das ausgekundschaftet. Er muß nur vorsichtig und schnell gefangen genommen werden, ehe er Wind bekommt.
Wir brauchen die Verhaftung von Lange Rübe nicht zu schildern. Genug, daß man ihn ins Gefängnis gesetzt hat, in den Kellern des Hauses, in welchem Messer Molinari mit Colomba wohnt; daß der große Schlüssel zu seinem Gefängnis über Messer Molinaris Bett hängt, und daß die tausend Skudi bar ausgezahlt sind. Da Lange Rübe den Kasten mit den Briefen vorher der schönen Colomba gegeben hat, so hat die Polizei den freilich nicht mehr finden können, und die Dame in Rom erklärt ihrem Neffen, daß sie ihm die tausend Skudi nicht ersetzen werde, denn ihr liege gar nichts an dem schlechten Menschen, den sie verachte, weil er zu tief stehe für ihren Haß, und der vielleicht nur darauf warte, um sie vor Gericht zu blamieren, sondern sie wolle ihre Briefe wieder haben. Sie ahnt nicht, daß bereits verschiedene Dichter beschäftigt sind, ihre Liebesgeschichte poetisch zu verherrlichen.
Natürlich hatten die schöne Colomba und Lange Rübe vorher einen Plan zur Flucht verabredet, bei welcher der Schlüssel über dem Bett eine Rolle spielt. Die Sparsamkeit der Tante macht aber das immerhin gefährliche Unternehmen überflüssig. Die Verhaftung war nur sozusagen ein Privatunternehmen des Messer Molinari gewesen. Er hat an den Neffen geschrieben, ob er Lange Rübe auf seine, des Neffen, Unkosten nach Rom schaffen solle, und der Neffe hat ihm grob geantwortet, seinetwegen könne er den Kerl aufhängen oder laufen lassen, ihn habe die Geschichte schon an die elfhundert Skudi gekostet und er habe keine Neigung, noch mehr Geld zum Fenster hinauszuwerfen. Der neapolitanische Staat hat nicht das geringste Interesse daran, einen römischen Gauner auf seinen Galeeren zu beköstigen, er hat genug Landeskinder zu versorgen. Messer Molinari hat desgleichen keine Lust, ihm täglich die Makkaroni auf seine Kosten ins Gefängnis zu schicken, denn die tausend Skudi hat er ja nun; so beschließt denn der Rat, man solle Lange Rübe rückwärts auf einem Esel durch die Stadt führen und ihn dann des Landes verweisen.
Während die schöne Colomba in einem Hinterstübchen weint, sieht Messer Molinari vom Balkon seines Hauses, wie Lange Rübe unter dem Jubel der Straßenjugend verkehrt auf den Esel gesetzt wird; immerhin ist er doch sozusagen der Schwiegervater von Lange Rübe, und Lange Rübe zieht deshalb seinen eleganten Federhut mit einer tiefen Verbeugung vor ihm ab. Die Straßenjugend findet, daß das ein guter Witz ist, bringt auf Lange Rübe ein Hoch aus und richtet die Wurfgeschosse von Dreck, die sie für ihn bereit gehalten, auf den Messer Molinari; eine Dame, die nebenan wohnt und verschiedene Gründe hat, über die Polizei verstimmt zu sein, wirft Lange Rübe einen Strauß gelber Rosen zu, den sie soeben von einem deutschen Fürsten geschenkt bekommen hat; Lange Rübe erhascht ihn, führt ihn an die Lippen und reitet weiter unter den entzückten Huldigungen des neapolitanischen Volkes. Man hätte dem Esel einen anständigen Sattel auflegen können; aber davon abgesehen ist der Ritt sehr genußreich. An dem Tor hilft ihm der Häscher auf das Pflaster, Lange Rübe gibt ihm ein Trinkgeld und wandert durch das Tor hinaus ins Freie auf der Straße nach Rom.
Daß die schöne Colomba die nächste Nacht mit den tausend Skudi und den Briefen zu ihm stößt, versteht sich von selber.
Von Messer Molinari brauchen wir nun nichts mehr zu wissen, als daß er noch Unannehmlichkeiten mit der Kamorra hat, welche zwanzig Prozent von den tausend Skudi verlangt, weil sie natürlich glaubt, daß die Flucht mit seiner Einwilligung geschehen ist. Er beteuert, weint, schwört, und nur mit der größten Mühe gelingt es ihm, daß man ihm die Zahlung wenigstens stundet.
Lange Rübe und die schöne Colomba mieten sich einen eleganten Wagen, und kommen wohlbehalten in Rom an, wo sie zunächst in den besten Geschäften Einkäufe für Colomba machen. Sie sagen sich, daß sie jetzt Geschäftsunkosten haben, denn wenn Colomba etwas verdienen soll, so muß sie natürlich anständig aussehen. Lange Rübe zieht inzwischen Erkundigungen ein, ob er die Briefe nicht verwerten kann; der Kutscher, bei welchem der Neffe seinerzeit nachgeforscht hatte, vermittelt die Bekanntschaft mit dem Neffen; dieser ist erbittert auf die undankbare Tante, die ihrer Dienerschaft Befehl gegeben hat, ihn nicht mehr vorzulassen, weil er immer seine elfhundert Skudi wiederhaben will, und so macht er gern ein Übereinkommen mit ihm. Lange Rübe tritt ihm einen der Briefe ab, und der Neffe schickt ihn an die Tante, indem er ihr schreibt, sie sehe nun wohl, wie er, trotzdem sie ihn immer verkannt habe, doch für sie arbeite; er könne ihr alle Briefe verschaffen; aber freilich müßte er dann sicher sein, daß er nicht wieder in seinen heiligsten Gefühlen gekränkt werde. Kurz und gut: die Tante geht mit ihm zum Notar und verschreibt ihm schon bei ihren Lebzeiten ein Gut unter der Bedingung, daß er den Besitz erst nach ihrem Tode an tritt, und Lange Rübe bekommt für die Briefe von dem Neffen noch neunhundert Skudi; er hatte tausend verlangt, aber der Neffe zog die hundert ab, die er für die Nachforschungen ausgegeben hatte.
Die gesparten Schlachtschüsseln
Wenn ein sorgsamer Hausvater heute ein Schwein schlachtet, dann hat er einen sauberen und sehr großen irdenen Topf; in diesen legt er die Ohren, die Schnauze, die Pfoten und die Rippchen, nachdem er alles tüchtig mit Salz eingerieben und bestreut hat; dann wartet er vierzehn Tage und sagt endlich zu seiner Hausfrau: »Morgen könntest du wohl einmal Pökelknochen mit Sauerkraut und Erbsen zubereiten«; und so hat er denn, je nach der Größe seiner Familie, vier bis sechs wohlschmeckende und nahrhafte Mittagessen.
Nun muß man aber wissen, daß dieses Einpökeln der Knochen eine verhältnismäßig junge Erfindung der Menschen ist. In früheren Zeiten verstand man diese Stücke nicht aufzubewahren; und da doch eine Familie nicht alles auf einmal essen konnte, so hatte sich die Sitte herausgebildet, daß der Hausvater, welcher schlachtete, seinen Nachbarn von ihnen schickte; man nannte das die Schlachtschüssel. Wenn dann die Nachbarn schlachteten, so schickten sie auch ihm eine Schüssel, und so ging zuletzt alles nach der Gerechtigkeit und hatte doch dabei seine nachbarliche Freundschaft.
Der Messer Filippo, der in Rom an der Porta del Popolo in dem alten Turm seines Geschlechtes wohnt, hat von seinem Gevatter in Albano ein fettes Schwein gekauft, ist dann zu Pietrino gegangen, dem Hausschlächter, und hat ihm gesagt, er möge zum Schlachten kommen; Pietrino hat geantwortet, einem Freund könne er nichts abschlagen, und ist erschienen.
Das Schwein wiegt seine drei Zentner. Der Gevatter in Albano hat beschworen, daß es reine Eichelmast ist, denn das ist bei ihm Prinzip, die Eichelmast, denn warum? Aufgeschwemmt ist das Schwein leicht, aber den Kernspeck bekommt es nur bei der Eichelmast.
Pietrino ist begeistert von dem Schwein, denn er weiß aus Erfahrung, daß der schlachtende Hausvater es liebt, wenn man das Schwein lobt. »Das ist ein Stückchen für den Heiligen Vater«, sagt er, »das ist eine Seltenheit! Da wird Ihnen das Fett in den Mundwinkeln herunterfließen, wenn Sie den Braten essen! Aber nur die Schwarte recht knusprig! Sie muß mit Wasser begossen werden, sonst wird sie zäh. Ja, das ist ein Tierchen! Wie es einen ansieht! So lieb und gut!«
Das Schwein grunzt und macht ein mißtrauisches Gesicht. »Komm du nur«, redet Pietrino jetzt das Schwein an und sucht es am Hinterfuß zu fassen, indessen sich das Schwein ihm gewandt entzieht. »Komm du nur, es tut ja gar nicht weh! Bin Augenblick, dann ist es vorbei! ... Drei Zentner? Guter Kauf, das Schweinchen wiegt seine viertehalb Zentner. Das ist ja ordentlich ekelhaft, wie das fett ist. Das ist ja nicht zu essen, das Schwein, so fett ist es!«
Hier hat Pietrino endlich den Hinterfuß gefaßt und den Strick um ihn geschlungen; nun wirft er den Strick über den Haken, der in der Hauswand eingemauert ist, Messer Filippo und die Signora legen mit Hand an, und so wird das quiekende Schwein hochgezogen, bis es ganz in der Luft hängt und die Umgebung mit seinem Geschrei erfüllt. Der große Topf, in welchem das Blut aufgefangen wird, steht bereit, die Signora mit dem Quirl kauert neben ihm, Pietrino nimmt sein Schlachtmesser, prüft es mit Kennerblick auf dem Handballen, wirft dem Schwein noch ein paar tröstende Worte zu und macht dann den Schnitt. Das Blut strömt, die Signora quirlt, das Schwein quiekt und röchelt, Pietrino beobachtet; zuletzt beugt er sich, legt sein Ohr an den Rüssel und gibt sich den Anschein, als höre er aufmerksam auf die letzten Töne des Tieres; dann richtet er sich auf und sagt: »Es hat ein mündliches Testament gemacht. Den Messer Filippo setzt es zum Universalerben ein, und mich hat es zum Testamentsvollstrecker ernannt.« Die Signora lacht über diesen Witz so lebhaft, daß sie rücküber fällt, und wenn Messer Filippo nicht zugesprungen wäre, so hätte sie den Topf mit dem Blut umgestoßen. Das ist nun wieder für Pietrino so komisch, daß er in Lachen verfällt, sich immer vornüber beugt und den Bauch hält. Da er ein stattlicher Fleischer ist, so erregt das seinerseits die Heiterkeit des Messer Filippo, und so lachen denn alle drei eine ganze Zeit, indem immer, wenn einer aufhört, der andere wieder anfängt.
Nun durchbohrt der Fleischer dem toten Tier die Kniekehlen und steckt das Krummholz durch; es werden zwei hölzerne Stühle aus der Küche geholt, auf welche die beiden Männer treten, und dann heben sie das Schwein und hängen es am Krummholz auf, damit es der Fleischer aufschlagen kann.
Wie es da nun so hängt, da beginnt Messer Filippo zu klagen, indem er sich über die Nachbarn beschwert und erzählt, welches Interesse sie alle an dem Schwein haben, wie sie das Gewicht abschätzten und über die Mast sprachen und ihm Ratschläge für die Würste gaben, und wie der eine sogar eine Anspielung auf die Schälrippchen gemacht hat, und wie heutzutage das Leben so teuer ist, und das Schwein kommt ihm mit allen Nebenausgaben hoch genug.
Pietrino ist hier ganz der Meinung des Messer Filippo; er findet, wer Schälrippchen essen will, der kann selber schlachten, denn der Hausschlächter wird ohnehin gedrückt heutzutage; und er schließt, daß er an der Stelle des Messer Filippo niemandem eine Schlachtschüssel schicken würde, sondern er würde sich die Knochen schön einsalzen und mit Sauerkraut und Erbsen essen, wie das die Deutschen tun, die kluge Leute sind und wissen, was gut schmeckt.
Dies ist nun für Messer Filippo eine neue Rede, denn er hat es bis dahin nicht anders gewußt, als daß man den Nachbarn die Schlachtschüssel schicken muß, weil einem der Segen sonst schlecht wird; deshalb fragt er Pietrino nach dem Näheren, und der erzählt ihm denn genau, wie man alles macht.
Das versteht nun Messer Filippo sehr gut; aber er sagt sich, daß die Nachbarn ihm das übelnehmen würden, wenn sie die Schlachtschüssel nicht bekämen, denn diese Leute glauben ja doch ein Anrecht zu haben, wenn einer, der ein bißchen etwas hat, sich ein Schwein schlachtet, weil sie selber nichts haben; und das erscheint ihm wirklich unrecht von den Leuten, denn er denkt gar nicht mehr daran, daß er selber ja doch auch immer Schlachtschüsseln bekommen hat. Und so schließt er denn, daß ihm das Herz zwar blutet über die Ungerechtigkeit, denn er ist immer ein Feind der Ungerechtigkeit, aber er will die Knochen doch lieber nicht einpökeln und den Nachbarn morgen früh jedem seine Schüssel schicken. Die Signora nickt mit dem Kopf und sagt, ihr Mann sei eben immer zu gut, aber sie könne dagegen nichts tun, er lasse sich ja nie in seine Geschäfte hineinreden.
Hier legt Pietrino den Finger an die Nase und sagt: »Messer, ich habe einen Einfall. Es ist ein Glück, daß ich nicht heute früh kommen konnte, wie Eure Exzellenz eigentlich wollten, und Eure Exzellenz haben mich ja auch sehr darüber gescholten. Denn warum? Jetzt hacke ich das Schwein noch auf, wir nehmen die Eingeweide heraus und waschen die Kaldaunen, ich kann es auch noch zerteilen, und dann ist Feierabend. Wäre ich gekommen, wie der Messer wollte, dann würde heute alles fertig, und ich müßte heute abend die Schlachtschüsseln herumtragen, wofür ich ja dann freilich von jedem Nachbar einen Soldo Trinkgeld zu erwarten habe. Aber so bringen wir das Schwein in den Keller, und wenn wir morgen früh mit der Arbeit fortfahren wollen, dann sagt Messer Filippo: Das Schwein ist mir diese Nacht gestohlen.«
Die Unverschämtheit der Nachbarn muß natürlich den Messer Filippo ärgern, und um ihnen einen Possen zu spielen, geht er auf Pietrinos Vorschlag ein, und es wird alles so gemacht, wie Pietrino vorgeschlagen hat.
Pietrino ist, wie der Leser schon gemerkt haben wird, ein kluger Mensch. Er sorgt also dafür, daß das Schwein im Keller versteckt wird, in den man durch das Fenster leicht einsteigen kann, damit der Diebstahl glaubhaft ist; und als es Nacht geworden ist und Messer Filippo und seine Gattin fest schlafen, da erscheint er still vor dem Hause mit seinem kleinen Handwagen. »Es war doch gut, daß ich es noch zerteilt habe, es trägt sich so leichter«, spricht er für sich, als er es herausholt und auf seinen Wagen legt. Er nimmt auch Herz, Lunge und Leber mit, die in einer Schüssel liegen, und die Kaldaunen, die noch im Wasser schwimmen, und den Topf mit dem Blut. Dann zieht er seinen Wagen fröhlichen Herzens nach Hause.
Am andern Morgen in der Frühe geht er zu Messer Filippo; vor dem Hause stehen die Nachbarn und sprechen untereinander, indem sie auf das Haus zeigen; ein Polizist hockt vor dem Kellerfenster, die Hände auf die Knie gestützt, und sieht in den Keller; die Tür öffnet sich, und aufgeregt erscheint Messer Filippo, einem andern Polizisten eine Erzählung machend; der Polizist schüttelt ruhig den Kopf und hört ihn an.
Pietrino tritt neben ihn und sagt leise: »Ausgezeichnet! Ganz recht!«
»Das Schwein ist diese Nacht gestohlen!« schreit ihm Messer Filippo zu.
»Was? Gestohlen? Das Schwein?« fragt Pietrino laut, und leise fügt er hinzu: »So ist es richtig! Kein Mensch schöpft Argwohn!«
Dem Messer Filippo kommen die Tränen, er faßt mit beiden Händen die Hand Pietrinos und sagt: »Gestohlen, wirklich gestohlen!«
»Sehr gut, das ist der richtige Ton«, erwidert leise Pietrino.
»Nein, wirklich gestohlen!« ruft der Messer.
»Und die Tränen! Ganz echt!« sagt Pietrino.
»Heute morgen, ich denke, ich will es mir doch einmal ansehen, ich gehe in den Keller...«, erzählt Messer Filippo den Nachbarn. »Nichts. Nichts. Da liegt das weiße Tuch, es ist noch blutig. Nichts weiter. Nichts.«
Die beiden Polizisten besprechen sich, grüßen dann den Messer Filippo und gehen. Sie haben ihre Pflicht getan. Die Nachbarn beginnen sich zu zerstreuen. Pietrino nimmt den Messer Filippo unter den Arm und führt ihn in das Haus, in die Küche, wo die Signora gebrochen auf der Eimerbank sitzt und weint.
»Nun wollen wir gleich ans Wurstmachen gehen«, sagt er. »Aber Pietrino, es ist wirklich gestohlen«, ruft der Messer, vor ihm stehend und die Hände beteuernd hochhebend. »Euer Exzellenz! Unter uns! Ich bin doch verschwiegen!« erwidert Pietrino.
Messer Filippo führt ihn in den Keller, zeigt ihm wortlos den leeren Tisch, auf dem das Schwein gelegen, das blutbefleckte Tuch, die leeren Schüsseln.
Hauptmann Tromba
Die oberste Polizeiperson in Rom ist der Hauptmann Tromba. Tromba ist von einer stattlichen und breiten Figur, nicht so ein Männchen, wie man sie oft sehen kann, der neben seiner Frau sitzt und für einen Soldo Bohnen ißt, indessen die Frau, breitschulterig und mit starken Hüften, eine Schüssel voll Krammetsvögel, ein halbes Brot und einen Haufen Salat nebst einem großen Fiasco Wein vor sich hat. Nein, Tromba ist ein Mann, und wenn sein Säbel auf dem Pflaster klirrt, wenn er die Backen aufbläst, die Augen rollt, den Schnurrbart streicht und spanische Flüche von sich gibt, dann zittern alle Gauner Roms, soweit sie wenigstens überhaupt vor der Polizei Furcht haben.
Er hat viele Besorgungen in der Umgebung Roms zu machen, und deshalb hält er sich einen leichten zweirädrigen Wagen und ein Pferd. Dieses Pferd ist von einer merkwürdigen Rasse; es hat einen sehr dicken Leib und sehr dünne Beine und ist so klein, daß man es leicht für einen Esel oder mindestens für den Sohn eines Esels halten kann, wenn man nicht weiß, daß es ein Pferd ist. Tromba hat schon Unannehmlichkeiten mit ihm gehabt, man wollte es vom Frühjahrskorso ausschließen, weil der für Esel verboten ist; Tromba aber hat dem wachthabenden Beamten einfach erklärt, ihn würde man freilich nicht auf den Korso lassen, wenn er eingespannt wäre; darüber entstand ein solches Gelächter unter den Zuhörern, daß der Beamte bestürzt wurde und Tromba durchließ.
Tromba hat also viel in der Umgebung zu tun, unter anderm muß er jeden Ersten nach Frascati fahren. In Frascati aber bereitet er jetzt einen Hauptschlag vor. Wahrscheinlich nämlich wird es ihm glücken, die große Gaunerin Colomba abzufangen. Ein Agent hat ihm berichtet, daß der Priester Mario eine neue Haushälterin bekommen hat, auf welche ganz die Beschreibungen von Colomba passen. Er hat bis nun immer nur beobachtet, denn der ehrwürdige Herr Mario ist schon ein alter Herr und ist etwas heftiger Natur; er hat kürzlich erst einen Sbirren die Treppe hinabgeworfen, daß er ein Bein brach, weil der Mann eine Haussuchung nach eingeschmuggeltem Käse bei ihm halten wollte; man muß dem ehrwürdigen Herrn Mario mit Tatsachen kommen, dann beugt er sich, aber auf bloßen Verdacht gibt er nichts.
Tromba ist in Frascati und hört den Agenten kopfschüttelnd und pustend an; der ehrwürdige Herr Mario hat eine Hypothek zurückbezahlt bekommen, zehntausend Skudi; der Agent glaubt, daß es die zehntausend Skudi sind, wegen deren Colomba in den Dienst gegangen ist; alle seine Maßregeln sind getroffen; wenn sie Frascati verlassen will, dann wird sie festgenommen; und die beiden malen sich schon das bestürzte Gesicht des ehrwürdigen Herrn aus, wenn sie zu ihm kommen und ihm sagen: »Vermissen der ehrwürdige Herr nicht zehntausend Skudi? Hier sind sie, die Polizei des Heiligen Vaters schützt das Eigentum des friedlichen Bürgers.« Tromba billigt also alle Anordnungen des Agenten; es ist schon spät, er muß noch nach Rom zurück, und so nimmt er denn Abschied.
Eben will er mit seinem Gefährt aus der Stadt ins Freie fahren, da steht ein junges und hübsches, kleidsam angezogenes Mädchen, mit einem Bündel am Arm, an der Straßenecke und winkt ihm zu; er hält, das Mädchen tritt an den Wagen und bittet ihn um seinen Schutz; sie muß noch diesen Abend nach Rom gehen; ihre Mutter liegt schwerkrank darnieder; die Tante in Frascati hat ihr Arzneien gegeben, die sie wieder gesund machen, denn die Tante hat einmal bei einem Arzt gedient und kann die Krankheiten heilen, und sie kennt ja doch das Innere der Mutter ganz genau; die Arzneien trägt sie in ihrem Bündel eingewickelt, die eine Rolle ist eine Flasche mit einem Trank zum Schwitzen, die andere enthält einen Trank, der die zerrissenen Eingeweide heilt, und die dritte ist zur Stärkung; und nun fürchtet sie sich, in der Dunkelheit den weiten Weg zu machen, und sie hat gedacht, der Herr Polizeihauptmann Tromba nimmt sie vielleicht mit auf seinem Wagen, denn bei dem Herrn Polizeihauptmann würde sie sich ganz sicher fühlen, und das Bündel ist auch so schwer, denn in den Arzneien sind lauter kostbare Bestandteile; und so spricht sie mit geläufiger Zunge, und ab und zu wischt sie sich eine Träne aus den Augen, und dann sieht sie den Hauptmann wieder so rührend an; und so sagt der denn lachend, einem so hübschen Mädchen wird ein feiner Mann nichts abschlagen; sie gibt ihm das schwere Bündel hinauf, das er sorgfältig neben sich setzt; dann reicht er ihr die Hand, sie tritt auf die Achse und schwingt sich leicht über den Radkranz neben ihn. Das Pferd zieht an, sie fahren an einem Mann vorüber, der sie neugierig ansieht; der Mann macht einen etwas verdächtigen Eindruck, das Mädchen drückt sich ängstlich an Tromba, und Tromba nimmt die Zügel in die eine Hand und legt die andere um das Mädchen, um sie väterlich an sich heranzuziehen. Dann beruhigt er sie; seit er im Amt ist, sind die Straßen schon sicher, und der Mann, welcher sie ansah, war sogar ein geheimer Angestellter der Polizei.
So fahren die beiden denn nun den Berg hinunter und über die Ebene, bis sie vor Rom ankommen; der Polizeihauptmann klopft mit dem Peitschenstiel an das Tor, die Wache sieht aus dem Fenster, erkennt Tromba, öffnet das Tor und läßt den Wagen ein. Das Mädchen hat während der Fahrt von der Mutter erzählt, denn sie ist von denen, die immerzu reden können, Tromba hat öfters versucht, das Gespräch auf andere Gegenstände zu bringen, hat sie auch einmal küssen wollen, sie aber ist beleidigt gewesen und hat gesagt, er müsse nicht denken, daß sie so eine sei; das hatte er denn auch nicht gedacht; und so war die Zeit angenehm vergangen. Er läßt es sich nicht nehmen, die Kleine bis nach ihrem Hause zu fahren; sie steigt flink ab, er gibt ihr das Bündel, sie läßt den Türklopfer fallen, und er fährt weiter.
Frühmorgens am anderen Tage kommt der Agent aus Frascati. Der Polizeihauptmann haut sich erfreut auf die starken Schenkel und ruft aus: »Haben wir sie?« Der Agent sieht ihn erstaunt an, dann schweigt er. Der Hauptmann fragt verwundert: »Was ist denn geschehen?« Der Agent aber geht ans Fenster, sieht gleichgültig auf die Straße und macht eine Bemerkung über das Wetter. Wir wollen die Sache abkürzen: Das junge Mädchen war Colomba gewesen, in ihrem Bündel hatte sie die zehntausend Skudi gehabt, und der Aufpasser hatte geglaubt, als er den Polizeihauptmann so vertraut neben ihr sitzen sah, er habe sich mit ihr geeinigt und bekomme vielleicht die Hälfte des Geldes; denn man kann es ja doch einem Beamten nicht übelnehmen, wenn er auch einmal an seine Familie denkt. Natürlich hatte er sie nicht angehalten. Nun war der Agent gekommen und hatte geglaubt, der Hauptmann würde ihm für seine Mühe etwas abgeben, und als der Hauptmann so tat, als wüßte er von nichts, da war er selbstverständlich beleidigt, was man ihm, wenn man sich auf seinen Standpunkt stellt, doch auch nicht übelnehmen kann.
Als nun alles klar wird, gerät der Hauptmann in eine heftige Entrüstung, denn natürlich müssen ihn doch alle seine Untergebenen jetzt für einen unehrenhaften Mann halten, daß er von Colomba das Geld nimmt und ihnen nichts abgibt. Der Agent teilt seine Erbitterung, denn schließlich hatte Colomba die zehntausend Skudi leicht genug verdient, und es wäre wirklich nicht schlimm gewesen, wenn sie der Polizei die Hälfte abgegeben hätte, die doch oft genug ihr gefällig sein muß. Was er über seinen Vorgesetzten denkt, sagt er nicht, aber bekanntlich fällen die Untergebenen im stillen oft scharfe Urteile über die oberen Behörden.