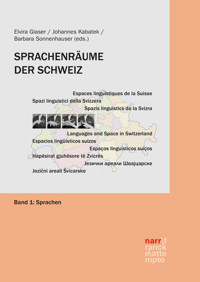
Sprachenräume der Schweiz E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Englisch
Das vorliegende Handbuch bietet eine umfassende Darstellung der Vielfalt der in der Schweiz bis in jüngste Zeit mündlich und schriftlich verwendeten Sprachen und Dialekte und der räumlichen und sozialen Bedingtheit ihres Auftretens. Es bezieht sich nicht ausschliesslich auf die Schweiz als viersprachiges Land, sondern geht neue Wege, indem es darüber hinaus das Englische sowie Sprachen berücksichtigt, deren heutige Präsenz in der Schweiz auf Migration beruht. Auch historische Sprachen und Dialekte, die in der Schweiz und im liechtensteinischen Sprachraum gesprochen werden, sowie die drei Schweizer Gebärdensprachen werden behandelt. Mit Ausblicken über die Schweiz hinaus bietet das Handbuch eine erweiterte Perspektive auf die Räume, die die Sprachen der Schweiz einnehmen. So wird das traditionelle Verständnis von Vielsprachigkeit um neue Aspekte und aktuelle Entwicklungen ergänzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 997
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
[1]Sprachenräume der Schweiz
Elvira Glaser / Johannes Kabatek / Barbara Sonnenhauser (eds.)
Sprachenräume der Schweiz
Band 1: Sprachen
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.dnb.de abrufbar.
Publiziert mit freundlicher Unterstützung der Stiftung EMPIRIS (Jakob Wüest Fonds) und des UFSP Sprache und Raum der Universität Zürich.
Elvira Glaser 0000-0002-9620-3851Johannes Kabatek 0000-0001-8743-6250Barbara Sonnenhauser 0000-0003-2757-3143
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381104024© 2024 Elvira Glaser, Johannes Kabatek, Barbara Sonnenhauser
Das Werk ist eine Open Access-Publikation. Es wird unter der Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen | CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, solange Sie die/den ursprünglichen Autor/innen und die Quelle ordentlich nennen, einen Link zur Creative Commons-Lizenz anfügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Werk enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der am Material vermerkten Legende nichts anderes ergibt. In diesen Fällen ist für die oben genannten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 · D-72070 TübingenInternet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISBN 978-3-381-10401-7 (Print)ISBN 978-3-381-10402-4 (ePDF)ISBN 978-3-381-10403-1 (ePub)
Inhalt
Elvira Glaser, Johannes Kabatek, Barbara Sonnenhauser
Von der viersprachigen zur vielsprachigen Schweiz: Einleitung zu diesem Band
Karin Stüber
Sprachliche Vorgeschichte
Helen Christen, Regula Schmidlin
Deutsch
Andres Kristol
Les traditions dialectales de la Suisse romande: francoprovençal et franc-comtois
Mathieu Avanzi
Français
Stephan Schmid
Italienisch: Landessprache
Matthias Grünert
Rätoromanisch
Penny Boyes Braem
Gebärdensprachen
Mercedes Durham
English
Susanne Oberholzer
Deutsch in Samnaun
Karina Frick
Sprachen in Liechtenstein
Christoph Landolt
Jiddisch
Anja Hasse, Guido Seiler
Die Sprache(n) der Schweizer Täufer in Nordamerika
Stephan Schmid
Italienisch: Migrations- und Herkunftssprache
Johannes Kabatek, Mónica Castillo Lluch
Spanisch
Johannes Kabatek
Portugiesisch
Hellìk Mayer
Bosnisch–Kroatisch–Montenegrinisch–Serbisch (BKMS)
Shpresa Jashari
Albanisch
Raphael Berthele
Sprachbeziehungen und Sprachregelungen in der mehrsprachigen Schweiz
Philippe Humbert, Alexandre Duchêne, Renata Coray
Geschichte der Sprachenstatistik in der Schweiz: Sprachräume, Sprachgemeinschaften, Zahlen und Macht
Glossar
Von der viersprachigen zur vielsprachigen Schweiz: Einleitung zu diesem Band
Elvira Glaser, Universität ZürichJohannes Kabatek, Universität ZürichBarbara Sonnenhauser, LMU München
1Einleitung zur Einleitung
Dass im «Sprachenland Schweiz» (so der Titel einer Ausstellung im Landesmuseum Schweiz im Herbst 2023, siehe Landesmuseum 2024) die Mehrsprachigkeit und das Verhältnis der Sprachen und Varietäten zueinander eine vergleichsweise besondere Rolle spielen, ist sowohl für die Bewohner und Besucher des Landes als auch für Sprachwissenschaftler eine unbestrittene Tatsache. Vier Landessprachen, eine lebendige Dialektvielfalt und die Präsenz zahlreicher weiterer Sprachen prägen die Schweiz auf eine ganz spezifische Weise. Es ist sicher kein Zufall, dass am Beispiel der Schweiz Standardbegriffe der Dialektologie, der Sozio- und der Kontaktlinguistik etabliert wurden.
Mehr als vierzig Jahre nach der «viersprachigen Schweiz» (Schläpfer 1982) erfüllt das vorliegende zweibändige Handbuch das doppelte Desiderat von Aktualisierung und Erweiterung: Aktualisierung bezüglich des Forschungs- und Wissensstands zu den Landessprachen und Erweiterung hinsichtlich weiterer in der Schweiz gesprochener Sprachen sowie, im zweiten Band, hinsichtlich ausgewählter Aspekte des Verhältnisses von Sprache(n) und Räumen (auch im metaphorischen Sinn) in der Schweiz. Indem es die Vielfalt der Schweizer Sprachlandschaften auch jenseits der Nationalsprachen und deren territorialer Verankerung in ihren diversen Ausprägungen berücksichtigt, eröffnet das Handbuch einen Blick auf die Spezifik der sprachlichen Verfasstheit der Schweiz weit über die bekannte politisch-gesellschaftliche Mehrsprachigkeit hinaus.
Band 1 geht dabei konsequent den in den letzten Jahren vielerorts immer wieder betonten Weg von der «viersprachigen» zur «vielsprachigen» Schweiz. Er enthält neben Informationen zu den Landessprachen auch solche zu weiteren in der Vergangenheit und in der Gegenwart auf dem Gebiet der Schweiz gesprochenen bzw. verwendeten Sprachen, einschliesslich der nicht eigentlich «gesprochenen» schweizerischen Gebärdensprachen. Hier zeigt sich eine ganz besondere Zweiseitigkeit, die charakteristisch für die jüngere Entwicklung des Landes ist, das konsequent einen Spagat zwischen Betonung der auch sprachlichen Eigentümlichkeit und der Öffnung zu Internationalität durch Migration, wirtschaftliche Vernetzung und Tourismus vollführt. Heute gibt es in der Schweiz weit mehr Sprechende des Englischen, Portugiesischen oder Albanischen als etwa der rätoromanischen Idiome. Bei der Bewertung dieser neuen Situation scheiden sich die Geister, wenn einerseits der hinzugekommene sprachliche und kulturelle Reichtum bei gleichzeitiger erfolgreicher Integration und möglicher Vielsprachigkeit betont und andererseits eine «Überfremdung» als Gefahr dargestellt wird. Die Frage, ob «Albanisch irgendwann zu einer weiteren Landessprache» wird, beschäftigte im Sommer 2023 die SRF-community (SRF 2023). Aber auch das Englische wird auf dem Weg zu einer «zweiten» (oder «fünften») Landessprache vermutet, und es wird diskutiert, ob dies das Ende der viersprachigen Schweiz bedeuten würde oder, im Gegenteil, einen Kitt über die Sprachräume hinweg darstellen kann (Aschwanden und Gerny 2024; Büchi 2024 und ►Sprachbeziehungen).
Dieses Handbuch versucht also, durch das Einbeziehen der Darstellung einer Reihe von in der Schweiz verbreiteten «Nicht-Landessprachen» der gesamten Sprachenvielfalt Rechnung zu tragen und dabei anzudeuten, dass die vielsprachige und die viersprachige Schweiz nicht eigentlich einen Gegensatz bilden, sondern sich fruchtbar ergänzen können. Damit kann die Schweiz auch heute und gerade vor dem Hintergrund der massiven Präsenz «neuer» Sprachen immer noch als Modell für die Verbindung von Pluralität und Eigenständigkeit dienen (►Sprachenstatistik), auch wenn die mit der Vielsprachigkeit verbundenen möglichen Probleme und Konflikte keinesfalls ignoriert werden sollen, wie dies verschiedene Beiträge zeigen. Über die Landessprachen, das Englische und einige Migrationssprachen hinaus sind im Handbuch den schweizerischen Gebärdensprachen, den Varietäten in Liechtenstein (das in vielen Punkten der Deutschschweiz sehr verbunden ist und selten thematisiert wird) sowie dem territorialen Sonderfall Samnaun und dem Jiddischen einzelne Kapitel gewidmet. Ein transversales Kapitel beschäftigt sich mit den Beziehungen der Landessprachen untereinander, ein weiteres mit den Herausforderungen der Sprachstatistik. Nicht vergessen wird zudem die Tatsache, dass die Schweiz ihrerseits lange ein Auswanderungsland war und im Zuge dieser Auswanderungen auch Sprachen der Schweiz in neue Kontexte gelangt sind (►Täufer).
Band 2 hingegen zeigt Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte zum Gesamtbereich des Verhältnisses von Sprache und Raum und seiner Dynamik in der Schweiz. Dabei werden vielfach die in Band 1 dargestellten einzelsprachlichen Aspekte unter spezifischen, oft transversalen Blickwinkeln neu aufgenommen und in Einzelstudien vorgestellt, deren Bandbreite von der Anwendung aktueller sprachgeographischer Methoden auf den «Fall Schweiz» über die Besonderheiten der Kurznachrichtenkommunikation bis hin zu verschiedenen Sprachkontaktphänomenen reicht. Diese Studien zeigen auch, dass der Raumbegriff im Verhältnis von Sprache und Raum nicht nur geographisch zu verstehen ist, sondern weitere Dimensionen umfasst, und u.a. auch sozial, perzeptiv oder medial zu verstehen ist. Ein Teil dieser Studien geht auf die Aktivitäten des an der Universität Zürich zwischen 2013 und 2024 bestehenden Universitären Forschungsschwerpunktes «Sprache und Raum» zurück und legt – wie das ganze Handbuchprojekt überhaupt – Zeugnis ab von der fruchtbaren interdisziplinären Zusammenarbeit insbesondere zwischen Linguistik und Geografie und zwischen den verschiedenen linguistischen Einzeldisziplinen untereinander (UFSP 2024).
2Von der viersprachigen zur vielsprachigen Schweiz
Die Beschreibung der Sprachenvielfalt der Schweiz hat verschiedene Dimensionen: politische, soziale, geographische, individuelle, linguistische, um nur die wichtigsten zu nennen. Ausgangspunkt von Sprachbeschreibungen sind oft – auch in diesem Handbuch – die Daten des Bundesamtes für Statistik (BFS), die einerseits der jährlichen Strukturerhebung (SE), andererseits der alle fünf Jahre durchgeführten Erhebung zu Sprache, Religion und Kultur (ESRK) entstammen. Den Daten kann u.a. entnommen werden, dass in individueller Hinsicht die grosse Mehrzahl der Personen, die in der Schweiz leben, üblicherweise mehr als eine Sprache spricht (Abb. 1):
Abb. 1: Individuelle Mehrsprachigkeit in der Schweiz 2014 und 2019. Quelle: BFS 2021: 9
Darüber hinaus zeigt sich, dass in der Schweiz neben den vier Landessprachen verschiedene weitere Sprachen von vielen Personen regelmässig gesprochen werden. Nach statistischer Häufigkeit sind dies zunächst das Englische, dann das Spanische, Portugiesische, Albanische und Bosnisch-Kroatisch-Serbisch-Montenegrinische (BKMS), wobei die Reihenfolge je nach Befragungskriterium – Hauptsprache, zuhause gesprochenen Sprache(n), Sprache(n) bei der Arbeit, regelmässig verwendete Sprache(n) – unterschiedlich sein kann und es nicht nur bei den Landessprachen regional deutliche Unterschiede gibt (Abb. 2):
Abb. 2: Häufigste regelmässig verwendete Sprachen im Jahre 2019. Quelle: ESRK, BFS 2021: 13
Schon hier ist anzumerken, dass eine rein quantitative Aufzählung von Sprecherzahlen der Beschreibung der Schweizer Sprachensituation nicht gerecht werden kann und z.T. komplexe Sachverhalte verbirgt. Die einzelnen Kapitel dieses Buches erlauben es, die Individualität der Sprachensituationen näher zu beleuchten. Hier nur kurz einige Bemerkungen: das Bundesamt für Statistik führt bei der Frage nach den zu Hause oder bei der Arbeit gesprochenen Sprachen Italienisch sowie Tessiner und bündneritalienischer Dialekt genauso wie Hochdeutsch und Schweizerdeutsch als getrennte Kategorien auf. Mag dies aufgrund der Diglossiesituation für Hochdeutsch und Schweizerdeutsch sinnvoll sein, ist es aufgrund des Dialektkontinuums im Tessin sicherlich schwieriger, eine solche Trennung vorzunehmen. Uns erschien es stattdessen angebracht, das Italienische als Landessprache – einschliesslich der italienischen Dialekte in den entsprechenden Südschweizer Territorien – als eine von Italienisch als Migrationssprache v.a. in der Deutschschweiz getrennte Grösse zu betrachten.
Bei der Reihenfolge der am meisten gesprochenen Sprachen kommt es darauf an, ob die zu Hause gesprochene Sprache, die bei der Arbeit gesprochene Sprache oder eine sonstwie beherrschte Sprache zugrunde gelegt wird. Bei der Frage nach der Hauptsprache, die in den Erhebungen des BFS danach definiert ist, dass man in ihr denkt und sie am besten beherrscht, wird in den Zahlen des BFS nicht zwischen Dialekt und Standardsprachen unterschieden, was bei einem Vergleich der Zahlen berücksichtigt werden muss (vgl. dazu auch ►Sprachenstatistik). Im Vergleich zum Spanischen, das nach Englisch die zweitmeist gelernte Nichtlandessprache ist, verfügen Albanisch und Portugiesisch über mehr Muttersprachler bzw. Sprecher, die diese Sprachen im Familienkontext erworben haben. Unterschiedliche Reihenfolgen ergeben sich auch bei der Betrachtung der regionalen Verteilung: die romanischen Sprachen Spanisch und Portugiesisch sind in der romanischen Westschweiz viel präsenter als in der Deutschschweiz (mit Ausnahme verschiedener urbaner Räume); das Portugiesische ist die am meisten gesprochene Migrationssprache in Graubünden, die balkanischen Sprachen sind v.a. in der Deutschschweiz präsent genauso wie die deutschen Varietäten von Einwanderern aus Deutschland und Österreich.
Die Funktionen der Sprachen sind sehr unterschiedlich, und die Vielsprachigkeit kann nicht auf einer kontinuierlichen Linie betrachtet werden. Die territorialen, angestammten, offiziellen Landessprachen haben legal und sozial einen völlig anderen Status als die Migrationssprachen und sie haben eben auch ihre Sprachgebiete und ihre räumliche Kontinuität, welche die Identität der Bewohner prägt. Doch selbst hier sind die Grenzen nicht immer so eindeutig: es spricht nicht das Land, sondern es sprechen die Menschen. Entsprechend ist die heutige Sprachensituation der Schweiz auch in Bezug auf die Landessprachen das Resultat einer komplexen Geschichte von Migrationen, selbst wenn diese weit zurück liegen und nicht mit den aktuellen Migrationsbewegungen zu vergleichen sind (►SprachlicheVorgeschichte). Beispielsweise gehen die Walserdialekte in verschiedenen Gegenden Graubündens und im Tessin auf Migration zurück, und gleichzeitig haben die heutigen Migrationssprachen in bestimmten sozialen Domänen oder in bestimmten Stadtvierteln oder sogar Dörfern ebenfalls schon eine gewisse Territorialität entwickelt (►Portugiesisch).
Die jeweils unterschiedliche historische Dynamik ist sicherlich eine der Haupteigenschaften der in Band 1 des Handbuchs beschriebenen Sprachen: da sind die angestammten Territorialsprachen einerseits und die v.a. seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts präsenten Migrationssprachen anderseits. In deren verschiedenen Sprechergemeinschaften gibt es unterschiedliche Tendenzen, was die Bewahrung der mitgebrachten Sprachen angeht: zunächst die Dynamik der Integration, wenn von Generation zu Generation die schweizerische Identität mehr und mehr an Gewicht gewinnt, mit der Herkunftsidentität gleichzieht und diese möglicherweise ersetzt und damit auch die Herkunftssprache zunehmend in den Hintergrund rückt. Der hohe Grad sprachlicher Integration lässt sich aus der häufigsten zu Hause gesprochenen Sprache der Kinder in den jeweiligen Sprachregionen ablesen (Abb. 3):
Abb. 3: Häufigste von Kindern zu Hause gesprochene Sprachen. Quelle: BFS 2021: 24
Aber das häufige Drei-Generationen-Schema, das für den Verlust von Sprachen drei Generationen an Sprechern ansetzt, ist kein Muss, und es gibt durchaus zahlreiche Fälle von Spracherhalt über die Generationen hinweg. Zudem sind ja auch die Zielterritorien der Migration nicht einsprachig, so dass es zuweilen interessante Präferenzen gibt (etwa bei Portugiesen, die als Integrationssprache das Romanische dem Deutschen vorziehen).
Eine zweite Dynamik ergibt sich bezüglich der verschiedenen Migrantengruppen und ihrer Sprachen untereinander; hier ist insbesondere die erwähnte Rolle der Italiener und des Italienischen als Koine zu erwähnen, aber auch unterschiedliche Netzwerkbildungen. So ist es aufgrund der Verwandtschaft der Sprachen wahrscheinlicher, dass Sprecher des Italienischen und Spanischen sich gegenseitig verstehen oder Sprecher des Spanischen und Portugiesischen als etwa Sprecher des Albanischen und Spanischen; auch religiöse und weitere kulturelle Faktoren prägen die Netzwerke. Der Zusammenhang von Sprache und Religion wird insbesondere im Falle der emigrierten Täufer deutlich, beim Jiddischen oder auch bei BKMS oder Rätoromanisch.
Im Verhältnis von «angestammten» und «eingewanderten» Sprachen ist zudem der internationale Status und das Prestige der Sprachen, das sich aus vielfältigen und sehr variablen Quellen speist, von Bedeutung. Die drei grossen Landessprachen sind auch aufgrund politischer Vorgaben die am meisten gelernten Sprachen der Schweiz (mit gewissen Diskussionen über den Status des Englischen in der Schule); daneben ist die einzige Sprache einer grossen Migrantengruppe, die aufgrund ihrer Bedeutung als Weltsprache in den Schulen gelehrt wird, das Spanische. Englisch wiederum hat einen ganz besonderen Status: als lingua franca, als Sprache zahlreicher Unternehmen und Institutionen, als immer mehr sich durchsetzende Sprache der universitären Bildung und, zusehends, als Modesprache unter Netflix-geprägten Jugendlichen, die etwa in Zürich seit der Pandemie nicht nur ihr Deutsch mit Anglizismen spicken, sondern sich gleich ganz auf Englisch unterhalten, nicht zuletzt, weil ihnen dies mittlerweile einfach als problemlose und coole Option zur Verfügung steht. Wohin die Reise hier geht, steht in den Sternen; das Handbuch will kein Ort der Spekulation, wohl aber einer der Aufnahme der gegenwärtigen Situation sein.
3Der Elefant im Raum: Deutsch als Migrationssprache
Obwohl das Handbuch eigentlich die Sprachsituation der quantitativ bedeutendsten Migrationsgruppen behandelt, gibt es kein Kapitel zur grössten Gruppe: den deutschsprachigen Migranten aus Deutschland und Österreich. Die Hintergründe dafür sollen im Folgenden kurz angesprochen werden. Es geht dabei um die regionale Verteilung ebenso wie um die Rolle der Standardsprache, die in der Deutschschweiz einen besonderen Fall darstellt.
Abb. 4: Grösste Gruppen ausländischer Staatsbüger in der Schweiz. Quelle: SEM 2024a
2024 sind 328’315 deutsche Staatsbürger (inklusive sog. Kurzaufenthalter) in der Schweiz wohnhaft. Sie liegen damit nur wenig unter der grössten Ausländergruppe, den italienischen Staatsbürgern, die 344’534 Einwohner umfasst (SEM 2024a, Stichtag Ende Mai 2024, siehe Abb. 4). Dazu kommen 47’752 österreichische Staatsbürger. Der grösste Teil dieser Einwanderungsgruppe wohnt in den deutschsprachigen Kantonen und spricht vermutlich eine Varietät des Deutschen. Allein im Kanton Zürich leben derzeit (2024) 88’061 Deutsche, die hier wie in allen deutschsprachigen Kantonen, ausser Solothurn und Glarus, aber auch im zweisprachigen Kanton Bern die grösste Gruppe bilden1. Während sie in Graubünden mit 7’950 Personen an zweiter Stelle hinter den portugiesischen Staatsbürgern liegen, befinden sie sich in den (dominant) französischsprachigen Kantonen meist nicht unter den fünf grössten Ausländergruppen. Im Tessin stellen die Deutschen die drittgrösste ausländische Population. Dieser geographischen Verteilung entsprechend ist damit zu rechnen, dass die meisten deutschen und österreichischen Staatsangehörigen im Alltag in einer Varietät des Deutschen kommunizieren. Genaue Zahlen dazu gibt es nicht. Wir wissen zwar, dass 2019 Hochdeutsch als regelmässig verwendete Sprache immerhin zu 20 % in der französischen Schweiz und zu 27 %in der italiensprachigen Schweiz verwendet wurde (BFS 2021), diese Zahl lässt sich aber nicht auf die Staatsbürgerschaft oder den Migrationsstatus zu beziehen. Eine entsprechende Auswertung der ESRK-Erhebungen von 2014 zeigt aber klar, dass deutsche Staatsbürger weniger Schweizerdeutsch verwenden als andere Nationalitäten. Nur 44 % gebrauchten nach eigener Angabe damals regelmässig Schweizerdeutsch, Österreicher immerhin zu 67 % (BFS 2017: 14–15).
Die vom Bundesamt für Statistik erhobenen Daten über die Hauptsprache als die Sprache, in der man denkt und die man am besten beherrscht, sind nicht auf die Staatsangehörigkeit beziehbar. Ausserdem werden bei der Frage nach der Hauptsprache die Landessprachen mit ihren Dialekten zusammengruppiert, so dass man nicht genau weiss, für wie viele Personen, die «Deutsch» angeben, die Hauptsprache Schweizerdeutsch ist. Allerdings wird in den seit 2010 durchgeführten sogenannten Strukturerhebungen (►Sprachenstatistik) auch nach den «üblicherweise zu Hause» und «üblicherweise bei der Arbeit» gesprochenen Sprachen gefragt, wobei hier Schweizerdeutsch und Hochdeutsch getrennt erhoben werden. Wenn jedoch jemand zu Hause einen in Deutschland oder Österreich beheimateten Dialekt spricht, wird das nicht eigens erfasst. Entsprechende Personen könnten z.B. bei den zu Hause gesprochenen Sprachen in einem solchen Fall lediglich die Vorgabe «andere Sprache(n)» wählen, obwohl sie bei der Hauptsprache Deutsch angekreuzt haben. Wie viele das tun, und wie viele «Hochdeutsch» auch bei der zu Hause gesprochenen Sprache ankreuzen, kann man nicht wissen, da die «anderen Sprachen» nicht aufgeschlüsselt sind. Insofern werden die Zahlen zu den Hochdeutschsprechenden zu Hause oder am Arbeitsplatz in den Statistiken tendenziell eher etwas zu hoch liegen. In der Strukturerhebung des BFS 2022 (BFS 2024b) gaben tatsächlich 826’181 Personen «Hochdeutsch» als zu Hause gesprochene Sprache an (nach Auskunft des BFS ist in den statistischen Tabellen «Deutsch» bedeutungsgleich mit «Hochdeutsch», falls keine weiteren Angaben dazu gemacht werden). Neben deutschen Staatsbürgern werden wohl auch österreichische Staatsbürger diese Auswahl getroffen haben. Sie können aber nicht für die Gesamtzahl verantwortlich sein, zumal ein gewisser Teil der österreichischen und deutschen Staatsbürger auch eine Minderheiten- oder Migrationssprache gewählt haben könnte. Hinter der Diskrepanz zwischen der auf der Staatsangehörigkeit basierenden Zahl und den wesentlich mehr Nennungen von Deutsch als zu Hause gesprochener Sprache können sich verschiedene Konstellationen verbergen. Zum einen könnte es sein, dass viele eingebürgerte Hochdeutschsprechende weiterhin beim Hochdeutschen bleiben und folglich deren Zahl erhöhen. Zum anderen spiegelt sich hier aber vielleicht auch die Situation in sprachlich gemischten Familien, in denen sich Hochdeutsch oder jedenfalls nicht Schweizerdeutsch als Familiensprache etabliert hat. Auf beide Faktoren deuten die Zahlen in der Tabelle «Zuhause gesprochene Sprachen in der Schweiz, 2022» (BFS 2024a): 201’903 «Schweizer/innen mit Migrationshintergrund» geben 2022 Deutsch als zuhause gesprochene Sprache an (gegenüber 484’476 Schweizerdeutsch), solche ohne Migrationshintergrund immerhin 168’080, gegenüber 3'214’224 Schweizerdeutsch.
Allerdings gibt es neben «zu Hause» und «am Arbeitsplatz» (dazu ►Wolf_Band2) noch allerlei weitere Situationen, für die die BFS-Strukturerhebungen keine Daten liefern. Und es ist nichts darüber bekannt, welche Sprachvarietät als Hochdeutsch bezeichnet wird, u.a. auch aus dem oben bereits genannten Grund, dass deutsche Dialekte – ausser Schweizerdeutsch – in den Strukturerhebungen gar nicht gewählt werden können. Ein weiterer Grund liegt darin, dass in Deutschland zwischen Dialekt und Hochdeutsch ein Kontinuum besteht und das gesprochene Hochdeutsch mehr oder weniger stark dialektal oder zumindest regional geprägt sein kann. Es stellt sich ausserdem die Frage, wie stark das als Hochdeutsch bezeichnete Deutsch Eigenheiten des Schweizer Hochdeutschen aufweist. Deutsche (und Österreicher) finden sich in der Schweiz in einer Situation wieder, in der sie zwischen Dialekt/Schweizerdeutsch und Hochdeutsch unterscheiden müssen (►Deutsch). Unter den 259’567 «Ausländer/innen der ersten Generation», die angeben, zu Hause gewöhnlich Schweizerdeutsch zu sprechen, werden wohl auch etliche aus Deutschland und Österreich sein, ebenso auch unter den 484’476 Schweizern und Schweizerinnen mit sonstigem Migrationshintergrund. Zahlenmässig aufschlüsseln lässt sich das leider nicht weiter. Für die Wohnbevölkerung insgesamt lässt sich entsprechend der ESRK-Erhebung von 2019 (BFS 2021: 14) sehen, dass Personen mit Migrationshintergrund in der ersten Generation nur 40,6 % Schweizerdeutsch als regelmässig gebrauchte Sprache angeben, während das für 78 % derjenigen ohne Migrationshintergrund der Fall ist. In der zweiten Generation steigt die Prozentzahl dann auf 68,1 %. Diese Verhältnisse werden wohl auch für Personen mit deutschem oder österreichischem Migrationshintergrund gelten.
Die zahlreichen Fragen, die sich rund um das heutige sprachliche Verhalten der aus Deutschland oder Österreich stammenden Wohnbevölkerung stellen, können hier nicht diskutiert oder gar beantwortet werden, da aktuelle Daten dazu fehlen (siehe aber ►Wolf_Band2). Die breit angelegte Untersuchung von Koller (1992), die zu Beginn der 1980er Jahre auf der Basis von 100 Interviews mit aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands stammenden Deutschen in der Deutschschweiz durchgeführt wurde, dürfte zwar in ihren grundsätzlichen Ergebnissen noch Gültigkeit besitzen. Verschiedene Faktoren, wie die massive Zunahme deutschsprachiger Einwanderer seit der Freizügigkeitsregelung, die seither erfolgte Ausweitung des Dialektgebrauchs, v.a. auch in den Medien und in neueren schriftlichen Kommunikationsformen (►Stark/Ueberwasser_Band2), sowie die allgemeine Tendenz zur Informalisierung gesprochener Sprache, aber auch die Rolle, die das Englische v.a. bei Jugendlichen einnimmt (►Englisch), die Zunahme des Tourismus (inklusive Einkaufstourismus) und grenzübergreifender kultureller Bewegungen, lassen aber neue empirische Untersuchungen dringend nötig erscheinen. Dabei wäre zusätzlich zu den von Koller (1992) kontrollierten Kriterien (z.B. Alter und Alter bei der Einwanderung, Aufenthaltsdauer etc.) auch die Zugehörigkeit zur ersten oder zweiten Generation ein wichtiges Unterscheidungskriterium, um die Komplexität der heutigen Situation zu erfassen. Die Zusammensetzung der Informanten Kollers, unter denen etwa die Hälfte das Schweizer Bürgerrecht besass und einen Deutschschweizer Ehepartner hatte, dürfte sich in den Ergebnissen zugunsten des Schweizerdeutschen ausgewirkt haben. Koller fokussierte mit Absicht auf bereits stark mit der Deutschschweiz verbundene Deutsche (1992: 86–87), was sicher auch damals nicht repräsentativ für die Gesamtheit der Deutschen in der Deutschschweiz war.
Die Grundproblematik, in der sich Deutschsprachige in der Deutschschweiz befinden, ist aber gleich geblieben. Ihre Deutschsprachigkeit macht sie zum Teil der deutschsprachigen Bevölkerung, wie sie in den Strukturerhebungen mit der Frage nach der Hauptsprache ermittelt wird. Insofern sehen sich Deutschsprachige häufig nicht in gleicher Weise als Migranten wie etwa Spanier, Portugiesen, Italiener etc. Kein oder nur schlecht Schweizerdeutsch zu sprechen, grenzt sie aber gleichzeitig als fremd aus. Hinderlich für den Erwerb und Gebrauch des Schweizerdeutschen wirkt sich vor allem die mitgebrachte soziolinguistische Kultur aus, derzufolge ein Dialekt, wenn überhaupt, nur kleinräumig, in familiärem Umfeld und nicht in öffentlicher Funktion gebraucht wird: In Deutschland herrscht eine Sprachkultur, die es als unangemessen ansieht, mit Sprechern anderer Varietäten einen lokalen Dialekt zu sprechen und die nach einer gemeinsamen, neutralen Varietät – meist dem Standard oder einer standardnahen Varietät – strebt, um eine möglichst symmetrische Kommunikation zu ermöglichen. In der Deutschschweiz ist hingegen asymmetrisches Kommunizieren (d.h. in der jeweiligen Mundart, bei passivem Verständnis der Kommunikationspartner) völlig üblich (►Deutsch und Kabatek 2015). Der sprachliche Abstand ist je nach regionaler Herkunft zwar unterschiedlich gross, im Allgemeinen ist aber nach einer gewissen Eingewöhnungszeit das Verständnis gewährleistet. Dennoch kann der Dialog zwischen Hochdeutschsprechern und Schweizerdeutschsprechern nicht in gleicher Weise polylektal geführt werden, wie es unter Sprechern verschiedener Schweizer Dialekte der Fall ist, was mit der besonderen Stellung des Hochdeutschen in der Deutschchweiz zusammenhängt (►Deutsch). Eigener Beobachtung zufolge praktizieren österreichische Staatsbürger aus Vorarlberg, deren Dialekt dem Schweizerdeutschen nahesteht, aber durchaus diese Art von Verständigung. Untersuchungen dazu fehlen jedoch.
Aus Bemerkungen der Sekundärliteratur ebenso wie aus individueller Beobachtung lässt sich entnehmen, dass sich Deutsche in der Deutschschweiz ganz unterschiedlich bezüglich der Sprachwahl verhalten und dass diese Sprachwahl von zahlreichen Faktoren abhängt. Koller (1992: 23) berichtet, dass drei Fünftel seiner Interviewpartner mit ihren Deutschschweizer Bekannten schweizerdeutsch sprechen und 80 % unter ihnen der Meinung seien, dass das notwendig sei. Vier Fünftel denken, dass das die Deutschschweizer mehrheitlich auch erwarten. Umgekehrt erklären 90 % derjenigen, die konsequent Hochdeutsch sprechen, das zu tun, weil sie das Schweizerdeutsche nicht gut genug beherrschen.
Informanten mit aktivem dialektalen Hintergrund können Schweizerdeutsch signifikant schneller verstehen und beginnen früher mit dem Schweizerdeutsch-Sprechen (Koller 1992: 128–129). Dabei ist die Qualität der Beherrschung sehr unterschiedlich, vereinzelt gibt es Personen, die sogar mit anderen Deutschen Schweizerdeutsch sprechen (Koller 1992: 263). Insgesamt scheint die Lautung am schwierigsten zu meistern zu sein, wobei die Gewährspersonen selbst angeben, mit den Wortstellungsregeln die grösste Mühe zu haben.
Was das Hochdeutsch der in der Deutschschweiz lebenden Deutschen betrifft, gab zwei Drittel der Informanten an, dass es bei Reisen nach Deutschland «in Klang und Wortschatz» auffalle (Koller 1992: 297). Koller (1992: 254, 305) stellt auch fest, dass «pragmatische Formeln» «eine erste Einbruchstelle des Dialekts sind.» Zwar sagt die Hälfte der Informanten, sie bemühe sich darum, ein «gutes Hochdeutsch» zu bewahren, für die übrigen spielt offenbar die Bewahrung der Herkunftssprache keine spezielle Rolle. Eine Zusatzbefragung unter Jugendlichen (Koller 1992: 308–320) zeigt, dass diese praktisch ausnahmslos völlig zum Schweizerdeutschen als Alltagssprache übergegangen sind, auch wenn sie zu Hause Hochdeutsch sprechen. Ob sie das Hochdeutsche später weitergeben, ist fraglich.
Überhaupt sind wenig Details bekannt, was das Verhalten der Deutschen bzw. der Schweizer mit deutschem Migrationshintergrund in der zweiten oder dritten Generation angeht. Aus der Statistik des BFS (2024a) geht generell hervor, dass zwischen Ausländern der ersten Generation und späteren Generationen ein deutlicher Rückgang des Hochdeutschen zu verzeichnen ist, von ca. einem Viertel (435’523 von 1’685’214) auf ca. 10 % (18’014 von 173’549), wobei es keine Langzeitstudien dazu gibt. Es scheint so zu sein, dass für die Gruppe der Deutschsprachigen kein Bewusstsein für Hochdeutsch als Herkunftssprache besteht, was tatsächlich einen deutlichen Unterschied zum Italienischen oder anderen Migrationssprachen ausmacht.
4Die vielsprachige Schweiz: Zu den Inhalten von Band 1
Der vorliegende Band 1 beschreibt anhand von umfassenden Sprachenportraits die Sprachen der Schweiz und – erstmals in diesem Kontext – auch Liechtensteins in ihrer komplexen Vielfalt. Dies betrifft ihre Strukturen und Funktionsbereiche ebenso wie die geographische und sozio-kulturelle Einbettung, die diese Vielfalt prägen und über längere Zeiträume mitgestaltet haben.
Der erste Beitrag, von Karin Stüber, ist der sprachlichen Vorgeschichte der Schweiz gewidmet, von den ersten Besiedlungen und den Resten des vorindoeuropäischen Rätischen über den keltischen Einfluss bis zur Herausbildung der heutigen Sprachräume durch Latinisierung und Alemannisierung. Der Text bildet die Grundlage für die territoriale Sicht auf die Sprachen der Schweiz, die mit einem ausführlichen Beitrag von Helen Christen und Regula Schmidlin zur deutschsprachigen Schweiz beginnt. Darin geht es sowohl um die dialektale Vielfalt als auch um das Verhältnis von Mundarten zur Standardsprache und die Rolle der Schriftsprache.
Dem frankophonen Raum in der Westschweiz sind zwei französisch geschriebene Beiträge gewidmet: ein Text von Andres Kristol, der vor allem das Frankoprovenzalische (einschliesslich seiner noch existierenden Reste) behandelt, aber auch auf die nordfranzösischen Dialekte und deren Einfluss auf die Schweiz eingeht. Dem Französischen von heute und dem Verhältnis von regionalen Elementen und Standardfranzösisch widmet sich der Beitrag von Mathieu Avanzi.
Das Italienische wird in diesem Band in zwei Beiträgen von Stephan Schmid behandelt, einem ersten, zu Italienisch als Landessprache, und einem zweiten, der die Situation des Italienischen als Migrationssprache in der Schweiz behandelt. Beide Texte sind so verzahnt, dass sie sich sehr gut ergänzen und dennoch auch als eigenständig gelesen werden können. Im ersten Beitrag geht es um Italienisch als Landessprache im Tessin und in den italienischsprachigen Regionen Graubündens. Hier wird die Andersartigkeit des Status der Dialekte und des italienischen Standards insbesondere im Vergleich mit der Situation der Deutschschweiz herausgearbeitet und die dialektale Vielfalt und der Zusammenhang mit dem norditalienischen Dialektkontinuum beschrieben (zum zweiten Beitrag siehe unten).
Der Beitrag von Matthias Grünert zum Rätoromanischen gibt nebst einigen historischen Informationen einen Einblick in die fünf gegenwärtig gesprochenen und geschriebenen «Idiome» und ihre soziolinguistische Einbettung, wobei auch das Verhältnis der oft als künstlich empfundenen jungen Gemeinsprache Rumantsch Grischun zum rätoromanischen Varietätenraum thematisiert wird.
Parallel zu den drei grossen gesprochenen Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch gibt es in der Schweiz drei Gebärdensprachsysteme mit jeweiligem Bezug zu den gesprochenen Pendants. Penny Boyes Braem erklärt in ihrem Beitrag zunächst einige der Grundprinzipien von Gebärdensprachen und geht dann auf die drei Gebärdensprachen im Einzelnen ein, sowohl hinsichtlich linguistischer als auch soziokultureller Faktoren. Sie beschreibt auch die radikale Änderung, die die Situaton der Gebärdensprachen durch die technische Innovation der Cochlea-Implantate erfahren hat.
Eine besondere Stellung in der Schweiz kommt dem Englischen zu, wie es in dem auf Englisch geschriebenen Beitrag von Mercedes Durham dargestellt wird. Das Englische ist die einzige flächendeckend gelehrte Nichtlandessprache der Schweiz und nimmt in manchen, vor allem urbanen Umgebungen, einen breiten Raum ein. Zudem sind die kommunikativen Domänen des Englischen in Ausdehnung begriffen. Der Erforschung des Englischen in der Schweiz wird auch in Band 2 ein Beitrag gewidmet sein (►Pfenninger/Becker_Band2).
Einem territorialen «Sonderfall», der Enklave Samnaun, ist der Beitrag von Susanne Oberholzer gewidmet, der sich detailliert mit den sprachlichen Eigenheiten dieses an nur einem Ort im Engadin gesprochenen südbairischen/Tiroler Dialekts auseinandersetzt. Die Besonderheit Samnauns ist zweifach: erstens, weil es eine deutsche Sprachinsel im rätoromanischen Gebiet darstellt und zweitens, weil dort ein nicht-alemannischer Dialekt gesprochen wird.
Dass in einem Handbuch zu Sprachräumen in der Schweiz auch das kleine Nachbarland Liechtenstein mit behandelt wird, ist aus sprachlicher Sicht und bezüglich des Dialektkontinuums zweifelsohne gut nachvollziehbar. Karina Frick beschreibt nicht nur das Verhältnis von Mundart und Hochsprache im Land, sie geht auch auf die innere Differenzierung ein.
In seinem Beitrag zum Jiddischen beschreibt Christoph Landolt die Geschichte der Präsenz jiddischsprachiger Personen in der Schweiz – inklusive einer erstmaligen Darstellung der Grammatik des traditionell im Surbtal gesprochenen Westjiddisch. Einzig dort war es Juden bis ins 19. Jahrhundert erlaubt, zu leben.
Eine weitere Perspektive wird durch den Beitrag von Anja Hasse und Guido Seiler eingebracht, die das Berndeutsch der Täufergemeinschaften in den USA behandeln, die ab dem 17. Jahrhundert aus Gründen der religiösen Unterdrückung ausgewandert sind. Ihre bis heute lebendige Sprache weist trotz ihrer religiös bedingt isolierten Lebensweise starke Einflüsse der Umgebungssprachen auf.
Bei den durch Migration in die Schweiz gekommenen Sprachen mussten wir uns auf einige der zahlenmässig präsentesten beschränken. Die Darstellung beginnt hier sozusagen chronologisch, mit Italienisch als nicht nur zahlenmässig bedeutendster Migrationssprache (es gibt mehr Italienischsprechende mit Migrationshintergrund in der Schweiz als «territoriale», angestammte Landessprachensprecher), sondern auch als erster grosser Migrationssprache ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Noch im 19. Jahrhundert war die Schweiz eher ein Land der Emigration, doch die wirtschaftliche (und z.T. auch politische) Entwicklung im 20. Jahrhundert drehte die Migrationsrichtung um; vor allem der ökonomische Boom nach dem 2. Weltkrieg führte zur Nachfrage an Arbeitskräften, die zunächst vor allem aus Italien kamen. Der Beitrag von Stephan Schmid zu Italienisch als Migrationssprache spricht nicht nur von der Präsenz des Italienischen in der Deutschschweiz, den italienischen Varietäten und ihrem Erhalt in den Folgegenerationen, er weist auch auf die besondere Rolle des Italienischen als Koine im Arbeitsbereich und als Kommunikationssprache auch mit den durch weitere Migrationswellen in die Schweiz kommenden anderssprachigen Migranten hin.
Johannes Kabatek und Mónica Castillo widmen sich dem Fall des Spanischen, das als Migrationssprache nicht nur die auf das Italienische folgende erste grosse Nichtlandessprache wurde, sondern aufgrund der globalen Bedeutung der Weltsprache Spanisch auch im Erziehungswesen und der Erwachsenenbildung Einzug hielt und nach Englisch zur zweitmeist gelernten Nichtlandessprache wurde. Für die spanischsprachige Migration ist auch eine innere Differenzierung notwendig. Die Spanischsprechenden stammen heute aus mehr als zwanzig Ländern, und innerhalb der grössten Gruppe, den Personen aus Spanien, kommt etwa ein Drittel aus dem Nordwesten und spricht oft neben Spanisch auch die Regionalsprache Galicisch.
In einer weiteren Phase erlangte mit dem Portugiesischen, v.a. nach der Nelkenrevolution in Portugal 1975, eine weitere Weltsprache eine beachtliche Präsenz in der Schweiz. Portugiesisch ist heute mit mehr muttersprachlichen Personen präsent als das Spanische, spielt jedoch im Bildungswesen eine untergeordnete Rolle. Es wird vor allem innerhalb der Gemeinschaften der Portugiesen und, in jüngerer Zeit, auch der Brasilianer gesprochen, wie der Beitrag von Johannes Kabatek ausführt.
Der Krieg im damaligen Jugoslawien sowie auch davor bereits politische und wirtschaftliche Gründe waren für die nächste Einwanderungswelle verantwortlich. Wie Hellìk Mayer darstellt, brachte diese zunächst vor allem Sprechende dessen ins Land, was wir heute als BKMS (Bosnisch-Kroatisch-Montenegrinisch-Serbisch) bezeichnen und was in früheren Zeiten vereinheitlichend Serbokroatisch genannt wurde. Die «mitgebrachte» sprachliche Vielfalt ist in der ursprünglichen Heimat nicht selten sprachpolitisch ideologisch aufgeladen, wird aber im Kontext der Schweiz häufig von den Sprechern selbst entspannter gesehen.
Zu der Gruppe der Varietäten oder Sprachen aus dem ehemaligen Jugoslawien kommt schliesslich auch das Albanische hinzu, dessen heutige Position von Shpresa Jashari beschrieben wird. Hier zeigt sich neben der allgemeinen Frage der Integration auch die Wichtigkeit der internen Differenzierung bezüglich der Herkunft der Sprecher (Kosovo, Nordmazedonien oder Albanien) und ihrer damit verbundenen sprachlichen Identität. So sind Sprecher des Albanischen aus dem Kosovo häufig nicht nur zwei- sondern vier- bis fünfsprachig: Sie sind mit dem gegischen Albanischen ebenso vertraut wie mit der toskischen Standardvarietät, die Älteren unter ihnen auch mit Serbisch und in der Deutschschweiz mit ihrem schweizerdeutschen Dialekt ebenso wie mit dem Standarddeutschen.
Mit dem Text zum Albanischen endet die einzelsprachliche Darstellung (zu weiteren Sprachen siehe unten). Zu den durch Migration in die Schweiz gekommenen Sprachen ist noch anzumerken, dass sie aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden können. Da ist einerseits die Aussenperspektive mit den demographischen Daten, der Festellung der Mehrsprachigkeit, der Notwendigkeit der Kommunikation, die sich u.a. in mehrsprachigen Publikationen des Bundes, der Kantone oder der Gemeinden widerspiegelt, oder in der externen Sicht- oder Hörbarkeit der Sprachen, wie sie in den letzten Jahren in Studien zu so genannten Linguistic Landscapes vermehrt erforscht wird. Es gibt aber auch eine interne Sicht der verschiedenen Sprachgemeinschaften, die nicht nur aus Individuen und Familien bestehen, sondern sich auch organisieren und in Vereinen, Zentren, Gaststätten oder Festivals ihre Kultur pflegen, Sport treiben oder sich einfach nur in verschiedenen Zusammenhängen begegnen.
Das Buch endet mit zwei wichtigen transversalen Kapiteln. Raphael Berthele betrachtet die Sprachen – mit Fokus auf den Landessprachen – nicht als Einzelfälle, sondern in ihrer Gesamtheit hinsichtlich der vielfältigen Beziehungen, die sich aus dieser Mehrsprachigkeitskonstellation ergeben.
Philippe Humbert, Alexandre Duchêne und Renata Coray werfen einen historisch-kritischen Blick auf die Geschichte der Sprachstatistik in der Schweiz. Dieses Thema ist für alle Beiträge in diesem Band relevant, da – wie eingangs beschrieben – ein erster Blick auf die Sprachensituation oft mit quantitativen Daten beginnt, die eine Zählbarkeit von Sprechern und Sprachen suggerieren. In Wirklichkeit setzt das Zählen von Sprachen die Berücksichtigung hochkomplexer Sachverhalte voraus.
5Weitere Sprachen, die in diesem Band nicht ausführlich berücksichtigt werden konnten
Trotz der Vielfalt an Beiträgen kann der Band nur einen Ausschnitt der Sprachen und Sprachenräume der Schweiz abbilden. Es fehlen wichtige Sprachen, die diese mitgestalten. Neben den Sprachen der verschiedenen in der Schweiz präsenten Nationen müssten zudem Regionalsprachen und Sprachvarietäten berücksichtigt werden. Umfassende Porträts von Sprachen, die auch in der Sprachstatistik unter «sonstige Sprachen» laufen, ihrer Kommunikationsräume und sozialen Funktionen im Kontext der Schweiz, wären ein dringendes Desiderat, das im Rahmen des vorliegenden Handbuchs leider nicht erfüllt werden kann. Dennoch möchten wir im Folgenden zumindest ein paar knappe Informationen zu einer Reihe von Sprachen geben, denen keine eigenen Kapitel gewidmet werden konnten.
Hier stellt sich zunächst die Frage der Auswahl und der Reihenfolge. Sprachen sind keine objektiv messbaren quantitativen Grössen; die Kompetenz ihrer Sprecher in den Einzelsprachen kann eine grosse Bandbreite umfassen und die Verwendung kann von sporadisch bis ständig schwanken. Die Verwendungskontexte können sich auf den Familien- und Freundeskreis beschränken und vom privaten, öffentlichen bis zum transnationalen Raum reichen. Darüber hinaus ist das Zählen von Sprechern nicht einfach. So ist es, wie bereits in Abschnitt 3 diskutiert, sehr problematisch, wenn von Nationalitäten auf Sprachen geschlossen wird. Dies kann nur in manchen Fällen als approximativer Wert gelten, da in den meisten Ländern mehrere Sprachen und manche Sprachen in mehreren Ländern gesprochen werden. Zudem fallen die eingebürgerten Personen aus der Ausländerstatistik heraus, die zwar sehr genaue und stets aktuelle, aber für die Frage der Sprachen eben nur sehr indirekt relevante Zahlen bietet.
5.1Ukrainisch
Eine aktuell (Sommer 2024) sehr wichtige Sprache – das Ukrainische – wird in den Statistiken nur unzureichend erfasst, da der Grossteil ihrer Sprecher nicht zur ständigen Wohnbevölkerung zählt. Die Zahlen des BFS zur ausländische Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit zeigen eine Zunahme von Personen aus der Ukraine von 2010 mit ca. 4’800 bis 2020 mit knapp 7’000. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Handbuchs ist diese Zahl in Wahrheit jedoch weit höher. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine seit Februar 2022 hat Millionen Ukrainer aus ihrer Heimat vertrieben und viele davon auch in die Schweiz geführt (Ende Juni 2024 hatten noch 66’189 Personen aus der Ukraine den Schutzstatus S; SEM 2024b). Von ihnen hat ein Teil als Sprache das Ukrainische mitgebracht, ein Teil auch das Russische, das für viele Personen ukrainischer Nationalität erste oder zweite Muttersprache war. Trotz der noch fehlenden statistischen Angaben soll das Ukrainische in unserer Einführung nicht unerwähnt bleiben, auch, weil es beispielhaft für die vielen weiteren eher verborgenen Sprachen in der Schweiz und für die Komplexität von sprachlichen und politischen Räumen und deren Dynamiken ist. Das Ukrainische weist typische Merkmale slavischer Sprachen auf (z.B. einen Verbalaspekt, d.h. eine grammatische Kategorie des Verbs, die Handlungen entweder als abgeschlossen oder als nicht-abgeschlossen darstellt) und wird kyrillisch geschrieben. Eine Besonderheit im lautlichen Bereich ist die stimmhafte Aussprache des mit dem kyrillischen Graphem г verschrifteten /h/ (z.B. bahato ‘viel’). Das Ukrainische ist Amtssprache in der Ukraine, mit grösseren Sprechergemeinschaften auch in Polen sowie in Kanada, den USA, Argentinien und Brasilien.
Seit 1945 existiert der Ukrainische Verein, der sich der Förderung der Ukrainer und der ukrainischen Kultur in der Schweiz verpflichtet hat (https://swiss-ukrainian.ch). Das Ukrainische wird an slavistischen Instituten in der Schweiz gelehrt (u.a. Bern/Fribourg), sowie am Ukrainischen Forschungszentrum URIS (https://uris.ch/about-uris).
5.2Jenisch, Romani und Sondersprachen
Auch für die Jenischen, die als «nicht territorial gebundene» Minderheit in der Schweiz geschützt sind, gibt es keine genauen Angaben in den BFS-Statistiken. Gleiches gilt für das Romani, die Sprache der Roma und Sinti, obwohl die Sinti zumindest ebenso wie die Jenischen unter einem besonderen Schutz des Bundes stehen.
Jenisch ist die praktisch ausschliesslich mündlich tradierte Sprache der sesshaften (über 90 %) sowie der nichtsesshaften Schweizer Jenischen. In der Schweiz gibt es schätzungsweise 35’000 Personen jenischer Herkunft (Arbeitsgruppe 2023: 12.1; Bundesrat 2006: 5). Die (Sprach)Statistiken des BFS liefern keine verlässlichen Zahlen. Im 19. Jahrhundert wurden Jenische, die nicht schon Bürger einer Gemeinde waren, in ihren jeweiligen Aufenthaltsgemeinden, viele in Graubünden, eingebürgert. Das Wort Jenisch, das 1714 erstmals als Sprachbezeichnung auftaucht und heute auch als Selbstbezeichnung verwendet wird, ist ebensowenig wie die Herkunft der Volksgruppe endgültig geklärt. Ausser einer Herleitung aus dem Romanes wird auch ein Zusammenhang mit dem ebenfalls noch ungeklärten frühneuhochdeutschen Wort jenne ins Spiel gebracht (Wottreng 2019). Jenische gibt es v.a. in den deutschsprachigen Ländern, aber auch in weiteren angrenzenden Ländern (Frankreich, Benelux, Italien, siehe Efing 2019: 109). Die Bürgerrechtsbewegung der Schweizer Jenischen schloss sich in den 1970er Jahren zeitweise der internationalen Romabewegung an, ein historischer Zusammenhang zur Gruppe der Sinti/Roma ist aber kaum nachweisbar, wenn auch in der Vergangenheit schon immer Beziehungen zu den Sinti bestanden.
Das Jenische ist grammatisch (weitgehend) den jeweiligen Regionalsprachen nachgebildet. Der Wortschatz, der gut 600 Grundwörter umfasst (Roth 2010), die für weitere Wortbildungen genutzt werden, besteht aus mehreren Komponenten, mit einem Grundstock an Wörtern, die verschiedenen älteren und jüngeren Varietäten des Deutschen entstammen, mit zahlreichen formalen und semantischen Weiterentwicklungen. Darunter sind Gemeinsamkeiten mit dem frühneuzeitlichen Rotwelschen, im Sinne einer Sammelbezeichnung diverser frühneuzeitlicher Geheimsprachen. Dazu kommen in unterschiedlichem Umfang Lehnwörter aus dem Jiddischen/Hebräischen sowie dem Romanes, mit weiteren Bestandteilen aus romanischen Sprachen (Matras 1998). Das Schweizer Jenisch weist im Wortschatz grosse Gemeinsamkeiten mit demjenigen in Österreich und Deutschland auf, knapp 60 % der Stichwörter im Wörterbuch von Roth (2001: 140) sind aber nur in der Schweiz belegt. Jenisch wird meist neben dem ortsspezifischen Dialekt als Familiensprache erlernt. Im Zuge der Repressionsmassnahmen, denen die Jenischen bis in die siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts, z.B. durch Fremdplatzierung der Kinder in Heimen, unterworfen waren, wurde die Sprachtradition teilweise unterbrochen. Wie viele Personen die Sprache heute noch im Alltag benutzen, ist nicht bekannt.
Da es sich bei Jenisch um eine mündlich tradierte Sprache für die gruppeninterne Kommunikation handelt, die für die Jenischen eine starke Identifikationsfunktion ausübt, ist die Erforschung durch Nicht-Jenische nur eingeschränkt möglich (entsprechend der Regel «Nichts über uns ohne uns»). Verschiedene vom Bundesamt für Kultur unterstützte Publikationen werden nur an Jenische abgegeben, sind also nicht für die Öffentlichkeit bestimmt (Bundesrat 2018: 19). Das erwähnte Wörterbuch des Schweizer Jenischen wird von der 1975 gegründeten Radgenossenschaft der Landstrasse, der Interessenvertretung der Jenischen, nicht anerkannt.
Ein erster Schritt zur Anerkennung der Jenischen als eigenständige Volksgruppe erfolgte 1975 in Bern auf kantonaler Ebene. Seit 1997 gehört ihre Sprache, ebenso wie die der kleinen Minderheit der Schweizer Sinti, neben Walserdeutsch, Jiddisch und den Westschweizer Patois zu denjenigen, für die auf Bundesebene infolge der Umsetzung der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitssprachen des Europarats Schutz- und Unterstützungsmassnahmen vorgesehen sind. Die Interessen der Jenischen werden durch Selbsthilfeorganisationen, vor allem die erwähnte Radgenossenschaft der Landstrasse, die auch eine Zeitschrift Scharotl herausgibt, vertreten. 2023 erschien ein von der Arbeitsgruppe «Jenische/Sinti/Roma» in Zusammenarbeit mit der PH Zürich herausgegebenes Lehrmittel für die Primarschule: «Jenische–Sinti–Roma. Zu wenig bekannte Minderheiten in der Schweiz» (Arbeitsgruppe 2023).
Romani (auch Romanes) ist die traditionell ausschliesslich mündliche Sprache der Roma (Eigenbezeichnung), die zum indoarischen Zweig des Indogermanischen gehört und ein reiches Formeninventar aufweist. Die Sprache der westeuropäischen Sinti, auch Sintitikes genannt, wird ebenfalls dieser Sprachgruppe zugerechnet. Romani wird über ganz Europa verbreitet in zahlreichen Varianten gesprochen, die stark von den Umgebungssprachen, mit denen die Sinti und Romani auf ihrer Wanderung nach Europa in Kontakt kamen, beeinflusst sind. Viele Sinti und Roma haben die Sprache zugunsten derjenigen ihres Aufenthaltsortes aufgegeben. Was die Schweiz angeht, sind die Verhältnisse schwer zu überblicken, zumal auch die BFS-Statistiken darüber nur unzueichende Daten vorweisen. Es scheint jedenfalls, dass es wesentlich weniger einheimische Sinti (verschiedenen Angaben zufolge ca. 400–500 oder mehrere Tausend), die als nationale Minderheit anerkannt sind, als Roma gibt (50’000–80’000). Roma kamen in den 1960er bis 1990er Jahren v.a. als Arbeitsmigranten aus verschiedenen ost- und südeuropäischen Ländern und sind in der Regel sesshaft. Wie viele davon Romani sprechen ist ebenfalls unbekannt. Die Roma sind bislang in der Schweiz nicht als nationale Minderheit anerkannt (Sozialinfo 2017). Wie gross der Anteil Roma an der in den letzten Jahrzehnten aus Nordmazedonien, Serbien oder dem Kosovo immigrierten Wohnbevölkerung ist, lässt sich nicht ermitteln, ebensowenig die Zahl der Fahrenden.
Stellvertretend für verschiedene Sondersprachen, die es in der Schweiz gegeben hat oder gibt, soll noch das so genannte Mattenenglisch kurz erwähnt werden. In der Berner Unterstadt am Ufer der Aare (der «Matte») gab es eine Sonderform der lokalen Umgangssprache, die v.a. im Wortschatz zahlreiche in anderen Berner Dialekten nicht existente Formen aufwies und somit eine kryptische Funktion hatte (Tschirren und Hafen 2016). Diese den berndeutschen Dialekt ergänzenden Wortschatzelemente entstammen grösstenteils dem Französischen und dem Rotwelschen (und damit indirekt u.a. dem Hebräischen). Neben fremdem Wortschatz zeichnet sich das Mattenenglische durch eine Technik des Silbentausches aus, wie sie in anderen Geheimsprachen in ähnlicher Weise vorkommt (u.a. Technik des Verlan im französischen Argot oder des Vesre im bonaerensischen Lunfardo). Heutzutage ist das Mattenenglisch ausgestorben, es gibt jedoch Vereine und Stammtische, die es als eine Art Spiel pflegen.
5.3Bosco Gurin
Um einen ganz anderen Fall handelt es sich bei der Sprache von Bosco Gurin, dem so genannten Ggurijnartitsch (Gurinerdeutsch): Infolge der spätmittelalterlichen Walserwanderungen von Walliser Bauern nach Süden gibt es heute nicht nur in Norditalien, sondern auch im Tessin noch eine kleine Siedlung, in der ein schweizerdeutschbasierter Dialekt gesprochen wird, Bosco Gurin (gurinerdeutsch Ggurin [ku'riɲ]), in einem Seitental des Maggiatals auf gut 1500 Meter gelegen. Das Tessin ist aber offiziell ein einsprachig italienischer Kanton, in dem das Gurinerdeutsche keinen amtlichen Status hat. In früheren Zeiten, als die Gemeinde noch grösser war, gab es verschiedene (zeitweise erfolgreiche) Versuche, Deutsch als Schulsprache zu etablieren. Das heutige Gurinerdeutsche, das in Wortschatz und Grammatik einige Archaismen, aber auch durchaus neue, oft italienischem Einfluss zuzuschreibende Wörter und Strukturen kennt, kann aufgrund der demographischen Entwicklung als äusserst bedroht angesehen werden, auch wenn die wenigen Kinder weiterhin in dieser Varietät sozialisiert werden. 2018 hat die Gemeindeversammlung eine Charta «zur Förderung der deutschen Sprache (Gurinerdeutsch und Hochdeutsch)» angenommen. Die Guriner beherrschen ausserdem Italienisch sowie den lokalen Tessiner Dialekt, manche auch Schweizerdeutsch und Standarddeutsch. Für weitere Informationen siehe Russ (2002), Bachmann und Glaser (2019), Stähli (2011).
5.4Weitere Sprachen nach Sprecherzahlen
Bei der folgenden Aufzählung weiterer in der Schweiz gesprochenen Sprachen stützen wir uns auf Zahlen des BFS (2024b), die sich auf die Angaben der «Hauptsprache» der Wohnbevölkerung über 15 Jahre beziehen (wobei das BFS Mehrfachnennungen zulässt, ►Sprachenstatistik). Auf die in Einzelkapiteln im Buch behandelten Sprachen folgen nach Sprecherzahlen die folgenden 13 Sprachen, die wir der Reihe nach kurz vorstellen:
Abb. 5: Weitere gesprochene Sprachen. Daten errechnet aus den Strukturerhebungen 2020–2022. Quelle: BFS 2024b
Abb. 6 zeigt die quantitative Entwicklung der genannten Sprachen zwischen 2000 (als allerdings nur eine Sprache als Hauptsprache genannt werden konnte) und 2022:
Abb. 6: Weitere gesprochene Sprachen: Entwicklung 2000–2022. Quelle: BFS 2024b
Türkisch. Knapp 77’000 Personen der ständigen Wohnbevölkerung über 15 Jahren geben das Türkische als Hauptsprache an (Abb. 5). Damit verzeichnet es mehr als doppelt so viele Sprecher wie das Rätoromanische. Das Türkische ist in der Schweiz seit Beginn der 1960er Jahre verankert. Während die Zuwanderung aus der Türkei bis in die 1980er Jahre überwiegend wirtschaftlich bedingt war, kam es mit dem Militärputsch von 1980 zu politisch motivierter Zuwanderung. Schülerinnen und Schüler mit familiären Vorkenntnissen des Türkischen können ihre Kenntnisse im Rahmen der Angebote für Heimatliche Sprache und Kultur in der Schweiz vertiefen.
Nicht alle türkischstämmigen Personen haben einen ausschliesslich oder primär türkischsprachigen Hintergrund bzw. das Türkische als Sprache ihrer Familie/Vorfahren; vielmehr brachte und bringt die Zuwanderung aus der Türkei eine weit grössere sprachliche Diversität mit sich, u.a. mit Sprechern des Kurdischen oder auch des Armenischen.
Das Türkische ist eine Turksprache, die heute überwiegend in der Türkei gesprochen wird. Ausserhalb davon sind grosse türkischsprachige Gemeinschaften v.a. in Deutschland anzutreffen. Es zeichnet sich durch eine agglutinierende Struktur aus, d.h. Morpheme werden rechts an die Wortwurzel in einer festgelegten Reihenfolge angefügt. Dabei entspricht ein Morphem genau einer Bedeutung, z.B. ev-im-de (Haus-mein-Loc) ‘in meinem Haus’, gör-dü-nüz mü (sehen-Pst-2pl Q) ‘habt ihr gesehen?’. Charakteristisch ist zudem die sogenannte Vokalharmonie, d.h. die lautliche Angleichung der Vokale an den der Wortwurzel, z.B. gör-dü-nüz mü? (sehen-Pst-2pl Q) ‘habt ihr gesehen?’ vs. gel-di-niz mi? (kommen-Pst-2pl Q) ‘seid ihr gekommen?’ oder ev-im-de (Haus-mein-Loc) ‘in meinem Haus’ vs. araba-m-da (Auto-mein-Loc) ‘in meinem Auto’.
Zur Einwanderung aus der Türkei, vgl. Romy und Kern 2022.
Arabisch. Arabisch gehört zu den häufigsten 2022 als Hauptsprache genannten Nicht-Landessprachen. Dabei ist zu bedenken, dass es sich nicht um eine einheitliche Sprache der zahlreichen zur arabischen Welt gezählten Staaten von der Levante bis nach Nord- und Ostafrika handelt, sondern um viele regionale Varietäten, die durch das Hocharabische als Schriftsprache, welche nur über die Bildungsinstitutionen und entsprechenden Medienkonsum erworben wird, zusammengehalten werden. Die Muttersprache vieler Migranten und Migrantinnen bilden also nicht immer gegenseitig verständliche arabische Dialekte, was den herkunftssprachlichen Unterricht in der Schweiz erschwert. Allgemeines Kennzeichen des Arabischen, das zu den semitischen Sprachen gehört, ist, dass die Wortwurzeln, die die Grundbedeutung tragen, durch vielfältige Abwandlungen, v.a. auch der Vokale, Wortableitungen und grammatische Information vermitteln, wie etwa: k – t – b ‘schreiben’, kitab ‘Buch’, kataba ‘er hat geschrieben’. Das Arabische wird mit einem eigenen Schriftsystem von rechts nach links geschrieben, wobei die Kurzvokale nicht verschriftet werden. Arabisch wird auch im Rahmen universitärer Studiengänge, z.B. an der Universität Zürich, angeboten.
Russisch. 40’600 Sprecher in der Schweiz geben Russisch (eine ostslavische Sprache) als ihre Hauptsprache an (Abb. 5). Damit liegt das Russische knapp vor dem Rätoromanischen. Die Geschichte der russischsprachigen Migration in die Schweiz geht auf die Mitte des 19. Jahrhunderts, noch aus dem zaristischen Russland, zurück. Diese Migration hat massgeblich Anstoss für die Etablierung der Slavistik an schweizerischen Universitäten gegeben (vgl. Slavisches Seminar 2024). Heute kann Russisch dort, aber auch an Sprachenzentren und bei kommerziellen Anbietern, sowie im Rahmen des häufig kantonal organisierten herkunftssprachlichen Unterrichts, der sich an Lerner mit familiären Vorkenntnissen des Russischen richtet, gelernt werden. Russisch ist zudem eine der 10 Sprachen, in denen swissinfo.ch Informationen zu aktuellen Themen mit Bezug zur Schweiz anbietet. Sichtbar ist das Russische, das in kyrillischer Schrift geschrieben wird, im öffentlichen Raum der Schweiz häufig auch in touristischen Gebieten, die kaufkräftige russischsprachige Urlauber ansprechen wollen. Im Zuge der durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022 ausgelösten Fluchtbewegung hat das Russische – gesprochen von Personen ukrainischer Nationalität – im öffentlichen Raum der Schweiz an Hörbarkeit zugenommen.
Ausserhalb Russlands fungiert Russisch als Erstsprache einer historisch verankerten Sprechergemeinschaft, als offizielle Amtssprache oder Lingua Franca in vielen Ländern Zentralasiens, des Kaukasus und im Baltikum, sowie in der Ukraine und in Belarus.
Polnisch. Mit knapp 34’500 Personen (Abb. 5), die es als Hauptsprache angeben, liegt das Polnische bezüglich der Sprecherzahlen nur unwesentlich hinter dem Rätoromanischen. Die Zuwanderung von Polnischsprechern in die Schweiz blickt auf eine lange Geschichte zurück, die ihre Anfänge Mitte des 19. Jahrhunderts als Fluchtbewegung aus Kongresspolen nahm. Zeugnis dieser ersten Zuwanderung ist das Polenmuseum Rapperswil. In den 1940er Jahren kamen 12’500 polnische Armeeflüchtlinge bis Ende des 2. Weltkriegs als Internierte in die Schweiz. Eine Zunahme des Polnischen in der Schweiz lässt sich für die 1980er Jahre feststellen und verstärkt wieder mit der Aufnahme Polens in die EU. Mit «Nasza Gazetka» existiert seit 1973 eine Zeitschrift, die sich in erster Linie an die polnische Community in der Schweiz, aber auch darüber hinaus, richtet. Zeugnis der Lebendigkeit der polnischen Sprache und Kultur in der Schweiz sind zudem die verschiedenen Polenvereine, darunter der 1894 gegründete Verein «ZGODA» in Zürich.
Das Polnische ist eine westslavische Sprache, die in Polen Amtssprache ist und neben der Schweiz auch im westdeutschen Raum eine grosse Sprechergemeinschaft hat. Sprecher mit familiären Vorkenntnissen können das Polnische im Rahmen der Angebote für Heimatliche Sprache und Kultur vertiefen; es wird zudem auch an Universitäten gelehrt, u.a. in Zürich und Bern/Fribourg.
Tamil. Tamil ist eine Sprache aus der dravidischen (nicht indoeuropäischen) Sprachfamilie, die in Südindien und v.a. in Sri Lanka gesprochen wird. Sie hat eine 2000 Jahre zurückreichende Schrifttradition mit eigenem Schriftsystem, einer Kombination aus Alphabet- und Silbenzeichen, wobei die etwa 76 Millionen Muttersprachler mündliche Formen verwenden, die sich stark vom klassischen Tamil unterscheiden und mit diesem in einer Diglossiesituation koexistieren. In der Schweiz gibt es ca. 31’919 Sprecher des Tamil (BFS 2024b), die meist als Bürgerkriegsflüchtlinge ins Land kamen: zwischen 1983 und 2009 herrschte in Sri Lanka ein bewaffneter Konflikt, dem etwa 100’000 Menschen zum Opfer fielen. Der Bürgerkrieg wurde z.T. von tamilischen Organisationen, die sich in der Schweiz etabliert hatten, mit gesteuert, bis diese verboten wurden. Eine umfassende Dokumentation des Bundesamtes für Migration (Moret et al. 2007) beschreibt die Geschichte der srilankischen Einwanderung in die Schweiz unter verschiedenen Gesichtspunkten; aktuellere demolinguistische Daten finden sich u.a. auf den Seiten des BFS.
Ungarisch. Seit etwa 2010 ist die Zahl der ungarischen Staatsbürger in der Wohnbevölkerung sehr stark angestiegen, laut SEM beträgt sie Ende Mai 2024 30’583 Personen (siehe Abb. 5) davon 7’367 im Kanton Zürich. 26’353 Personen haben 2022 Ungarisch als Hauptsprache angegeben. Im Jahr 2000, in dem allerdings nur eine Sprache als Hauptsprache angegeben werden konnte, waren es 5’799 gegenüber damals 3’559, also deutlich weniger, Staatsbürgern (Abb. 6).
Bereits nach der Niederschlagung des Aufstands von 1956 durch die sowjetischen Truppen waren zahlreiche Ungarn (ca. 14’000) als Flüchtlinge in die Schweiz gekommen. Angehörige dieser ersten Immigrationswelle, mehrheitlich gut Gebildete, haben sich schnell integriert und u.a. auch wichtige Positionen in Kultur, Politik und Gesellschaft eingenommen. Die Sprache wurde dabei wohl nicht konsequent weitergegeben. Heute dominieren unter den Ungarischsprachigen Arbeitsmigranten in verschiedensten Berufen, v.a. in der Deutschschweiz.
Ungarisch gehört zur Gruppe der finno-ugrischen Sprachen, und wird mit lateinischer Schrift, einigen besonderen Zeichenkombinationen (vgl. Namen wie Nagy [nɒɟ] oder Károly [kaːroj]) und zusätzlichen diakritischen Zeichen für Langvokale (ő, ű) geschrieben. Alle ungarischen Wörter werden auf der ersten Silbe betont und die Sprache kennt kein Genus. Obwohl verschiedene Universitäten gelegentlich Ungarisch-Kurse anbieten, wird es in der Schweiz nicht als Studienfach gelehrt.
Niederländisch. Laut SEM 2024a waren am 31.5.2024 22’552 Personen niederländischer Staatsbürgerschaft in der Schweiz wohnhaft, die Zahl stieg seit 2008 kontinuierlich an. Dass 2022 etwas mehr Personen (23’645) Niederländisch als Hauptsprache angaben, wird darauf zurückzuführen sein, dass auch ein gewisser Teil der 15’753 belgischen Staatsbürger der flämischen Sprachgruppe angehört und ebenfalls Niederländisch als Hauptsprache angegeben hat. Die niederländischen Staatsbürger sind über die ganze Schweiz verteilt, die grösste Zahl befindet sich aber aktuell im Kanton Zürich (5’491). Es bestehen enge wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Ländern.
Das Niederländische, die drittgrösste germanische Sprache nach Englisch und Deutsch, ist eng mit dem Deutschen verwandt. Es gibt aber keine Gross- und Kleinschreibung, und in weiten Teilen der Grammatik herrscht ein im Vergleich zum Deutschen reduziertes Formensystem (nominale Kasus, Adjektivflexion, Artikel, Verbflexion). Das Niederländische wird in den Niederlanden und im flämischen Landesteil Belgiens mit einigen spezifischen nationalen Besonderheiten als Standardsprache gebraucht. Verschiedene Institutionen bieten in der Schweiz Sprachkurse an. Einzig an der Universität Zürich kann seit 1970 Niederländisch studiert werden, seit 2019 im Rahmen der germanistischen Linguistik. Im Kanton Zürich besteht ein vom niederländischen Erziehungsministerium anerkanntes Unterrichtsangebot «De Oranje Koe» für niederländische und belgische Kinder.
Kurdisch. Während 2010 gut 13’000 Personen in der Schweiz Kurdisch als ihre Hauptsprache angeben, waren es 2022 fast 22’000 (Abb. 6). Ein erstes grösseres Ankommen von Sprechern einer kurdischen Varietät in der Schweiz erfolgte im Rahmen der Arbeitsmigration aus der Türkei in den 1960er Jahren, später waren in erster Linie Kriege für den Zuzug von Sprechern des Kurdischen verantwortlich. Das Kurdische zeigt sehr deutlich, wie dringend notwendig es ist, einen Blick hinter die reinen statistischen Zahlen zu werfen. Zum einen verbirgt sich das Kurdische als Sprache hinter verschiedenen Herkunftsländern (insbesondere der Türkei, dem Iran, dem Irak und Syrien), zum anderen ist das Kurdische selbst in unterschiedliche Dialekte differenziert, die in statistischen Erhebungen unter dem Oberbegriff «Kurdisch» subsumiert werden. Die in der Schweiz hauptsächlich vertretenen Dialekte sind das nordkurdische Kurmandschi, das v.a. in der Türkei, aber auch in Syrien, Irak, Iran und Armenien verbreitet ist, und das zentralkurdische Sorani, das hauptsächlich im Irak und Iran gesprochen wird. Im Rahmenlehrplan für den Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur des Kantons Zürich sind beide Varianten vertreten. Der Unterricht erfolgt im Verein für Kurdisch-Unterricht (https://kurdisch.ch bzw. https://zimanekurdi.ch). Nicht selten sind Sprecher einer kurdischen Varietät vielsprachig, da sie meist auch die offizielle Sprache ihrer Herkunftsländer mitbringen, in denen der Gebrauch des Kurdischen häufig Beschränkungen unterworfen war und teilweise noch ist. Abhängig vom Herkunftsland ist auch die Verschriftung des Kurdischen: lateinisch (z.B. in der Türkei), arabisch (Iran) oder beides (Nordirak). Das Kurdische gehört zum iranischen Zweig der indoeuropäischen Sprachen.
Rumänisch. Die rumänische Präsenz in der Schweiz hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen: gab es im Jahr 2000 noch ca. 3’000 Rumänischsprecher in der Schweiz, waren es um 2010 schon knapp 10’000 und zehn Jahre später knapp 20’000 (Abb. 6). Laut Ausländerstatistik gibt es im Mai 2024 36’086 Personen mit rumänischer und 1’045 Personen mit Staatsbürgerschaft der Republik Moldau, wobei von diesen Zahlen nicht unmittelbar auf Sprecherzahlen geschlossen werden kann: in Rumänien wird neben Rumänisch – wenn auch minderheitlich – u.a. auch Ungarisch und Deutsch gesprochen und ein Teil der Bevölkerung Moldawiens ist russischsprachig. Zudem erscheinen die eingebürgerten Personen nicht mehr in der Ausländerstatistik. Der Zuwachs in den letzten Jahren hat v.a. politische und ökonomische Gründe und ist u.a. Konsequenz der Öffnung Rumäniens und des EU-Beitritts des Landes. Aufgrund der so genannten «Ventilklausel» erhielten bis 2019 jährlich nur 996 Personen aus Rumänien eine B-Bewilligung; seit 2019 gilt Personenfreizügigkeit wie bei anderen EU-Bürgern. Die Facebook-Gruppe Români în Elveția (Rumänen in der Schweiz) hat über 60’000 Mitglieder (siehe auch von Wyl 2018).
Rumänisch ist Staatssprache in Rumänien und in der Republik Moldau, zudem leben rumänische Minderheiten in den angrenzenden Ländern. Von den etwa 30 Mio. Muttersprachlern lebt etwa ein Drittel im Ausland, u.a in Spanien, Frankreich, Deutschland. Rumänisch ist eine romanische Sprache, die an der Universität Zürich gelehrt wird. Es weist als balkanromanische Sprache einige Besonderheiten auf, die ansonsten nicht typisch für romanische Sprachen sind (u.a. Erhalt morphologischer Kasusunterscheidung, enklitische Artikel, zahlreiche slavische und sonstige balkanische Einflüsse v.a. im Wortschatz). Rumänisch wird in lateinischer Schrift mit einer Reihe von Diakritika geschrieben; in der Republik Moldau war es lange üblich, kyrillisch zu schreiben. Zu Sowjetzeiten wurde eine «moldauische Sprache» gefördert, die sich jedoch bis auf die Graphie kaum vom Standardrumänischen unterschied.
Farsi. Das Persische oder Farsi (in Afghanistan auch Dari) wurde in der Schweiz laut Angaben des BFS (2024b) zu Beginn der 2020er Jahre von ca. 18’000 Personen gesprochen; 10 Jahre früher waren es etwa 8’000 (Abb. 6). Die Zunahme hängt vor allem mit der politischen und ökonomischen Lage im Iran und in Afghanistan zusammen. So gab es in der Schweiz im Jahr 2023 mehr als 1’500 Personen aus dem Iran und mehr als 16’000 aus Afghanistan, die sich im politischen Asylprozess befanden (Abb. 7). In Afghanistan wird Dari-Persisch von ca. 32 % der Bevölkerung gesprochen (u.a. in der Hauptstadt Kabul); die grösste Sprache in Afghanistan ist Paschtu; im Iran ist Farsi als Staatssprache fast überall verbreitet, auch wenn es verschiedene weitere Sprachen gibt. Farsi ist auch offizielle Sprache in Tadschikistan und wird auch in Usbekistan gesprochen.
Abb. 7: Asylgesuche aus Afghanistan 01.01.2020 bis 30.06.2024. Quelle: SEM 2024b
Die starke Zunahme der afghanischen Flüchtlinge in der Schweiz steht in engem Zusammenhang mit der Machtübernahme der Taliban und der daraus folgenden Menschenrechtslage im Land.
Ein Teil der Iraner in der Schweiz gehört der christlichen Minderheit an und ist aus religiösen Gründen aus dem islamistischen Land geflohen. Dabei sind die Iraner in der Schweiz keine geschlossene Gemeinschaft. Die Schweiz unterhält auch Handelsbeziehungen zum rohstoffreichen Land Iran und verfolgt das Motto «Wandel durch Handel». Daneben nimmt die Schweiz eine Vermittlerrolle zwischen dem Iran und dem Westen ein. In der Schweiz haben sich verschiedene regimekritische Grupen etabliert, die meist auf Farsi kommunizieren. Verschiedene lokale Radioprogramme in Basel und Zürich senden Programme auf Farsi.
Farsi ist eine indoeuropäische Sprache (iranischer Zweig), die von 60–70 Mio. Personen als Ersterwerbssprache und von weiteren ca. 50 Mio. Personen als Zweitsprache gesprochen wird. Sie wird in einer angepassten Form der arabischen Schrift geschrieben; in Tadschikistan herrscht eine kyrillische Schreibtradition vor. Zwischen der neupersischen Standardsprache und den gesprochenen Dialekten gibt es teils grössere Unterschiede, dennoch ist die Verständigung auch zwischen Personen verschiedener Herkunft gut möglich. Der Wortschatz des Farsi weist zahlreiche Lehnelemente des Arabischen auf. Farsi wird in der Schweiz an verschiedenen Sprachschulen (u.a. Migros Clubschule) unterrichtet.
Tigrinya. Tigrinya gehört zu den südsemitischen Sprachen, es wird mit einer für die Region typischen Silbenschrift von links nach rechts geschrieben. Tigrinya wird ausser in Eritrea, wo es die Mehrheitssprache ist und auch im öffentlichen Verkehr verwendet wird, v.a. auch in Tigray (Nordäthiopien) gesprochen. Tigrinya hatte in der wechselvollen jüngeren Geschichte lange um seine Anerkennung gerungen. Tigrinyasprachige sind in einer ersten Welle während des eritreischen Befreiungskampfes in die Schweiz geflohen, in den letzten Jahren sind die Zahlen der Asylsuchenden, die vor dem jetzigen eritreischen Regime fliehen, erneut stark angestiegen. Eritreer stellten 2023 die grösste Gruppe unter den anerkannten Flüchtlingen dar, wobei Tigrinyasprecher unter ihnen vermutlich einen hohen Anteil einnehmen. 17’664 Personen haben 2022 Tigrinya als Hauptsprache angegeben. Auch ein Grossteil der seit 2018 stark angestiegenen Zahl an Kindern mit eritreischer Staatsangehörigkeit dürfte tigrinyasprachig sein. Tigrinya gehört zu den 14 Sprachen, in denen das Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich Informationen zum Schulsystem und zu Veranstaltungen verbreitet sowie zu den 19 Sprachen, in denen das Schweizerische Rote Kreuz das Gesundheitssystem der Schweiz darstellt.
Tigrinya weist entsprechend der wechselvollen politischen Geschichte der Region in seinem Wortschatz viele Entlehnungen auf, aus dem Arabischen und Englischen sowie aufgrund der Kolonialgeschichte in bestimmten Bereichen auch aus dem Italienischen.
Chinesisch. In der Schweiz waren am 31.5.2024 20’637 chinesische Staatsbürger registriert; hinzu kommen 1’145 Taiwanesen (SEM 2024a). Aufgrund der demolinguistischen Verhältnisse in China ist darauf zu schliessen, dass die Mehrheit der in der Schweiz lebenden Chinesen Mandarin spricht; darüber hinaus gibt es sicherlich eine gewisse Präsenz anderer Varietäten (v.a. Kantonesisch) und Sprachen (u.a. Uigurisch). Den Daten des BFS (2024b) zufolge nahm die Zahl der chinesisch Sprechenden zwischen 2012 und 2022 von 11’700 auf 17’000 zu (siehe auch Lüscher 2017).
Darüber hinaus gibt es eine unbekannte Zahl von eingebürgerten Personen chinesischer Herkunft. Etwa 1’000 Personen aus China geniessen in der Schweiz politisches Asyl. Mehr als die Hälfte der Chinesen lebt in den Kantonen Zürich, Genf und Waadt. Die grösste chinesische Gemeinschaft (mehr als 4’000 Personen) lebt in Zürich. An der ETH Zürich studieren derzeit mehr als 700 chinesische Studierende auf Masterstufe, 2012 waren es noch 144. Dabei gibt es in den letzten Jahren vermehrt Diskussionen über die Frage des Wissenstransfers und insbesondere den illegalen Export sensibler Informationen.
Im Bereich des Tourismus in der Schweiz spielt der chinesische Anteil eine wichtige Rolle und hat ein enormes Wachstumspotenzial. Zwischen 2009 und 2019 stieg die Zahl der chinesischen Touristen um 389.8 %; sie liegen inzwischen an dritter Stelle der ausländischen Touristen und haben 2019 einen Umsatz von mehr als 700 Mio CHF generiert (wobei die Pandemie hier zu einem Einbruch führte, der erst langsam wieder überwunden wurde). Dies hat auch sprachliche Konsequenzen: an beliebten Reisezielen wie in Zürich oder Luzern werden mehr und mehr Informationen auf Chinesisch gegeben. Es führt auch zu einer grösseren Visibilität chinesischer Schriftzeichen im öffentlichen Raum nicht nur mit dekorativem, sondern auch mit funktionalem Charakter. Die chinesische Han-Schrift repräsentiert Silbenzeichen; die Silbe als morphematische Bedeutungseinheit ist die tragende Säule des isolierenden chinesischen Sprachsystems.
Griechisch.





























