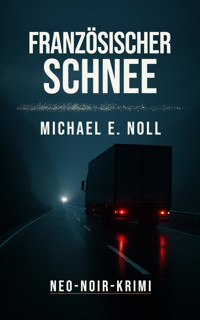4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MNbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Hinterau, 31. Mai 2003: Die neunjährige Maria spielt im Wald – Sekunden später ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Suchtrupps, Spürhunde, Hubschrauber: keine Spur. 2013 übernimmt das Kommissariat 13 den Cold Case. Lars Bergener, ehemaliger Hamburger Mordermittler, sucht am Alpenrand Ruhe – und findet das Gegenteil. An seiner Seite: Alexander Rindler, eigensinnig, derb, bayerisch bis ins Mark. Gemeinsam stoßen sie auf Widersprüche und eine Reihe unheimlicher Motive: Lichter über dem Wald, ein Gewitter aus heiterem Himmel, Hunde, die mitten auf der Lichtung winselnd stoppen. Je näher die beiden Ermittler der Wahrheit kommen, desto stärker drängt sich die Frage auf, ob sie es mit Tätern aus Fleisch und Blut zu tun haben – oder mit einem Phänomen, das man sonst aus den Wäldern Nordamerikas kennt: Missing 411. Lars Bergeners und Alexander Rindlers erster Fall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Spur durch die Zeit
Der Fall Maria A.
Mystery-Krimi
von
Michael E. Noll
Erstausgabe im Juni 2021
Alle Rechte bei Michael E. Noll
Copyright © 2025
MNbooks – Michael Noll
c/o IP-Management #6681
Ludwig-Erhard-Str. 18
20459 Hamburg
https://mnbooks.de
ISBN 978-3-912186-01-7
Hinweise
Markennamen und Produktbezeichnungen werden ausschließlich beschreibend verwendet. Sie sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber; die Nennung impliziert keine Kooperation oder Billigung.
Dieses Werk ist fiktional. Namentlich erwähnte reale Personen erscheinen nur beiläufig; alle übrigen Figuren sowie einige Schauplätze sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig.
Sprache & Darstellung: Dieses Buch enthält explizite Sprache, Gewaltbeschreibungen sowie diskriminierende Begriffe in Figurenrede. Sie dienen der authentischen Milieudarstellung und spiegeln nicht die Haltung des Autors wider.
31. Mai 2003
»Mama, derf’n mia im Wald spielen?«, fragte Julian.
»Wer is denn mia?«, hob die Mutter eine Augenbraue.
»Die Maria und i!«, antwortete er.
»Na guad, aber ihr seids bis zum Abendessen wieder da! Und ihr nehmts den Felix mit!«
»Ach naaa …«
»Da gibts jetzt koa Diskussion. Entweder so – oder du bleibst dahoam! Und nehmts was zum Trinken mit!«
Widerwillig schnappte sich Julian seinen kleinen Bruder Felix. Als sie die Haustür passierten, wartete Maria schon an der Gartentür und grinste wie die Sonne selbst. Es war ein drückend heißer Samstag; die Luft hing schwer, der Himmel wolkenlos. Doch das konnte die kindliche Energie nicht im Geringsten bremsen. Die schwere Plastikwasserflasche wurde hastig auf den Gepäckträger geklemmt, und so schwangen sich alle drei auf ihre Fahrräder, um sich auf den Weg zum nahegelegenen Wald zu machen. Dort hatten sie vor einiger Zeit mithilfe von Julians Vater ein Lager errichtet.
Er fuhr neben Maria her und erzählte ihr von seinem Ärger darüber, dass er den Felix nun schon wieder mitnehmen musste. Er war ja immerhin schon acht und verstand nicht, warum er immer das Kindermädchen für seinen sechsjährigen Bruder sein musste. Die Maria war seine beste Freundin, und die war sogar schon neun. Sie war zwar immer recht ruhig, aber auch – oder vielleicht gerade deshalb – eine gute Zuhörerin. Der Felix fuhr mit etwas Abstand hinter ihnen her und ahmte Sirenengeräusche nach, weil er an seinem Fahrrad eine Polizeifahne befestigt hatte, auf die er besonders stolz war.
Ihr Weg führte sie an einigen bunt bewachsenen Wiesen hinter Weidezäunen, einem verwitterten Geräteschuppen und einem Jägerstand vorbei. Nach wenigen Minuten tauchte vor ihnen der dunkle Saum des Waldes auf. Dahinter ragte der Gipfel des Wildbarrens wie ein grüner Rücken, und man hörte, abgesehen von Felix’ Sirenengeräuschen, nur Vogelrufe und das trockene Zirpen der Grillen.
»Du konnst dei Siren ausschalten, mia san jetzt da!«, sagte Maria, ließ ihr Fahrrad in die Wiese fallen und lief lachend in den Wald. Julian lehnte sein Rad an einen Baum und folgte ihr, mit Felix im Schlepptau. Unter dem Blätterdach war es sofort kühler; es roch nach feuchtem Moos und Erde. Julians Augen brauchten einen Moment, um von Weißlicht auf Waldgrün umzuschalten. Wenige Augenblicke später standen sie vor ihrem Lager, einem Verschlag aus Brettern und Ästen, befestigt an drei eng aneinanderstehenden Bäumen. Dort machten sie es sich erst einmal gemütlich und überlegten, was sie heute treiben könnten.
Irgendetwas war anders als sonst, denn Julian hatte das Gefühl, dass sie jemand beobachten würde. Ein dünner Faden Unruhe, als würde einer zwischen den Stämmen stehen und zuhören. Aber wer sollte hier draußen schon sein – außer dem Jäger vielleicht, und der hätte sie längst weggescheucht. So ließ er den Gedanken fallen, und schon bald waren sie alle drei in den Abenteuergeschichten versunken, die sie sich gegenseitig erzählten.
»Felix, geh du mal Wache spielen«, sagte Maria schließlich und legte Ernst in die Stimme. »I muss dem Julian a Geheimnis sagn.«
Der trottete ab, wichtig wie ein richtiger Polizist, während er leise tatütata summte. Zuerst aber musste Julian einen heiligen Schwur ablegen, dass er es niemals in seinem Leben jemandem erzählen würde. Das tat er natürlich – war ja Ehrensache.
Sie hatten ein wenig das Gefühl für die Zeit verloren, und Julian hatte das Abendessen im Hinterkopf – das gab es immer um sechs. Er hatte zwar keine Uhr dabei, aber er war sich nach einem prüfenden Blick zur Sonne sicher, dass es noch nicht so spät sein konnte. Also beschlossen sie, den Wald zu erkunden; vorhin hatten sie darüber diskutiert, ob hier jemand einen Schatz versteckt haben könnte.
Sie folgten einem leichten Abhang hinunter und sprangen über einen kleinen Bach. Nur Felix schaffte es nicht ganz und hatte danach nasse Schuhe und eine durchtränkte Hose bis zu den Knien. Auf der anderen Seite zog der Hang wieder an. Nach einem kurzen Marsch öffnete sich eine Lichtung; das Gras reichte ihnen bis zur Hüfte, dazwischen Margeriten und Kornblumen. Wenn jemand einen Schatz versteckt hat, dann hier! Julian griff sich einen herumliegenden Stock und schnitzte mit seinem Taschenmesser die kleinen Ästchen und Blätter weg. Dann begann er, das Gras niederzuschlagen, um sich einen Weg zur Mitte der Lichtung zu bahnen.
»Da kimmt ma doch a so locker durch!«, rief Maria, während sie ihn überholte und lachend ein paar Meter vorweglief.
»I mog a so an Stock«, hörte er Felix hinter sich sagen.
Julian drehte sich um und reichte seinem Bruder den Stecken. »Da, den konnst ham. Brauch i jetzt eh nimmer.«
Als er sich wieder umdrehte, konnte er Maria nicht mehr sehen. Nicht hinter einem Grasbüschel, nicht kichernd hinter einem Baum – weg. Wie vom Erdboden verschluckt.
»Mei, jetzt hat sie sich versteckt. Komm, die such ma jetzt«, sagte er zu Felix.
»Mama, Mama, die Maria is verschwunden!«, rief Julian in heller Aufregung und stürmte zur Gartentür hinein, gefolgt von Felix, der noch immer den Stock in der Hand hielt.
»Die werd sich halt versteckt ham. Da müsstses halt suchen«, sagte ihre Mutter, die gerade im Garten die Blumen goss.
»Mia ham alles abg’sucht! Die is nimmer da!«, rief Julian, während Felix bekräftigend nickte.
»A geh, so a Schmarrn. Niemand verschwindt einfach!«, entgegnete die Mutter.
Nach einer ausgedehnten Diskussion holte sie schließlich den Vater hinzu, der gerade im Schuppen arbeitete. Dieser begab sich dann – anfangs widerwillig – zusammen mit seinen beiden Söhnen zurück zum Wald, wo ihn Julian zu der Lichtung führte, auf der sie Maria zuletzt gesehen hatten. Sie riefen laut nach ihr und suchten die gesamte Lichtung sowie die umliegende Umgebung ab. Erst als es langsam zu dämmern begann, beschloss der Vater, mit den Kindern zurück in den Ort zu gehen und Marias Eltern zu informieren.
Innerhalb kurzer Zeit bildete sich eine Gruppe von etwa einem Dutzend Freiwilligen aus der Dorfgemeinschaft, die nun den Wald nach dem verschwundenen Mädchen absuchten. Spätestens ab diesem Zeitpunkt glaubte niemand mehr an ein Versteckspiel. Etwa eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit traf dann die verständigte Polizei im Ort ein. Aus einem Streifenwagen wurden schnell mehrere, und schließlich kam sogar ein Bus mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei. Männer mit Spürhunden rückten an. Die Feuerwehr, die Bergwacht und sogar der Jäger schlossen sich mit der Polizei zu Suchtrupps zusammen. Später kreiste ein Hubschrauber über dem Wald; sein Suchscheinwerfer strich wie ein weißer Besen über die Baumkronen.
Julian stand vor dem Haus inmitten von Blaulicht, Aggregatbrummen und Funkknacken – er fühlte sich unsichtbar. Sein Vater half bei der Suche, und seine Mutter hatte allerhand damit zu tun, den weinenden Felix ins Bett zu bringen. Plötzlich stand Marias Vater vor ihm und schaute ihn mit glasigen, roten Augen vorwurfsvoll an. Kurz darauf wankte er wortlos und schweren Schrittes in die Dunkelheit davon. Er schien mal wieder betrunken zu sein. Julian hatte schon oft die Gespräche seiner Eltern belauscht, in denen es um Marias Vater ging. Vielleicht war das auch der Grund, warum das Mädel mehr Zeit bei ihnen verbrachte als daheim.
Der erste Donner rollte; dann kam ein Windstoß, als würde jemand eine Tür aufreißen. Der Himmel brach auf. Regen prasselte, Hagel peitschte auf die Straße; das Treiben zerfloss in hastige Kommandos, durchnässte Jacken und fluchende Männer.
Fünf Tage suchten sie. Taucher gingen in die Weiher, Leichenspürhunde in die Senken. Die Polizei vernahm jeden im Ort. In der Schule gab es nur noch ein Gesprächsthema. Zeitungen, Radiosender, ja sogar das Fernsehen berichteten über Julians Freundin. Doch trotz aller Bemühungen blieb sie verschwunden – es gab nicht die geringste Spur von ihr.
Als hätte sie der Erdboden verschluckt.
Zeit für Veränderung
»Sie sind in der Tat ein vorbildlicher Polizist und ein brillanter Ermittler. Ihre Erfolge sind nicht von der Hand zu weisen«, sagte sein Chef und lächelte, ohne dass die Augen mitmachten.
Vor ihm saß der neue Leiter des Morddezernats der Hamburger Kriminalpolizei. Solche Worte sollten ihm eigentlich schmeicheln. Doch der Tonfall war glatt wie frisch gewachster Parkettboden – kaum wahrnehmbar süffisant. Lars hörte den Unterton, wie andere einen falsch gestimmten Flügel hören. Er hatte zu viele Vernehmungen geführt, um solchen Nuancen zu trauen.
Ein Karrieretyp, wie er im Buche stand: bereits Kriminaloberrat, Anfang vierzig. Auch der Rest des Auftretens passte dazu. Er war groß, durchtrainiert, sportlich; das dunkle, volle Haar akkurat gekämmt und gestriegelt, Anzug und Designerhemd auf Linie. Die gesamte Erscheinung war aalglatt, wie aus dem Ei gepellt. Lars war sich nicht schlüssig, wie er mit diesem Typen umgehen sollte. Schließlich hatte er selbst diesen Senkrechtstarter auf genau den Stuhl befördert, auf dem der Mann jetzt saß. Saubere Arbeit, Bergener. Und jetzt räum die Bühne.
»Ich denke, es ist an der Zeit, hier mal etwas frischen Wind hineinzubringen. Wir brauchen ein paar neue Impulse«, fuhr der Vorgesetzte fort.
Sein alter Chef war seit geraumer Zeit vom Dienst suspendiert und würde wohl auch nicht zurückkehren. Er, Lars Bergener, hatte den Stein ins Rollen gebracht: zunächst auf eigene Faust gegen ihn ermittelt und ihm mit unbeirrbarer Akribie nachgewiesen, dass dieser sich regelmäßig ein gutes Zubrot verdiente, indem er interne Ermittlungsergebnisse nach draußen sickern ließ – unter anderem an Mitglieder eines berüchtigten Hamburger Drogenkartells. Inzwischen lag der Fall beim Staatsschutz.
»Ich werde ein neues, dynamisches, junges Team aufbauen und frage mich, ob Sie Teil davon sein möchten.«
»Nun, ich verstehe die Frage nicht ganz. Passt so ein alter Hauptkommissar vielleicht nicht in Ihr ›neues, dynamisches, junges Team‹?«, entgegnete Lars direkt.
»Ähm, so war das nicht gemeint. Ich meine, Sie sind fachlich top – da besteht gar kein Zweifel. Allerdings halte ich die eine oder andere Ihrer Ermittlungsmethoden für etwas aus der Zeit gefallen. Über einen großen Zeitraum hinweg allein vor sich hin zu ermitteln, außerhalb der eigenen Zuständigkeit und ohne jeglichen Austausch: So etwas wird es unter meiner Leitung nicht mehr geben. Wir sind ein Team, das muss Ihnen klar sein. Und auch die soziale Komponente darf man nicht unbeachtet lassen. Immerhin haben Sie gegen Ihren ehemaligen Chef ermittelt – und das über Monate, ohne jemanden einzuweihen – und damit auch allen anderen Kollegen ein gehöriges Misstrauen entgegengebracht. Wenn Sie ehrlich zu sich selbst sind, hat Ihnen das nicht unbedingt nur Sympathien eingebracht.«
»Wollen Sie damit sagen, dass ich das besser hätte sein lassen sollen?«
»Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, wir reden hier gerade aneinander vorbei. Ich wollte nur sagen: Sie sind jetzt vierundfünfzig und haben sich Ihre Lorbeeren verdient. Haben Sie nicht schon einmal darüber nachgedacht, sich in ruhigeres Fahrwasser zu begeben?«
Darum ging es also. Den Gedanken, in ein paar Jahren in den Ruhestand zu gehen, hatte er immer verdrängt, auch wenn er sich an manchen Tagen inzwischen tatsächlich etwas berufsmüde fühlte. Aber war das nicht normal – selbst für jemanden, der mehr als sein halbes Leben Polizist mit Leib und Seele gewesen war? Sein Blick wanderte zu der rechteckigen schwarzen Digitaluhr über dem Schreibtisch seines Gegenübers. Sie zeigte den 2. Februar 2013, kurz vor Mittag. Die digitalen Ziffern erschienen ihm ebenso grau wie der Himmel an diesem verregneten Tag.
»Ach, wissen Sie was? Denken Sie einfach mal in Ruhe darüber nach, was Sie machen wollen – und wo Sie hier zukünftig Ihren Platz sehen.«
»Geradlinigkeit, Zielstrebigkeit und Integrität sind heute offenbar keine Werte mehr, auf die es bei der Polizeiarbeit ankommt. Aber ja, das werde ich tun. Ich werde darüber nachdenken. Danke für dieses aufschlussreiche Gespräch.«
Ohne weitere Worte zu verschwenden, stand Lars auf, kehrte seinem Vorgesetzten demonstrativ den Rücken und verließ den Raum. Das war seine Art, diesem selbstgefälligen Idioten zu zeigen, dass er ihn am Arsch lecken konnte.
»Weißt du, Bettina, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns verändern«, sagte er, als sie später beim Abendessen in ihrer gemütlich eingerichteten Altbauwohnung am Hamburger Stadtrand saßen.
»Wir uns verändern? Wie kommst du denn darauf?«
»Hast du nicht immer von einem Leben am Alpenrand geträumt? Darüber haben wir doch gerade in letzter Zeit wieder öfter gesprochen.«
»Das stimmt. Aber das wollten wir doch erst machen, wenn wir beide im Ruhestand sind.«
»Nun ja, vielleicht sollte man Dinge manchmal einfach machen, statt sie auf die lange Bank zu schieben. Ausreden, warum man dieses und jenes gerade nicht umsetzen kann, findet man immer.«
»Ist irgendetwas nicht in Ordnung mit dir? Du wirkst heute so nachdenklich, seit du von der Arbeit heimgekommen bist. War irgendwas im Büro?«
»Ich hatte heute ein Gespräch mit dem neuen Chef. Ich habe das Gefühl, die wollen mich loswerden. Ich frage mich zugegebenermaßen schon länger, ob ich da noch reinpasse. Vielleicht sollte ich tatsächlich meinen Kompass neu ausrichten – und ich könnte mir gut vorstellen, das mit einem Ortswechsel zu verbinden.«
»Das hat etwas mit der Sache mit deinem alten Chef zu tun, oder? Aber wie dem auch sei – das ist mal wieder typisch du. Immer gleich Nägel mit Köpfen, hm?«
»Mag sein … Jedenfalls habe ich mich, rein interessehalber, nach offenen Stellen bei der bayerischen Polizei erkundigt. Die hätten da tatsächlich eine passende Ausschreibung für mich. Wenn es klappt, bräuchten wir nur noch etwas für dich. Aber für eine Lehrerin sollte sich doch etwas finden lassen – Schulen gibt es in Bayern ja genug.«
»Das ist aber ein großer Schritt, den wir uns wirklich gut überlegen sollten. Vielleicht sollten wir dort erst einmal wieder Urlaub machen und es uns ansehen. Das kann man doch sicher irgendwie verbinden, oder?«
»Sozusagen ein Neustart im Süden. Aber wenn wir noch länger warten, machen wir es vielleicht nie. Ich kümmere mich mal darum«, sagte er.
Kommissariat 13
Es war Lars’ erster Arbeitstag an seiner neuen Dienststelle in Kiefersfelden. Er hatte lange mit sich gerungen und war letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass es das Beste sei, den Schritt einfach zu wagen. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Für so eine ländliche Region war das Backsteingebäude der Dienststelle größer, als er es sich vorgestellt hatte. Was genau auf ihn zukommen würde, wusste er noch nicht – das Vorstellungsgespräch hatte in Rosenheim stattgefunden, wo die zuständige Kriminalpolizeiinspektion saß. Die Abteilung der Kriminalpolizei für grenzüberschreitende Kriminalität, ebenso wie das Kommissariat 13, waren ausgelagert und teilten sich im Grenzort Kiefersfelden ein Gebäude mit der örtlichen Polizeiinspektion.
Er wurde in einer Gruppe von etwa einem Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kommissariats 10 freundlich aufgenommen und nach einer kurzen Vorstellungsrunde bei Kaffee und Kuchen von einem der neuen Kollegen durchs Haus geführt. Lars war motiviert und freute sich auf seinen zukünftigen Aufgabenbereich. Nach all den Jahren, in denen er sich zwischen Milieu-Morden, organisiertem Verbrechen und den Abgründen einer Großstadt bewegt hatte, war es an der Zeit, es ruhiger angehen zu lassen – plus Bergpanorama.
Sein neuer Arbeitsplatz, das Kommissariat 13 mit besonderem Aufgabenbereich, dessen Leiter er nun war, war noch einmal extra ausgegliedert. Es befand sich in einem Doppelbüro im Erdgeschoss, am Ende des Flurs. Dazu gehörte ein Aktenarchiv, das sich über den gesamten Keller erstreckte.
»So, des werd ab jetz dei zukünftiger Wirkungsbereich. Dann lass i di mal allein. Wennst Fragen hast, dann rührst di einfach«, sagte der freundliche Kollege, der sich als Alois vorgestellt hatte.
»Danke, dann werde ich mich mal einrichten«, sagte Lars.
Er betrat das Büro durch eine schwere Holztür mit Oberlicht und stand in einer Art Vorzimmer: Schreibtisch mit Computer, Aktenschränke, Telefon, ein altes Küchenradio. Auf dem Wandkalender – ein Werbegeschenk der Polizeigewerkschaft – stand der 3. Juni 2013. Daneben ein etwas größerer Raum mit zwei gegenüberstehenden Schreibtischen, auf denen jeweils zwei weiße Monitore standen. Von einem gerahmten Foto lachten ihm zwei Kinder entgegen, ein Junge und ein Mädchen. Das war sein zukünftiges Büro, das er sich mit einem Kollegen teilen würde, den er noch nicht kannte. An der Wand hingen Polizeiplakate, eine weiße Tafel und ein kleiner Schaukasten mit Asservaten. Außerdem: Blechschrank und Waffentresor, darauf ein Funkgerät in der Ladestation. Zwei Fenster – eines mit Bergblick, eines in den Hof, wo ein paar Streifenwagen standen. Es roch leicht muffig und nach kaltem Kaffee; Lars öffnete erst einmal ein Fenster.
Aus dem Vorzimmer murmelte das alte Küchenradio die Gegenwart herein: Meldungen über steigende Pegel an Donau und Inn, gesperrte Ortsdurchfahrten, Sandsackausgaben bei den Feuerwehren. Die Bahn streiche einzelne Verbindungen, hieß es. Dann wechselte der Sprecher auf Weltlage – ein Whistleblower in den USA habe geheime Abhörprogramme offengelegt. Lars hörte nur halb zu; draußen stand die Bergkante dunkel und fest, als wolle sie den Laden zusammenhalten.
Er zögerte nicht lange und begann, sich einzurichten. Nach einigen Telefonaten mit der IT-Abteilung des Präsidiums schaffte er es schließlich, sich am PC anzumelden. Er war ein geduldiger Mensch, der nicht zum Fluchen neigte, doch diese Gerätschaften konnten einem wirklich den letzten Nerv abverlangen. Immerhin war der Kollege am anderen Ende freundlich und hilfsbereit, wenn auch etwas hektisch. Kurz darauf ging die Tür. Eine Frau betrat das Vorzimmer, stellte ihre Tasche auf den Tisch und blieb im Rahmen stehen.
»Hallo!«, rief er. Sie fuhr zusammen, dann grinste sie.
»Ah ja, grias di! I bin die Pauline. Und du musst der neue Chef sei!«
»Äh, ja – Lars Bergener. Sehr erfreut. Und Sie müssen die Schreibkraft sein«, antwortete er, etwas perplex. Eine derart saloppe Begrüßung hatte er nicht erwartet.
»Ja, genau des bin i«, sagte Pauline und lachte herzlich. »Wir duzen uns hier alle. Mogst an Kaffee? Drent im Gemeinschaftsraum steht a Automat – i geh eh glei rüber.«
»Nein danke, ich hatte schon einen.«
»Passt. Dann sagst einfach, wennst was brauchst«, meinte sie und nahm im Vorzimmer an ihrem Schreibtisch Platz.
Das war also Pauline. Etwa zehn Jahre jünger als er, rundes freundliches Gesicht, schulterlange braune Locken, vermutlich gefärbt. Zumindest die Schreibkraft war schon einmal eine sympathische Erscheinung. Der erste Eindruck zählt, dachte Lars.
Wenige Augenblicke später ging die Tür ein zweites Mal.
»Ja guad Moing, Alex – hast du etwa verpennt? Und des am ersten Arbeitstag von unserm neuen Chef!«, hörte er Pauline.
»Geh ma ned mit deiner G’schaftlerei auf’n Sack und bring ma liaba an Kaffee«, kam eine männliche Stimme zurück.
»Hol da selber oan – du woast doch, wo da Automat steht!«, fauchte Pauline.
Der Mann betrat das Büro; Lars musterte ihn. Etwa Mitte vierzig, eins fünfundsiebzig, untersetzt, leichter Bauch. Auf dem eckigen Kopf eine Glatze mit dunklem Haarkranz, breites Gesicht, ein grau melierter, eher ungepflegter Vollbart. Zerknittertes weißes Hemd, ausgewaschene Jeans, eine überdimensionierte silberne Gürtelschnalle in der Bauchfalte. Rechts am Gürtel hing das Holster – ein Hauch John Wayne. Na ja, wenigstens keine Hosenträger, dachte Lars.
»Servus. I bin da Alex«, sagte der Mann, ließ sich ihm gegenüber nieder und fiel wie ein Sack Zement in den Stuhl; der quittierte es mit einem erbärmlichen Ächzen.
»Hallo. Lars Bergener. Sehr erfreut. Ich bin der neue Kommissariatsleiter.«
»So förmlich glei. Kriminalobermeister Alexander Rindler. I bin dann quasi dei neuer Untergebener.«
In dem Alter noch Kriminalobermeister – da muss schon was im Argen sein, dachte Lars. Angesichts von Auftreten und Erscheinungsbild wunderte ihn das nicht.
»Wo bleibt mei Kaffee, zefix!«, rief Alex provokativ in den Flur.
»Du konnst mi mal«, kam prompt Paulines Antwort.
»Ich bin wirklich keiner, der gleich ein Machtwort spricht, aber können wir uns bitte auf einen etwas gemäßigteren Umgangston einigen?«, sagte Lars.
»Oh, da Chef spricht glei a mal a Machtwort. Also: Dei Vorgänger, der jetz im Ruhestand is, dem war des herzlich wurscht. Möcht i bloß erwähnt haben.«
»Das mag sein – mir ist es nicht ›wurscht‹«, erwiderte Lars.
»Ois klar, i nimms mal zur Kenntnis. Ihr Preißn habts doch alle an Stock im …«, murmelte Alex.
»Wie bitte? Ich glaube, ich habe mich verhört.«
»I glaub a. I hab nix g’sagt.«
»Denk da nix, der is immer so. Is nix Persönliches«, rief Pauline aus dem Vorzimmer.
»Na, das kann ja heiter werden …«, entfuhr es Lars.
Am Abend schlenderte er den gut ausgebauten Fußweg am Inn entlang durch Kufstein, wo er eine schöne Wohnung inmitten der Stadt gefunden hatte. Ein Spaziergang war die richtige Beschäftigung, um den Kopf freizubekommen. Der erste Tag im Kommissariat 13 war anstrengend gewesen: viele neue Gesichter und Namen, ein kleiner Kulturschock, dieser seltsame Kollege, dazu die Einarbeitung in regionale Eigenheiten – und, was am schwersten wog, die Trennung von Bettina. Kurz vor der Abreise aus Hamburg hatte sie ihm eröffnet, dass sie nicht mitgehen würde – und seit mehr als zwei Jahren einen Liebhaber habe. Sie hatten sich über die Jahre auseinandergelebt; er hatte sich in die Arbeit geflüchtet. All die Zeit hatte er nichts bemerkt; das musste er sich eingestehen. Vielleicht lag es auch daran, dass ihre Ehe kinderlos geblieben war. Nun war sie auf Selbstfindung und plante eine lange Reise durch Indien. Es schmerzte ihn. Er fühlte sich einsam – und gab sich die Schuld.
»Mal schauen, was die Zukunft noch so bringt«, sagte er zu sich selbst und blickte in das schnell fließende, türkisgrüne Wasser des Inns, der seine Farbe den Gesteinssedimenten verdankte, die er auf seinem Weg durch die Alpen mitnahm. Ein Fluss hatte immer eine beruhigende Ausstrahlung auf ihn. Beständig, geduldig – er hatte sich lange vor den Menschen seinen Weg gebahnt. Und er würde wohl noch fließen, wenn hier längst niemand mehr lebte.
Der Fall
»So, Kollege Rindler, nun erkläre mir doch mal, was wir hier beim Kommissariat 13 so machen. Was genau ist unser Aufgabengebiet?«, sagte Lars.
»Solltest du des ned selber wissen ois Kommissariatsleiter?«, antwortete Alex patzig und sah ihn aus müden Augen provozierend an. Er wirkte noch heruntergekommener, als Lars ihn vom ersten Tag in Erinnerung hatte. Er trug dasselbe Hemd wie gestern und roch nach jemandem, der nach dem Sport zu faul zum Duschen war und das nun mit übermäßig viel Deodorant zu kaschieren versuchte. Nur dass Alex nicht so aussah, als hätte er sich in den letzten Jahren jemals ernsthaft körperlich ertüchtigt.
»Ich will es aber aus deinem Mund, mit deinen Worten hören«, sagte Lars unbeirrt.
»Na guad. Kurzum: Wir machen hier jeden Dreck, für den si bei der Kripo koa anderer zuständig fühlt.«
»Aha, das ist alles?«
»Na, was hast denn erwartet? Ja ok – wir san so was wie die ›Abteilung Q‹ in den Romanen von dem Schweden da. Die, wo die alten Fälle lösen. Oder soll i lieber Cold Cases dazu sagn? Des scheint ja jetz modern zum sei, dass ma – weiß Gott wo – solche Abteilungen einführt.«
»Du meinst Jussi Adler-Olsen. Der ist Däne, kein Schwede. Aber ich bin beeindruckt. Hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass du seine Bücher liest.«
»Jetz pass a mal auf. Erstens is ma des wurscht, wo der herkimmt. Schwede, Däne, Norweger – is für mi ois des Gleiche. Und zwoatens hab i koa Buch von dem g’lesen. Des hat mir die Pauline erzählt. Die liest so a Zeug.«
»Na ja, dann bin ich zumindest aufgrund der Tatsache beeindruckt, dass du zu wissen scheinst, dass Dänemark, Schweden und Norwegen nah beieinander liegen.«
»Ja schee, dass i di beeindruckt hab.«
»Du stellst dich doch viel dümmer, als du eigentlich bist. Warum machst du das? Und wie lange willst du dieses Spiel spielen?«
»Wer woaß – vielleicht stellst du di a viel gscheider, wie du bist. Mei Aufgabe is dann, des auszugleichen.«
»Blöde Antworten sind genau dein Ding, oder?«
»Jahrelangs Training.«
»Na gut. Belassen wir es dabei. Aber eines interessiert mich noch.«
»Was denn?«
»Du sprachst vom Lösen alter Fälle. Also siehst du dich auch als jemanden, der Fälle löst?«
»Wir lösen hier gar nix. Akten prüfen, Stempel drauf, und ins Archiv damit. Ois, was älter is wie zehn Jahr. Irgendwann soll des Zeig amal digitalisiert werden. Des war’s.«
»Klingt eigentlich ziemlich frustrierend, oder?«, sagte Lars.
»Wie ma’s nimmt. I mach des, was ma ang’schafft wird – und am Abend geh i hoam. Mir ham hier no nie a Verbrechen aufgeklärt.«
»Also gut.«
Lars schob einen Stapel Fallakten, den er vorbereitet hatte, über den Tisch zu Alex.
»Was werd jetz des?«, fragte der, die Stimme einen Tick gestresst.
»Es ist gleich neun Uhr. Du fragst jetzt die Pauline ganz nett, ob sie dir einen Kaffee holt. Das sind fünf Akten – alles Fälle, die nie endgültig aufgeklärt wurden. Such dir einen aus. Den sehen wir uns näher an. Du hast Zeit bis Mittag.«
»Ja klar, sonst no was? Und was machst du derweil?«
»Dienstsport. Ich gehe joggen und schau mir die Gegend an.«
»Des is jetz ned dei Ernst, oder?«
»Doch. Oder willst du statt meiner joggen gehen? Dann schau ich mir die Akten an.«
»Na, passt scho …«
Der Morgen hing grau über Kiefersfelden, als hätte jemand einen nassen Lappen über den Himmel geworfen. Lars lief im lockeren Trab am Kieferbach entlang; das Wasser schoss klar und kalt zwischen Steinen, die aussahen, als hätten sie seit Jahrhunderten nichts anderes getan, als Strömung auszuhalten. Am Ufer hing noch Treibgut in den Weiden, ein heller Schlammstrich gut einen halben Meter über dem jetzigen Spiegel – vor ein paar Tagen musste hier deutlich mehr Wasser durchgeschossen sein. Die Gemeinde – sechstausend Seelen inmitten des Inntals, Grenzort mit Blick nach Tirol – atmete langsam, noch halb verschlafen.
Die Luft war schwerer als in Hamburg, satt vom Grün, vom feuchten Holz der Gärten, von Hangwasser, das nachts an den Felsen heruntergelaufen war. Von echter Höhenluft konnte bei fünfhundert Metern noch keine Rede sein, aber der Körper diskutierte dennoch mit jedem Anstieg. Vielleicht war es die Müdigkeit der letzten Wochen, vielleicht nur der Süden, der die Wärme in die Gassen drückte, bis auch der letzte Schatten schwitzte. Der Sommer hier war drückend, anders als er es aus der wetterumtosten Großstadt gewöhnt war, wo beinahe immer eine feine Meeresbrise durch die Straßen zog. Als wesentlich gewöhnungsbedürftiger empfand er allerdings die Mentalität der Menschen, die zwar meist freundlich waren, dabei aber immer irgendwie verschlossen und distanziert wirkten. So wie sein neuer Kollege Alex, aus dem kaum etwas Persönliches herauszubekommen war. Nur dass es bei diesem darüber hinaus bisweilen an jeglichen Umgangsformen haperte. Vielleicht hatte Lars seinen neuen Posten auch mehr seinem ruhigen Gemüt als seiner Fachkompetenz zu verdanken, denn dieser Alex hätte vermutlich jeden anderen bereits binnen Stunden in den Wahnsinn getrieben.
Er passierte Einfamilienhäuser, in deren Einfahrten die Sommerreifen übereinanderlagen, einen Bauhof, vor dem Sandsäcke zu ordentlichen Wällen geschichtet waren. Ein laminiertes Blatt am Tor versprach Ausgabezeiten bei Hochwasser – die Art Papier, die erst dann auffällt, wenn es zu spät ist. Der Sommer meint es ernst, dachte Lars, und seine Schritte wurden fester, der Atem ruhiger, das Tempo gleichmäßiger.
Der Weg führte ihn durch einen Wald. Das Licht wurde grün, gedämpft, die Geräusche klebten näher am Boden. Ein älteres Ehepaar mit Hund kam ihm entgegen; sie nickten knapp, aber freundlich. Nach zwei Kilometern folgte eine Brücke. Er wechselte die Seite, lief zurück, der Bach jetzt links, die Berge vor der Stirn. In einer Seitenstraße stand ein kleines Café, als hätte es nur auf ihn gewartet: Tische auf dem Gehsteig, Metallstühle, der Duft von Pfirsich und Kaffee. Er bestellte eine Apfelschorle, trank in großen Zügen und sah der Bergrippe beim Stillsein zu. Noch fühlte sich alles ein wenig wie Urlaub an – aber darunter begann etwas zu arbeiten, ein leises, hartnäckiges Räderwerk.
Auf dem Rückweg summten seine Muskeln. Der Kopf war frei genug, um wieder zuzuhören.
Kurz vor Mittag trat er – frisch geduscht – ins Büro. Auf seinem Platz gegenüber von Alex hatte sich Pauline eingerichtet.
»Oh, Lars – entschuldige …«, sagte sie und war im Begriff aufzustehen.
»Alles gut. Kein Grund, sich zu entschuldigen«, sagte er.
»I dacht ma, i geh dem Alex a bissl zur Hand«, meinte sie.
»Na klar«, sagte Lars – und sah, dass der Aktenstapel unberührt auf seinem Schreibtisch lag. Papierreiter wie kleine, aufgerissene Zungen. »Und, seid ihr schon zu einem Ergebnis gekommen?«
»I sag da oans: Des konnst vergessen. I woaß ganz ehrlich ned, was i mit dem alten Schmarrn soll – außer abheften und ins Archiv klatschen.«
»So? Dann erzähl mir doch mal, was diese Fälle gemeinsam haben. Aus welchem Grund könnte ich diese fünf ausgesucht haben?«
»Des san ois Vermisstenfälle!«, rief Pauline dazwischen.
»Richtig – Vermisstenfälle«, bestätigte Lars. »Und weiter?«
Alex seufzte. »Alle im näheren Umkreis passiert. Koane Spur von dene Vermissten – bis heit. Zwoa verschwundene Wanderer 1996 und 1998, a Opa, der 2000 ausm Altersheim abghauen is, 2001 a G’schäftsmann aus Tirol – und 2003 a Kind.«
»Na, das ist doch schon mal was. Also – welchen schauen wir uns an?«
»Mir is des ehrlich g’sagt herzlich wurscht. Da kimmt eh nix bei raus«, murrte Alex.
»Das sehe ich anders. Du bist Polizist – also zeig gefälligst ein bisschen Ehrgeiz. Da draußen leben Menschen in Ungewissheit, weil ihnen jemand fehlt. Uns ist das nicht herzlich wurscht. Die Leute verlassen sich auf uns.«
»Da muss i eam jetz recht geben«, sagte Pauline und warf Alex einen vorwurfsvollen Blick zu.
Alex hob abwehrend die Hände. »Na guad, wenns ihr unbedingt meints … Dann nehm i halt die Akte mit dem Kind.«
»Na also, geht doch. Und warum genau die?«, bohrte Lars nach.
»Is doch logisch. Die zwoa Wanderer san wahrscheinlich irgendwo in die Berg abgstürzt – da geh i ned von a Verbrechen aus. Der alte Opa war verwirrt und is wahrscheinlich in’n Inn g’fallen. Meines Erachtens die bessere Alternative zum Altersheim – falls des wen interessiert. Und bei dem G’schäftsmo ausm Ösiland hat’s Hinweise auf psychische G’schichten mit Eigengefährdung g’eben. Nur bei dem Madl – da geh i ziemlich sicher von a Straftat aus.«
»Ja, i kenn den Fall vo da Maria noch. A heftige G’schicht. Da kriag i glei Gänsehaut …«, sagte Pauline leiser.
»Ich versteh zwar ned ganz, was ihr euch davon erhofft’s«, brummte Alex, stand auf und griff nach seiner Jacke. »Aber gut … I geh jetz erst a mal Mittag essen.«
Die Tür schnappte zu wie ein schlecht gelaunter Hund. Einen Moment blieb nur das Summen der Neonröhren, das Rascheln von Papier. Lars legte die Hand auf die oberste Akte, spürte die raue Kante des Kartons.
»Gut – also der Fall mit dem vermissten Mädchen«, sagte er.
Draußen zog ein Zug durchs Inntal, tiefes Grollen, kurz und entschlossen – als würde die Landschaft selbst den Takt angeben. Drinnen war etwas in Bewegung geraten. Nicht laut, nicht spektakulär. Aber spürbar.
Erste Ansätze
Den gesamten Nachmittag verbrachte Lars damit, sich in die Akte einzuarbeiten. Im Grunde hatte er keinerlei Erfahrung mit Vermisstenfällen. Zumindest nicht mit Vermisstenfällen dieser Art. Sein Spezialgebiet waren Tötungsdelikte – und davon hatte er im Lauf seiner Polizeikarriere nicht gerade wenige bearbeitet. Dieser Fall schien anders zu sein; vor allem aber lag er zehn Jahre zurück. Ziemlich genau zehn Jahre. Eine Zeitspanne, die wie Mörtel in Ritzen sitzt: Spuren werden weichgescheuert, Erinnerungen poliert, Täter haben Luft zum Abtauchen.
Das vermisste Mädchen hieß Maria Altmanstorfer, und sie war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens neun Jahre alt gewesen. Sie stammte aus Hinterau: hundert Seelen, Gemeindegebiet Oberaudorf, der nächste Ort nördlich von Kiefersfelden. Eine Leiche gab es nie, und es fand sich kein brauchbarer Hinweis darauf, was ihr zugestoßen sein könnte. Menschen verschwanden ständig; die meisten tauchten binnen Stunden oder Tagen wieder auf. Im Idealfall lebend und unversehrt, manchmal tot. Hier: nichts von beidem.
Je weiter er sich durch die Akte grub, desto merkwürdiger wurde die Geschichte. Fotos vom vermeintlichen Ort des Verschwindens sowie Einsatzfotos (Waldrand, Parkbucht, Forstweg); Luftbilder und eine 1:25.000-Karte mit Markierungen; Einsatzpläne, Lagejournal und Suchraster (3-Meter-Gassen) mit A-/B-Sektoren; Zeitungsartikel; Kennzeichenlisten aus Straßensperren und Schleierfahndung; Protokolle von Zeugenvernehmungen; Berichte der Suchtrupps. Auf einem Bild lächelte ihn Maria selbst an: ein hübsches blondes Kind mit großen, wachsamen Augen. Klug, dachte Lars, ohne den Blick loszubekommen.
Kurz nach dem Verschwinden war eine SOKO Maria gegründet worden, und das Inntal hatte seine größte Suchaktion der jüngeren Zeit gesehen: Hunderte Freiwillige, Feuerwehr, Bergwacht, Hundestaffeln, ein Hubschrauber mit Suchscheinwerfer und Wärmebild. Auf österreichischer Seite durchkämmte die Tiroler Polizei die Wälder; Taucher gingen in Weiher und Altarme. Straßenkontrollen und Schleierfahndung im Grenzraum, europaweite Fahndung – und doch kein Ergebnis.
Grob skizziert ergab die Akte: Erstmeldung am frühen Abend, noch am selben Tag erste Absuche am Waldrand. In den folgenden fünf Nächten Suchketten, die die Lichtung im Schachbrettmuster durchkämmten; Hunde verloren die Spur mittig; der Hubschrauber brach die Suche einmal wegen Hagel ab. Lars strich sich mit dem Daumen über den Aktenrand. Genau da, wo der Boden offen lag und die Logik zu knirschen begann.
Kurzzeitig stand der Onkel im Fokus. Der Verdacht blieb dünn: alibifähige Zeiten, ein paar Quittungen, Zeugen – nichts, worauf man heute noch bauen könnte. Lars machte sich Notizen. Manches wirkte lückenhaft: Wiederholungsbefragungen? Späterer Abgleich der damaligen Hinweise mit neuen Hinweisen? Nachsuche zu anderen Tageszeiten? Es fand sich wenig dazu. An anderer Stelle fehlten Fragen, die er heute stellen würde: Wer sah sie zuletzt wirklich? Wie waren Sichtlinien, Geräusche, Ablenkungen? An welcher Stelle wurden die drei Kinder räumlich getrennt – und was war der Auslöser?
Er blätterte weiter. Ein Einsatzbericht notierte: »Starker Regen. Suchketten abgebrochen. Fortsetzung 06:00 Uhr.« Ein anderer: »Hunde schlagen kurz an, gehen dann aus. Abriss mittig; Wiederansatz am Rand negativ.« Er markierte die Stellen. Wenn Hunde mitten auf einer offenen Fläche die Witterung verloren, gab es nur wenige Erklärungen – und keine davon machte den Fall einfacher.
Als er aus dem Fenster sah, dämmerte es bereits. Pauline und Alex waren längst weg; das Gebäude klang nach Flurlicht und Putzwagen. Lars klappte die Akte zu. Für heute genug. Auf dem Weg über den Flur traf er auf einen uniformierten Kollegen der Inspektion, der sich als Stefan vorstellte – Nachtschicht, wie sich nach einem kurzen Smalltalk herausstellte. Einen Moment überlegte Lars, ob er den Jungen zu dem Vermisstenfall anstupsen sollte. Stefan wirkte motiviert, hellwach. Aber er mochte höchstens fünfundzwanzig sein, damals also fünfzehn. Erinnerungen in diesem Alter waren oft bunt und brüchig zugleich. Bunt – und brüchig, dachte Lars und verwarf den Gedanken.
Kurz darauf stieg er in seinen alten grauen 190er Benz mit Hamburger Kennzeichen. Über dreihunderttausend auf der Uhr, sprang aber an wie am ersten Tag. Auf dem Weg über die Grenze nach Kufstein dachte er wieder an Maria. Neunzehn wäre sie heute. Ein Gesicht ohne Zukunft; eine Akte ohne Ende. Danach die profane Frage: Warum eigentlich nicht mit dem alten Rennrad pendeln? Er beschloss, es am nächsten Tag zu versuchen.
Er saß auf dem kleinen Balkon seiner Wohnung im dritten Stock und ließ die ersten beiden Arbeitstage Revue passieren. Das Appartement in Kufstein war Zufall gewesen – ein guter. Die Stadt am Inn hatte ihn sofort gepackt: die Burg auf dem Felsen, die engen Gassen, genug Welt für eine Provinz, in der sogar eine internationale Hochschule stand. Die Miete war freundlicher als in Bayern, aber das war Nebensache. Schwieriger war es gewesen, in Bayern überhaupt einen Besichtigungstermin zu bekommen. Von Vermietern, die ihm abgewohnte Löcher zu Fantasiepreisen und mit feistem Lächeln präsentiert hatten, hatte er schnell genug.
Die Menschen hier in Österreich waren wieder anders als jenseits der Grenze, die Sprache kantiger, das Lächeln direkter. Die Vielzahl neuer Eindrücke half gegen das, was sich sonst breit zu machen versuchte: Einsamkeit. Sein Magen knurrte, riss ihn zurück in die Gegenwart. Der Kühlschrank war ernüchternd leer. Er beschloss kurzerhand, auswärts essen zu gehen. Also runter in die Stadt.
Er landete im Purlepaus am Stadtplatz unterhalb der Burg und aß steirischen Backhendlsalat. Das Lokal war rustikal und hell, gut besucht für einen Dienstagabend; Stimmengewirr, Besteckklirren und die geölte Routine eines Ladens, dessen Betreiber sein Handwerk versteht. Der Wirt fragte persönlich, ob alles passe. Obwohl er kaum Alkohol trank, ließ Lars sich auf einen Obstler aufs Haus überreden. Gut für die Verdauung, hieß es. Manchmal darf man sich belügen lassen.
Draußen, auf den Stufen zum Eingang des mäßig belebten Biergartens, streckte er sich und sog die Abendluft ein. Es war angenehm warm, der Mond stand hoch über dem Platz, eine leichte Brise stieg vom Inn herauf. Da fiel ihm eine gedrungene Gestalt auf, die den abschüssigen Stadtplatz hochgestapft kam.
»Ja, der Kollege Rindler! Das ist ja ein Zufall, was machst du denn hier?«, rief Lars, als er ihn erkannte. Alex blieb stehen, drehte den Kopf und schaute wenig begeistert.
»Mein Gott, ned a mal im Ösiland hat ma sei Ruh vor die Preißn … Muss i a außerhalb vom Dienst mit dir reden?« Der Mann hatte offensichtlich einige Bier intus – und trug immer noch dasselbe Hemd wie seit zwei Tagen.
»Ja, entweder du schlagst jetz Wurzeln da oder du kimmst mit!« Alex setzte sich wieder in Bewegung. Lars überlegte kurz, eine Entscheidung zwischen einer eigentümlichen Einladung – oder Gedankenkarussell allein. Er nahm Ersteres.
»Und wohin gehen wir?«
»In a Kneipn.«
»Bist du öfter hier in Kufstein?«
»Jedn Dienstag. Zum Spickern.«
»Spickern? Du spielst Darts?«
»So schaut’s aus. Aber heut bin i a bissl spät dran.«
»Ach was, ist doch erst halb elf«, sagte Lars, leicht zynisch.
»Des hier is ned Hamburg. Hier klappn spadestens um oans die Gehsteige hoch. Zumindest unter der Woch.«
Die Kneipe war eine verqualmte Spelunke mit zwei Dartautomaten, gelbem Licht und Tischplatten, die schon bessere Zigaretten gesehen hatten. Als Anfänger hatte Lars nicht den Hauch einer Chance. Runde für Runde beendete Alex das Spiel und quittierte es mit spöttischen Gesten, manchmal begleitet von einem fiesen Lacher. Er schien sichtlich Spaß daran zu haben, seinem neuen Chef einen Whitewash zu verpassen, wie er es nannte. Auf dem Stehtisch neben den Automaten landete sein drittes Bier, seit sie dort waren. Dazu rauchte er eine Zigarette nach der anderen – im Österreich des Jahres 2013 kein Thema, zumindest nicht in Lokalen wie diesem.
Lars hatte das Gefühl, dass die Bedienung – kurzhaarig, blond, um die sechzig, Kippe im Mundwinkel – mit ihm flirtete. Als sie das vom Kalk milchig angelaufene Bierglas abstellte, ließ sie ihn provokativ in den tiefen Ausschnitt ihrer offenbar gemachten Brüste blicken, die sich unter einem Leopardenmuster abzeichneten. So groß ist die Einsamkeit dann doch nicht, stellte er fest und ignorierte sie.
»Dir fehlt einfach der Kessel, um a guader Darter zum sei. So a dürrer Hund wie du, des konn nix werdn«, tönte Alex. Zielwasser schien bei ihm tatsächlich zu wirken.
»Ich denke, das liegt eher an meiner mangelnden Spielpraxis«, konterte Lars und nippte an seiner Apfelschorle.
»Was machst du eigentlich sonst noch so, außer Darten?«
»Schafkopfen. Fußball schaun. Was ma halt so macht.«
»Schafkopfen? Was ist das?«
»A Kartenspiel. Spielt ma z’viert. So ähnlich wie Doppelkopf, nur mit bayerische Karten.«
»Mogst du a no was trink’n?«, fragte die Bedienung, die noch immer neben dem Tisch stand. Lars fiel auf, dass sie die einzigen Gäste waren. Von Alex’ Dartkumpels keine Spur. Eine derart leere Kneipe hatte er in Hamburg nie erlebt.
»Nein, danke«, sagte er freundlich.
»Ihr Tiroler hörts euch beim Redn immer o, als hätts ihr a Kehlkopfentzündung. I kannt mi jeds Mal obrunzn«, posaunte Alex.
»Jetzt reichts aber! Du konnst a zoin und dann kennts eich schleicha! Mir schließen eh boid!«, fauchte die Frau, drehte auf dem Absatz ab und stapfte davon.
»Das war wohl ein ziemlich deutlicher Rauswurf«, stellte Lars fest.
»Des Ösibier hängt mir heut eh scho zum Hals raus. Des konnst kaum saufn. Da Durscht treibts eini, da Ekel treibts obe und da Geiz behalts drin«, knurrte Alex.
Wenig später standen sie draußen auf dem Gehsteig. Bezahlt hatte am Ende Lars – Alex hatte keinen Cent mehr, die letzten Euros wohl im Schlund des Automaten versenkt.
»Also, ich werde jetzt nach Hause gehen und mich hinlegen«, sagte Lars.
»Äh ja, dann guad Nacht!«
»Und du? Wie kommst du heim? Rufst du dir ein Taxi?«
»Ähm … i woas ned. Konn i vielleicht bei dir pennen? Du hast doch sicher a Couch, oder?«
Lars sah ihn an. Ein Kollege, der wie eine menschliche Abrisskugel durch den Abend schwang; dazu ein Fall, der in den Knochen zog; eine Stadt, die neu war und doch vertraut roch. Morgen wieder an die Akte, dachte er. Auf nach Hinterau. Und diesmal würde er mit Dreck unter den Nägeln zurückkehren.
Ermittlungen
Lars war an diesem Tag schon früh auf den Beinen und mit seinem alten Rennrad in die Arbeit gefahren, so wie er es sich vorgenommen hatte. Als er die Wohnung verlassen hatte, lag Alex noch auf seiner Couch und schnarchte derart laut, dass man glauben konnte, er würde gerade einen ganzen Wald abholzen. Lars weckte ihn mit Mühe und teilte ihm mit, dass er ins Büro fahre und Alex sich selbst ein Frühstück organisieren müsse, da nichts im Kühlschrank sei. Alex hatte mit glasigen roten Augen genickt – eine Informationsdichte, die sein Gehirn in diesem Zustand sichtlich überforderte.
Nun saß er im Büro, genoss den ersten Kaffee aus dem Gemeinschaftsraum und blätterte weiter in der Fallakte. Aus dem kleinen Radio im Vorzimmer kamen Meldungen zu gesperrten Ortsdurchfahrten und Hangrutschen nach dem Hochwasser; die Bahn meldete Ausfälle auf der Strecke Rosenheim–Salzburg, das THW sei weiter im Dauereinsatz. Lars hörte nur mit halbem Ohr hin. Er hatte Blut geleckt: Der Gedanke daran, was mit dem verschwundenen Mädchen passiert war, ließ ihn nicht mehr los. Natürlich war ihm auch bewusst, dass das Wiederaufrollen eines solchen Falls mit einem immensen Arbeitsaufwand, diversen Widerständen und emotionalen Anstrengungen verbunden war – das nahm er in Kauf.
»I bin heut übrigens nur bis Mittag da. Also immer am Mittwoch«, sagte Pauline, die gerade den Kopf in sein Büro streckte. Im Gegensatz zu Alex war diese wesentlich gesprächiger, und so wusste Lars zumindest von ihr, dass sie verheiratet war, hier im Ort lebte und zwei schon große Kinder hatte, die beide gerade eine Berufsausbildung machten.
»Ist in Ordnung«, sagte Lars.
»Ähm, du, sag mal, Pauline … Was ist eigentlich mit dem Kollegen Rindler los?«, fragte er nach kurzem Zögern.
»Was genau moanst du?«, fragte sie.
Er erzählte ihr vom gestrigen Abend mit Alex.
»Oh mei, des klingt nach eam. Ja, der hat Probleme«, sagte Pauline.
»Was denn für Probleme?«, wollte Lars wissen.
»So ganz genau woas i des a ned. I konn dir nur sagen, dass ihn wohl sei Frau mit die Kinder vor einiger Zeit verlassn hat und er seitdem in Fischbach bei seiner Mutter im Haus wohnt.«
»Ok, das klingt tatsächlich nach Problemen«, stellte er fest.
Gegen halb elf blickte er durch das gekippte Fenster zum Hof, da das Geräusch eines Wagens mit kaputtem Auspuff seine Aufmerksamkeit erregte. Ein knallgelber Peugeot, rostig und verbeult, hatte sich dort soeben schief über zwei Parkplätze gelegt. Im Scheibenwischer klemmte ein Strafzettel. Die Tür öffnete sich, und Alex hievte sich aus dem Wagen. Er steckte sich eine Zigarette an, knallte die Tür zu und ging schwerfällig ein paar Meter in Richtung Eingang des Dienstgebäudes, machte dann jedoch kehrt und stapfte zurück zum Auto. Er schien etwas aus dem Handschuhfach herauszukramen. Lars konnte erkennen, dass es das Holster mit der Dienstwaffe war. Ungelenk versuchte Alex, es an seinem Gürtel zu befestigen, bis es ihm schließlich aus der Hand rutschte und dumpf auf dem Asphalt aufschlug.
»Kreiz Kruzifix no mal!«, fluchte er über den Hof, ohne zu bemerken, dass er gerade beobachtet wurde. Schließlich klappte der Sicherungssteg, die Kippe landete am Boden, Alex stapfte Richtung Eingang.
»Kaffee!«, raunte er schließlich durchs Vorzimmer, als er an Pauline vorbeiging.
»Servus, Chef!«, sagte er und ließ sich – diesmal vorsichtig – auf den Stuhl sinken, die Hand im Kreuz. »Dei Couch is ganz schee unbequem.«
Er roch nach einer Mischung aus jemandem, der sich mehrere Tage nicht geduscht hatte, Alkoholfahne und kaltem Zigarettenrauch.
»Guten Morgen, Kollege Rindler! Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?«, sagte Lars mit strenger Stimme.
»Was denn?«
»Du willst mir jetzt nicht allen Ernstes erzählen, dass du deine Karre mit der Dienstwaffe im Handschuhfach über Nacht irgendwo in Kufstein geparkt hattest und jetzt mit ungefähr drei Promille Restalkohol hierher gefahren bist?«
»Na, des würd mir im Traum ned einfallen.«
»Ich glaube, du spinnst! Dieses Verhalten ist nicht nur äußerst unprofessionell, sondern auch noch absolut verantwortungslos und gefährlich! Oder willst du mir erzählen, dass so etwas bei der bayerischen Polizei normal ist? Mich würde mal interessieren, was unser Dienstherr dazu sagt …«, fuhr Lars ihn in scharfem Ton an.
»Mei, des muss ma ja jetz ned glei an die große Glocke hängen …«, sagte Alex kleinlaut.
»So? Wir gehen gleich mal zu den Kollegen nach nebenan und machen einen Atemalkoholvortest. Der Strafzettel auf deiner Scheibe sollte den Rest beweisen«, setzte Lars nach.
»Is ja scho guad, es kimmt ned wieder vor.«
»Das hoffe ich, sonst war’s das letzte Mal! Und noch was …«
»Ja?«
»Du stinkst wie ein Iltis! Der einzige Grund, warum ich dich nicht sofort zum Alkotest darüber schicke, ist, dass man das den Kollegen nicht zumuten kann! Bei dem Gestank muss man ja Angst haben, dass die Leichenspürhunde anschlagen!«
Lars atmete einmal durch.
»Hier gelten ab sofort ein paar klare Regeln. Du wirst in Zukunft spätestens um acht hier deinen Dienst antreten. Dann wirst du die Pauline mit Respekt behandeln. Und drittens wirst du ab sofort wenigstens jeden zweiten Tag duschen! Ist das klar, Herr Kollege Kriminalobermeister?«
»Wenns sei muass …«
»Und jetzt gehst du raus auf den Hof und hebst deine beschissene Kippe vom Boden auf!«
»Dem hast es jetzt aber gegeben. Des hat der mal gebraucht!«, sagte Pauline mit einem breiten Grinsen, nachdem Alex sich ohne Widerrede nach draußen getrollt hatte.
Nach verordneter Körperpflege im Duschraum der Dienststelle saß Alex mit einer alten Uniform, die an jeder Stelle seines unförmigen Körpers zu spannen schien, wieder an seinem Platz. Er hatte die Dienstbekleidung in seinem Spind in der Umkleide aufbewahrt, aber wohl schon länger nicht mehr getragen.
»So, Fallbesprechung. Pauline, nimm dir deinen Stuhl und setz dich zu uns«, sagte Lars.
»Also, nachdem wir jetzt alle zwischenmenschlichen Modalitäten geklärt haben, konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Wir haben hier einen Vermisstenfall zu bearbeiten. Die neunjährige Maria Altmanstorfer aus dem nahegelegenen Ort Hinterau verschwand am 31. Mai 2003 beim Spielen in einem Wald nahe des Ortes – spurlos«, fuhr er fort, nachdem sich alle im Büro eingefunden hatten.
»Wir haben hier einiges an Ermittlungsmaterial vorliegen, und es ergeben sich aus meiner Sicht mehrere Möglichkeiten, was ihr zugestoßen sein könnte«, fuhr er weiter fort.
»Womit beginnen wir also?«, fragte er in die Runde.
»I würd sagen, mia schließen erst mal alles aus, was ned infrage kimmt«, sagte Alex.
»Richtig, wir beginnen die Ermittlungen mit einem Ausschlussverfahren. Du weißt ja doch was, Kollege Rindler«, bestätigte ihn Lars.
»Fakt ist, dass sich Menschen nicht einfach so spurlos in Luft auflösen. Es muss also einen Grund für das Verschwinden von Maria geben. Welche Möglichkeiten haben wir? Pauline, nimm dir bitte den Stift und schreib an die Tafel«, fuhr Lars fort.
»Entführung«, sagte Alex.
»Durch wen?«, fragte Lars.
»Menschenhändler, Organhändler, Pädophile oder sonst irgendwelche perversen Drecksäue …«, schlug Alex vor.
»Oder vielleicht irgendwelche Reichen, die selber keine Kinder kriang kennan und zu alt zum Adoptieren san«, ergänzte Pauline.
»Du meinst eine Auftragsentführung? Gut, schreib es mit dazu. Was noch?«, sagte Lars.
»Viecher«, warf Alex ein.
»Viecher?«, fragte Lars verwundert.
»Na ja, wilde Tiere. Was woas den i. Bärn, Wölf’, wildernde Hund’ oder Greifvögl«, entgegnete Alex.
»Greifvögel würde ich direkt ausschließen. Ein normal ernährtes neunjähriges Kind wiegt etwa 30 bis 35 Kilogramm. Das trägt kein Greifvogel. Flugsaurier sind ausgestorben. Landraubtiere: können wir in Erwägung ziehen, aber nur mit Spuren. Außerdem: freiwilliges Weglaufen als Option«, sagte Lars.
»Dann blieben noch Unfall, Ertrinken, natürlicher Tod«, ergänzte Alex.
»Vielleicht a Jagdunfall? Der Jager hat sie versehentlich abknallt und die Leich dann beseitigt – ums zu vertuschen?«, fügte er an.
»Dann müsste jemand einen Schuss gehört haben – laut Unterlagen war das nicht der Fall. Der zuständige Jäger war demnach nicht im Revier, hat später Suchtrupps geführt. Das setze ich vorerst nach hinten«, sagte Lars.
Pauline sah auf die Uhr. »I müsst dann langsam los.«
»Gut – wir haben jetzt eine erste Liste. Ich würde sagen, ich fahre am Nachmittag mit dem Alex nach Hinterau und wir befragen einige der Leute, die damals bei der Suche dabei waren. Außerdem will ich mir mal diesen Wald ansehen«, sagte er.
»Oh Gott, was willst denn da in Hinterau? Da wohnan lauter Inzuchtler«, sagte Alex.
»Was führt dich zu der Annahme, dass dort lauter ›Inzuchtler‹ wohnen?«, wollte Lars wissen.
»Fahr hin und red mal mit dene, dann woast, was i moan.«
Lars sah kurz zur Uhr, dann auf die Tafel. Vom Ort herüber schlug die Kirchturmuhr – einmal, dann wieder Ruhe. Genug Papier, dachte er. Zeit für Boden unter den Schuhen.
Willkommen in Hinterau
»Diese drecks Rennradlfahrer! Die hab i vielleicht dick! Warum kennan die ned auf irgend an Radlweg fahrn? Diese Deppen lernans einfach nie …«, schimpfte Alex.
Seit gut einem Kilometer hingen sie hinter einem Trikotträger, der seinen sehnigen Körper in der Schwüle des Nachmittags die schmale, kurvige Straße hinaufpumpte. Der Himmel schien fast blank, die Klimaanlage wälzte kalte Luft in den Innenraum; hinter ihnen wuchs eine ungeduldige Kolonne.
»Ja, das ist wie mit den Rauchern, die überall ihre Zigarettenstummel hinwerfen«, entgegnete Lars, ohne sich als Fahrer von der Situation aus der Ruhe bringen zu lassen. Sein Blick streifte die bergige Landschaft – so anders als seine norddeutsche Heimat. Liebevoll bemalte Fassaden, breite Balkone, Geranienkaskaden in den Kästen: noch immer ein Hauch von Urlaub. Erst auf einer langen Geraden setzte er den Blinker und zog am Radfahrer vorbei. Aus dem Autoradio zischten Kurznachrichten: Die CSU erneuere ihre Forderung nach einer Pkw-Maut und ernte prompt Widerspruch aus Berlin und Brüssel.
»Moanst wirklich, dass des was bringt?«, fragte Alex nach einer Schweigeminute.
»Was?«
»Na, da jetz zum Ermitteln – in dem alten Fall. I moan, die Kollegen damals werdn ihren Job scho richtig g’macht ham.«
»Die Kollegen sind auch nur Menschen, und Menschen machen Fehler. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Wir vom Kommissariat 13 haben jetzt die Aufgabe, das zu überprüfen. Immerhin geht es um ein Kind, das spurlos verschwunden sein soll.«
»Was denn zum Beispiel ›übersehen‹?«
»Hast du dir die Aussagen der beiden Jungen durchgelesen, mit denen Maria im Wald gespielt hat? Beide sagen, sie sei plötzlich verschwunden – von einer Sekunde auf die andere. Sie haben niemanden gesehen, der das Mädchen hätte entführen können. Und wieso ausgerechnet auf einer abgelegenen Waldlichtung im Nirgendwo? Kommt dir das nicht seltsam vor?«
»Mei, des san halt Kinder. Die reden doch oft einfach an Schmarrn.«
»Oder sie sagen die Wahrheit. Ich will mir die Stelle ansehen und mit ein paar Leuten im Ort sprechen. Mehr haben wir ohnehin nicht. Die Zeugen sind neben den Unterlagen unsere einzige Chance, noch etwas herauszufinden. Spuren werden wir nach der langen Zeit sicher keine mehr finden.«
In einem Waldstück, das sie gerade auf der Landstraße durchfuhren, wies eine kleine gelbe Pfeiltafel mit schwarzer Schrift den Weg nach Hinterau aus.
»Da hättn wir übrigens abbiegen müssn«, bemerkte Alex trocken. Nach ein paar hundert Metern wendete Lars den weißen Skoda auf einem Wanderparkplatz, fuhr zurück und folgte dem Pfeil. Die Straße wurde schmal und holprig. Links standen Fichten wie dunkle Kämme, rechts hingen Wiesen an den Hängen, als wären sie mit Stecknadeln festgepinnt. Harzgeruch lag in der Luft und irgendwo ratterte unsichtbar eine Presse, die Heu zu Ballen schnürte. Am Ortseingang stand eine morsche Holztafel wie eine Parodie ihrer selbst: Willkommen in Hinterau, in schiefer, weißer Farbe hingeschmiert; der Schriftzug blätterte wie alte Haut.
Hinterau saß auf der Hochebene zwischen Schwarzenberg und Wildbarren wie ein zusammengeklaubtes Nest aus Holz und Stein – festgezurrt mit Wegen, die der Regen blank geschrubbt hatte. Die Hitze stand auf dem Schotter, die Luft flimmerte über dem Weg und Schwalben schnitten in flachen Bögen durchs Licht.
Das mit Abstand größte Gebäude war die Kirche, ihr Zwiebelturm tönte im hellen Blech des Himmels. Davor befand sich ein kleiner Platz mit einem runden Brunnen aus rohem Stein; das Wasser gluckerte, als wollte es den Nachmittag leiser stellen. Gegenüber erhob sich das Gasthaus Zum Schneiderwirt mit angeschlossenem Wohnhaus – Ruhetag, verkündete ein Schild. Die Fensterläden waren geschlossen, die Biergartengarnituren hochgestellt, und es wirkte beinahe so, als hätte jemand dem Ort die Stimme abgedreht.
Rundherum drängten sich ein paar verwitterte Häuser im Voralpenstil: dunkles Holz, Naturstein und breite Balkone, die unter der Last von Geranien überquollen. An manchen Fassaden hing Lüftlmalerei – Heilige, die über Türen wachten und ein Erzengel, dessen Schwert in der Sonne aufglomm. An einem Giebel klapperte ein Wetterhahn und irgendwo schlug eine Tür dumpf gegen einen Rahmen. Aus der Ferne tönte das Surren einer Kreissäge, dazwischen das scheue Bimmeln einer Kuhglocke.
Lars parkte auf einem der ausgewiesenen Plätze vor dem Wirtshaus und scheuchte damit ein Rudel Hühner auf, das sich im trockenen, staubigen Boden gesuhlt hatte. Der Hahn krähte empört, Staub stieg auf und lag wie Mehl in der Luft. Sonst war es still. Die Dorfstraße war so leer, dass jeder ihrer Schritte klang, als würde man in einer Kirche husten. Nach einigen Metern trafen sie auf einen älteren Mann mit Hut, der hinter dem Holzzaun seines Grundstücks Unkraut zu jäten schien.
»Guten Tag, entschuldigen Sie …«, setzte Lars an.
Der Mann erhob sich; ein zerfurchtes Gesicht sah ihn wenig freundlich an. Er schüttelte den Kopf und widmete sich wieder der Arbeit.
»Lass mi des machen. Mit ›Guten Tag‹ brauchst du hier koan Menschen anreden. Des konnst dir glei mal hinter die Ohren schreiben. Des Oanzige, was hier no unbeliebter is wie a Preiß, des is a Münchner«, klärte ihn Alex auf.
»Ja gut, dann mach du mal. Vielleicht kann ich ja noch etwas von dir lernen«, sagte Lars.
»Griaß di. Mia suachadn des Haus vo da Familie Altmanstorfer«, gab Alex in astreinem Bairisch zum Besten.
Der Dorfbewohner baute sich erneut auf und musterte Alex in Uniform. Ohne sein Schweigen zu brechen, zeigte er mit dem Finger auf ein Haus am Ende eines kleinen Weges, etwa fünfzig Meter entfernt. Alex bedankte sich, und die beiden Polizisten machten sich dorthin auf den Weg.
Es war ein kleines Holzhaus mit verwildertem Vorgarten und einem langen Vordach, das von zwei Holzpfeilern gestützt wurde. Zur linken Seite eröffnete sich eine Art Veranda, direkt neben der Eingangstür stand eine kleine Holzbank. Die Fassade zeigte deutliche Spuren der Sonneneinstrahlung, die Fenster wirkten milchig.
»Soll’n mir jetz da wirklich klingeln?«, fragte Alex unsicher.
»Versuchen wir’s«, sagte Lars und drückte auf den eisernen Knopf an der Hauswand.
Keine Reaktion. Niemand öffnete; im Haus waren keinerlei Geräusche zu vernehmen.
»Kanada«, sagte Alex.
»Kanada?«
»Keiner da. Du kennst den Witz ned, oder?«
»Nein.«
»Ach, lass guad sei. Kapierst eh ned«, antwortete Alex lapidar.
»Sehr freundlich …«, erwiderte Lars.
»Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«, ertönte eine weibliche Stimme vom Nachbargrundstück. Eine ältere Frau mit langen weißen Haaren stand vor ihrer Eingangstür und blickte herüber.
»Wir sind von der Polizei und wollten mit der Familie Altmanstorfer sprechen«, sagte Lars.
»Sie meinen mit der Christl? Der Franz hat sich vor sechs Jahr aufg’hängt«, sagte die Frau.
»Das ist tragisch«, sagte Lars.
»Wie ma’s nimmt. Hätt er sich ned aufg’hängt, hätt er sich früher oder später totg’soffn. Die Altmanstorfer Buben waren scho immer Taugenichtse.«
»Was meinen Sie damit? Sie wohnen also schon länger hier?«
»Seit mehr als fünfzig Jahr wohn i hier. Hab hier sozusagen eing’heiratet. Mei Mann is hier aufg’wachsen … Was wollens denn eigentlich von der Christl?«
»Es geht um die Maria Altmanstorfer. Wir führen Nachermittlungen zum Vermisstenfall durch«, sagte Lars.
»Um die Maria … Des hab i ma glei dacht … Da kommts ihr jetz nach all den Jahren daher …«, sagte sie mit niedergedrückter Stimme.
»Können Sie uns etwas dazu sagen?«
»Ja, kommens rei. Dann könn ma uns unterhalten. Hier draußen kommens ja um – bei der Hitz.«
Sie fanden sich in der Küche der Nachbarin wieder, die sich ihnen als Hilde Meier-Landsdorfer vorstellte. Lars schätzte ihr Alter auf etwa siebzig. Sie servierte frisch gekochten Tee, weil das – wie sie erklärte – an heißen Tagen das Beste sei. Lars musste an einen Urlaub in Marokko denken: Auch dort trank man heißen Tee in der Hitze. Schaden kann es nicht, dachte er, während sich bereits Schweißflecken unter seinen Achseln abzeichneten. In dem alten Bauernhaus war es angenehm kühl – die dicken Steinmauern wirkten wie ein Bollwerk gegen die Hitze. Eine Katze strich unter dem Tisch um seine Beine. Schließlich wanderte sie zu Alex; der bückte sich, hob sie hoch und setzte sie auf seinen Schoß. Während Alex die schnurrende Mieze kraulte, sprach Lars mit der gastfreundlichen Frau.
»Wissens, seit mei Mann letztes Jahr ins Altersheim kommen is, wohn i allein hier. Demenz, wissens … Wenigstens bekomm i ab und zu Besuch, immerhin bin i scho zweifache Oma …«, erzählte sie. Lars dachte an seine Mutter, ein paar Jahre älter, die bald zu Besuch kommen wollte.
»Aber i will Sie ned mit meiner Lebensg’schicht langweilen. Sie wollt’n ja was wissen«, fuhr sie fort, stellte eine Schale mit selbst gemachtem Gebäck auf den Tisch und setzte sich wieder. Alex griff sofort zu und steckte sich einen großen Keks in den Mund, während die andere Hand weiter die Katze kraulte.
»Schon gut. Jeder hat ja sein Päckchen zu tragen«, sagte Lars.
»Des mit der Maria damals … Schlimme Gschicht … I erinner mi noch, als wär’s gestern g’wesen.«
»Wie war denn die Maria so?«
»A ganz a ruhigs Mädel. Aber schlau, sag i Ihnen. Sie war öfter bei mir – die Kekse mocht’s genauso gern wie Ihr Kollege«, sagte sie und lachte.
»Aber schwer hat’s es g’habt …«
»Warum hatte sie es schwer?«
»Mei, die Eltern … Der Vater hat g’soffen und die Mutter war total überfordert … Seit die Kleine weg is, hat man die kaum no g’sehn. Und dann no des mit’m Franz … Die nimmt jetz Tabletten wegen da Psyche, wissens …«
»Ja, das macht was mit einem, wenn das eigene Kind spurlos verschwindet«, sagte Lars.
»Der Franz – i glaub, der is dran zerbrochen. Aber der Willi, sei Bruder … Des is a ganz a anderer Schlag. Den hams dann sogar verdächtigt, weil er plötzlich mit’m Porsche rumg’fahrn is, kurz nachdem die Maria verschwunden war. Ham eam aber nie was nachweisen kenna.«
»Und was glauben Sie? Hat er was damit zu tun?«
»Na, glaub i ned. Die Maria haben d’Engel gholt. Des glaub i.«
»Die Engel? Was meinen Sie damit?«
»I mein des, wie i’s sag. I bin ned abergläubisch, aber da Herrgott hat a Erbarmen g’habt mit dem Kind.«
»In Ordnung – aber das müssen Sie mir genauer erklären.«
»A paar Tage, bevor die Maria weg war, san nachts Lichter überm Wald gwen.«
»Nun ja – Lichter am Himmel sind erst mal nichts Ungewöhnliches. Wetterleuchten, ein Flugzeug … Warum glauben Sie, dass das etwas mit Marias Verschwinden zu tun haben könnte?«
»Glauben’s ma, des war koa Wetterleuchten. I woaß, wie so was ausschaut. Zweitausenddrei war a extrem hoasser, trockner Sommer. Die Nächt, wo des Licht überm Wald war, war da Himmel glasklar. So a Licht hab i no nie g’sehn.«
»Gut. Ich glaube Ihnen, dass Sie das so erlebt haben. Hat sonst noch jemand diese Lichter gesehen?«
»Ja, da Pfarrer hat’s a g’sehn. Der sagt a, des warn d’Engel. Glauben’s ma – des warn d’Engel …«
Lars nickte knapp, bat um Erlaubnis, sich Notizen zu machen, und schrieb den Namen der Frau sowie eine Telefonnummer auf. ›Lichter über dem Wald – wenige Tage vor 31.05.03 – Zeugin: H. Meier-Landsdorfer.‹ Dann legte er den Stift beiseite. Draußen summte die Hitze. Drinnen roch es nach Tee und alten Dielen.
In Gottes Ohr
»Lichter am Himmel … Die Engel ham des Kind g’holt … So an Schmarrn hab i scho lang nimma g’hört. Am End’ warn’s no die Aliens oder da Bigfoot, der des Kind g’fressn hat«, sagte Alex in abschätzigem Tonfall, als sie wieder am Auto standen.
»Weißt du, Alex, genau das ist dein Problem«, sagte Lars.
»Was denn, ha? Is doch so«, entgegnete er patzig und steckte sich eine Zigarette an.
»Du musst den Leuten zuhören und