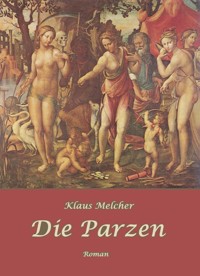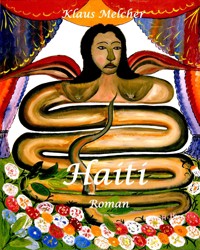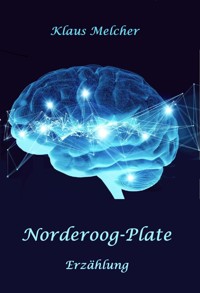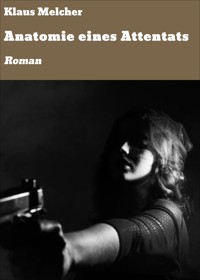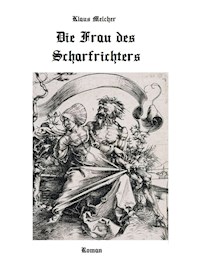Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Wer war mein Opa?", ist die stets unbeantwortete Frage, die das Kind Julia an seine Oma stellte und auf die sie nie eine Antwort bekommen hat. Nachdem die Großmutter gestorben ist, begeben sich Mutter und die inzwischen erwachsene Tochter auf Spurensuche und entdecken die Schuld, die ihre Vorfahren von der Kaiserzeit bis heute durch falsche Ehrbegriffe, Verdrängen,Naivität, blinden vorauseilenden Gehorsam und Fanatismus und Ausleben niederster Instinkte auf sich geladen haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Melcher
Spurensuche
Wer war mein Opa?
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
Impressum neobooks
1. Kapitel
Verwehte Spuren
An meinen Opa habe ich keine Erinnerung, hatte ich eigentlich nie, auch nicht als ich Kind war.
Wenn ich nach meinem Opa fragte, hieß es immer: „Opa ist im Himmel“ oder „Dein Opa war ein sehr wichtiger und angesehener Mann“ oder „Er ist verreist.“.
Und wenn ich etwas besonders gut gemacht hatte, sagte meine Oma: „Das würde den Opa freuen“.
Aber das kam sehr selten vor.
Sehnlich hatte ich mir einen Opa gewünscht, wie andere Kinder ihn hatten.
Graue etwas schüttere Haare, ein sonnengegerbtes Gesicht, eine tiefe sanfte Stimme, so stellte ich ihn mir vor .
Und gutmütig sollte er sein, mir jeden kleinen Wunsch von den Lippen ablesen und erfüllen, bevor ich ihn ausgesprochen hatte. Aussprechen würde ich meine Wünsche nämlich nicht, das schien mir unverschämt, denn ich wusste, dass mein Opa mich liebte, und Opas, die ihre Enkelin lieben, tun für sie alles.
Aber ich hatte – wie gesagt – keinen Opa.
Wenn ich mal meine Oma fragte, ob mein Opa nicht irgendwann von seiner Reise zurückkäme, dann schien sie einen Augenblick traurig und bekam ganz wässrige Augen, noch wässrigere, als sie sowieso schon hatte, so wie Magermilch, so ein helles verwässertes Blau.
In den Büchern, die ich damals las, gab es öfter solche Omas.
Auch mit solchen Magermilchaugen. Aber die waren immer lieb zu ihren Enkeln und ihre Enkel liebten sie.
Meine Oma liebte mich nicht, und ich hatte sie auch nicht lieb.
Meine Oma hatte eigentlich niemanden lieb. Ich glaube, nicht einmal meine Mutter.
Tiere, ja, die hatte sie lieb, jedenfalls sagte sie das immer, auf die wäre Verlass, die wären nicht falsch wie die Menschen, und dabei sah sie mich immer so merkwürdig an.
Jahre später, als ich mich nicht mehr mit der Geschichte vom Verreisen abspeisen lassen wollte und auch nicht mehr an den Himmel glaubte, fragte ich einmal – vielleicht zu energisch: „Wer war eigentlich mein Opa?“ und bekam nur zur Antwort: „Dein Opa hat sich nichts zuschulden kommen lassen!“
Und dabei blieb es.
Inzwischen bin ich fast dreißig und habe mich damit abgefunden, keinen Opa zu haben, egal, ob er im Himmel, auf Reisen oder sonst wo ist.
Er ist einfach nicht da, als hätte es ihn nie gegeben.
Nur eine Frage beschäftigt mich nach wie vor: Wie kann es geschehen, dass ein sehr wichtiger und angesehener Mann, wie meine Oma immer sagte, einfach spurlos verschwindet?
2. Kapitel
Berlin, Waldfriedhof, 13. November 1994
Die Grabstelle H 23 lag am hinteren Rand des Waldfriedhofs, Rücken an Rücken mit einem der aufwändigen Mausoleen in diesem Bereich. Von der Friedhofsmauer trennten sie nur ein schmaler Weg und ein noch schmalerer Streifen, der mit schlanken Sträuchern und Büschen bepflanzt war. Da man die Büsche sich selbst überließ und nicht regelmäßig beschnitt, hatten sie sich im Laufe der Zeit ausgebreitet. Der Weg war immer weiter zugewachsen, so dass man sich nur im Krebsgang fortbewegen konnte oder auf eins der anderen Gräber dieser Reihe ausweichen musste.
Hier ein Grab zu unterhalten, war für die Angehörigen eine Qual. Die Pflege der Gräber war so anstrengend, dass sich die Friedhofsgärtnerei weigerte, die Arbeiten zu übernehmen, oder einen erheblichen Aufpreis berechnete, wenn sie – aus Mitleid - doch mal einen Auftrag übernahm.
Und so sahen die Gräber auch aus. Ungepflegt, von Dornen und Unkraut überwuchert. Die Grabsteine waren zugewachsen, ihre Inschriften nicht mehr erkennbar.
Man nannte ihn den Friedhof der Vergessenen, wenn man ihn überhaupt kannte.
Anpflanzen konnte man auf der Grabstelle H 23 praktisch nichts. Sie lag im Schatten des Mausoleums, eines tempelartigen Baus aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, dessen Eingang zwei kniende, dick bemooste Engel bewachten, und einer Platane gewaltigen Ausmaßes.
Efeu bot sich als einzige Grabbepflanzung an, im Frühjahr allenfalls noch Winterling und Schneeglöckchen und Buschwindröschen. Spätestens wenn das Laub der Platane ein dichtes Dach bildete, würde es keine Farbtupfer mehr auf der dunkelgrün-schwarzgrauen Grababdeckung geben.
Wer hier bestattet wurde, hatte kein Geld für eine bessere Grabstelle. Oder er wollte oder sollte vergessen werden, aus welchem Grunde auch immer.
Kaum jemand würde ihn auf seinem letzten Weg begleiten. Es gab keinen Platz für eine Trauergesellschaft. Wer kam, würde sich in der Kapelle verabschieden müssen – und später wahrscheinlich nie den Weg in diese abgelegene Gegend finden.
Wen wundert es, dass diese Grabstelle noch nicht wieder belegt war. Seit zwei Jahren war sie abgelaufen.
Nachdem keine Hinterbliebenen in Erfahrung gebracht worden waren, die sie hätten verlängern können, hatte die Friedhofsverwaltung das Grab einebnen lassen. Den Grabstein hatte der Steinmetz entfernt und mit seinem Aufwand verrechnet. Jetzt lag er auf seinem Betriebshof und wartete darauf, abgeschliffen und wieder verkauft zu werden.
Die Inhaber des Mausoleums, eine gewisse Familie Möller, hatten den freien Platz als Versteck für alles mögliche Gartengerät entdeckt und nutzten ihn eifrig, nachdem sie auch ihre herrschaftliche Grabstelle in den letzten Jahren und Jahrzehnten sträflich vernachlässigt hatten.
Aber nach dem Krieg hatte man zunächst andere Sorgen. Man war schon froh, dass die Platane den Winter 1946/47 unbeschadet überstanden hatte. Wahrscheinlich war sie den Holzdieben schon zu groß, um gefällt zu werden. Jedenfalls besondere Maßnahmen zum Schutz des Baumes hatte die Familie Möller nicht ergriffen. Sie hatte Berlin mit unbekanntem Ziel verlassen.
Wer auch immer seit einigen Jahren das Grab in Ordnung hielt - pflegte wäre zuviel gesagt – der hatte sich auch der Grabstelle auf der Rückseite bemächtigt. Sogar eine Gartenkarre hatte er dort deponiert, zugedeckt durch eine grüne Plastikplane. Laub und abgeschnittene Efeuranken wurden nicht mehr in die Grüncontainer gebracht, sie wurden einfach auf die Rückseite geworfen.
Die Grabstelle H 23 war ein Bild des Jammers und hätte ganz sicher den Zorn der Nachbarn erregt und zur Beschwerde bei der Friedhofsverwaltung geführt, wenn, ja wenn überhaupt jemand diesen Winkel je betreten hätte.
Ausgerechnet diese Grabstelle steuerte eine Gruppe von drei Frauen an. Sie sahen nicht aus wie übliche Friedhofsbesucher, trugen keine Blumen oder Geräte mit sich, schritten energisch aus, als wären sie in Eile.
Voran ging die Älteste.
Ab und zu sahen sich die beiden Frauen, wohl Mutter und Tochter, die im Schlepptau der Alten gingen, fragend an, schüttelten den Kopf und versuchten sich vor dem alles durchdringenden Novembernebel zu schützen, den Kopf tief in den Kragen und Schal eingezogen.
Kurz hinter dem kleinen Pavillon zu Ehren der Königin Luise verließen die Frauen die breite Kastanienallee und bogen nach rechts auf einen der vielen Hauptwege ab, die sich immer weiter verästelten, bis sie zu den einzelnen Grabfeldern führten.
Als sie einen der zentralen Kompostcontainer erreicht hatten, bogen sie vom Hauptweg ab, schritten durch eine Reihe gepflegter Gräber und kamen in die
Reihe H.
Mühsam zwängten sie sich an den Büschen vorbei und blieben an dem eingeebneten Grab stehen.
„Das ist es“, sagte Elisabeth von Wernher.
Ungläubig sah ihre Tochter sie an.
„Das ist doch nicht dein Ernst.“
„Und warum nicht?“
Elisabeth von Wernher war es nicht gewohnt, dass man ihr widersprach oder ihre Entscheidungen in Frage stellte. Das hatte es nie gegeben und würde es nie geben.
„Hier will ich liegen und nirgends woanders. Hier habe ich meine Ruhe!“
Damit war das Thema erledigt.
Elisabeth von Wernher drehte sich auf dem Absatz um und trat auf das Grab, um an ihrer Tochter und Enkelin vorbeizukommen. Ihre Füße versanken in dem aufgeweichten Boden, der links und rechts an ihren Schuhen empor quoll.
Wieder auf dem schmalen Weg, stapfte sie zweimal auf, und als der Schlamm noch immer an den Sohlen klebte, suchte sie eine einzelne Grassode und strich ihre Schuhe ab. Unzufrieden mit dem Erfolg, ging sie den gleichen Weg unterhalb der Mauer zurück.
Als sie auf dem Hauptweg angekommen war und der Blick auf das Mausoleum frei war, sah sie kurz in die Richtung, murmelte etwas Unverständliches und übernahm wieder die Führung.
An dem Luisen-Pavillon hatten die beiden jüngeren Frauen sie endlich eingeholt.
Inmitten im Wind torkelnder trockener Kastanienblätter war sie stehen geblieben, völlig außer Atem. Sie würdigte ihre Tochter und Enkelin nur eines kurzen Blickes.
„Ich habe noch was zu erledigen. Also dann bis später.“
Sie nickte den beiden Frauen zu und eilte in Richtung Haltestelle.
Unmittelbar nachdem sie in den wartenden Bus gestiegen war, setzte er sich in Bewegung und fuhr in Richtung Innenstadt.
„Verstehst du das?“
Anneliese von Wernher sah ihre Tochter an.
Julia schüttelte den Kopf.
Zwar war ihr ihre Großmutter schon immer sehr fremd gewesen, gefühlskalt war sie, egoistisch und herrschsüchtig; aber sie hatte sich bisher wenigstens immer den Anschein gegeben, ihre Meinung zu begründen. Auch wenn sie Widerspruch nicht zuließ.
Und auf einmal tat ihre Mutter ihr leid.
3. Kapitel
Friedrichshagen, Juni 1913
Elisabeth von Wernher wurde am 15. 11. 1923 als drittes Kind eines verarmten Adelsgeschlechts in Friedrichshagen bei Oranienburg geboren.
Der Großvater war als Offizier im Preußischen Garderegiment sehr spendabel gewesen und hatte gerne, aber erfolglos gespielt. Als er feststellte, dass nicht nur sein Portemonnaie leer war, sondern auch von seinem Familienbesitz wenig übrig geblieben war, quittierte er den Dienst und kehrte nach Friedrichshagen zurück, in der Hoffnung, wenigstens noch etwas retten zu können.
Den Mut, seiner Frau zu sagen, dass er nun immer hier bleiben würde und dass ihr Schicksal sehr ungewiss wäre, hatte er nicht. Stattdessen gab er bei seiner Ankunft ein opulentes Abendessen für den übernächsten Abend in Auftrag und ließ seine Nachbarn zu dem Fest seiner Rückkehr einladen.
Nachdem er die notwendigen Briefe geschrieben und Instruktionen erteilt hatte, ging er durch das weitläufige Gutshaus, das eher an ein Schloss erinnerte.
Im breiten Westflügel, der dem Spiegelsaal in Versailles nachempfunden war, blieb er stehen.
„Das war es also“, sagte er und drehte sich um. Die Vasen, die kleinen Statuen, die Leuchter – all das war nicht mehr seins.
Kameraden, die ihn an den vielen Abenden im Offizierscasino besiegt hatten, würden sie hinaustragen, unter den mitleidigen Blicken des Personals.
Und was noch schlimmer war, die Bankiers, die ihm erst ermöglich hatten, durch ihre großzügigen Kredite auch außerhalb des Offizierscasinos zu spielen, zu bedeutend höherem Einsatz, die würde man zwar nicht sehen. Aber man würde sehen, wenn sie – fernab in Berlin – mit einem Federstrich sein Schicksal und das seiner Familie besiegelten.
Achim von Wernher betrachtete sich in einem der Spiegel der Spiegelwand.
„Das war es also“, sagte er noch einmal. „Und keine Hoffnung?“
Er wusste, dass es keine Hoffnung gab. Zwar hätte er seinen Schwiegervater bitten können, ihm eine gewisse Summe zu leihen, sein Bruder hätte ihm sicher auch geholfen, aber er hätte sein erbärmliches Scheitern eingestehen müssen. Und diese Blamage wollte er sich ersparen.
An seine Familie hatte er dabei nicht gedacht. Einmal nur kurz, als er sich sagte, es wäre für sie besser, nicht mit einem Bankrotteur leben zu müssen. Aber das war, wenn er ehrlich war, nicht sein wahrer Grund für den Schritt, den er für unausweichlich hielt.
Er sah aus einem der Fenster in der langen Westfront. Die Vorhänge waren nicht zugezogen. Man hatte einfach nicht daran gedacht und auch nicht damit gerechnet, dass so spät im Sommer die Temperaturen so ansteigen könnten, und so tauchte die frühe Abendsonne den Saal in ihr goldenes Licht.
So, genau so hatte er es sich vorgestellt, als er den Bauauftrag erteilt hatte. Dieses Licht, diesen Saal – es fehlte nur die gewohnte heitere Gesellschaft. Und wenn die großen Lüster entzündet wären, die Paare, die über das Parkett schwebten.
Seine Frau saß mit den Kindern im Park unter der alten Eiche, wie immer im Sommer.
Es war der Lieblingsplatz der Familie. Dort hatte er seiner Frau den Heiratsantrag gemacht. Dort hatte sie ihm erzählt, dass sie schwanger war. Dort hatten sie viele gemeinsame Stunden verbracht, sie hatte gestickt, er hatte seine Pfeife geraucht und dabei die „Königlich Privilegierte Berlinische Zeitung“ gelesen. Später, als die Kinder da waren, hatten sie unter dem Baum gespielt. Er hatte an einem der unteren Äste eine Schaukel befestigt.
Der Baum und sein Schatten waren fast ihr Sommerzimmer gewesen all die Jahre lang.
Und jetzt sollte alles vorbei sein.
Einen Moment noch wollte er sie die Ruhe genießen lassen.
Er drehte sich um, verließ den Saal und ging in das benachbarte Arbeitszimmer.
Es war nicht weniger prächtig ausgestattet, doch daran fand er jetzt kein Interesse mehr.
Er zog die oberste Schreibtischschublade auf und entnahm ihr ein in Filz eingeschlagenes Päckchen. Vorsichtig öffnete er die Schleife, mit der es zusammengebunden war, und breitete den Filz auseinander. In seiner Hand lag seine Duellpistole. Er hatte sie von seinem Vater geschenkt bekommen, gerade als er achtzehn Jahre alt geworden war.
„Geh nicht leichtfertig mit ihr um. Gebrauche sie nur, wenn es gar nicht anders geht“, hatte sein Vater gesagt.
Achim von Wernher hatte sich immer daran gehalten.
Jetzt ging es nicht anders.
4. Kapitel
Friedrichshagen, Anfang Juli 1913
Es fiel Luise von Wernher nicht leicht, sich auf die veränderten Lebensumstände einzustellen. Auf einmal saß sie da, allein mit drei Kindern, ohne Vermögen, ohne die gewohnten gesellschaftlichen Kontakte.
Natürlich schnitt man sie nicht, man schien besorgt, bot ihr Hilfe an, aber das geringste Angebot klang so großzügig, als wäre es unverschämt, es anzunehmen.
Lediglich den kleinen Hof eines Tagelöhners hatte ein befreundeter Anwalt retten können. Ein kleines Bauernhaus mit zwanzig Morgen Land war ihr und ihren drei Kindern geblieben.
Völlig unerfahren in der Landwirtschaft, ungeübt in körperlicher Arbeit stand sie vor der schier unlösbaren Aufgabe, sich und ihre Familie durchzubringen.
Hätte ihre Mutter nicht zu ihren Gunsten interveniert, hätte ihr Vater aus verletztem Stolz nichts unternommen, ihr zu helfen.
„Was bist du nur für ein Mensch“, hatte ihre Mutter getobt, „deine einzige Tochter und ihre Kinder sind in größter Not, und du tust nichts, nur weil Achim sich das Leben genommen hat! Wir nehmen sie hier auf. Und wenn du dich auf den Kopf stellst.“
Und als er noch etwas dagegen sagen wollt, fügte sie nur hinzu: „Und wenn es dir nicht passt, ziehen wir zu meinen Eltern!“
Damit war die Sache ausgestanden.
Zwei Wochen später kam der Möbelwagen aus Berlin.
Schon am Nachmittag wurden die Möbel und das Geschirr, das ganze bewegliche Hab und Gut, das Luise geblieben war, verladen.
Die Köchin hatte am Nachmittag einen Berg Bouletten gebraten und ihren köstlichen Kartoffelsalat gemacht, und so saßen Luise von Wernher, ihre Kinder, das Personal und die Möbelpacker sowie der Kutscher ein letztes Mal in der großen Küche beisammen. Die Frauen und Kinder tranken Limonade, die Männer Bier und zum Abschluss einen kleinen Schnaps. Aber obgleich das Essen wirklich jeden Geschmack getroffen hatte, war die Stimmung gedrückt. Jeder Versuch, sie aufzulockern, misslang.
Man wusste, es war ein Abschied für immer. Nicht nur von dem zauberhaften Anwesen, auch von der schönen Vergangenheit.
Luise schickte ihre Kinder früh zu Bett.
„Wir müssen morgen früh aufstehen“, sagte sie, „da solltet ihr ausgeschlafen sein.“
Und als sie protestieren wollten, hatte sie ein Leckerchen bereit.
„Ich habe“, begann sie und machte ihr spitzbübisches Gesicht, dem niemand in der Familie widerstehen konnte, „mit den Möbelmännern gesprochen“.
Sie machte eine Pause, um die Spannung zu steigern.
„Wenn ihr ausgeruht seid und auf der Fahrt nicht einschlaft, dann dürft ihr in dem Möbelwagen mitfahren.“
Diese Aussicht wirkte Wunder. Bevor man es überhaupt bemerkt hatte, waren die Kinder in ihren Zimmern verschwunden.
Ein letztes Mal ging Luise in die Kinderzimmer.
Da, wo bisher die Betten gestanden hatten, lagen nur die Matratzen auf dem Boden. Die Bettgestelle waren schon verladen.
‚Mein Gott’, dachte sie, als sie die Kinder sah. Natürlich wusste sie, dass sie nur so taten, als ob sie schliefen. Aber sie schien diesen kleinen Betrug zu glauben, gab jedem ihrer Kinder einen Gutenachtkuss, löschte das Licht und ging in ihr eigenes Schlafzimmer.
Lange stand sie am Fenster und sah in den Garten hinaus, der inzwischen im Dunkel lag.
Sie hatte Anweisung gegeben, die Allee zu beleuchten und unter der Kastanie eine Fackel zu entzünden. Sie warf ihr flackerndes Licht auf die Bank, auf den Stamm des Baumes, zauberte Figuren, sich ständig bewegend, ausgelassen tanzend. Paare, die sich trennten und sich wieder fanden und zwischen all den ausgelassenen Gästen sie, Luise und Achim.
„Schluss jetzt!“, befahl sie sich, und mit einem Mal war alles vorüber: Die Allee lag in trübem Licht, die Gartenfackel blakte, die Musik war nur der Wind.
Mit einem Ruck drehte sie sch um. Die Frau, die ihr im Spiegel gegenüber stand, sah traurig aus, müde auch, abgekämpft vielleicht, verzweifelt wohl eher nicht. Das wäre zuviel gesagt. Nein, verzweifelt war sie nicht wirklich. Leer, das traf es wohl besser. Während sie sich im Spiegel betrachtete, ohne wirkliches Interesse, legte sie die Kleidung ab.
Stück für Stück legte sie auf den einen noch verbliebenen Stuhl. Sie sah sich zu, wie sie das Kleid gerade zog, wie sie das Unterkleid glättete.
Sie wunderte sich, dass sie sich auf einmal so fremd war. Nichts konnte sie mit dem Bild, das sie im Spiegel sah, verbinden. Sie und ihr Spiegelbild hatten nichts gemein.
Sie schnitt eine Grimasse. Ihr Spiegelbild gab sie wieder. Aber sie spürte nichts.
Sie entkleidete sich weiter, machte sich nicht mehr die Mühe, alles ordentlich auf den Stuhl zu legen. Bis sie nackt vor dem Spiegel stand.
Sie war schön. Immer noch.
Warum sah man ihrem Körper die letzten Tage und Wochen nicht an?
Sie wandte sich von ihrem Spiegelbild ab und schlüpfte unter die Decke. Es dauerte nicht lange, und sie war eingeschlafen.
5. Kapitel
Dollien, 14. Juli 1914
Liebste Freundin!
Man sagt immer, wenn es einem gut geht, lässt man nichts von sich hören, und wenn man an dem Leben oder irgendwelchen Beschwernissen leidet, teilt man das gerne mit. Ich weiß nicht, wie das bei mir ist. Es geht mir nicht gut. Aber auch dass es mir schlecht geht, kann ich nicht mit Fug und Recht sagen. Ich wäre ungerecht.
Jetzt ist es mehr als ein Jahr her, dass wir Friedrichshagen verlassen haben und hier bei meinen Eltern in der Uckermark Asyl gefunden haben. Was ich nicht geglaubt habe, die Kinder sind hier in der ruhigen und beschaulichen Umgebung richtig aufgeblüht. Bettina und Clementine haben sich zu hübschen kleinen Damen entwickelt. Ich muss nur aufpassen, dass sie nicht zu kokett werden. Vor allem Clementine hat eine Art, die die jungen Männer reizen und sie selbst in Gefahr bringen könnte. Glücklicherweise gibt es hier nur wenig junge Männer, denn der kleine Ort in der Nähe ist zwar recht ansehnlich, aber weit ab von Berlin und Potsdam. Und die wenigen ledigen Männer, die es gibt, sind so wenig attraktiv, dass sie Clementine nicht gefährlich werden können.
Ludwig entwickelt sich nach anfänglichen Schwierigkeiten prächtig. Anfangs hat er sich mit seinem Großvater überhaupt nicht verstanden. Er spürte die Ablehnung meines Vaters gegen Achim. Aber inzwischen hat sich das geändert. Vater hat sich etwas zurückgenommen. Es scheint ihm jetzt vor allem um Ludwigs Wohl zu gehen. Er nimmt ihn mit auf die Felder, lässt ihn das Korn prüfen, lässt ihn die Ernte schätzen und die Tagelöhner und Helfer einteilen. Nur ganz selten muss er noch eingreifen, wenn Ludwig wie ein junges Fohlen zu ungestüm ist.
Aber, und das, liebste Freundin, macht mir Sorgen, er will nicht hier bleiben. Er will nicht von seines Großvaters Gnaden das Gut verwalten. Und Max von Walther, den jetzigen Verwalter, nicht von seinem Platz verdrängen.
„Lieber will ich unseren kleinen Hof bewirtschaften als dieses Gut. Dort bin ich mein eigener Herr“, hat er letztens gesagt. Und das hat mir, wie Du Dir denken kannst, im Innersten sehr wehgetan.
Noch etwas anderes beschäftigt mich sehr.
Du weißt, wir sind immer aus dem Raum geschickt worden, wenn die Erwachsenen, vor allem die Männer, politisiert haben.
Jetzt lässt sich das kaum noch machen. Ich bin inzwischen zu alt geworden und füge mich nicht mehr so einfach.
Seit einigen Tagen, ich spüre es ganz deutlich, hat sich etwas verändert. Ich habe meinen Vater gefragt, doch er hat nicht geantwortet. Früher hatte er immer gesagt: „Davon verstehst du sowieso nichts“, jetzt hat er nur geschwiegen.
Meine Mutter hat mir dann gesagt, es wäre etwas ganz Schlimmes passiert, man hätte den Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich in Sarajewo ermordet. Und es könnte durchaus Krieg geben.
Krieg! Stell Dir vor, Krieg!
Die Männer hier im Ort gebärden sich wie die Kinder. Schwenken Fahnen, singen vaterländische Lieder, treffen sich am Abend in der Wirtschaft und verteilen schon das Bärenfell, als hätten sie es gewonnen. Und mein Vater, den ich immer für so klug gehalten habe, ist in der ersten Linie. Wie gerne würde er losziehen.
„Es gibt keinen Zweifel an unserer Treue zu Österreich, und es darf und wird nie einen Zweifel geben! Auf die Treue!“, hat er gestern Abend auf einer Versammlung bei uns im Haus ausgerufen. Ich habe weggehen müssen, so schrecklich fand ich das.
Was denken diese Menschen, die so den Krieg herbeisehnen? Der Krieg erscheint ihnen wie ein Abenteuer, aus dem sie jederzeit nach Hause zurückkehren können. Arme Menschen! Ich wünsche uns allen, dass sie sich nicht irren.
Nun bin ich mir doch untreu geworden. Ich wollte Dich nicht belasten und habe es ganz sicher getan. Sei mir nicht bös! Noch können wir hoffen, dass alle Sorgen umsonst sind, dass das nur die überspannten Gedanken einer jungen Witwe waren.
Nimm Deine Kinder in den Arm und küsse sie. Umarme vor allem Deinen Mann! Halte ihn fest, und bete zu Gott, dass Du ihn immer behältst.
Deine Luise
6. Kapitel
Dollien, August 1914
Den ganzen Nachmittag war Luise mit den Kindern an einem der vielen kleinen Seen gewesen, die zu dem Gut gehörten. Sie liebte diesen Platz, eine Wiese am Rande eines kleinen Kiefernwaldes. Wie eine Halbinsel streckte sich diese Badestelle in das klare Wasser.
Vor Jahren, als sie noch Kinder waren, hatte ihr Vater hier eine Badehütte und einen Bootssteg bauen lassen, hatte dann aber kaum Zeit gefunden, mit seiner Familie hier die Sommernachmittage zu verbringen. Mag auch sein, dass ihn nur die Ruhe langweilte. Luise sah ihn noch vor sich, wie er steif und schweigend auf der Decke saß, vollkommen bekleidet, einen Strohhut auf dem Kopf. Ein schreiend stiller Vorwurf.
Irgendwann hatte es ihrer Mutter gereicht.
„Du musst nicht mitkommen“, hatte sie gesagt, „du verdirbst uns nur den Spaß.“
Er war dankbar – und sie genossen von nun an die Nachmittage allein
***
Als Luise die Halle betrat, fiel ihr sofort die ungewohnte Betriebsamkeit auf. Die Köchin, die um diese Zeit grundsätzlich in der Küche zu tun hatte, und sich bisher immer erfolgreich dagegen gewehrt hatte, irgendwelche Aufgaben außerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches zu übernehmen, kam von der Galerie geeilt, verschwand im Arbeitszimmer und lief gleich wieder nach oben.
Hans, der erste Knecht, hastete ins Arbeitszimmer, empfing irgendeinen Befehl und verschwand in der Remise.
„Was um alles in der Welt ist hier los?“, wandte sie sich an die erste, die sie anhalten konnte.
„Krieg! Wir haben Krieg!“, rief die alte Wirtschafterin und verschwand im Wirtschaftsraum.
Langsam ging Luise durch die Halle und trat in den Salon. Auf der gegenüberliegenden Seite stand ihre Mutter und sah aus dem Fenster. Sie schien sie nicht bemerkt zu haben, jedenfalls sagte sie nichts und sah sich auch nicht um.
Endlos lange schien sie so zu stehen, völlig erstarrt, die Arme an den Körper gepresst, die Hände zu Fäusten geballt.
Luise durchzuckte ein Gedanke, der sie erschrecken ließ. Zum ersten Mal nach Achims Tod bedauerte sie die Frauen, deren Männer noch am Leben waren.
„Muss Vater?“ Sie war zu ihrer Mutter getreten.
„Nein, noch nicht. Er muss sich nur in Bereitschaft halten. Aber deine Brüder, alle drei.“
Es war erstaunlich. Obgleich die ganze Welt mit Deutschland im Krieg lag, änderte sich in Dollien nichts. Zuerst hatten die Kriegserklärungen Deutschlands die Straßen gefüllt, hatten den Kriegerverein mobilisiert, hatten ein Meer von schwarz-weiß-roten Fahnen an die Häuser gezaubert, die die Schäbigkeit der meisten Fassaden mit ihrer vaterländischen Euphorie übertünchten.
Jetzt war man Deutscher.
Mehr noch, man war Nibelunge.
Glücklich schätzte sich der, der in dieser Zeit lebte, vor allem der Mann, der das Glück hatte, für Kaiser und Vaterland in den Krieg ziehen zu dürfen.
Luise sah diese Kinder.
Kinder waren es in ihren Augen, die sich auf dem Marktplatz versammelten und darauf warteten, nach Friedrichswalde gefahren zu werden, um dann in den Zug nach Potsdam oder Berlin zu steigen.
An den Haaren hätte sie sie von den Wagen wegziehen mögen, sie ohrfeigen, bis sie ganz kleinlaut zu ihren Müttern zurückkehren würden.
Sie wusste, sie könnte es nicht. Und wenn sie es versuchen würde, sie anschreien würde, dass der Krieg kein Kinderspiel wäre, dass sie alle sterben würden, nein, krepieren würden, den Mund voll gestopft nicht mit französischer Ente, sondern französischer Erde, Dreck und Schlamm, es würde nichts nützen.
Schon sangen sie, siegestrunken, ihre vaterländischen Lieder.
Wo hatten sie die so schnell gelernt? Luise konnte sich nicht erinnern, von ihren Kindern gehört zu haben, dass man sie in der Schule eingeübt hatte. Text und Melodie.
Und immer wieder schallte es: „Weihnachten sehen wir uns wieder!“
Bis der Apotheker und Leiter des Männergesangsvereins nach vorne trat, die Sänger Aufstellung nahmen und das schreckliche Lied „Heil dir im Siegerkranz“ intonierten.
Was bringt erwachsene Männer nur dazu, solchen Schwachsinn zu singen? fragte sie sich. Aber da sah sie die leuchtenden Gesichter der Sänger, die strahlenden Augen der jungen Männer auf ihren Karren, die sie – sie stockte, wollte den Gedanken verdrängen, vergeblich, er kehrte immer wieder – zum Schafott bringen sollten.
Weg, weg von hier!
Sie floh von diesem Platz, weg von dieser grauenhaften Fröhlichkeit.
Am Gasthaus „Unter der Linde“ hatte sie ihr Pferd festgebunden. Eilig band sie es los, bestieg den Landauer und fuhr durch die weiten Felder zurück zum Gutshaus.
Das Korn war schon fast reif, goldgelb hob es sich vom blauen Himmel ab, an dem sich nur einige Schönwetterwolken aufplusterten.
Bald würde man ernten. Und das war auch gut so. Da kam man nicht zum Nachdenken.
Man durfte nicht nachdenken. Oder man würde verrückt werden.
Luise unterließ es, ihren Eltern von ihren Erlebnissen am Nachmittag zu erzählen. Sie hätten sie nicht verstanden, und es hätte nur Streit gegeben.
Warum sollte man den auch noch heraufbeschwören?
***
Es hatte sich so ergeben, ganz zufällig und unbemerkt von allen.
Ohne dass es eine Heimlichkeit gegeben hätte.
Es geschah so unauffällig wie eine Stunde verstreicht, wenn man nicht in Eile ist, oder das Korn reif wird und man nicht darauf wartet, weil das Wetter nicht umzuschlagen droht.
Wenn man es merkt, ist es zu spät. Man kann nicht mehr eingreifen, kann sich nur mit den Gegebenheiten abfinden, versuchen, das Beste daraus zu machen und es zu genießen.
Die letzten Tage hatten gereicht, das Korn reifen zu lassen. Kerzengerade stand es auf dem Halm. Eine goldene Pracht, so weit das Auge reichte. Kein Hagelschauer war niedergegangen, keine Bö hineingefahren.
Es war Zeit zum Mähen.
Es fehlte nur die Anweisung des Barons. Und der war jetzt ausgerechnet in Berlin. Sein Verwalter hatte alle Vollmachten, und er hatte bisher in einem solchen Falle immer zur Zufriedenheit des Barons gehandelt, doch diesmal zögerte er.
Er ging ins Herrenhaus und fragte nach Ludwig.
„Wollen wir ernten, was meinen Sie?“, fragte er, als Ludwig vor ihm stand.
Ludwig sah ihn erstaunt an. Max von Walther hatte ihn immer respektiert und ihm das Gefühl gegeben, er sei gleichberechtigt, doch dass er ihn fragte, war noch nicht vorgekommen. Natürlich würde er doch tun, was er für richtig hielt, unabhängig von Ludwigs Meinung, schließlich hatte er die Erfahrung – und trug er die Verantwortung, aber es schmeichelte doch sehr.
„Ich denke, ja. Oder?“, antwortete Ludwig. Und damit war beschlossen, übermorgen würde geerntet werden.
„Warum erst übermorgen?“, fragte Clementine.
Sie hatte das Gespräch ihres Bruders mit Max von Walther mitgehört und sich gewundert, dass Männer so eine einfache Sache wie Korn Mähen so kompliziert machen konnten. Was war schon dabei, ein paar Halme abzusäbeln?
Sie nahm sich vor, das Max zu fragen.
Sie spürte, wie ihr das Blut in den Kopf schoss. Wie kam sie dazu, den Verwalter einfach Max zu nennen? Sie war keineswegs vertraut mit ihm. Hatte immer die nötige Distanz gewahrt, die gleiche, die er auch wahrte. Als hätten sie sich abgesprochen: bis hier und nicht weiter! Mal ein Scherz, vielleicht ein koketter Blick als Dank für seine Hilfe beim Satteln des Pferdes, wie zufällig eingefangen. Vielleicht wäre sie auch mit weniger Hilfestellung in den Sattel gekommen. Aber sie genoss diese Hilfe.
Es war doch nichts dabei.
Sie war nicht verliebt. Da war sie sich ganz sicher.
Max – sie hatte einfach für sich beschlossen, von Walther nur noch beim Vornamen zu nennen – war schließlich Verwalter bei ihrem Großvater, mehr nicht.
Aber er sah doch verdammt gut aus. Vor allem seine Augen. Stundenlang könnte sie in diese Augen sehen. Wenn er ihren Blick auffing, wurde sie immer ganz verlegen. Das war schon sehr früh geschehen, nicht erst jetzt. Aber jetzt sah sie ihm öfter in die Augen, heimlich. Und wenn er es merkte, lachte sie und sagte: „Sie haben da einen braunen Punkt.“
Wenn er es nicht schon wusste, inzwischen wusste er es ganz sicher. So oft hatte er es gehört. Aber er sagte es nicht. Er ließ ihr ihre kleine Schwärmerei.
Max und Ludwig waren gemeinsam aufgebrochen, um die Felder, die zu mähen waren, abzureiten, um die Erntehelfer einzuteilen.
Bisher hatten sie den Sommerweg am Rande der Chaussee gewählt, doch jetzt mussten sie sich trennen. Links und rechts ging es auf Sandwegen in die endlosen Kornfelder, die nur hier und dort durch einige kleinere Baumgruppen unterbrochen wurden.
Ein paar Stunden würden sie in der Sommernachmittagshitze aushalten müssen, bis sie gegen Abend im Herrenhaus ankommen würden.
Während Ludwig die Felder östlich der Straße übernommen hatte, lenkte Max von Walther sein Pferd auf den westlichen Teil des Gutes. Hier lagen die Felder nicht alle beisammen, waren durch Bäche und keine Waldstreifen getrennt. Ludwig war noch nicht hier gewesen, hier musste sich jemand umsehen, der sich auskannte.
Vor Max lag der Ellenbogen, dieser schmale Heidegürtel, bewachsen mit Birken, Büschen und gedrungenen Kiefern. Und natürlich Heidekraut und Wacholder. Nur drei- oder viermal im Jahr kam er in diese abgelegene Gegend. Dann machte er, wenn es die Arbeit erlaubte, einen Abstecher zu dem kleinen See. Weiher, wäre eigentlich passender. Er hatte nicht einmal einen Namen, war auf keiner Karte verzeichnet. Aber er hatte einen ungeheuren Reiz. Das Wasser war dunkel und doch kristallklar. In allen Farben schillernde Libellen standen über den Seerosen, die fast die Hälfte des Sees bedeckten. Schossen durch die Luft und blieben wieder ruckartig stehen, um sich gleich wieder hochzuschrauben oder zu senken.
Diese Tiere hatten ihn schon immer fasziniert. Das müssten Menschen können, dachte er. Ein Wunschtraum der Menschheit würde in Erfüllung gehen.
Aber es würde wohl ein Wunschtraum bleiben.
Beide hatten nicht damit gerechnet, sich hier zu begegnen, und doch waren sie nicht erstaunt oder gar erschrocken, wie es sich zumindest für Clementine gehört hätte. Kein „Uch!“, kein hektisches Zusammenraffen des Kleides.
Sie saß auf dem schmalen Sandstreifen am Rande des Sees, hatte die Beine angezogen und hielt ihre Knie umklammert. Den Kopf hatte sie auf die Knie gelegt und sah wie selbstvergessen über die Wasserfläche.
Als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt, trat Max näher, zog seinen Hut, der ihn bisher vor der Sonne geschützt hatte, und blieb neben ihr stehen.
„Darf ich?“, fragte er und setzte sich, als sie nickte.
„Das ist nicht ungefährlich, ohne Begleitung hierher zu reiten“, versuchte er eine Unterhaltung, und als sie nicht reagierte, „man kann sich leicht verirren. Hierher findet man leicht, aber zurück? Da sieht alles gleich aus.“
Als sie immer noch nicht reagierte, sondern ihn nur aus seltsam traurigen, fast verlorenen Augen ansah, hätte er sich schlagen können. Warum musste er so plump sein?
„Verzeihen Sie, ich war nicht ganz anwesend.“
Sie machte eine Pause und blickte wieder über den See.
„Wissen Sie, ich mache mir Vorwürfe. Uns geht es gut, wir haben alles, was wir brauchen, vielleicht auch etwas mehr. Und unsere Männer sind im Krieg. Glauben Sie, dass sie glücklich sind, wenn sie für ihren Kaiser und das Reich krepieren?
Glauben Sie, dass sie ‚Heil dir im Siegerkranz’ singen, wenn sie von einer Granate zerrissen werden? Glauben Sie, dass sie ihren obersten Kriegsherrn preisen werden, wenn ihnen ein Bein amputiert wird – oder zwei?“
Von Walther wollte etwas sagen, irgendetwas, das sie beruhigen, auf andere Gedanken bringen könnte. Ihm fiel nichts ein. Sie hatte ja Recht. Auch er konnte diese Begeisterung nicht verstehen, doch deshalb machte er sich keine Vorwürfe. Er hatte nicht den Krieg erklärt, seinen Ausbruch nicht gefeiert. Ihn traf keine Schuld. Wie viel weniger erst dieses junge Mädchen!
„Erinnern Sie sich an den Christian, den Sohn von der Frau Wolf? Er war einer der Lautesten. Zu Fuß wäre er an die Front gelaufen. Ließ sich nicht halten, so sehr ihn seine Mutter auch bat. Beschworen haben wir ihn. Er sei verantwortlich für die Familie, jetzt wo sein Vater krank sei. Wissen Sie, was er geantwortet hat? Er sei verantwortlich für Deutschland. – Und nun“, flüsterte sie, „ist er tot.“
Max von Walther machte gar nicht den Versuch, Clementine abzulenken oder gar aufzuheitern, und so ritten die beiden schweigend nebeneinander her. „Entschuldigen Sie, ich muss nur kurz den Weizen prüfen“, unterbrach von Walther das Schweigen, schwang sich vom Pferd, griff ein paar Ähren und zerrieb sie in den Händen. Er betrachtete den Inhalt, probierte einige Körner und warf die restlichen auf das Feld.
Das machte er noch einige Male, bis sie wieder die Chaussee erreicht hatten.
„Bitte, sagen Sie nichts meiner Mutter“, bat Clementine, als sie die Pferde versorgten.
***
Fünf Tage lag die Ernte zurück, fünf Tage mit Sonnenschein, wolkenlosem Himmel, Hitze. Die Luft flirrte und war immer noch voller Kornstaub.
Es war wie in jedem Jahr. Die Bauern waren entlassen und brachten ihre eigene Ernte ein.
Nur die Helfer, die Max von Walther angeworben hatte, waren noch auf dem Gut. Hinten, hinter der großen Scheune war ihre Unterkunft, ein eingeschossiges Fachwerkhaus, das zwei Schlafsäle mit je 12 Betten, zwei Waschräume und einen großen Aufenthaltsraum beherbergte. Da die Arbeiter aus der Gutsküche versorgt wurden, hatte man auf eine Kochstelle im Haus verzichtet, schon aus Feuerschutzgründen. Aus dem ursprünglich als Küche vorgesehenen Raum hatte man die gemauerten Herde und Spülbecken entfernt und nutzte ihn jetzt als Lager für Strohsäcke, stapelte Bettgestelle und brachte alles unter, was in der Unterkunft irgendwann mal gebraucht werden könnte.
Selbst ein kleines Krankenzimmer mit zwei Betten, einem einfachen Behandlungsstuhl, einem runden Waschtisch und einem Medizinschrank an der Wand war vorhanden. Er wurde selten gebraucht, aber der Baron war stolz darauf, ihn eingerichtet zu haben.
„Man kann nie wissen“, hatte er gesagt, „irgendwann passiert was. Der Arzt kommt schneller hierher als der Kranke zum Arzt.“
Mit schnellen Schritten eilte Bettina von Wernher über den Gutshof zur Unterkunft der Erntehelfer.
„Wo ist er?“, rief sie schon vom Eingang, als sie die Tür geöffnet hatte.
Die Männer zeigten auf den zweiten Schlafsaal und machten den Weg frei. Dort saß einer von ihnen, kreidebleich und hielt sich sein Bein.
„Lassen Sie mal los“, bat sie und zog vorsichtig das Hosenbein nach oben.
Der Mann hatte sich eine scheußliche Wunde am Schienbein zugezogen. Er hatte seine Sense gedengelt, und beim Prüfen hatte er nicht aufgepasst.
„Sie bleiben erst mal hier“, verfügte sie und versorgte die Wunde notdürftig.
„Das muss sich ein Arzt ansehen.“
Während sie auf den Arzt warteten, entschied sie: Sie würde Krankenschwester werden. Und bis sie alt genug für die Ausbildung wäre, würde sie bei Dr. Hellmann lernen.
Wenn er sie nähme.
7. Kapitel
Dollien, 19. Dezember 1914
Liebste Freundin!
Nun nähert sich das erste Jahr dieses entsetzlichen Krieges seinem Ende. Obgleich weit ab von der Front, gewinnt er doch immer mehr Einfluss auf unser Leben. Wenn man durch die Königstraße geht, sieht man immer weniger Männer in ihren Geschäften. Die Frauen, die zuvor es abgelehnt hatten, hinter der Ladentheke zu stehen und ihre Kundschaft zu bedienen, haben sich mit ihrem Schicksal arrangieren müssen. Aber weißt Du, was das Fürchterlichste ist, sie hadern mit ihrem Schicksal, weil sie diese Arbeit verrichten müssen. Nicht weil ihre Männer an der Front sind.
Front. - Man gebraucht dieses Wort so leicht.
Ich habe mir nie vorstellen können, was es bedeutet. Erst als mir zwei junge Bauernsöhne aus unseren Dörfern berichtet haben, die bei Langemarck schwer verwundet und vor wenigen Tagen auf Genesungsurlaub nach Hause geschickt worden waren, habe ich angefangen zu ahnen. Ich glaube, ich werde Ludwig mal auf einen Besuch mitnehmen. Auf einmal redet er immer öfter davon, dass auch er sich freiwillig melden will. Alles, was er früher gesagt hatte, zählt nicht mehr. Er soll sich anhören, was diese jungen Krüppel – Männer kann man wirklich nicht mehr sagen – zu erzählen haben. Und er soll sie sehen!
Mein Gott, wenn ich daran denke, wie begeistert sie noch vor wenigen Wochen waren!
Ich sagte es ihnen. Weißt Du, was sie antworteten?
„Wir waren dumm. Angestachelt von unserem Lehrer. Wir wussten doch gar nicht, worum es ging und was Krieg bedeutet. Wir sollen ‚Deutschland, Deutschland über alles’ bei unserem Angriff gesungen haben? Uns war nicht nach Singen zumute. Gestürmt sollen wir sein? Wir hatten nur die Wahl, von vorne vom Feind oder von hinten von unseren Offizieren erschossen zu werden. Da war der Feind noch besser. Den konnte man wenigstens manchmal sehen.“
Bettina hat sich entschieden. Sie ist nach Berlin gegangen. Sie will Krankenschwester werden.
„Überall an der Front werden in den Lazaretts Krankenschwestern gebraucht. Ich will helfen, dass ausgebildete Schwestern für die Front frei werden“, hat sie gesagt, hat ihren Koffer gepackt und sich von Walther zum Zug nach Berlin bringen lassen. Ich habe noch nichts von ihr gehört. Sicher wird die Ausbildung anstrengend sein, und sie wird keine Zeit finden, ihrer Mutter zu schreiben. Ich will ihr Schweigen als gutes Zeichen nehmen.
Clementine geht es, wenn ich es richtig beobachte, am besten von uns allen. Unsere kleine Revolutionärin, die schon lange den ganzen Adel abschaffen wollte, hat sich verliebt. Sie verbirgt es recht geschickt, aber ich sehe die kleinen Anzeichen, die heimlichen Blicke, die sie Max von Walther bei Tisch zuwirft. Und wenn sie ihn bittet, ihr irgendetwas zu erklären, das sie bisher nie interessiert hat, fragt sie immer wieder nach. Aber nur so oft, dass er nicht denken müsste, sie wäre dumm. Das hat sie sehr genau im Gespür.
Letztens hat Max von Walther meinem Vater gegenüber eine Andeutung gemacht, wollte wohl erst das Terrain abklären. Der alte Herr hat sich erstaunlicherweise sehr diplomatisch verhalten. Max müsse die Mutter – und vor allem Clementine selbst fragen.
Ich denke mal, er wird es Weihnachten oder Silvester tun.
Die Zeit könnte günstiger sein. Aber gerade in dieser Zeit braucht man Halt.
Ich wünsche Dir und Deinen Lieben alles Gute und grüße Dich ganz herzlich,
Deine
Luise
8. Kapitel
Dollien, 7. Januar 1915
Liebste Freundin!Nun ist alles viel schneller gegangen, als wir alle erwartet hatten. Clementine hat Weihnachten geheiratet, ohne Verlobungszeit, gleich so. Die beiden hatten das vorher abgesprochen, dass sie auf eine Verlobung verzichten wollten.
„Wir wollen heiraten“, hatte Clementine gesagt, „was sollen wir Zeit mit der Verlobung verlieren? Max hat seinen Stellungsbefehl bekommen. Da haben wir keine Zeit zu verlieren.“
Und sie hatte natürlich Recht. Jetzt in diesen Zeiten zählt manchmal jeder Tag. Ich habe ihr zu Bedenken gegeben, sie könne ganz schnell Witwe werden.
Sie hat mich nur ganz traurig angesehen.
„Dann ist es immer noch besser, ich war wenigstens kurze Zeit seine Frau als gar nicht.“
Wie ich sie verstehe!
Wir hatten – wie Du Dir denken kannst – keine ausgelassene Feier, aber würdig und schön war sie doch. Nur Maxens Eltern, einige wenige Nachbarn und einige Honoratioren aus der Stadt waren geladen. Der Pastor hatte angeregt, am Weihnachtstag die Trauung direkt vor dem Gottesdienst vorzunehmen, und natürlich haben wir dankbar angenommen. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Sogar in den Gängen und auf der Empore standen die Leute. Fast alle unsere Bauern waren gekommen, und die Erntehelfer hatten eine Abordnung geschickt. Das hat mich am meisten gefreut.
Vater sagte: „Das machen die nur, weil sie abhängig von uns sind“.
Aber das glaube ich nicht. Ich habe ihre Gesichter gesehen. So sieht nicht jemand aus, der nur aus Pflichtgefühl an so einer Feier teilnimmt.
Wer mir gar nicht mehr gefällt, ist Ludwig. Jetzt, wo Max im Krieg ist, nimmt er die Stelle des Verwalters ein. Und das ist nicht gut. Er ist zu jung dafür. Mag sein, dass er ein guter Landwirt ist und beurteilen kann, wann was zu machen ist. Aber ihm fehlt das Menschliche. Er sieht nur, was gut für das Gut ist. Die Menschen interessieren ihn nicht.
Bei uns war es ungeschriebenes Gesetz, dass die Erntehelfer bis in den April blieben. Arbeit hatten sie genug. Erst waren sie mit Dreschen beschäftigt, dann haben sie Holz gemacht und schließlich Zäune repariert. Nach der Saat wurden sie dann entlassen. Aber den ganzen Winter hatten sie ein Dach über dem Kopf und wurden versorgt.
Und was hat Ludwig gemacht?
Mehr als die Hälfte hat er rausgesetzt, jetzt mitten im Winter.