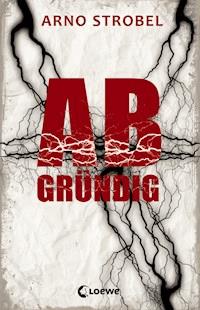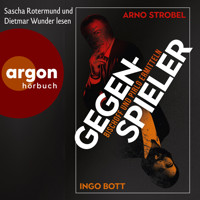8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: SPY
- Sprache: Deutsch
Ein Geheimagent macht keinen Urlaub Endlich Ferien. Drei Wochen lang keine gefährlichen Abenteuer, keine Sprünge, keine Action, sondern gemütliches Segeln vor der Küste der Algarve. Aber schon in Lissabon werden Nick und sein Vater Zeugen einer Entführung. Später bei einem Törn Richtung Madeira treffen sie auf eine Gruppe von Umweltaktivisten, die merkwürdige radioaktive Strahlen gemessen haben. Und schließlich verschwindet ein ganzes Kreuzfahrtschiff für 15 Minuten von der Wasseroberfläche. Welcher Geheimdienst hat da wohl seine Finger im Spiel? Auch Band 5 der Abenteuer-Reihe von Bestsellerautor Arno Strobel und Nina Scheweling bietet turboschnelle Action und ist das ideale Lesefutter für Jungen und Mädchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
Prolog
Kapitel 1 – Ein stahlblauer Himmel …
Kapitel 2 – Nick warf einen …
Kapitel 3 – Taberna do Tubarão …
Kapitel 4 – Als der Kellner …
Kapitel 5 – Fassungslos starrte Nick …
Kapitel 6 – Das Segelboot glitt …
Kapitel 7 – Die Frau steuerte …
Kapitel 8 – Nick schüttete schwungvoll …
Kapitel 9 – Marta Gutierrez fragte …
Kapitel 10 – Das Taxi bog …
Kapitel 11 – Das Büfett befand …
Kapitel 12 – Nick schreckte hoch …
Kapitel 13 – Dein Besuch ist …
Kapitel 14 – Nicks Verstand weigerte …
Kapitel 15 – Allendes Haus befand …
Kapitel 16 – Nick lieh sich …
Kapitel 17 – Sie knieten vor …
Kapitel 18 – Um möglichst schnell …
Kapitel 19 – SCANNEN donnerte es …
Kapitel 20 – Können wir auf …
Kapitel 21 – Die nächste Bushaltestelle …
Kapitel 22 – Hastig riss Becca …
Kapitel 23 – Er trat hinaus …
Kapitel 24 – Der Duft frisch …
Kapitel 25 – Nick hatte Glück …
Kapitel 26 – Nick blieb erst …
Kapitel 27 – Bruno, ich möchte …
Kapitel 28 – Nick stapfte durch …
Kapitel 29 – Wie vom Blitz …
Kapitel 30 – Wenn ich dein …
Kapitel 31 – Ohne wen fragte …
Kapitel 32 – Nick sah aus …
Kapitel 33 – Nick lief den …
Kapitel 34 – SPY an RENEGADE …
Kapitel 35 – Nick saß auf …
Epilog
PROLOG
Sie tariert ihre Weste ein wenig nach, während ihr Blick über den steinigen Untergrund streift. Die unendlich vielen kleinen Höhlen und Vertiefungen bieten optimale Versteckmöglichkeiten für Kleinfische, Seeigel, Garnelen und Krabben. Um diese Jahreszeit kann man hier durchaus auch großen Rochen begegnen, das weiß sie, aber es sind weder die kleinen noch die großen majestätischen Fische, wonach sie sucht.
Ein Schwall Luftblasen trudelt um sie herum nach oben und nimmt ihr für einen Moment die Sicht. Sie stammen von Juan, der zwei Meter unter ihr eine größere dunkle Vertiefung im Fels untersucht hat und nun kopfschüttelnd zu ihr heraufblickt.
Sie nickt und greift an ihren Tauchgürtel, an dem neben den kleinen Bleigewichten drei Probenfläschchen befestigt sind, zieht das hinterste hervor und verschließt es mit dem seitlich an einem Faden hängenden Deckel, womit das darin enthaltene Wasser nicht mehr entweichen kann. Sie betrachtet die fette 3, die mit einem schwarzen Stift aufgemalt ist, und steckt das Fläschchen dann wieder in den Gürtel.
Ein Blick auf das Manometer zeigt ihr, dass es Zeit wird, den Tauchgang abzubrechen. Sie befinden sich seit einer halben Stunde in etwa dreißig Metern Tiefe, was bedeutet, dass sie vor dem Auftauchen einen etwa zehnminütigen Dekompressionsstopp einlegen müssen.
Mit einigen festen Flossenschlägen ist sie neben Juan, tippt ihm auf die Schulter und deutet nach oben, woraufhin Juan verstehend nickt und ebenfalls einen Blick auf sein Manometer wirft.
Eine Viertelstunde später zieht sie sich das Atemgerät aus dem Mund und winkt zum Boot hinüber, das sich kurz darauf in Bewegung setzt und auf sie zuhält.
»Ich kapier das nicht!«, ruft sie Juan zu, der neben ihr Wasser tritt, und spuckt prustend Wasser aus. »Irgendwo da unten muss doch was sein.«
»Ich weiß nicht …«, entgegnet Juan. »Wenn da wirklich Fässer verklappt worden wären, dann hätten wir was finden müssen.«
»Nicht unbedingt. Aber wenn wir gleich die Werte von da unten sehen, wissen wir mehr.«
Nachdem sie über die schmale Leiter an Bord geklettert sind, schaut Marco sie fragend an. »Und?«
Sie schüttelt den Kopf. »Nichts. Hilf mir mal.«
Marco hilft erst ihr und dann Juan, die Ausrüstungen auszuziehen, und bringt die Flaschen in die Ausrüstungskammer, während Marta die Wasserproben vom Gürtel löst und ihren Nassanzug über ein Seil hängt.
Als Marco zurückkommt, bringt er einen kleinen Geigerzähler mit und hält ihn Marta entgegen.
»Danke«, sagt sie und ergreift das Gerät. Nachdem sie die Probefläschchen aufgeschraubt hat, testet sie wortlos nacheinander ihren Inhalt. »Leicht erhöhte Werte, genau wie an der Oberfläche.«
»Also wohl keine radioaktiven Fässer«, bemerkt Marco.
»Nein, wohl nicht.« Marta legt den Geigerzähler zur Seite und blickt über die Reling zu der kleinen Hügelgruppe der wilden Inseln, die sich am Horizont abzeichnen.
1
Ein stahlblauer Himmel spannte sich bis zum Horizont. Kein Wölkchen war zu sehen, und das Sonnenlicht brach sich glitzernd auf den Wellen. Nick verschränkte die Hände hinter dem Kopf, schloss die Augen und ließ sich vom sanften Schaukeln des Bootes einlullen. Eine laue Brise streifte sein Gesicht. Irgendwo über ihm kreischten ein paar Möwen, und ab und an brachen sich Wellen mit einem leisen Platschen am Bug. Darüber hinaus herrschte Stille. Vollkommene, friedliche, ungestörte Stille.
Automatisch rechnete Nick damit, Brunos Stimme in seinem Ohr zu hören. Sein CBPI hatte ein Talent dafür, Momente der Entspannung durch sein Geplapper zunichtezumachen. Nick vermutete darin einen Nebeneffekt von Brunos Emotionschip – irgendjemand musste ihn so programmiert haben, dass er längeres Schweigen als unangenehm klassifizierte. Doch der Einzige, der die Ruhe zu stören vermochte, war sein Vater, der am anderen Ende des Segelbootes saß und in einen knapp tausend Seiten langen historischen Roman vertieft war.
Ben und Nick hatten vereinbart, ihre Computer Based Personal Interfaces während ihres Urlaubs auf Standby zu schalten, und bisher bereute Nick diese Entscheidung keine Sekunde.
Er warf einen Blick auf das GPS-Gerät, kontrollierte ihren Kurs und bewegte das Steuerrad um zwei Grad Richtung Backbord. Sein Vater schaute kurz von seinem Buch auf. Als Nick einen Daumen in die Höhe reckte, lächelte Ben und versank wieder in den Schlachten und Ränkespielen des mittelalterlichen Englands.
Entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit, in ihrem Urlaub entlegene Länder zu besuchen oder waghalsigen Hobbys nachzugehen, hatten sie sich in diesem Sommer erstaunlich schnell darauf geeinigt, nichts zu tun. Sie würden zwei Wochen lang an der Küste Portugals entlangsegeln, schwimmen, in der Sonne liegen und sich durch einen beachtlichen Stapel aus Büchern und Comics arbeiten. Auch diese Entscheidung hatte Nick noch nicht bereut. Er hielt die Nase in den Wind und sog die salzige Meeresluft ein. Den ganzen Tag faulenzen, lesen und Musik hören. Sich ab und zu im Wasser abkühlen. Sonst nichts. Er lächelte zufrieden. Das hatte er sich verdient.
Zwei Stunden später erreichten sie Lissabon. Sie wollten einige Tage in der portugiesischen Hauptstadt verbringen, ihre Vorräte auffüllen und die Stadt als Ausgangspunkt für Tagesausflüge zu abgelegenen Tauchspots und einsamen Buchten nutzen, bevor sie weiter an der Küste hinauf bis nach Porto segelten. Geschickt lenkte Nick das Boot in die Flussmündung des Tejo, und kurz darauf fuhren sie unter der riesigen »Brücke des 25. April« hindurch, die Nick stark an die Golden Gate Bridge in San Francisco erinnerte.
Ben hatte sich neben ihn ans Steuer gestellt und ließ den Blick gedankenversunken über die roten Ziegeldächer schweifen, die sich von der Bucht bis hinauf in die umliegenden Hügel erstreckten. »Lissabon ist eine wunderschöne Stadt«, sagte er. »Sie wird dir gefallen.«
»Du warst schon einmal hier?«, fragte Nick überrascht. »Das wusste ich gar nicht.«
»Ja, vor ein paar Jahren. Leider hatte ich kaum Zeit für Sightseeing, diesmal muss ich unbedingt eine Tour mit einem Tuk Tuk machen.«
»Du meinst diese kleinen Autorikschas? Ist das nicht typischer Touri-Kram?«
»Stimmt«, bestätigte Ben und lächelte verschmitzt. »Das sind wir ja schließlich auch: typische Touris. Oder nicht?«
Nick erwiderte das Lächeln. Dann konzentrierte er sich wieder auf den Bootsverkehr, der deutlich zunahm, je näher sie der Stadt kamen. Frachtschiffe, Segelboote und Jachten befuhren den breiten Fluss, und an einem Kreuzfahrtterminal manövrierte gerade ein riesiges Schiff an die Anlegestelle.
»Warum warst du damals in Lissabon?«, fragte er, während er nach dem Jachthafen Ausschau hielt, an dem sie anlegen wollten. Es gab unzählige kleinere Häfen entlang des Tejo, und sie hatten sich für einen in Innenstadtnähe entschieden, um keine unnötige Zeit mit Bus- oder Taxifahrten zu verschwenden. »Hattest du einen Einsatz?«
Ben nickte. »Es ging um internationalen Waffenschmuggel im ganz großen Stil. Wir hatten die Hintermänner ausfindig gemacht, konnten ihnen aber nichts nachweisen. Die Sache hat ziemlich hohe Wellen geschlagen, deswegen haben wir die Operation als diplomatische Krise zwischen Portugal und dem Mittleren Osten getarnt. Ich bin als Unterhändler aufgetreten, der angeblich zwischen den beiden Parteien vermittelt hat.«
»Hast du sie erwischt? Die Hintermänner?«
»Natürlich. Und das Handelsembargo habe ich ebenfalls verhindert.«
»Das Handelsembargo, das es offiziell nie gegeben hat.«
»Das wusste ja niemand«, erwiderte Ben ungerührt, musste dann aber doch lächeln.
Nick dachte an die Jahre zurück, in denen auch er seinen Vater für einen hochrangigen Diplomaten gehalten hatte, der ununterbrochen in der Welt umherreiste und kaum Zeit mit seinem Sohn verbringen konnte. Völlig unvorstellbar, dass die Diplomatentätigkeit nur als Tarnung diente und Ben in Wahrheit als Agent des BND unterwegs war. Zum Glück hatte sich sein Vater nun aus dem aktiven Dienst zurückgezogen und einen Job als Lehrer an der Schule angenommen, wo Nick zum Junior-Agenten ausgebildet wurde. Seitdem sahen sie sich fast jeden Tag.
Ihre Marina kam in Sicht, und Nick steuerte das Segelboot in die schlauchartige Einfahrt hinein, die rechts und links von Schleppern gesäumt wurde. Nach einigen Metern erweiterte sich das Hafenbecken und gab den Blick auf unzählige Boote der verschiedensten Art frei – Segelboote, Motorboote, luxuriöse Jachten und in die Jahre gekommene Fischerboote. Langsam fuhren sie an den belegten Anlegeplätzen vorbei, bis Ben an der südlichen Hafenmauer einen freien Platz erspähte und Nick fachmännisch einwies. Kurz darauf hatten sie ihr Boot an einem der Pontons auf dem Steg vertäut und gesichert.
Neugierig sah Nick sich im Hafen um, doch außer den friedlich vor sich hin schaukelnden Booten gab es nicht viel zu entdecken. Sie hatten Lissabon um die Mittagszeit erreicht, und die kleine Marina lag wie ausgestorben da.
»Die machen alle Siesta«, sagte Ben.
»Kein Wunder bei der Hitze«, erwiderte Nick. Ohne die frische Brise, die ihnen auf dem offenen Meer stetig um die Nase geweht war, spürte er zum ersten Mal, wie unbarmherzig die Sonne auf sie niederbrannte. »Ich bin dafür, dass wir uns den hiesigen Gepflogenheiten anpassen.«
Ben trat zu Nick und legte ihm einen Arm um die Schulter. »Ich finde es bewundernswert, wie unvoreingenommen du dich auf fremde Kulturen einlässt, mein Sohn. Ich bin stolz auf dich.« Ben und Nick grinsten sich an, dann wandten sie sich zu der kleinen Treppe um, die unter Deck führte, und zogen sich jeder in seine Kabine zurück.
Doch als Nick kurz darauf in seiner Koje lag und aus dem Bullauge ins Hafenbecken hinausschaute, merkte er, wie es in seinem Magen zu kribbeln begann. Ein Blick auf die Uhr verriet, dass er noch zwei Stunden Zeit hatte, bis er sich auf den Weg zu seiner Verabredung machen musste. Plötzlich war er sich gar nicht mehr so sicher, ob das mit der Siesta eine gute Idee gewesen war. Das untätige Herumliegen verschaffte ihm viel zu viel Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie nervös ihn der Gedanke an den bevorstehenden Nachmittag machte.
2
Nick warf einen letzten Blick in den Spiegel und fuhr sich noch einmal durch die Haare, sodass sie locker zur Seite fielen. Oder doch lieber wild verstrubbeln?
Ein Räuspern ließ ihn herumfahren. Ben lehnte mit verschränkten Armen am Türrahmen und betrachtete ihn amüsiert. »Musst du nicht langsam los?«
»Äh … ja. Natürlich.« Nick sah hektisch auf die Uhr, quetschte sich an Ben vorbei und lief die wenigen Stufen hinauf an Deck. »Bis später.«
»Nick?«
»Ja?«
Er drehte sich um. Sein Vater hatte immer noch diesen unverschämt amüsierten Ausdruck im Gesicht, und zu allem Überfluss zwinkerte er ihm nun auch noch zu. »Viel Spaß.«
»Danke«, murmelte Nick und wandte sich rasch um, bevor Ben merkte, dass er rot geworden war.
Eine halbe Stunde und einen schweißtreibenden Fußmarsch später erreichte er den Praça do Comércio, einen weitläufigen Platz direkt am Fluss, der von prachtvollen, säulengeschmückten Gebäuden eingefasst wurde. Nick ging bis zu dem Reiterstandbild in der Mitte der riesigen Freifläche und sah sich angespannt um. Noch nichts zu sehen. Er atmete tief durch, konnte aber nicht verhindern, dass er mit jeder Minute zappeliger wurde.
Der Platz war ein beliebtes Ziel bei den Touristen, die staunend umherschlenderten, die palastähnlichen Gebäude fotografierten oder auf die breiten Treppenstufen zustrebten, die zum Fluss hinunterführten und zu einer kleinen Verschnaufpause einluden. Deswegen dauerte es eine Weile, bis ihm die roten Locken auffielen, die zwischen den anderen Köpfen auf und ab wippten.
Er hatte sich fest vorgenommen, cool zu bleiben, doch als sie schließlich vor ihm stand, konnte er nicht anders: Er grinste wie ein Honigkuchenpferd.
»Hi«, sagte Becca und strahlte ihn an. Als sie nach einer Weile fragend eine Augenbraue hochzog, fuhr er zusammen.
»Oh, äh … hi«, stotterte er und merkte, wie ihm erneut die Röte in die Wangen schoss. Verflixt. Er benahm sich wie ein kompletter Idiot. »Wow! Du siehst toll aus«, schob er schnell hinterher. Was die Sache auch nicht viel besser machte.
Aber es stimmte immerhin. Sie trug ein luftiges weißes Sommerkleid, das ihre sportliche Figur umspielte. In der Sonne leuchteten ihre Locken in einem strahlenden Kupferrot, und die Sommersprossen, die über Nase und Wangen gesprenkelt waren, verliehen ihrem Gesicht diesen vorwitzigen Ausdruck, der ihn schon während ihres gemeinsamen Himalaya-Einsatzes so fasziniert hatte.
Nick hatte die Mossad-Agentin vom ersten Augenblick an mehr als nur nett gefunden, doch sie hatte ihm rasch zu verstehen gegeben, dass sie einen festen Freund hatte. Umso mehr hatte es ihn gefreut, dass sie nach dem Einsatz über E-Mails und Chatnachrichten in Kontakt geblieben waren. Als er erwähnte, dass er im Sommer mit seinem Vater eine Segeltour entlang der portugiesischen Küste machen würde, stellten sie fest, dass Becca zur gleichen Zeit bei Verwandten in Lissabon zu Besuch war, und so hatten sie sich für den heutigen Tag verabredet.
»Danke. Und du hast dich kein bisschen verändert«, konterte Becca sein Kompliment.
»Ist das jetzt gut oder schlecht?«, fragte Nick.
Becca lachte bloß, nahm seine Hand und zog ihn hinter sich her. »Komm, du Superagent. Ich zeig dir die Stadt. Was wollen wir machen? Bummeln? Sightseeing? Eis essen?«
»In der Reihenfolge«, sagte Nick und ließ sich bereitwillig mitschleifen.
Becca hielt Wort. Sie schlenderten über die altehrwürdige Rua Augusta, eine der größten Einkaufsstraßen Lissabons, ratterten mit der berühmten Straßenbahnlinie 28 durch enge steile Häuserschluchten und kraxelten anschließend zur Castelo de São Jorge hinauf, einer Burg, die hoch über der Stadt thronte und von der aus man einen atemberaubenden Blick bis zum Meer hatte. Danach setzten sie sich in ein Café, bestellten zwei riesige Eisbecher und unterhielten sich über vollkommen normale Dinge, über die sich vollkommen normale Sechzehnjährige eben so unterhielten. Während Nick einen besonders großen Schokoladensplitter zerkaute, dachte er belustigt, dass niemand, der sie zufällig belauschte, auf die Idee kommen würde, dass sich hier zwei Agenten des Mossad und des BND gegenübersaßen. Sie tauschten Empfehlungen für neue Serien aus, stellten fest, dass sie eine Leidenschaft für Mangas teilten, und diskutierten hitzig über ihren jeweiligen Musikgeschmack, der unterschiedlicher nicht hätte sein können – Nick mochte Hip-Hop und R ’n’ B, Becca spanische Rockmusik –, um sich schließlich darauf zu einigen, dass sie sich über Musik niemals einig werden würden. Als Nick Becca beiläufig nach ihrem Freund fragte und Becca ebenso beiläufig mitteilte, dass sie nicht mehr zusammen waren, versuchte Nick, sich nichts anmerken zu lassen, und wechselte schnell das Thema. In Wahrheit scheuchte die Nachricht jedoch einen riesigen Schwarm Schmetterlinge auf, der wie wild in seinem Magen herumflatterte.
Als Nick schließlich widerstrebend darauf hinwies, dass er mit Ben zum Essen verabredet war und er sich langsam auf den Rückweg machen musste, bot Becca an, ihn bis zum Hafen zu begleiten. Doch als sie zwanzig Minuten später am Boot ankamen, war es leer. Auf dem kleinen Tisch unter Deck fand Nick einen Zettel, auf den sein Vater in sauberer Handschrift geschrieben hatte: »Mache einen Spaziergang. Bin spätestens um neunzehn Uhr zurück. B« Schulterzuckend präsentierte er den Zettel Becca, die auf dem Steg gewartet hatte.
»Ist dein Dad so oldschool, dass er dir lieber einen Zettel schreibt, anstatt eine SMS zu schicken?«, fragte Becca erstaunt.
Nick lachte. »Ben ist das totale Gegenteil von oldschool. Aber wir haben uns einen heiligen Eid geschworen, dass wir im Urlaub unsere Handys und Interfaces ausgeschaltet lassen.«
»Ich verstehe. Also auch kein Bruno?«, hakte Becca nach. Sie wusste von Nicks CBPI und dessen etwas vorlauter Art, auch wenn sie ihn natürlich nie »persönlich« kennengelernt hatte.
»Auch kein Bruno«, bestätigte Nick. »Und ich überlege ernsthaft, ihn gar nicht mehr einzuschalten.«
»Glaub ich dir nicht. Du würdest ihn furchtbar vermissen.«
Nick seufzte. »Wahrscheinlich schon. Ganz schön armselig, oder?«
»Ach was. Die Welt ist voll von Leuten, die glauben, nicht ohne ihr Handy leben zu können.«
»Die werden von ihrem Handy aber nicht jeden Morgen über den aktuellen Ruhepuls und die Länge der verschiedenen Schlafphasen informiert, bekommen keine Predigt gehalten, wenn ihr Essen den empfohlenen Tageskalorienwert überschreitet, und werden auch nicht zu jeder sich bietenden Gelegenheit angebettelt, nur noch eine allerletzte, superkurze Partie Schach mit ihm zu spielen. Ich bin inzwischen so gut, dass ich dich innerhalb von fünf Zügen schachmatt setzen könnte. Dabei mag ich das Spiel nicht mal besonders.«
Becca lachte. »So schlimm?«
»Du hast keine Vorstellung.«
Da weder Nick noch Becca es eilig hatten, sich voneinander zu verabschieden, spazierten sie über den Pier am Wasser entlang. Stählerne Poller ragten in regelmäßigen Abständen aus dem aufgeplatzten Teer heraus, am Rand lagen ausrangierte Fischernetze und alte Holzkisten, und getrocknete Pfützen aus Schlick verströmten einen leicht modrigen Geruch.
Ein älterer Mann kam ihnen entgegen, der trotz der frühen Uhrzeit bereits betrunken zu sein schien. Er schwankte hin und her, starrte aus glasigen Augen geradeaus und schien dabei stetig vor sich hin zu murmeln. Kurz bevor er Nick und Becca erreicht hatte, stolperte er über ein Tau und schlug der Länge nach auf den Boden.
Becca war als Erste bei ihm. »Sind Sie verletzt?«, fragte sie ihn auf Portugiesisch.
Der Mann rappelte sich langsam auf, ohne sein Gemurmel zu unterbrechen.
»Die spinn’n«, brabbelte er vor sich hin. »Nordpol, sag’n sie. Verrückt. Total verrückt. Merk’n gar nicht, dass sich alle über sie lustig mach’n.«
Becca und Nick ignorierten das Geplapper und halfen dem Mann auf die Füße. Nick schlug der Geruch von billigem Alkohol entgegen, aber davon abgesehen schien der Alte unverletzt zu sein. Ohne die beiden Jugendlichen weiter zu beachten, setzte er seinen Weg fort. Nick und Becca sahen sich an und zuckten mit den Schultern. Sie wollten gerade weitergehen, als der Mann plötzlich laut auflachte.
»Ha. Als könnte ’n Schiff einfach verschwind’n.«
Becca blieb wie angewurzelt stehen. »Warte mal kurz«, sagte sie und lief dem Mann hinterher. »Was haben Sie gerade gesagt?«
Der Alte sah sie verständnislos an.
»Sie haben von einem Schiff gesprochen, das verschwunden ist«, half Becca ihm auf die Sprünge.
»Ach«, sagte der Mann und winkte ab. »Die woll’n sich bloß wichtig mach’n.«
»Von wem sprechen Sie?«, fragte Becca höflich. Nick wunderte sich, warum sie solches Interesse zeigte. Sie konnte das Geplapper dieses Trunkenboldes doch nicht ernsthaft für bare Münze nehmen.
Der Mann beugte sich so nah zu Becca, dass sein Gesicht nur wenige Zentimeter von ihrem entfernt war. »Javier, Ed und Vicente. Drüben in der
Taberna do Tubarão.« Er deutete ans Ende der Mole, wo sich einige Bars und Kneipen befanden. »Fall bloß nicht auf die rein, Schätzchen. Sauf’n den ganzen Tag irgend’n Fusel und mach’n sich wichtig.« Er richtete sich wieder auf und schwankte leicht hin und her. Nachdem er das Gleichgewicht wiedergefunden hatte, wandte er sich um und torkelte wortlos davon.
»Mir scheint, dass er sich ebenfalls kräftig an dem billigen Fusel bedient hat«, meinte Nick grinsend.
»Mag schon sein«, erwiderte Becca. »Aber vielleicht lohnt es sich trotzdem, mal in der Bar vorbeizuschauen.«
»Ernsthaft?« Nick sah sie entgeistert an.
»Hab ich noch nie erwähnt, dass ich verrückte Geschichten liebe?« In Beccas Augen blitzte es unternehmungslustig auf. »Komm schon, wo ist deine Abenteuerlust geblieben? Eine zwielichtige Hafenkneipe, grimmige Seebären, vielleicht das ein oder andere Messer, das geworfen wird …«
Nick sah sie zweifelnd an, merkte aber, wie seine Gegenwehr angesichts ihres strahlenden Lächelns ins Wanken geriet. »Ich bin in einem Relax-Urlaub, schon vergessen?«, versuchte er es dennoch. »Ich glaube nicht, dass unter den Umständen der Besuch von zwielichtigen Hafenkneipen erlaubt ist.«
»Ganz lahme Ausrede«, entgegnete Becca lachend und zog ihn mit sich. »Ich pass auf dich auf. Versprochen.«
3
»Taberna do Tubarão«, las Nick auf dem rostigen Schild über der Tür. »Haifischbar. Na bravo.«
Die Bar lag zwischen einem Fischrestaurant und einem Lagerhaus und sah schon von außen aus wie aus einem schlechten Film. Kleine, dreckverkrustete Fenster, splitternde Fensterrahmen, abblätternder Putz. Die Tür quietschte in den Angeln und war so niedrig, dass Nick instinktiv den Kopf einzog. Zwei Stufen führten in den Innenraum hinab, und wie sich herausstellte, war das mit der zwielichtigen Hafenspelunke gar nicht so weit von der Realität entfernt. Nachdem sich Nicks Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, sah er sich unauffällig um: Die Wände waren vollgestopft mit vergilbten Bildern und Fotografien, alten Rettungsringen, Schiffsglocken und sogar einem kleinen Schiffsanker. Auf einem Brett standen Flaschenschiffe und Schiffslaternen, und unter der Decke war ein großes Fischernetz gespannt, von dem lange Staubfäden hinabhingen. Die Tische aus abgewetztem dunklem Holz waren zur Hälfte besetzt, aber die meisten Gäste saßen allein oder zu zweit und starrten schweigend in ihre Gläser. Als Nick und Becca den Raum betraten, sahen einige von ihnen auf, doch obwohl die Agenten den Altersdurchschnitt beträchtlich senkten, nahm niemand groß Notiz von den beiden.
Der Wirt – ein hünenhafter Kerl, dessen tätowierte Oberarme so dick waren wie Nicks Oberschenkel – polierte gerade Whiskeygläser. Im Gegensatz zu seinen Gästen musterte er Nick und Becca misstrauisch, als diese zu ihm an die Theke traten.
»Bier könnt ihr haben, Schnaps erst ab achtzehn«, brummte er missmutig.
»Olá«, sagte Becca, ohne auf seine Bemerkung einzugehen. »Wir sind auf der Suche nach drei Seeleuten, die sich angeblich öfter hier aufhalten. Javier, Ed und Vicente heißen sie, wenn ich mich richtig erinnere.«
Das Misstrauen im Blick des Wirtes wuchs. Er legte Glas und Abtrockentuch zur Seite und verschränkte die Arme, wodurch sein Bizeps noch beeindruckender zum Vorschein trat. »Was wollt ihr von ihnen?«
Becca ließ sich von dem drohenden Gebaren nicht beirren. »Wir haben von der Geschichte mit dem verschwundenen Schiff gehört, und jetzt würden wir sie zu gern aus erster Hand erfahren. Ich habe eine Schwäche für alte Seemannslegenden.«
Sie schenkte dem Wirt das gleiche strahlende Lächeln wie Nick ein paar Minuten zuvor, und auch bei ihm verfehlte es seine Wirkung nicht. Nach kurzem Zögern deutete er ans andere Ende der Theke, wo drei Fischer stumm nebeneinandersaßen und sich an halb leeren Biergläsern festhielten.
Becca bedankte sich und trat zu den Männern, die sie argwöhnisch musterten. Als sie jedoch von der Begegnung mit dem alten Mann berichtete und höflich fragte, ob sie bereit wären, die Geschichte von dem verschwundenen Schiff zu erzählen, hellten sich ihre Gesichter auf.
»Der alte Sergio hat es euch erzählt?«, fragte erstaunt einer der drei, ein kleiner, hagerer Glatzkopf. »Und uns beschimpft er immer, sobald wir davon anfangen.«
»Er hat ein bisschen was angedeutet«, antwortete Becca ausweichend. »Ich bin übrigens Becca, und das ist Nick.«
»Ich bin Ed. Das ist Vicente, und der da drüben ist Javier. Nehmt ihm nicht übel, dass er nicht mit euch spricht. Er hat seit fünf Jahren kein Wort mehr gesagt.«
Vicente hustete röchelnd und murrte dann: »Sergio ist nicht der Einzige, der uns für Spinner hält. Niemand glaubt uns die Geschichte.«
»Stimmt es denn?«, fragte Becca. »Ist euer Schiff wirklich verschwunden?«
Ed und Vicente warfen sich einen schwer zu deutenden Blick zu und schwiegen.
Becca spürte, dass ein wenig Überredungskunst vonnöten war, und rief kurz entschlossen in Richtung Wirt: »Drei Bier, bitte!«
Kurz darauf tauschte der Wirt die halb leeren Gläser gegen volle aus. Ed, Vicente und Javier nahmen fast zeitgleich einen tiefen Schluck des Gebräus, was auszureichen schien, um ihre Zungen zu lösen. Während Javier weiterhin stumpf vor sich hin starrte, wischte sich Ed den Schaum von der Oberlippe und begann zu erzählen:
»Fünf Jahre ist das jetzt her. Wir fahren frühmorgens mit unserem Kutter raus bis zur Palheiro de Terra, eine der Wilden Inseln. Ist ’ne weite Fahrt, aber es lohnt sich. Alles ist wie immer. Ich bringe gerade die Netze aus, als ich plötzlich sehe, wie Javier hinterm Steuer zusammenbricht und Vicente sich an der Reling festkrallt, als wär ihm schwindlig. Dabei ist gar kein Seegang. Zwei Sekunden später wird mir schwarz vor Augen. Als ich wieder zu mir komme, zitter ich am ganzen Leib. Ich kapier gar nicht, was los ist. Aber ich merke, dass was anders ist als vorher. Die Luft fühlt sich falsch an, viel zu kalt, und riecht auch anders. Ich seh, wie Vicente sich aufrappelt. Dann such ich Javier. Der steht wieder am Steuer und starrt raus aufs Meer, in die Richtung, in die wir fahren. Ich dreh mich um, und dann glaub ich endgültig, dass ich den Verstand verloren habe. Ein paar Meter vor uns ragt ein riesiger Eisberg aus dem Wasser. Ein Eisberg! Vor der portugiesischen Küste! Wir sind alle so verdattert, dass wir dastehen wie festgewachsen. Dann fangen Vicente und ich an zu schreien und Javier reißt wie wild das Ruder rum. Ich glaub nicht, dass wir es geschafft hätten, dem Berg auszuweichen. Auf einmal wird mir wieder schwarz vor Augen, und ein paar Sekunden später schippern wir wieder in unseren alten Gewässern herum. Kein Eisberg, keine Kälte. Alles wie immer.«
Ed nahm einen tiefen Schluck aus seinem Glas und verfiel in Schweigen. Der Wirt, der während der Erzählung auf der Arbeitsfläche herumgewischt hatte, warf den Lappen in die Spüle und sagte zu Becca und Nick: »Ihr solltet nicht alles glauben, was ihr hört. Die drei Spezialisten hier sind bekannt dafür, gern mal einen über den Durst zu trinken. Wahrscheinlich haben sie am Abend vorher ordentlich getankt und waren immer noch voll wie die Haubitzen, als sie zum Fischen rausgefahren sind. Da kann man sich schnell mal einen Eisberg zusammenfantasieren.«
Vicente fuhr so heftig auf, dass ein Schwall Bier aus seinem Glas schwappte. »Zusammenfantasieren, hm?« Er hustete röchelnd und fragte: »Und wie erklärst du dir den Heilbutt?«
Der Wirt winkte ab und ging zum anderen Ende der Theke, wo ein Gast Nachschub verlangte.
»Heilbutt?«, fragte Nick.
»Allerdings«, bestätigte Vicente. »Nach dem Vorfall sind wir sofort zum Hafen zurückgefahren. Kurz vor der Anlegestelle ist uns aufgefallen, dass Ed ja bereits einen Teil der Netze ausgebracht hatte. Als wir sie einholten, waren sie leer – bis auf einen stattlichen Heilbutt.«
»Und?«, fragte Nick verständnislos. Von Fischen hatte er zugegebenermaßen überhaupt keine Ahnung.
»Und?«, äffte Vicente ihn nach. Er musste so lachen, dass er einen heftigen Hustenanfall bekam und nicht weitersprechen konnte.
»In den Gewässern vor Portugal gibt es keinen Heilbutt«, erklärte Ed an seiner Stelle. »Dem ist es hier viel zu warm.«
»Und wo kommt er normalerweise vor?«, hakte Nick nach.
Ed sah Nick durchdringend an. »Im Nordatlantik zum Beispiel. Island, Grönland. Überall dort, wo es so kalt ist, dass auch Eisberge im Wasser schwimmen.«
Nick brauchte einen Augenblick, bis er verstand. »Sie glauben, dass Sie mitsamt Ihrem Schiff in den Nordatlantik teleportiert worden sind? Und wieder zurück?«
Ed und Vicente sahen sich an und zuckten dann mit den Schultern. »Genau. Welche Erklärung sollte es sonst dafür geben?«
Nick musste sich ein Grinsen verkneifen. Den drei Männern war die ganze Sache offenbar bitterernst, da wollte er nicht respektlos erscheinen. Wider Erwarten amüsierte ihn die Situation, auch wenn die Geschichte natürlich Quatsch war. Becca hingegen schien jegliches Interesse verloren zu haben.
Vicente leerte sein Bierglas mit wenigen Schlucken und stellte es mit einem lauten Knall auf die Theke. »Keine Ahnung, wie das damals genau passiert ist. Oder warum. Auf jeden Fall ist es nicht mit rechten Dingen zugegangen. Ed sind ein paar Tage später sämtliche Haare ausgefallen. Ich hab diesen grässlichen Husten bekommen, der nicht mehr weggeht. Und Javier hat seit dem Vorfall kein einziges Wort mehr gesprochen.«
»Das tut mir leid«, sagte Nick diplomatisch.
Becca sah demonstrativ auf die Uhr. »Wir sollten los. Es ist schon nach sieben.«
»Schon klar«, sagte Ed traurig. »Ihr glaubt uns kein Wort. Genau wie alle anderen.«
Sie verabschiedeten sich von den drei Männern, die jetzt wieder in dumpfes Schweigen verfallen waren. Becca legte dem Wirt noch einige Münzen für das Bier auf den Tresen, und kurz darauf traten sie aus der niedrigen Tür ins Freie hinaus.
»Danke«, sagte Nick. »Das war in der Tat eine nette kleine Abwechslung.«
Becca schnaubte. »Mag sein. Aber die Geschichte war der totale Blödsinn.«
»Seemannsgarn eben. Was hast du denn erwartet?«
Sie schlenderten zurück zum Jachthafen.
»Sollen wir uns noch mal treffen, solange ihr in der Stadt seid?«, fragte Becca.
Nicks Herz schlug einen kleinen Salto vor Freude. »Das wär toll.«
»Wir können ja schreiben.«
»Okay. Allerdings darf Ben auf keinen Fall mitkriegen, dass ich mein Handy wieder einschalte. Der heilige Eid, du erinnerst dich.«
»Ach ja.« Becca grinste. »Wäre nicht das erste Mal, dass Kinder ihre Eltern austricksen, wenn’s um den vereinbarten Handykonsum geht.«
Nick lachte. »Stimmt. Und der Zweck heiligt bekanntlich die Mittel.«
Sie hatten das Boot erreicht. Zeit, sich zu verabschieden.
Nick wurde verlegen. Sollte er sie umarmen? Vielleicht sogar einen Kuss auf die Wange geben? Oder war das zu vorschnell?
Zu seiner Überraschung schien Becca ebenso unsicher zu sein wie er. Nachdem sie sich einen peinlichen, endlos erscheinenden Augenblick lang unschlüssig gegenübergestanden hatten, sah Becca plötzlich irritiert auf einen Punkt dicht neben ihm. Mit Schrecken stellte er fest, dass sie seine Hand betrachtete, die er unbewusst für ein High five erhoben hatte. Nick wäre am liebsten im Boden versunken. Was war denn bitte schön mit seinem Hirn los? Sicherung durchgebrannt? Auf Standby, wie Bruno?
Ehe er die Hand runternehmen konnte, hatte Becca bereits eingeschlagen. »Also dann – mach’s gut«, sagte sie. Dann drehte sie sich um und war kurz darauf zwischen den Booten verschwunden.
Nick hätte sich am liebsten in den Hintern gebissen. Wie konnte man nur so dämlich sein?! Superagent hatte Becca ihn heute Nachmittag genannt … ha, ha. Was sie einem an der Agentenschule wirklich beibringen sollten, war, wie man sich von der coolsten Frau der Welt verabschiedete, ohne sich völlig zum Affen zu machen.
4
Als der Kellner die dampfenden Teller vor ihnen abstellte, merkte Nick erst, wie hungrig er war. Die Riesenportion Eis, die er zusammen mit Becca verdrückt hatte, war immerhin schon ein paar Stunden her.
Sie saßen an einem der wenigen Tische vor einer Taverne am Rande der Alfama, dem ältesten Viertel Lissabons, das besonders durch seine verwinkelten, steilen Sträßchen von sich reden machte. Es war bereits dunkel, doch die gusseisernen Laternen vor dem Restaurant tauchten die unmittelbare Umgebung in ein gemütliches Licht.
Während sie sich ihr Essen schmecken ließen, erzählte Nick von den Fischern, die behaupteten, zum Nordpol und wieder zurück teleportiert worden zu sein. Ben amüsierte sich ebenfalls königlich.
»Und als Beweis für ihre Geschichte diente ihnen ein Heilbutt«, endete Nick.
»Was sie wohl mit ihm gemacht haben?«, sinnierte Ben.
»Wenn sie schlau waren, dann haben sie ihn gegessen«, erwiderte Nick lakonisch.
Ben lachte. »Die Geschichte erinnert mich ein bisschen an das Philadelphia-Experiment«, warf er ein.
»Sagt mir nichts«, erwiderte Nick. »Was ist das?«
»Eine Legende – also im Grunde auch nichts anderes als das, was diese drei Fischer zum Besten gegeben haben.« Ben nahm einen Schluck Rotwein und fuhr dann fort: »In den 1940er-Jahren hat ein Mann namens Carl Allen behauptet, dass vor seinen Augen ein Schiff der US-Marine aus dem Hafen in Philadelphia verschwunden ist. Angeblich ist es zu einem Stützpunkt im dreihundert Kilometer entfernten Norfolk teleportiert worden, nur um dann ein paar Minuten später wieder in Philadelphia aufzutauchen.«
»Aha«, machte Nick. »Und was sagen die anderen Augenzeugen dazu?«
»Es gibt keine. Allen ist der Einzige, der davon berichtet hat.«
»Ernsthaft? Und er hat tatsächlich geglaubt, dass ihm irgendjemand diese Geschichte abkauft?«
»Es kommt noch besser. Laut Allen hat die Besatzung des Schiffes großen Schaden genommen: Einige erlitten schwere Verbrennungen, manche waren sogar mit Teilen des Schiffes verschmolzen, andere waren geistig verwirrt oder blieben spurlos verschwunden. Deswegen, so Allen, hätte die Navy den Vorfall konsequent vertuscht. Sämtliche Zeugen und Crewmitglieder wurden einer Gehirnwäsche unterzogen, Unterlagen und Papiere wurden gefälscht oder vernichtet.«
»Darauf ist doch hoffentlich niemand reingefallen, oder?«
»Hast du eine Ahnung! Überleg mal, welchen Kultstatus die Area 51 in Nevada genießt. Hältst du Allens Geschichte für so viel unwahrscheinlicher als die Theorie, dass die USA seit Jahrzehnten die Landung von Außerirdischen vertuschen?«
»Auch wieder wahr«, gab Nick zu.