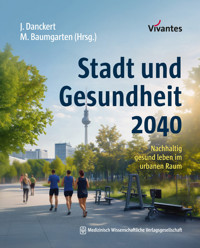
Stadt und Gesundheit 2040 E-Book
64,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Urbane Lebens- und Arbeitswelten verändern sich rasant: Sie werden smarter, vielfältiger und attraktiver, aber auch komplexer. Demografischer Wandel, Digitalisierung und der Wunsch nach nachhaltigen Lebensweisen prägen unser Zusammenleben und stellen uns vor neue Herausforderungen. Im Jahr 2040 wird die gealterte Gesellschaft vor allem in städtischen Ballungsräumen leben. Gesundheit entwickelt sich dabei immer mehr zum zentralen Motor gesellschaftlicher Entwicklung. Doch um den Bedürfnissen aller Bevölkerungsgruppen gerecht zu werden, muss die Stadtgesellschaft heute schon handeln und sich folgende Fragen stellen: Wie wollen wir in Zukunft leben? Welche Gesundheitsversorgung wünschen wir uns? Und wer wird diese bereitstellen? Dieses interdisziplinäre Fachbuch bringt Expertinnen und Experten aus Praxis und Wissenschaft zusammen, um innovative Lösungsansätze und Visionen zu skizzieren. Die Beiträge des Buches beleuchten das Zusammenspiel von Gesundheit, Gesellschaft und urbaner Lebensweise – oft am Beispiel Berlins –und zeigen neue Perspektiven für die Zukunft des städtischen Lebens und der Gesundheitsversorgung im urbanen Raum.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Johannes Danckert | Mina Baumgarten (Hrsg.)
Stadt und Gesundheit 2040
Nachhaltig gesund leben im urbanen Raum
mit Beiträgen von
M. Adli | N. Alwardt | J. Baas | S. Batt-Nauerz | M. Baumgarten | K.U. Bindseil | S. Blaschke | M. Blei | K. Blum | C. Brandt | L. Brethfeld | S. Bruns | G. von Cossel | I. Czyborra | J. Danckert | D. Dettling | S. Eilers | C. Fernekohl | K. Fiedler | L. Fischer | S. Franzke | D. Freis | C. Fuchs | F. Gerken | T. Grau | N. Gundlach | T. Guthknecht | S. Haerdle | N. Haffer | P. Hänel | A. Heimendahl | A. Holland | M. Huetten | T. Johnson | A. Kirchner | J. Klaubert | A. Knieriem | R. Knorr | S. Kral | F. Kreis | A. Krüger | A. Landgraf | C. Lang | P. Lemmer | S.H. Liebe | J. Liersch | M. Mangler | L. Mattauch | T. Meixner | D. Meyer zum Büschenfelde | J. Michael | S. Moebus | I. Nachtigall | N. Osbaldiston | S. Otto | M. Pilgramm | K. Raile | J. Rump | G. Sack | M. Schreiner | J. Schröder | P.M. Schulte-Frankenfeld | S. Schwertfeger | K. Stary | N. Stroglidis | S. Thun | C. Vogler | E. Volk | D. J. Walker | M. Weiss | M. Wilke | B. Wimmer-Puchinger | S. Wittjen | M. Woods | J. Zeller-Grothe | A.-M. Zeschmann-Hecht
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Das Herausgeberteam
Dr. Johannes Danckert
Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH
Berlin
Dr. med. Mina Baumgarten
Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH
Berlin
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Unterbaumstraße 4
10117 Berlin
www.mwv-berlin.de
978-3-95466-960-8 (eBook: PDF) 978-3-95466-961-5 (eBook: ePub)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Informationen sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Berlin, 2025
Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Im vorliegenden Werk wird zur allgemeinen Bezeichnung von Personen nur die männliche Form verwendet, gemeint sind immer alle Geschlechter, sofern nicht gesondert angegeben. Sofern Beitragende in ihren Texten gendergerechte Formulierungen wünschen, übernehmen wir diese in den entsprechenden Beiträgen oder Werken.
Die Verfasser haben große Mühe darauf verwandt, die fachlichen Inhalte auf den Stand der Wissenschaft bei Drucklegung zu bringen. Dennoch sind Irrtümer oder Druckfehler nie auszuschließen. Der Verlag kann insbesondere bei medizinischen Beiträgen keine Gewähr übernehmen für Empfehlungen zum diagnostischen oder therapeutischen Vorgehen oder für Dosierungsanweisungen, Applikationsformen oder Ähnliches. Derartige Angaben müssen vom Leser im Einzelfall anhand der Produktinformation der jeweiligen Hersteller und anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Eventuelle Errata zum Download finden Sie jederzeit aktuell auf der Verlags-Website.
Projektmanagement: Dennis Roll, Berlin
Copy-Editing: Monika Laut-Zimmermann, Berlin
Layout & Satz: zweiband.media, Agentur für Mediengestaltung und -produktion GmbH, Berlin
Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Zuschriften und Kritik an:
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Unterbaumstr. 4, 10117 Berlin, [email protected]
Geleitwort
Urbanisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel und Klimawandel sind die Megatrends, die unsere Gesellschaft tiefgreifend verändern und auch den Wandel des Gesundheitswesens antreiben. Was macht Menschen gesund, was hält sie gesund? Die Autoren dieses Buchs stellen sich der ebenso schwierigen wie dankbaren Aufgabe, diese Fragen aus den unterschiedlichsten Perspektiven zu bearbeiten.
Gesundheit ist eine Grundaufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge. Wissen ist dabei die Grundlage, aber Vernetzung und Kooperation sind der Schlüssel zum Erfolg. Es ist daher kein Zufall, dass der Impuls zu diesem Buch von Vivantes, dem größten kommunalen Klinikunternehmen Deutschlands, kommt. Es ist somit keine Überraschung, dass sich viele Zukunftsszenarien auf Deutschlands größte Metropole und Hauptstadt Berlin beziehen. Hier wird Zukunft gedacht und gemacht.
Dasselbe geschieht an vielen anderen Orten unseres Landes. Nicht nur Berlin kann Gesundheit, Deutschland kann Gesundheit. Mit interdisziplinärem Denken, regionaler Vernetzung und sektorenübergreifender Kooperation bei gleichzeitiger Spezialisierung der einzelnen Akteure können wir unser nach wie vor ausgezeichnetes Gesundheitssystem zukunftsfest machen.
Strukturveränderungen sind hierfür unerlässlich – sie bringen aber immer Verteilungskämpfe um Ressourcen mit sich. In einer offenen Gesellschaft werden diese auch offen ausgetragen, und das ist gut so. Die aktuelle Diskussion über Defizite des deutschen Gesundheitssystems ist also notwendig und wichtig, verliert sich aber oft in kleinteiligen Details, der Vertretung von Partikularinteressen und der medialen Konkurrenz um kurzfristige Aufmerksamkeit. Umso wertvoller ist es, einmal die Ebene der alltäglichen Debatten zu verlassen, den Horizont zu erweitern und die Chancen des Wandels, in dem wir uns bereits befinden, in den Blick zu nehmen. Der vorliegende Sammelband leistet das in hervorragender Weise.
Mein Dank gilt dem Herausgeber-Team aus Dr. Mina Baumgarten und Dr. Johannes Danckert sowie allen Autorinnen und Autoren. Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine anregende und gewinnbringende Lektüre.
Prof. Joachim Breuer
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH
Im Januar 2025
Nachhaltig gesund leben in der Stadt – eine Einführung
Berlin kann Gesundheit. Und nicht nur das, Berlin weiß auch, wie das gehen könnte, die Versorgung der Zukunft zu gestalten. Wir haben im Grunde kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Problem damit, unsere gemeinsamen Erkenntnisse auch verbindlich umzusetzen. Dieses Problem potenziert sich insbesondere da, wo die verschiedenen Themenfelder des menschlichen Miteinanders aufeinandertreffen.
Gesundheit, die mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit, braucht daher ein starkes Netzwerk aus Akteurinnen und Akteuren aus vielen Lebensbereichen der Stadtgesellschaft, die zusammen auf das Ziel hinwirken, dass die breite Bevölkerung in psychischem und physischem Wohlbefinden leben kann.
Für das vorliegende Buch haben wir uns gemeinsam mit Partnern aus der Wissenschaft – aber vor allem auch aus der unmittelbaren Praxis – dann aber doch noch einmal einige wichtige Kernfragen gestellt: Wie wollen wir in Zukunft leben? Unter welchen Bedingungen wollen wir arbeiten? Welche Gesundheitsleistungen wünschen wir uns und wer wird diese bereitstellen? Wie übernehmen wir Verantwortung in der Gesundheitsstadt Berlin?
Die Abschnitte dieses Buches umreißen die möglichen Antworten. Auf Grundlage der jeweiligen Fach- und Organisationsexpertise der beteiligten Autorinnen und Autoren berücksichtigen die Beiträge globale Trends, insbesondere im Hinblick auf geografische und sozialpolitische Kontexte der Gesellschaft im Ballungsraum und den unmittelbar umliegenden Regionen.
Wir haben die Autorinnen und Autoren eingeladen, auf eine konstruktiv-kritische Zeitreise zu gehen. Das Buch skizziert so für den urbanen Raum, oft am Beispiel von Berlin als Deutschlands größter Metropole, Antworten auf diese Fragen.
Abschnitt I bringt dabei vielfältige Perspektiven von Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Bildung und Kultur, Mobilität und Verkehr, Ernährung und Landwirtschaft zusammen. Der Abschnitt beleuchtet die Verantwortung von öffentlichen Organisationen und Unternehmen in der Ausgestaltung lebenswerter und gesunder Lebens- und Arbeitsräume. In zwei Exkursen werden hier zudem grundsätzliche, philosophische Fragestellungen zu Lebensgeschwindigkeit und Gerechtigkeit eingebracht.
In Abschnitt II rückt die Ausgestaltung von Gesundheitsversorgung in den Fokus. Wichtige bereits in Umsetzung befindliche Ansätze werden weitergedacht, mit besonderem Augenmerk auf die Integration einer personenzentrierten Versorgung. Der Buchabschnitt nimmt auch die Arbeitswelten im Gesundheitswesen auf und stellt dem Gesundheitswesen kritische Fragen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Resilienz. In Exkursen werden die Erkenntnisse auf spezifische Versorgungsszenarien konkretisiert. Geburts- und Kindermedizin, Frauengesundheit, Seelsorge und chronische Erkrankungen dienen als Blaupause für die Prüfung der eingebrachten Thesen. Naturgemäß entsteht in den Zukunftsszenarien ein starker Fokus auch auf digitale Lösungen, die durch spezifische Beiträge beispielsweise zu Interoperabilität und Cybersecurity, aber auch Kommunikation flankiert werden.
Die einzige Konstante ist Wandel – und so werden wir auch 2040 die Ansätze zur Versorgung stetig weiterentwickeln müssen. Abschnitt III beleuchtet daher Erreichtes sowie Zukünftiges in der translationalen Forschung, in Ausbildung und Lehre sowie in der Ausschöpfung von medizinisch-technischen Innovationen. Ein letzter Exkurs trägt zudem den Impuls bei, die Vergänglichkeit von Zukunftsvisionen zu würdigen.
Im gesamten Buch bringen Autorinnen und Autoren ihre vielfältige – uns häufig fachfremde – Expertise und Grundannahmen mit ein. Zwei Schwerpunktlinien lassen sich jedoch erkennen; diese sind als Fokuslinien im Buch gesondert hervorgehoben. Zum einen ist dies die unmittelbare Notwendigkeit, die ökologische Nachhaltigkeit bei allen Plänen und Umsetzungen im Blick zu behalten (Fokus Nachhaltigkeit). Zum anderen sollen unsere Anstrengungen die menschliche Vielfalt ermöglichen und erhalten. Unter der Fokuslinie Vielfalt finden sich Beiträge zu Lebensphasen und Alter, Diversität und Gender wieder.
Ausgehend von der Evidenz im Hier und Heute entsteht so über alle Abschnitte hinweg im Zusammenspiel der Beiträge das Zukunftsbild des Anzustrebenden und Erreichbaren, sofern es gemeinsam gelingt, die Möglichkeiten von Translation, Innovation, Digitalisierung, neuer Business- und Servicemodelle und menschlicher Kreativität auszuschöpfen.
Wir danken allen Autorinnen und Autoren, die ihre Gedanken und Überzeugungen in diesem Buch mit uns und mit den Leserinnen und Lesern teilen. Sie alle engagieren sich auch maßgeblich in der nachhaltigen Umsetzung der Ansätze und Projekte. Trotz der breiten Beteiligung muss ein solches Buch unvollständig bleiben.
Wir hoffen gerade auch deshalb, dass die Denkanstöße und der Ausblick auf das Machbare Mut machen, die Möglichkeiten in der Ausgestaltung unseres gemeinsamen Lebens weiter zu denken, zu diskutieren und zu realisieren. Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
Es gibt viel zu tun, lassen Sie es uns gemeinsam anpacken!
Dr. Johannes Danckert und Dr. Mina Baumgarten
Vivantes – Netzwerk für Gesundheit
Im März 2025
Inhalt
IGesund leben in der Stadt 2040
1Die gesunde Stadt: Klimaanpassung, soziale Gerechtigkeit und Resilienz in der urbanen EntwicklungIna Czyborra und Arvid Krüger
2EXKURS:New Pace of Life in the City and the Growing Desire to Slow DownNick Osbaldiston
3Gesundheitsförderung als transformative Kraft sozial-ökologischer (Stadt-) EntwicklungJudith Schröder und Susanne Moebus
4Gesundheitsversorgung in der Stadt: Eine gute Zukunft in einer Zeit der KrisenJens Baas
5FOKUS NACHHALTIGKEIT:Die klimagesunde Stadt: Eine urbane Vision von Planetarer Gesundheit 2040Kerstin Blum und Emily Volk
6Stress in the City: Wie das urbane Leben unsere psychische Gesundheit beeinflusstMazda Adli und Poul M. Schulte-Frankenfeld
7EXKURS:A Spatial Justice Approach to Urban Health InequalitiesMichael Woods
8FOKUS VIELFALT:Quartiersentwicklung des ehemaligen Flughafens Tegel in BerlinGudrun Sack
9Wohnen 2040: Vier PerspektivenKlaus Fiedler, Sandra Bruns, Mario Blei und Manfred Pilgramm
10Daseinsvorsorge im Wandel: Grundlage für Gesundheit, Lebensqualität und urbane ResilienzStephanie Otto
11FOKUS NACHHALTIGKEIT:Gesunde Städte, gesunde Mobilität: Die BVG als Schlüsselakteurin für eine nachhaltige und vernetzte ZukunftJenny Zeller-Grothe und Manuela Huetten
12FOKUS NACHHALTIGKEIT:Bewegung statt Abgase: Wie Berlin bis 2040 gesünder werden kannLuka Fischer und Linus Mattauch
13Museen im Wandel: Vom Archiv zum Bildungs- und RegenerationsraumChristine Fuchs
14Grüne Inseln: Was können zoologische Einrichtungen für Gesundheit, Bildung und Forschung leisten?Andreas Knieriem
15FOKUS NACHHALTIGKEIT: Berlins grüner Schatz vor den Toren der Stadt: Nahrung, Natur und Luft für die MetropoleKatrin Stary und Stephanie Haerdle
16Vom Wert der Arbeit für die GesundheitKai Uwe Bindseil und Stefan Franzke
17FOKUS VIELFALT:Lebensphasengerechte Beschäftigung als Schlüssel zur Entzerrung der FachkräfteengpässeJutta Rump und Silke Eilers
18Zukunftsbranche Gesundheitswirtschaft: Ein Wirtschaftszweig mit enormem Potenzial in StädtenRabea Knorr und Felix Kreis
IIGesundheitsversorgung 2040
1Urbane Versorgung 2040: Beschleunigt der Mangel medizinische Netzwerke?Johannes Danckert und Tobias Meixner
2Shared Decision Making: Partizipative Entscheidungsfindung in der Gesundheitsversorgung als Modell der ZukunftNele Gundlach und Mina Baumgarten
3EXKURS:Gesunde Zukunft – gesunde Seele?! Einfluss eines sich wandelnden Gesundheitswesens auf die SeelsorgeAnne Heimendahl, Sebastian Schwertfeger und Franziska Gerken
4Mehr Versorgung wagen: Krankenhäuser in Berlin 2040Marc Schreiner
5EXKURS:Frauengesundheit der Zukunft: Eine VisionMandy Mangler
6EXKURS:Versorgung entlang der Lebensspanne: Zukunft Neonatologie 2040Mikosch Wilke
7Gesundheitsversorgung in eng aufeinander abgestimmten Versorgungsketten: Mehrwert für Patient:innen und WirtschaftlichkeitGebhard von Cossel
8EXKURS:„We will not wait“: Ein patientenbetriebenes Ökosystem gibt Perspektiven für die Therapie chronischer Erkrankungen in der ZukunftKlemens Raile
9Smarte Patientenreisen und digitale Exzellenz im Krankenhaus als Antwort auf die Herausforderungen im GesundheitswesenJens Klaubert und Nikos Stroglidis
10Cybersicherheit im Gesundheitswesen 2040: Chancen und Herausforderungen der zunehmenden Vernetzung und Digitalisierung des GesundheitswesensStefan Wittjen und André Kirchner
11EXKURS:Hospital bei mir daheimDaniel Joseph Walker
12Pflege 2040: Zwischen smarter Technik und sozialer VerantwortungSimon Blaschke
13Mensch Maschine! – Verantwortungsvolle Zusammenarbeit mit Kollegin KI und Kollege Roboter in GesundheitsteamsNils Alwardt und Mina Baumgarten
14Gemeinsam vernetzt: Wie Interoperabilität das Gesundheitssystem transformiertNina Haffer und Sylvia Thun
15Gesundheit für alle: Die neue Ära der abgestimmten Primärversorgung in der Stadt 2040Patricia Hänel
16FOKUS NACHHALTIGKEIT: Zwischen Belastung und Anpassung: Klimawandel im GesundheitswesenSimon Batt-Nauerz und Jannis Michael
17EXKURS:Essen in Gesundheitseinrichtungen – mit Augenmerk auf das Jahr 2040Tobias Grau
18FOKUS NACHHALTIGKEIT: Wege zur Nachhaltigkeit in Gesundheitsbauten: Zwischen Illusion und WirklichkeitTom Guthknecht
19Zusammenarbeiten im Krankenhaus: Interprofessionalität und InterdisziplinaritätChristine Vogler und Pascal Lemmer
20FOKUS VIELFALT:Arbeitszeitmodelle und Dienstplangestaltung im Gesundheitswesen der Zukunft: Flexibel, digitalisiert und attraktiv arbeitenChristian Fernekohl und Cynthia Brandt
21FOKUS VIELFALT:Gesundes Leben und gesundes Arbeiten: Chancen und Aufgaben für unser Gesundheitswesen bis 2040Susanne H. Liebe, Melanie Weiss und Lukas Brethfeld
22Digital, ganzheitlich, gleichberechtigt: Der digitale Gesundheitskosmos der Zukunft braucht flexible KommunikationChristoph Lang
23FOKUS VIELFALT:Zukunft Krankenhaus: Diversity leben, Chancengleichheit sichernThomas Johnson und Jeanette Liersch
IIIForschung und Entwicklung
1Personenzentrierte Forschung auf, mit und am Menschen: Ein Paradigmenwechsel für das Jahr 2040Irit Nachtigall
2Interoperabilität als Schlüssel zur sektorenübergreifenden PatientenversorgungDirk Meyer zum Büschenfelde
3EXKURS:Medizin und Gesundheit in der Zukunft: Eine kurze GeschichteDavid Freis
4Wie lernen wir in Zukunft? Lernen als Enabler von Transformation und Kulturwandel im GesundheitswesenAnna-Maria Zeschmann-Hecht und Annika Holland
5Medizintechnik individuell wie der MenschAndreas Landgraf
6FOKUS VIELFALT:Gendermedizin: Quo vadis?Beate Wimmer-Puchinger und Sophia Kral
IVLeben 2050
1Die Stadt in 2050: Gesund, grün und gemeinsamDaniel Dettling
IGesund leben in der Stadt 2040
1Die gesunde Stadt: Klimaanpassung, soziale Gerechtigkeit und Resilienz in der urbanen Entwicklung
Ina Czyborra und Arvid Krüger
Unsere Städte stehen vor gewaltigen Herausforderungen – und gleichzeitig vor ebenso großen Chancen. Urbanisierung, Klimawandel und gesellschaftlicher Wandel formen das Leben in einer Metropole wie Berlin jeden Tag neu.
Der Klimawandel ist Realität. Was bedeutet das für eine europäische Metropole wie Berlin? Schon immer war die Lausitz eine der sonnenreichsten Regionen Deutschlands, der Trend wird sich verstärken – bis hin zur Versteppung. Neben Trockenheit wird die Berliner Kanalisation aber einer doppelten Belastung ausgesetzt sein. Plötzliche Starkregenereignisse verwandeln Straßen in lebensbedrohliche Flüsse, führen zu überlaufenen Keller sowie nicht benutzbaren Straßentunneln und U-Bahn-Stationen. (Riechel 2022; Siemer 2022)
Die Gesellschaft befindet sich gleichzeitig in einem umfassenden demografischen Wandel. So viele Geburten wie rund um die „Boomer“-Jahre 1964/65 hat es in Deutschland seitdem nicht mehr gegeben und aufgrund längerer Lebenszeit und der Geburtenentwicklungen von den 1970er- bis zu den 2000er-Jahren gibt es mehr und mehr Alte, eine Alterskohorte, die Ende dieses Jahrzehnts in Rente gehen wird. Dieser Wandel der Bevölkerungszusammensetzung wird seit mehreren Jahrzehnten bereits diskutiert (Frevel 2004).
Auch die COVID-19-Pandemie veränderte die Stadtgesellschaft 2020: Jenseits der Frage, wie gut oder schlecht die Gesellschaft durch die Pandemie gekommen sein mag: es hat sich real etwas verändert, wovon die Stadtforschung nur begrenzt prognostizieren kann, ob diese Veränderungen dauerhaft sein werden, nach 2022 wieder rückgängig gemacht wurden oder lediglich Verstärkungen bestehender Transformationsprozesse waren. Erste Handlungsempfehlungen, lokale und regionale Wertschöpfung zu fördern und den Einfluss der öffentlichen Hand auf die Stadtentwicklung zu stärken, um eine lebenswerte, resiliente und sozial gerechte Nach-Pandemie-Stadt zu schaffen, haben seitdem nicht an Aktualität verloren (Krüger 2020).
1.1Krise – Vulnerabilität – Resilienz: Ein Blick auf eine „neue Suburbanität“
All diese Veränderungen und Krisen zeigen uns auf, wie vulnerabel wir als Gesellschaft sind, und sie machen die Fragen, wie wir unsere Städte gestalten, zu Fragen nach unserer gemeinsamen Zukunft.
In der Stadtforschung werden aktuell die Allokationsmuster sozialer Infrastrukturen in Neubauquartieren des Stadtrands untersucht (Altrock et al. 2024). Denn gerade am Stadtrand geht es darum, neue Quartiere in einer Art zu entwickeln, dass man dort gern hinziehen möchte. Diese neuen Quartiere sind die Labore der Zukunft, Orte, an denen wir ausprobieren können, wie Wohnen, Gesundheit und Gemeinschaft besser miteinander verbunden werden können.
In einer alternden Gesellschaft, die gleichzeitig mit Migration, sozialer Ungleichheit und den Folgen des Klimawandels konfrontiert ist, dürfen wir Gesundheit nicht isoliert betrachten. Gesundheit ist eine infrastrukturelle Aufgabe, die weit über medizinische Einrichtungen hinausgeht und vielmehr sektorübergreifend gedacht werden muss. Sie ist untrennbar mit den Räumen verbunden, in denen Menschen leben, arbeiten und sich begegnen.
Wie verteilen sich die Angebote, wenn man das Quartier neu errichtet und das soziokulturelle Zentrum, den Campus dorthin setzen kann, wo man es für ideal hält? Wie lässt sich der räumliche Aspekt des Wohnens mit den Angeboten kombinieren, die es für Jugendliche, Kinder und junge Familien, die es für Senioren und damit mittelbar für Gesundheit und Pflege braucht? Welche Rolle könnten öffentliche Unternehmen des Gesundheitswesens spielen, um am Ende quartiersbezogene Anlaufmöglichkeiten vor Ort mit der medizinischen Spitzenforschung zu verbinden?
Es ist notwendig, Wechselwirkungen zwischen urbanen Strukturen und dem individuellen sowie kollektiven Wohlbefinden, das Zusammenspiel von sozialem Raum, mentaler Gesundheit und physischer Umgebung integriert zu betrachten. Städte sind nicht nur Orte, die wir gestalten – sie gestalten uns zurück (Lukas 2014). Urbaner Raum sollte nicht nur funktional, sondern auch emotional ansprechend gestaltet sein. Isolation, Stress und Überforderung können durch durchdachte Stadtplanung reduziert werden.
Die Folgen des Klimawandels – Hitzewellen, Starkregenereignisse, Luftverschmutzung – stellen Städte vor enorme Herausforderungen. Gleichzeitig betreffen diese Phänomene besonders stark vulnerable Gruppen, etwa ältere Menschen oder Kinder. Grünflächen und Parks sind eine Antwort. Sie werden nicht nur als Kaltluftentstehungsgebiet, wie die Stadtökologie es nennen würde, benötigt, sondern dienen als Orte, die die psychische Gesundheit fördern, wenn Menschen zusammenkommen, spielen, sich bewegen oder einfach innehalten können (Becker 2019). Sie sind soziale Infrastrukturen, die sowohl als Erholungsorte dienen als auch Gemeinschaft fördern.
Eine weitere Antwort sind Krankenhäuser. Sie könnten zu resilienten Orten ausgebaut werden, die sowohl medizinische Versorgung bieten als auch Schutzräume in Krisensituationen darstellen.
Doch es sind nicht nur die Gebäude, die zählen. Es ist der Raum dazwischen, der das Leben in der Stadt prägt. Der Straßenraum sollte nicht mehr nur dafür da sein, dort irgendetwas abzustellen, liegenzulassen oder in den Weg zu platzieren. Solange wir nicht begreifen, dass oft nicht der rollende Verkehr (Auto, Fahrrad – völlig egal), sondern der ruhende Verkehr das Problem ist, solange wird es uns nicht gelingen, den recht einfach einzunehmenden Blick einer 74-Jährigen Frau einzunehmen, die nicht mehr so gut zu Fuß ist – oder die Perspektive all jener Menschen, die Kinderwagen oder Rollatoren schieben oder selbst im Rollstuhl sitzen. Dies ist ein Plädoyer für Gender-Mainstreaming in der Stadtentwicklung (Bertram 2021). Oder anders formuliert: Jungs, denkt an eure Mütter, wenn ihr Stadtentwicklung macht. Nicht umsonst werden neue Quartiere am Stadtrand von Wien, Hamburg oder Freiburg so entwickelt, dass das Parken (für Autos) in Quartiersgaragen gebündelt wird (Krüger u. Altrock 2023).
Mobilität ist dabei weit mehr als ein technisches System, das Menschen von A nach B bringt. Sie ist ein Fundament sozialer Infrastruktur und ermöglicht den Zugang zu Gesundheits- und Bildungsangeboten, kulturellen Einrichtungen und sozialen Netzwerken. Eine moderne und gerechte Stadtentwicklung stellt sicher, dass diese Wege kurz, barrierefrei und für alle zugänglich sind.
Kurze Wege zu Gesundheits- und sozialen Angeboten sind auch ein Gebot der Gerechtigkeit – insbesondere aus einer Genderperspektive. Frauen tragen nach wie vor einen Großteil der Sorgearbeit und sind oft in besonderer Weise von der Zugänglichkeit dieser Angebote abhängig. Quartiere, die auf eine enge Verzahnung von Wohnen, Arbeiten und sozialer Infrastruktur setzen, fördern nicht nur die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern auch den sozialen Zusammenhalt.
1.2Daseinsvorsorge im 21. Jahrhundert
Krankenhäuser sollten als zentrale Bausteine einer sozial gerechten und resilienten Stadtplanung verstanden werden – nicht nur als Orte der Akutversorgung, sondern als integrierte Gesundheitszentren im suburbanen Raum. Diese könnten präventive, pflegerische und soziale Angebote bündeln und so zu Knotenpunkten einer gesamtstädtischen Daseinsvorsorge werden.
Ein kommunales Unternehmen (wie in Berlin z.B. Vivantes) könnte in Neubauquartieren stadtteilorientierte Gesundheitszentren etablieren, die medizinische Versorgung, Pflegeeinrichtungen und (mentale) Präventionsangebote mit sozialen und kulturellen Angeboten unter einem Dach vereinen – als Orte der Begegnung und Teilhabe für alle Generationen. Dabei übernähme Vivantes eine Rolle, die hier und da auch Wohnungsunternehmen bereits ausfüllen: Bereitsteller von Immobilieneinheiten für freie Träger der Wohlfahrtspflege zu sein, die dann z.B. soziokulturelle Angebote der Begegnung in ein integriertes Standortkonzept beisteuern. Mobile Gesundheitsdienste könnten insbesondere in weniger dicht besiedelten Randbezirken Versorgungslücken schließen.
Daseinsvorsorge ist Aufgabe der öffentlichen Hand und darf nicht von Profitinteressen dominiert werden. Gesundheit ist ein Recht, kein Privileg. Ein kommunales Unternehmen wie Vivantes hat also eine Schlüsselrolle, um Versorgung niederschwellig und für alle zugänglich zu machen. Dies bedeutet auch, soziale Gerechtigkeit durch konkrete Maßnahmen zu fördern: barrierefreie Einrichtungen, kultursensible Angebote und eine enge Verzahnung von Gesundheitsversorgung und sozialer Infrastruktur. Gleichzeitig muss der Gesundheitssektor als Teil einer sozial-ökologischen Transformation gedacht werden, um sowohl die Bedürfnisse der heutigen als auch künftiger Generationen zu berücksichtigen.
Die Gestaltung der Stadt von morgen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie verlangt Mut, Innovation und ein klares Bekenntnis zu Solidarität und Gerechtigkeit. Eine enge Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Akteuren wie Vivantes, Genossenschaften, Stadtplaner:innen und Stadtmacher:innen aus der Zivilgesellschaft ist dabei unerlässlich. Einem Unternehmen wie Vivantes als Akteur der öffentlichen Hand kommt eine entscheidende Rolle zu, um Gesundheitsversorgung ins Zentrum der urbanen Entwicklung zu rücken. Gemeinsam können wir Berlin zu einem Modell für eine sozial gerechte, gesundheitlich resiliente und ökologisch nachhaltige Stadt machen. Das ist keine Frage des technischen Könnens, sondern eine Frage des Willens, der Solidarität und der Verantwortung füreinander. Eine Frage, wie wir zusammenleben wollen – heute und in der Stadt von morgen.
Literatur
Altrock U, Bertram H, Krüger A (Hrsg.) (2024) Neue Suburbanität? Bielefeld: transcript
Becker C (2019) Strategien für eine klimaangepasste Stadt. In: vhw Forum Wohnen und Stadtentwicklung (5), 233–236
Bertram H (2021) Genderverhältnisse und (suburbaner) Raum. Wechselwirkungen, Wandel und Rolle der Planung. Diskussionspapiere der Neuen Suburbanität 1; Kasseler Online-Bibliothek, Repository und Archiv Kassel
Frevel B (Hrsg.) (2004) Herausforderung demografischer Wandel. VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden
Krüger A (2019) The double Legacy of Weimar. Urban Design and Public Housing 1919–2019 and its Consequences for Teaching Urban Planning. In: Warda J (Hrsg.) Beyond Bauhaus. New approaches to architecture and design theory. Heidelberg:
arthistoricum.net
(ART-Books), 155–178
Krüger A (2020) German Planning Discourses on the Post-Pandemic City. In: disP – The Planning Review 56(4), 98–106. DOI: 10.1080/02513625.2020.1906063
Krüger A, Altrock U (2023) Mobility Hubs: A Way Out of Car Dependency Through a New Multifunctional Housing Development? In: Urban Planning: Car Dependency and Urban Form 8(3), 112–125. DOI: 10.17645/up.v7i4.5744
Lukas T (2014) Sicherheit in der Stadt. In: Sicherheiten und Unsicherheiten. LIT Verlag Berlin/Münster
Riechel R (Hrsg.) (2022) Hitze, Trockenheit und Starkregen. Klimaresilienz in der Stadt der Zukunft. Deutscher Städte- und Gemeindebund. Berlin: Deutscher Städte und Gemeindebund (DStGB); Deutsches Institut für Urbanistik (Difu) (Dokumentation No. 166)
Siemer A (2022) Klimaanpassung und Schwammstadt als Querschnittsaufgabe der Stadtplanung. Rhombos-Verlag Berlin. In: Meinel G, Krüger T, Behnisch M, Ehrhardt D (Hrsg.) Flächennutzungsmonitoring XIV. Beiträge zu Flächenmanagement, Daten, Methoden und Analysen. Berlin: Rhombos, 51–60
Dr. Ina Czyborra
Ina Czyborra studierte Prähistorische Archäologie und Geschichte an der Freien Universität Berlin und Bonn und wurde 2001 zur Dr. phil. an der FU Berlin promoviert. 2003 gründete sie eine eigene Firma in der IT- und Veranstaltungsbranche. Von 2019 bis 2023 war sie Landesvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt Berlin (AWO). Sie trat 1984 in die SPD ein und ist seit 2011 Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Am 27. April 2023 wurde sie zur Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege des Landes Berlin ernannt.
Dr. Arvid Krüger
Arvid Krüger ist Stadt-/Raumplaner und an der Universität Kassel als Projektleiter tätig, so in der DFG-Forschergruppe „Neue Suburbanität“ sowie in einem BMBF-Projekt „Kommunen Innovativ,“ und hatte 2020 Gastprofessuren an der UC San Diego (2017) der FH Erfurt (2020). Er hat in Berlin und Stockholm studiert und 2018 an der Bauhaus-Universität Weimar promoviert. Seine Forschungsschwerpunkte verbindet er kontinuierlich mit der Planungspraxis. Zudem ist er ehrenamtlich bei der SRL und der ARL sowie der AWO aktiv.
2EXKURS:New Pace of Life in the City and the Growing Desire to Slow Down
Nick Osbaldiston
“The rate of communicating, writing, connecting, shopping, browsing, surfing, and working has increased since the internet came on the scene. I was correct, in 1989, to notice that capitalism has sped up since Marx’s time, and even since the post-World War II period […] But I didn’t foresee the extent of acceleration and instantaneity we have come to know today. Who could have?” (Agger 2015, 3)
We live in a culture of speed. Quick, fast, and instantaneous times, it seems, has penetrated, and overcome much of our social, political, economic, and personal lives (Parkins u. Craig 2006; Tomlinson 2007). In particular, the intensity and acceleration of urban/suburban life has led to some difficult truths, that include ill-health, increased stress, pollution, noise, and constant change (Tranter u. Tolley 2020). Workplaces too are transformed from places distinct from home to ones which blur the lines between work and life. We carry in our pockets for the most part, devices that keep us constantly connected to our occupations. Effectively leading us to be more connected to our labour, than we ever have been before. Global capitalism, especially in the service industries, requires attention 24/7, as markets never sleep (Agger 2015). Even within the hallowed halls of academia, the time to consider, reflect, and produce quality ideas, has been infiltrated by a culture of immediacy, measured by key performance targets of volume and output (Berg u. Seeber 2016).
Despite all of this, there is a growing desire to push back on these fast-paced times in our vocational, social, and personal lives (Honoré 2004). Across the developed world, there has been several examples of people seeking refuge from the onslaught of time pressures (Osbaldiston 2013). We might describe this loosely as the ‘culture of slow’, which ultimately ranges from extreme lifestyle changes such as voluntary simplicity (Doherty u. Etzioni 2003) through to personal switches to how we consumer or travel such as through cycling (Ryle u. Soper 2013). Fundamentally, the increased pressures of modern life, I argue here, has led to a deeper yearning for simplicity. Not just in relation to material or consumerism either, but a thirst for meaning that turns people towards slower actions and lifestyles. In this article, I want to argue that there are several ways we can understand this thirst for slowing down. I argue that slowing down is not new, but also there are new patterns that we must recognise exist now, and will no doubt be a feature of modern life in 2040/2050.
Unease with the Tempo of Modern Life
As noted, this anxiety towards the intensity and speed of capitalism and life in general, is not new. We need only remember the 19th century naturalist and writer Henry David Thoreau’s genuine unease with the progress of modern life.
“This world is a place of business. What an infinite bustle! I am awaked almost every night by the panting of the locomotive. It interrupts my dreams. There is no sabbath. It would be glorious to see mankind at leisure for once. It is nothing but work, work, work. I cannot easily buy a blank-book to write thoughts in; they are commonly ruled for dollars and cents […] I think there is nothing, not even crime, more opposed to poetry, to philosophy, ay, to life itself, than this incessant business.” (Thoreau 1965, 712)
Compare this to modern slow advocate Carl Honoré (2004, 11) in the following,
“If we carry on at this rate, the cult of speed can only get worse. When everyone takes the fast option, forcing us to go faster still. Eventually, what we are left with is an arms race based on speed, and we all know where arms races endup: in the grim stalemate of Mutually Assured Destruction.”
In my own research with lifestyle migrants (Benson u. Osbaldiston 2016), the ideal of escaping the intense time-scape of the city is a recuring theme amongst participants. This excerpt from an interview with a middle-aged woman who left the global metropolitan hub of Melbourne, Australia, for a quieter country life in Tasmania, illustrates this well.
“The hustle and bustle are not there in the same way (as back in the city). I don’t find it as chaotic, and people are much more connected to the land and things like that […] I just find there’s a peacefulness and a tranquility here […] it’s a simpler way of life, I find. I don’t mean that people are simple and dumb […] but I just find that it is – you can breathe out.” (Interviewee, Tasmania 2019)
These sorts of narratives are spread across a range of ‘slow’ genres (Osbaldiston 2013). As mentioned above, these can range from deeper critiques of fast capitalism in movements like voluntary simplicity, through to attempts to recapture time in the everyday.
Slow Living in the Modern World
The desire for a simpler, slower, or stiller way of living was perhaps predicted best by German sociologist Max Weber. Renowned for his theoretical contribution on the rationalisation and disenchantment of everyday life, through ever encroaching bureaucracy, scientific information, the rationality of capitalism, and the entwinement of these into the goals/ambitions in people’s lives, Weber also somewhat predicted a push back in later modernity (1919[2012], 348). While the modern world, especially time, becomes more goal-orientated, in that time is commodity that we spend, save, and use, Weber (1919[2012]) predicted that people will seek to escape, especially rationalisation in their everyday, through new means of living. This is evident in Barbara Adam’s (2009, 11) commentary on his work where she suggests,
“future[s] controlled through rational calculation is shadowed by its opposite; that is a yearning for charismatic leaders, spiritual fulfillment, ‘sublime values’, and, in the most general sense, all that escapes the iron grip of rationality in the social world.”
We see this in part, with attempts to recapture time, to slow down, both in the everyday mundane world, and in specific areas of our modern life. This is, for instance, the mantra of the slow food movement which seeks to motivate individuals to transform their relationship to food, from a fast-paced, quick, and easy diet, to one that engages with local cuisine, utilises authentic ingredients, and most importantly, encourages people to slow down and enjoy mealtime together (Petrini 2013). Slow food, it is contested, pushes back on our instantaneous culture of food, to one that embraces sensual delight, shared rituals of meals, and a communal mentality that works against fast-food culture.
However, slowing down does not require some sort of radical reformation of industry, or a revolt against ‘fast capitalism’. Parkins and Craig (2006, 3) outline slow life in the following.
“At its heart, slow living is a conscious attempt to change the temporal order to one which offers more time, time to attend to everyday life […] ‘Having time’ for something means investing it with significance through attention and deliberation. To live slowly in this sense, then, means engaging in ‘mindful’ rather than ‘mindless’ practices that consider the pleasure or at the least the purpose of each task to which we give our time.”
In essence then, slowing down is not simply a recapturing of ‘time’, but a repurposing of time towards things that are of importance to the self. This push towards ‘mindful’ practices is now well established across the west, in particular and has become an industry, driven partially by psychological science. We often see mindfulness as a sort of existential quest to redefine the self, and become grounded with the present, thus overcoming anxieties, and other mood disorders.
However, repurposing time, in an effort to engage in practices that are mindful, is not necessarily about health only. Sassatelli (2013, 172) for instance, highlights that through consumerism, we can explore creativity and the role it plays in reengaging the self in slow processes, that push back against instantaneous ‘satiation’, and instead entice individuals to engage in processes that require learning new skills, developing satisfying hobbies, and exploring areas important to their sense of self – including creativity. We can take as an example the recent renewal of interest in certain hobbies or interests such as photography, model building, designing and making clothes, vinyl collecting and so on. All these practices are not necessarily a revolt against fast-paced capitalism, but rather require patience, practice, skill development and most importantly, time. They represent shifts in how people make use of their ‘time’, in a way that requires careful use of time, moving them away from instantaneous culture, and speed.
Alternative Hedonism
The slow movement can and does have ecological motivations at times also, without being ‘revolutionary’. Kate Soper (2008) describes this mentality as a new form of engaging with the time-intensive world of fast-paced capitalism. Termed ‘alternative hedonism’, Soper (2008, 572) outlines that involves individuals engaging with wider collective issues such as environmentalism, while also experiencing hedonistic pleasure.
“Under this impulse, the individual acts with an eye to the collective impact of aggregated individual acts of affluent consumption for consumers themselves, and takes measures to avoid contributing to it. It is, for example, a decision to cycle or walk whenever possible in order not to add to the pollution, noise and congestion of car use. The hedonist aspect, however, of this shift in consumption practice does not reside exclusively in the desire to avoid or limit the unpleasurable by-products of collective affluence, but also in the sensual pleasures of consuming differently.” (Soper 2008, 572)
For her, there are ‘intrinsic pleasures to be had in walking or cycling which the car driver will not be experiencing’ (Soper 2008, 572). We could say that about many of the facets of our everyday lives. There are more intrinsic pleasures for those who maintain and skillfully create their own clothes, or those who create their own artwork, or who cook their own food through care and attention. Soper’s (2008) vision here, however, is that these alternative means of living life, do have potential to shape ecological futures, if planners and other local officials within cities specifically, ‘encourage’ their use (e.g. encourage and plan for more bike transportation and walking). The principle being that people slow down, then cities can also slow down, and create more ecologically friendly spaces.
However, Soper’s (2008) view that this could well be a potential solve for the current climate crisis, perhaps overstates the power of the individual consumer. The mammoth task now of dealing with carbon emissions, while also starting the task of adapting, is not something that can be changed through more cycling or walking tracks. It could, and does, however form part of a wider holistic approach that embraces people’s inherent desire to slow down, enjoy an alternative hedonistic pleasure through mobilities, consumption and other parts of our lifestyles. Movements such as Cittaslow for instance, seeks for cities and towns to adopt principles wherein people can reclaim time, and ‘appreciate the slow’ including a reanimation of past traditions, recovery of living with ‘seasons’ while interweaving a rich tapestry of creative, spiritual, and living spaces within the city itself. As the manifesto suggests, this is designed to increase chances for a slower, more relaxed pace of life.
Despite this, there is something inherently attractive for people today about slowing down. Arguably as we look forward to 2040/2050 and beyond, we could predict that the desire to slow down life, through different activities, will only increase in popularity. The tempo of life continues to intensify, as life continues to be more mobile than ever before. This mobility does not just include people, but objects, images, symbols, commodities, knowledge and importantly of course, money. To use Georg Simmel’s (1903[1997], 175) famous phrase from his essay The Metropolis and Mental Life, our lives are increasingly marked by an ‘intensification of nervous stimulation’ that has deep rooted consequences for the self, especially in urban life. However, Simmel (1903[1997]) would not have predicted what we have today. Life it seems is instantaneous, and we, as a culture, have become expectant of it as such.
Underlying all of this, as I have tried to set out above though, is a fundamental desire to recapture a pace for deeper, meaningful, and more purposeful life. We might describe this also as a ‘stilling’ of lifestyles. As Bissell and Fuller (2011, 6) argue, the intensification and growth in mobility of all of life, has led to desire for ‘stillness’ in our habits, actions, activities and even how we move. Activities that are designed for the purposes of ‘stilling’ the mind and body, such as the meditative practices of Eastern religions (and even the meditative practices of Christian religions such as the early mystics), are increasing in popularity. It is clear that, for personal health and well-being, people desire to slow down and order their times better.
Recapturing Slowness in a Climate Changed World
Yet, beyond these existential reasons for slowing down, it is also important to recognise that slowing down, is at times, enforced upon people due to climatic conditions. Weather plays an active role, in our activity. Vannini et al. (2012, 377) argue,
“Few of our mundane activities remain untouched by weather. The weather shapes our personal and social identities, our lifestyles, our line of work, our places of residence, and our leisure activities.” (Vannini et al., 377)
Heat already plays a role in people’s lives in how they move, especially during peak times in summer (see Kim, Sung and Park 2022 for instance). As we move towards 2040/2050, and as climate change continues to increase our global mean temperatures, the impact of this on our mobilities, may well enforce a slowing down. It is perhaps already evident in parts of the world that climate is impacting on people’s well-being. Participants in one of my studies into migration from urban mainland Australia to the cooler and variable climate of Tasmania, repeatedly complained about how heat in cities was forcing them inside, and therefore missing out on outdoor activities (Osbaldiston 2022). For instance, one man who migrated from England for Australia suggested that he then subsequently left Brisbane (capital city in Queensland, Australia),
“because the summers were getting hotter and hotter and we were in a very comfortable house with air conditioning […] we made it comfortable but it was still uncomfortable. And people would tease me and say ‘Isn’t it lovely you can be outside all this time’, I said, ‘I spend more time indoors in the summer in Brisbane than I ever spent in England’”
Another participant complained that life in the city was ‘disgusting’ during summer and said she would spend all day indoors in air conditioning. She contrasted this to life in Tasmania where she could head out and participate in activities that were personally important to her such as bushwalking, photography, and sightseeing. As argued in that particular study, statements like these may be anecdotal (though this was also based on survey data as well), yet as climate modelling predicts hotter years ahead, this enforcing of indoor life, and immobility, will certainly be a factor. As Kim, Sung and Park (2022) argue, this is where we require urban planning that adapts to heat, and provides safe ways for people to move through the city.
Conclusion
To conclude, what I have tried to argue above is that there is indeed a thirst for practices, habits, and lifestyle changes that are aimed at slowing down life that come with different motivations and practices. There is a spectrum here ranging from the extreme transformations such as voluntary simplicity or off-the grid living, through to smaller changes that aim to still the body and mind. The temporality of life is not likely to slow down either, with technological change rapidly interjecting into our everyday through smartphones, watches, and other devices that we carry on our person. With this increasing tempo, as Max Weber might have predicted, comes an increased desire to disconnect, escape, and slow down. While climate change and heat in particular may enforce this, especially our mobility, the value for people to embrace a slower way of living, will only increase in years to come.
Literature
Adam B (2009) Cultural Future Matters: An exploration in the spirit of Max Weber’s methodological writings. Time & Society 18(1), 7–25
Agger B (2015) Speeding up fast capitalism: Cultures, jobs, families, schools, bodies. Routledge
Benson M, Osbaldiston N (2016) Toward a critical sociology of lifestyle migration: Reconceptualizing migration and the search for a better way of life. The Sociological Review 64(3), 407–423
Berg M, Seeber BK (2016) The slow professor: Challenging the culture of speed in the academy. University of Toronto Press
Bissell D, Fuller G (Hrsg.) (2011) Stillness in a mobile world. Routledge
Doherty D, Etzioni A (Hrsg.) (2003) Voluntary simplicity: Responding to consumer culture. Rowman & Littlefield
Honoré C (2005) In praise of slowness: Challenging the cult of speed 97800. HarperOne San Francisco, USA
Kim MJ, Sung JH, Park KS (2022) Effect of High Temperature on Walking among Residents of Rural and Urban Communities. Yonsei Medical Journal 63(12), 1130
Osbaldiston N (2022) ‘The Summers Were Getting Hotter’: exploring motivations for migration to Tasmania away from mainland Australia. Australian Geographer 53(4), 461–476
Osbaldiston N (Ed.) (2013) Culture of the slow: Social deceleration in an accelerated world. Springer
Parkins W, Craig G (2006) Slow living. Berg
Petrini C (2013) Slow food nation: Why our food should be good, clean, and fair. Rizzoli Publications
Ryle M, Soper K (2013) Alternative hedonism: the world by bicycle. In Culture of the Slow: Social Deceleration in an Accelerated World, 94–109. Palgrave Macmillan London, UK
Sassatelli R (2013) Creativity takes time, critique needs space: Reworking the political investment of the consumer through pleasure. In Culture of the slow: Social deceleration in an accelerated world, 154–177. Palgrave Macmillan London, UK
Simmel G (1903[1997]) The metropolis and mental life. In: Frisby D, Featherstone M (Hrsg.) Simmel on culture: selected writings, 174–186. Sage
Soper K (2008) Alternative hedonism, cultural theory and the role of aesthetic revisioning. Cultural Studies 22(5), 567–587
Thoreau H (1965) Walden and other writings of Henry David Thoreau. Random House
Tomlinson J (2007) The culture of speed: the coming of immediacy. Sage
Tranter P, Tolley R (2020) Slow cities: conquering our speed addiction for health and sustainability. Elsevier
Vannini P, Waskul D, Gottschalk S, Ellis-Newstead T (2012) Making sense of the weather: Dwelling and weathering on Canada’s rain coast. Space and Culture 15(4), 361–380
Weber M (1919[2012]) Science as a vocation. In: Bruun H, Whimster S (Hrsg.) Max Weber: collected methodological writings, 335–354. Routledge London
Ass. Prof. Nick Osbaldiston
Nick Osbaldiston is an associate professor in sociology at James Cook University, Cairns, Australia. He has published widely in the areas of lifestyle migration, coasts, cultural sociology and the slow movements. He is presently working on researching migration from urban to regional/rural Australia.
3Gesundheitsförderung als transformative Kraft sozial-ökologischer (Stadt-)Entwicklung
Judith Schröder und Susanne Moebus
3.1Urban Public Health im Transformationsdiskurs
Wie werden Städte im Jahr 2040 aussehen? Eine Frage, die niemand seriös beantworten kann und stattdessen zu Vorhersagen aus der Kristallkugel heraus einlädt. Fest steht jedoch, dass das deutsche Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) für das Jahr 2040 die Reduktion von Treibhausgasemissionen um mindestens 88% gegenüber dem Jahr 1990 festschreibt (Deutscher Bundestag 2019). Um das umzusetzen, werden umfangreiche Transformationsprozesse notwendig, insbesondere in den Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft sowie Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft.
Sollen diese Klimaschutzziele erreicht werden – und dass dies gelingt, ist zum jetzigen Zeitpunkt alles andere als sicher –, sind Transformationen in den genannten Sektoren gleichsam mit großen Veränderungen in der Gestalt und Gestaltung von Städten verknüpft. Wie das schlussendlich konkret aussehen wird, hängt davon ab, welche Transformationspfade ausgewählt und eingeschlagen werden. Und diese Richtungsentscheidung wiederum ist Ergebnis politischer Aushandlungsprozesse.
Um zu diesen Aushandlungsprozessen beizutragen, eröffnet der vorliegende Beitrag eine Public-Health-Perspektive, die dezidiert die Gestaltung gesundheitsförderlicher Strukturen und Lebensverhältnisse in den Vordergrund stellt. Im Kern geht es hier darum, verhältnisorientierte Gesundheitsförderung in den Mittelpunkt gesundheits- und klimapolitischer Entscheidungen zu stellen und die Schaffung gesundheitsförderlicher Umwelten als Zielhorizont zu verankern. Eine solche Perspektive kann einen konsensfähigen Pfad für eine sozial-ökologische Transformation zur Bewältigung der (gesundheitlichen) Herausforderungen aufzeigen, die aus den ökologischen und sozialen Folgen der sich global ausbreitenden fossilistischen Lebensweise erwachsen.
Im Folgenden wird in die verwendeten Begrifflichkeiten von Gesundheit und Gesundheitsförderung eingeführt, um von dort aus die Brücke zu schlagen zur gesundheitsförderlichen Gestaltung urbaner Umwelten.
3.2Gestaltung von Gesundheit
Eine, wenn nicht die gängigste Definition von Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit; Gesundheit wird hier mittels der Definition ex negativo als nicht-krank verstanden. Dieses Verständnis von Gesundheit ist die Basis der sogenannten Pathogenese, die sich auf die Entstehung und Bekämpfung von Krankheit fokussiert, und in der Medizin und der Gesundheitsversorgung handlungsleitend ist.
Die zugrundeliegende Frage „Was macht krank?“ gibt jedoch nicht automatisch Aufschluss auf die Frage „Was macht gesund?“. Wissen und Erkenntnisse zu verschiedenen Krankheiten lassen nicht zwangsläufig Schlüsse zu auf Erhaltung und Förderung von Gesundheit. Die sogenannte Salutogenese (Antonovsky 1988) nimmt sich dieser Leerstelle an durch die Entwicklung eines alternativen Gesundheitsmodells, welches die Möglichkeiten der Erhaltung und Förderung von Gesundheit beleuchtet. Statt der dichotomen Unterscheidung in zwei Zustände (entweder gesund oder krank), begreift die Salutogenese Gesundheit und Krankheit als Pole eines Kontinuums. Gesundheit und Krankheit sind hier stets gleichzeitig vorhanden, erleben im Laufe eines Lebens jedoch Schwankungen in Art, Umfang oder Intensität. In einem solchen Verständnis ist Gesundheit das Ergebnis komplexer Interaktionen von biologischen, sozialen, psychologischen und umweltbedingten Faktoren, die in ihren Ausprägungen mal mehr und mal weniger balanciert sind. Die Prozesshaftigkeit und Kontextualität von Gesundheit werden damit in den Vordergrund gerückt.
Diese Herangehensweise trägt dem Umstand Rechnung, dass die Gesundheit des Individuums sowie ganzer Bevölkerungsgruppen maßgeblich von den umgebenden Strukturen und Umwelten beeinflusst wird, also den Orten des Alltagslebens der Menschen, an denen sie wohnen, lernen, arbeiten, spielen und lieben (WHO Regional Office for Europe 1986) – eine Erkenntnis, die mindestens seit der Antike bekannt (Rodenstein 2022 [1988]) ist. Gesundheit ist demnach kein reines Produkt isolierter individueller Eigenschaften, Gewohnheiten und Schwächen (Rosenbrock 2001), sondern abhängig von den jeweiligen Kontexten und damit das Resultat sowohl persönlicher als auch gesellschaftlicher Entwicklungen. Deshalb lohnt es sich, die Gestaltung jener Kontexte verstärkt in das Licht der Aufmerksamkeit zu rücken und auf ihre gesundheitsförderlichen sowie schädlichen Wirkungen hin zu beleuchten.
Denn vor dem Hintergrund der dargelegten Gesundheitsdefinition erweist sich Gesundheit als Mittel wie auch Ergebnis sowohl persönlicher als auch gesellschaftlicher Entwicklung sowie deren soziale Konstellationen und Strukturen (Nijhuis u. van der Maesen 1994; Smart 2023). Fragen zur Erhaltung und Förderung von Gesundheit bedürfen folglich der Verknüpfung mit Fragen gesellschaftlicher Entwicklung und Verfasstheit. Der Begriff der Gesundheitsförderung schließt hier an den Ansatz der Weltgesundheitsorganisation an, der zur Stärkung von Gesundheitsressourcen und -potenzialen auf allen gesellschaftlichen Ebenen ansetzt (WHO Regional Office for Europe 1986). Dieses Verständnis trägt der dialektischen Produktion von Gesundheit innerhalb alltäglicher Lebensbedingungen und -verhältnisse (Settings (WHO Regional Office for Europe 1986)) Rechnung.
Auch dies ist keine neue Erkenntnis. Inzwischen ist umfassend wissenschaftlich belegt, dass die Gesundheit der Menschen in wesentlich höherem Maße von den umgebenden Lebensbedingungen abhängt als von individuellen Verhaltensweisen (Holifield et al. 2018). Durch Schaffung und Erhaltung gesundheitsförderlicher Lebensbedingungen können Gesundheitschancen für Bevölkerungen und Bevölkerungsgruppen erwachsen. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, eben solche gesundheitsförderlichen Bedingungen für alle gleichermaßen zugänglich zu machen. Gesundheitsförderung bedeutet dann, politische, ökonomische, soziale, kulturelle, biologische und ökologische Faktoren so zu gestalten, dass sie sich für alle Menschen in gerechter und für die Gesundheit der Bevölkerung nützlicher Weise entwickeln. Die Förderung von Gesundheit muss daher in einen breiteren sozialen, ökonomischen und ökologischen Zusammenhang gestellt werden. Das bedeutet, dass unter anderem soziale Strukturen, gesellschaftliche Machtverhältnisse und politische Entscheidungsprozesse zwingend berücksichtigt werden müssen.
Erste Bestrebungen in diese Richtung sind in der historischen Rückschau bereits zu finden: Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland (und nicht nur dort) wurden Ideen entwickelt zur Umsetzung struktureller Maßnahmen, um die unsäglichen Lebensbedingungen in den Städten der Industrialisierung zu verändern und die Gesundheit der dort lebenden Bevölkerung zu verbessern. Namen wie Virchow, Pettenkofer, Koch, Grotjahn und Neumann haben die Verknüpfung von Gesundheit mit sozialen Bedingungen offengelegt und die gesundheitlichen Auswirkungen von Armut und schlechten Wohn- und Arbeitsbedingungen sichtbar gemacht. Während dieser historischen Phase entstanden erstmals Synergien zwischen der Sozialmedizin sowie Vertretern von Kommunalpolitik, Stadtverwaltung, Stadtplanung, Architektur und Ingenieurwesen (Labisch 1992). Ein Beispiel stellt das von Ebenezer Howard entwickelte städtebauliche Konzept der Gartenstadt dar. Dieses beinhaltete nicht nur die Idee einer durchgrünten Siedlung mit kurzen Wegen zu zentralen Einrichtungen und Produktionsstätten, sondern auch einen Verwaltungs- und Finanzplan, der auf eine gerechte Verteilung der Ressourcen ausgerichtet war und die am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen im Blick hatte (Howard 2003 [1898]).
Langfristig konnten diese Ideen der systematischen Gestaltung gesundheitsförderlicher Umwelten jedoch nicht flächendeckend verankert werden. Stattdessen etablierten sich im historischen Verlauf das pathogenetische Modell als vorherrschendes Paradigma sowie eine hegemoniale Deutungshoheit über Gesundheit und Krankheit aufseiten der Individuenbezogenen und verhaltensorientierten Medizin (Schröder u. Moebus 2024). Die öffentliche Gesundheit blieb derweil weitgehend auf medizinische Vorsorgemaßnahmen wie Grippeschutzimpfungen oder gesundheitsbezogene Aufklärung beschränkt. Die systematische Verknüpfung von öffentlicher Gesundheit mit den Herausforderungen und Gestaltungsoptionen gesellschaftlichen Zusammenlebens, speziell auch in städtischen Räumen, blieb aus. Gleichsam erfolgte auch keine oder nur wenig dezidierte Auseinandersetzung mit Anforderungen und Konzepten öffentlicher Gesundheit durch andere Disziplinen jenseits des klassischen Gesundheitssektors. Gesundheit wurde primär zu einer Privatangelegenheit des Individuums, deren Gestaltung der Eigenverantwortung sowie dem individuellen Gesundheitsverhalten obliegt (Schröder u. Moebus 2024). Obwohl es inzwischen Stimmen gibt, die sich explizit für die Stärkung systemischer Ansätze und die Gestaltung von öffentlicher Gesundheit aussprechen (ExpertInnenrat der Bundesregierung Gesundheit und Resilienz 2024a; 2024b), hapert es noch an der Umsetzung solcher Empfehlungen.
3.3Sozial-ökologische Transformation durch Schaffung von Gesundheitsressourcen
Vor dem Hintergrund der vorangestellten Skizzierung des Gesundheitsbegriffs, einschließlich des Aspekts der Gesundheitsförderung und der Rolle von strukturellen Verhältnissen, eröffnen sich Anknüpfungspunkte zwischen sozial-ökologischen Transformationsbestrebungen und der Gestaltung gesundheitsförderlicher Umwelten.
Die Stadt als Lebensraum wird häufig vor allem als Gesundheitsrisiko empfunden, unter anderem aufgrund räumlicher Enge, hohen Verkehrsaufkommens, Lärmbelastungen, Luftverschmutzung, Kriminalität oder Segregation. Die Stadt bietet jedoch auch Strukturen und Funktionen, die als Gesundheitsressource dienen, wie beispielsweise die Nahversorgung mit Geschäften und Dienstleistungen, vielfältige Bildungsangebote, gesundheitsförderliche Mobilität per Fuß oder Rad sowie eine hohe Dichte an Kultur- und Freizeiteinrichtungen und sozialen Netzwerken. Die Stärkung solcher Gesundheitsressourcen kann ein Anknüpfungspunkt sein für urbane Transformationsstrategien angesichts der Herausforderungen durch den Klimawandel und die ökologische Krise.
Denn im Zuge dieser Herausforderungen stehen Städte in doppelter Weise unter Transformationsdruck: als Verursacher von Treibhausgasemissionen und damit als Adressat für effektive Klimaschutzmaßnahmen sowie als Betroffene von Klimawandelfolgen und damit als Umsetzungsebene der Klimafolgenanpassung. In diesem Kontext sind durch den Klimawandel notwendige urbane Transformationen und sozial-räumliche Gestaltungen urbaner Umwelten wesentliche Variablen, die sowohl fördernd als auch hemmend auf Gesundheit wirken können. Die Ausrichtung nachhaltiger Stadtentwicklung an Gesundheit und Gesundheitsförderung im oben beschriebenen Sinne kann jedoch einen Zielhorizont eröffnen für die Verknüpfung und Integration von nachhaltiger, sozial-ökologisch tragfähiger Klima- und Gesundheitspolitik, die nicht nur Krankheiten behandelt und Gesundheitsrisiken verhindert, sondern proaktiv Gesundheit fördert und Gesundheitsressourcen schafft. Eine gesundheitsförderliche sozial-räumliche Gestaltung von Städten ermöglicht den Zugang zu sozial-ökologisch nachhaltigen Produktions- und Konsumformen, Mobilitäts- und Infrastrukturen, Wohnbedingungen und Aufenthaltsmöglichkeiten. Eine gesundheitsförderliche sozialräumliche Gestaltung schafft Strukturen und Verhältnisse, die den Menschen bestmögliche Chancen für ein ökologisch und sozial nachhaltiges und gesundes Verhalten ermöglichen.
In einer solche Perspektive werden Co-Benefits, d.h. Maßnahmen, die in die Gesundheit der Bevölkerung sowie in Klimaschutz und Nachhaltigkeit einzahlen, unmittelbar offensichtlich. So können durch eine klimaschützende und -angepasste Entwicklung, insbesondere in städtischen Räumen, die Exposition, Anfälligkeit und gesellschaftliche Ungleichheit gegenüber den Folgen des Klimawandels verringert werden (IPCC 2022). Der Weltklimarat (IPCC) stellt in seinem jüngsten Gutachten fest, dass durch das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels die Zahl vorzeitiger Todesfälle zwischen 2020 und 2100 weltweit um schätzungsweise 152 Millionen reduziert werden könnte (IPCC 2022), schlicht durch Verbesserung der Luftqualität, Verringerung des Risikos für extreme Wetterereignisse sowie Erhöhung der Ernährungssicherheit (IPCC 2022). Darüber hinaus können durch zahlreiche Klimaschutzmaßnahmen weitere gesundheitsfördernde Effekte erzielt werden, von denen hier nur einige beispielhaft herausgegriffen werden:
Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energien;
Umstieg auf erneuerbare Energien und Steigerung der Energieeffizienz;
energetische Sanierung des Gebäudesektors;
Mobilitätswende mit einem Umstieg auf aktive Mobilität;
Umstellung auf nachhaltige Nahrungsmittelsysteme;
Senkung städtischer Treibhausgasemissionen durch bauliche Maßnahmen;
Schaffung Grüner und Blauer Infrastrukturen.
Die systematische Verknüpfung von Klimawandel und Gesundheit, insbesondere die systematische Nutzung der genannten Co-Benefits, kann einen Transformationsschub in der Gestaltung von Städten auslösen. Co-Benefits stellen eine radikal neue Möglichkeit dar, (zunächst womöglich unpopulär erscheinende) Maßnahmen nachhaltiger und resilienter Stadtentwicklung zu begründen und zu vermitteln. Damit können sie gleichzeitig dazu beitragen, die Umsetzungsgeschwindigkeit von Klimamaßnahmen zu beschleunigen und eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung und bei verschiedenen Interessengruppen zu schaffen (WHO 2020). Dabei geht es nicht nur um bekannte Instrumente, wie Maßnahmen der Luftverbesserung, sondern vor allen Dingen geht es um ein breites Verständnis gesundheitsfördernder Umwelten und „die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, produzieren, konsumieren und regieren, zu überdenken.“ (WHO 2020, S. 20, eigene Übersetzung).
3.4Was heißt das jetzt für das Jahr 2040?
Sollte es tatsächlich gelingen, ein Verständnis von Gesundheit als breiten gesellschaftlichen Konsens zu verankern, welches proaktiv Gesundheitsförderung und die Schaffung von Gesundheitsressourcen in den Mittelpunkt stellt, dann können sich Städte eventuell sogar bereits bis zum Jahr 2040 zu Orten einer gesellschaftlichen Ordnung entwickeln, die erkennbar ein höheres Maß an sozialer Gerechtigkeit, Lebensqualität und Nachhaltigkeit aufweisen und weiterhin an diesen Zielen arbeiten. In solchen Städten werden Gesundheit und Wohlbefinden integraler Bestandteil und Ausdruck des gesellschaftlichen Zusammenlebens sein, wobei alle Bevölkerungsgruppen Zugang zu gesundheitsfördernden Ressourcen haben.
Voraussetzung dafür ist, dass die Gestaltung von Gesundheit verstärkt als Angelegenheit der Öffentlichkeit betrachtet und verhandelt wird. In diesem Sinne beschreibt Öffentlichkeit als spezifische Kategorie des politisch-sozialen Lebens den Ort der politischen Willensbildung. Es ist der Ort, an dem sich demokratische Gesellschaften als politischer Körper und Souverän konstituieren (Brunner et al. 1972). Die Gesundheit einer Gesellschaft kann hier nicht als rein individuelle Verantwortung, sondern auch als kollektives Gut begriffen werden. So kann eine kollektive Idee eines gesundheitsförderlichen Gemeinwillens à la Rousseau (Rousseau 2023[1762]) entwickelt werden: ein Gemeinwille (volonté générale), der über den Willen aller (volonté de tous) als bloße Summe individueller Einzelinteressen (volonté particulière) hinausgeht. Ob dies gelingt, wird in der historischen Rückschau zu beurteilen sein.
Literatur
Antonovsky A (1988) Unraveling the mystery of health. How people manage stress and stay well. 2. pr. Jossey-Bass (Jossey-Bass health series) San Francisco, Calif
Brunner O, Conze W, Koselleck R (Hrsg.) (1972) Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Arbeitskreis für Moderne Sozialgeschichte. 8 Bände. Klett-Cotta Stuttgart
Deutscher Bundestag (2019) Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3905) geändert worden ist. KSG. URL:
https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/index.html
(abgerufen am 16.12.2024)
ExpertInnenrat der Bundesregierung Gesundheit und Resilienz (2024a) Gesundheit: Ganzheitlich denken, vernetzt handeln. 3. Stellungnahme des ExpertInnenbeirats. URL:
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975196/2310120/b1bde757a2f2e4392ddd3b2144b7cf29/2024-09-20-expertinnenrat-stellungnahme-3-data.pdf?download=1
(abgerufen am 16.12.2024)
ExpertInnenrat der Bundesregierung Gesundheit und Resilienz (2024b) Klimawandel und Gesundheit: Zusammen Denken, Systemgrenzen Überwinden. 5. Stellungnahme des ExpertInnenbeirats. URL:
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975196/2316964/b447f13789821257f713312a15cda3e5/2024-10-22-expertinnenrat-stellungnahme-5-data.pdf?download=1
(abgerufen am 16.12.2024)
Holifield R, Chakraborty J, Walker GP (Hrsg.) (2018) The Routledge handbook of environmental justice. Routledge Taylor & Francis Group (Routledge handbooks) London, New York City. URL:
http://www.routledge.com/p/book/9781138932821
(abgerufen am 16.12.2024)
Howard E (2003 [1898]) To-Morrow. A Peaceful Path To Real Reform. Original edition with commentary by Peter Hall, Dennis Hardy and Colin Ward. Routledge London, New York City
IPCC (2022) Climate Change 2022. Impact, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. International Panel on Climate Change. Cambridge, New York City. URL:
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
(abgerufen am 16.12.2024)
Labisch A (1992) Homo hygienicus. Gesundheit und Medizin in der Neuzeit. Campus-Verlag Frankfurt, New York City. URL:
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=002873422&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
(abgerufen am 16.12.2024)
Nijhuis HG, van der Maesen LJ (1994) The philosophical foundations of public health: an invitation to debate. Journal of epidemiology and community health 48(1), 1–3. DOI: 10.1136/ jech.48.1.1-a
Rodenstein M (2022 [1988]) „Mehr Licht, mehr Luft“. Gesundheitskonzepte im Städtebau seit 1750. 2., unveränderte, von 1988 nachgedruckte Aufl. Campus Verlag Frankfurt, New York City
Rosenbrock R (2001) Was ist New Public Health? In: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 44(8), 753–762. DOI: 10.1007/s001030100231
Rousseau JJ (2023[1762]) Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts. Bibliografisch ergänzte Auflage 2020, [Nachdruck] 2023. Brockard H, Pietzcker E (Hrsg.). Reclam Ditzingen
Schröder J, Moebus S (2024) The (Re)Production of Health in Climate Change. In: Front. Sustain. Cities 6 (1359930). DOI: 10.3389/frsc.2024.1359930
Smart B (2023) Concepts of health and disease in public health. In: Broadbent A, Venkatapuram S (Hrsg.) The Routledge Handbook of Philosophy of Public Health. Routledge (Routledge Handbooks in Applied Ethics) London, 53–69
World Health Organization (WHO) (2020) WHO Global Strategy on Health, Environment and Climate Change. The transformation needed to improve lives and wellbeing sustainably through healthy environments. Geneva. URL:
https://www.who.int/publications/i/item/9789240000377
(abgerufen am 08.01.2025)
WHO Regional Office for Europe (1986) Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung (WHO/EURO:1986-4044-43803-61669). URL:
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/349654/WHO-EURO-1986-4044-43803-61669-ger.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(abgerufen am 16.12.2024)
Judith Schröder, M.A.
Judith Schröder studierte Politikwissenschaft, Philosophie und Europawissenschaften mit Schwerpunkt Politische Ökologie. Sie ist seit 2020 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Urban Public Health in Essen tätig und befasst sich dort mit dem Themenkomplex Öffentliche Gesundheit und Klimawandel im Kontext urbaner Strukturen.
Prof. Dr. Susanne Moebus
Susanne Moebus ist promovierte Biologin, Professorin für urbane Epidemiologie und Direktorin des von ihr 2020 gegründeten Forschungsinstituts für Urban Public Health an der Medizinischen Fakultät der Universitätsmedizin Essen. Susanne Moebus und ihr Team erforschen mit modernen Methoden sowohl die Zusammenhänge zwischen städtischer Umwelt und Gesundheit als auch die gesundheitsförderliche Gestaltung urbaner Räume mit Blick auf Klima und Nachhaltigkeit. Sie war Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention. Zudem ist sie Co-Vorsitzende im ExpertInnenrat Gesundheit und Resilienz der Bundesregierung.
4Gesundheitsversorgung in der Stadt: Eine gute Zukunft in einer Zeit der Krisen
Jens Baas





























