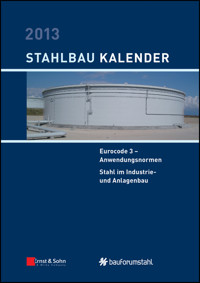
Stahlbau-Kalender 2013 E-Book
70,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der Stahlbau-Kalender ist ein Wegweiser für die richtige Berechnung und Konstruktion im gesamten Stahlbau, er dokumentiert und kommentiert verlässlich den aktuellen Stand der Stahlbau-Regelwerke. Zur bauaufsichtlichen Einführung von Eurocode 3 werden seit der Ausgabe 2011 systematisch alle Teile der Norm mit ihren Nationalen Anhängen kommentiert. In diesem Jahr sind neben der Aktualisierung zum Teil 1-8 "Bemessung von Anschlüssen" auch praxisnahe Anwendungshinweise für die Nachweisformate und optimalen Bemessungsabläufe zum Teil 1-1 "Allgemeine Bemessungsregeln" enthalten. Weitere ausführliche Kommentare aus erster Hand werden zu den Teilen 1-3 "Kaltgeformte Bauteile und Bleche", 2 "Stahlbrücken" und 5 "Pfähle und Spundwände" verfasst. Der Industrie- und Anlagenbau ist ohne den modernen Stahlbau undenkbar. Beiträge über Türme und Maste, Tankbauwerke, Silos und Industrieanlagen stellen aktuelle Entwicklungen vor und berücksichtigen die neuen europäischen Normen für Einwirkungen und Tragwerksbemessung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1307
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhaltsübersicht
1: Stahlbaunormen – DIN EN 1993-1-8: Bemessung von Anschlüssen
1 Allgemeines
2 Grundlagen der Tragwerksplanung
3 Schrauben-, Niet- und Bolzenverbindungen
4 Schweißverbindungen
5 Tragwerksberechnung, Klassifizierung und statische Modelle
6 Anschlüsse mit H- oder I-Querschnitten
7 Anschlüsse mit Hohlprofilen
2: Technische Baubestimmungen, Normen, Bauregellisten und Zulassungen im Stahlbau
1 Muster-Liste der Technischen BaubestimmungenFassung September 2012
2 Normen und Richtlinien für den Stahlbau
3 Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik DIBt (Stand: 03.12.2012)
4 Bauregelliste A, Bauregelliste B und Liste C Ausgabe 2012/2
3: Stahlbaunormen – Anwendung der DIN EN 1993-1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau
1 Einleitung
2 Struktur von DIN EN 1993-1-1
3 Werkstoffe
4 Tragwerksberechnung
5 Imperfektionen
6 Berechnungsmethoden bezüglich nichtlinearen Materialverhaltens
7 Klassifizierung von Querschnitten
8 Grenzzustände der Tragfähigkeit
9 Anwendungsbeispiele
10 Literatur
4: Stahlbaunormen – Kommentar zu DIN EN 1993-1-3: Allgemeine Bemessungsregeln – Ergänzende Regeln für kaltgeformte Bauteile und Bleche
0 Vorbemerkungen
1 Einleitung
2 Grundlagen der Bemessung
3 Werkstoffe
4 Dauerhaftigkeit
5 Tragwerksberechnung
6 Grenzzustände der Tragfähigkeit
7 Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit
8 Verbindungen
9 Versuchsgestützte Bemessung
10 Besondere Angaben zu Pfetten, Kassettenprofilen und Profilblechen
11 Anhang A – Versuche (normativ)
12 Anhang B – Dauerhaftigkeit von Verbindungsmitteln
13 Anhang D – Gemischte Anwendung von wirksamen Breiten und wirksamen Dicken bei einseitig gestützten Querschnittsteilen (informativ)
14 Anhang E – Vereinfachte Pfettenbemessung
15 NCI Literaturhinweise
16 Hinweise zur Verzweigungslastanalyse von kaltgeformten, dünnwandigen Bauteilen
17 Beispielrechnung nach DIN EN 1993-1-3 Unversteiftes C-Profil unter Druck- und Biegebeanspruchung
18 Literatur
5: Stahlbaunormen – Kommentar zu DIN EN 1993-2: Stahlbrücken
0 Vorbemerkung
1 Einleitung
2 Lastannahmen
3 Werkstoffe
4 Tragwerksberechnung
5 Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit
6 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
7 Verbindungen
8 Ermüdung
9 Ausführung und Montage
10 Lager und Fahrbahnübergänge
11 Ausgewählte Bauweisen
12 Beispiele
13 Schlussbemerkungen
14 Literatur
6: Türme und Maste nach DIN EN 1993-3-1
1 Vorbemerkungen
2 Einleitung
3 Tragwerksberechnung
4 Einwirkungen
5 Modellbildung
6 Tragsicherheitsnachweise
7 Herstellung, Montage und Zustandsüberwachung
8 Literatur
7: Silos und Einwirkungen auf Silos nach DIN EN 1993-4-1
1 Einleitung
2 Grundsätzliches zur Konstruktion von Silobauwerken aus Metallen
3 Die neue Normensituation
4 Werkstoffe
5 Einwirkungen
6 Bemessung von Silobauwerken
7 Ausführung/Fertigung
8 Literatur
8: Stählerne Tankbauwerke nach DIN EN 1993-4-2
1 Einleitung
2 Begriffe
3 Funktionstypen
4 Abmessungsbereiche und konstruktive Ausführung
5 Regelwerke
6 Werkstoffe
7 Einwirkungen
8 Schnittgrößenermittlung
9 Zylindrische Tankwand
10 Dach
11 Tankfuß
12 Boden/Gründung
13 Ausrüstung
14 Tanks mit ebenen Wä nden
15 Zahlenbeispiel
16 Zusammenfassung
17 Danksagung
18 Literatur
9: Stahlbaunormen – Kommentar zu DIN EN 1993-5: Pfähle und Spundwände
0 Einleitung
1 Allgemeines
2 Grundlagen für Entwurf, Bemessung und Konstruktion
3 Werkstoffe
4 Dauerhaftigkeit
5 Grenzzustände der Tragfähigkeit
6 Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit
7 Anker, Gurtungen, Aussteifungen und Anschlüsse
8 Ausführung
A Anhang A (normativ): Dünnwandige Stahlspundwände
B Anhang B (informativ): Versuche mit dünnwandigen Spundbohlen
C Anhang C (informativ): Anleitung zur Bemessung von Stahlspundwänden
D Anhang D (informativ): Tragelemente bei kombinierten Spundwänden
9 Literatur
10: Stahl im Industriebau
1 Historische Entwicklung der Eisen- und Stahlbauweise im Industriebau
2 Hallen und Überdachungen
3 Mehrgeschossige Industriebauwerke
4 Tragwerke von Industriebrücken
5 Literatur
11: Kraftwerke
1 Einleitung
2 Kraftwerksanlagen und Dampferzeuger mit Kohlefeuerung
3 Tragwerksplanung von Kesselgerüst und Tragrost
4 Projektlogistik in Großprojekten am Beispiel von Kohlekraftwerken
5 Produktion und Qualitätssicherung
Stichwortverzeichnis
Hinweis des Verlages
Die Recherche zum Stahlbau-Kalender abJahrgang 1999 steht im Internet zur Verfügungunter www.ernst-und-sohn.de
Titelbild: BTC Marine Terminal (Türkei)Fotograf: Robert Ofner / Institut für Stahlbau – TU Graz
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2013 Wilhelm Ernst & Sohn,Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG,Rotherstraße 21, 10245 Berlin, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikrofilm oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprint, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publishers.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
ISBN: 978-3-433-02994-7ISSN: 1438-1192Elektronische Version, obook ISBN 978-3-433-60318-5
Vorwort
Während im vergangenen Jahr die Grundlagen-Teile der neuen europäischen Bemessungsnorm Eurocode 3, die am 01. Juli 2012 bauaufsichtlich eingeführt worden ist, den Schwerpunkt bildeten, konzentriert sich der neue Stahlbau-Kalender 2013 auf die Anwendungs-Teile, wie zum Beispiel Teil 2 für Stahlbrücken, Teil 5 für Pfähle und Spundwände oder Teil 3 und Teil 4 für Türme, Maste, Silos und Tanks. Ergänzt wird dieser normenorientierte Teil des Stahlbau-Kalenders 2013 um zwei Beiträge zur Verwendung von Stahl im Industrie- und im Kraftwerksbau.
Anknüpfend an die Tradition der früheren Stahlbau-Kalender, jeweils die Grundnorm DIN 18800 im Originaltext mit Kommentaren abzudrucken, wird in ähnlicher Form einer der beiden Hauptteile des Eurocode 3, in diesem Jahr die Grundnorm DIN EN 1993 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen im Originaltext wiedergegeben. Dabei sind die Regeln des zugehörigen Nationalen Anhangs sowie ergänzende Kommentare und Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Dieter Ungermann und Dipl.-Ing. Stephan Schneider, TU Dortmund, aktualisiert an den jeweiligen Stellen eingearbeitet. Gegenüber der Fassung im Stahlbau-Kalender 2011 werden in dieser Ausgabe kleine Fehler berichtigt und Kommentare zu aufgetretenen Fragen bzw. aktuellen Entwicklungen ergänzt. Damit der Stahlbau-Kalender auch zukünftig für die Praxis das Referenzwerk für die jeweils aktuell geltenden Regeln im Stahlbau ist, sollen auch weiterhin regelmäß ig im Wechsel die beiden Hauptteile als aufbereitete Originalnormen abgedruckt werden.
In der Muster-Liste der Technischen Baubestimmungen haben sich durch die Einführung der Eurocodes im Jahr 2012 erhebliche Änderungen ergeben. Der Beitrag von Dr.-Ing. Karsten Kathage und Dipl.-Ing. Christoph Ortmann, Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin Technische Baubestimmungen, Normen, Bauregellisten und Zulassungen im Stahlbau ist deshalb in diesem Jahr für die Praxis von besonderer Relevanz. Er stellt neben den aktualisierten Listen der Technischen Baubestimmungen und den neuen Bauregellisten in Auszügen auch die gültigen für den Stahlbau wichtigen Zulassungen zusammen.
Aufgrund seiner Erfahrung in Seminaren zum Eurocode 3 und auf der Basis einer unter seiner Federführung entstandenen Beispielsammlung hat Dipl.-Ing. Sivo Schilling, bauforumstahl e.V., eine kompakte Zusammenstellung und Erläuterung der wesentlichen Regeln von DIN EN 1993-1-1 erstellt und mit konkreten Rechenbeispielen verknüpft. Sein Beitrag Anwendung der DIN EN 1993-1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau gibt wertvolle Informationen und ist eine praktische Anleitung zur Umsetzung der neuen Regeln. Die Rechenbeispiele gehen in ihrer Kommentierung über das gewohnte Maß hinaus und zeigen zum Teil auch unterschiedliche Nachweisverfahren für gleiche Problemstellungen auf.
Der vorliegende Kommentar zu DIN EN 1993-1-3: Allgemeine Bemessungsregeln – Ergänzende Regeln für kaltgeformte Bauteile und Bleche von Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Bettina Brune, TU Dortmund, erleichtert die Anwendung dieser für den Stahlleichtbau wichtigen Norm. Zu den Regelungen werden Hinweise und Erläuterungen gegeben und partiell die wissenschaftlichen Hintergründe aufgezeigt. Die Kommentierung folgt dabei der Gliederung der Norm und geht auf die verschiedenen Bereiche Werkstoffe, Tragwerksberechnung und detailliert auf Tragfähigkeits- und Stabilitätsnachweise ein. Ebenso werden Besonderheiten zu Pfetten, Kassettenprofilen und Profilblechen behandelt. Ein ausführliches Rechenbeispiel rundet den Beitrag ab.
Nachdem im Hochbau die Eurocodes im Juli 2012 bauaufsichtlich eingeführt wurden, ist nun auch im Dezember 2012 deren Einführung im Brückenbau erfolgt. Damit lösen die Eurocodes die DIN-Fachberichte ab. Der Beitrag Kommentar zu DIN EN 1993-2: Stahlbrücken von Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann, Universität Stuttgart, Dr.-Ing. Christina Schmidt-Rasche, Ostfildern, Dipl.-Ing. Ralf Schubart, Wunstorf und Dr.-Ing. Wolfram Schleicher, Eichwalde, sowie den Mitautoren Dr.-Ing. Jörg Frickel, Dipl.-Ing. Antje Schumann und Dipl.-Ing. Antonio Zizza erläutert die Bemessung und Konstruktion von Stahlbrücken entsprechend DIN EN 1993-2. Unter anderem werden die Änderungen und Umstellungen im Vergleich zum bisher gültigen DINFachbericht 103 dargestellt. Dabei soll die Anwendung der Eurocodes für den Stahl- und Verbundbrückenbau insgesamt erleichtert werden, indem auch Hinweise zu den Lasten auf Straß en- und Eisenbahnbrücken oder zu Ausbauteilen, wie Lager- und Fahrbahnübergänge, gegeben werden. Für ausgewählte Bauweisen, wie orthotrope Stahlfahrbahnen, Tragsysteme mit Hängern, Brücken in Hochgeschwindigkeitsstrecken oder Brücken mit Hohlprofilen, werden die Besonderheiten erläutert. Beispiele veranschaulichen die Anwendung der neuen Bemessungsregeln.
Prof. Dr.-Ing. Udo Peil, Wolfenbüttel und Dr.-Ing. Mathias Clobes, TU Braunschweig, haben es dankenswerterweise übernommen, in ihrem Beitrag Türme und Maste nach DIN EN 1993-3-1 deren Bemessung in einer zurzeit in Deutschland bauaufsichtlich noch etwas schwierigen Situation zu erläutern, da der Nationale Anhang zur europäischen Norm gegenwärtig noch nicht endgültig fertiggestellt ist. Dank ihres Einblicks in die Sachlage und ihrer Erfahrung gelingt es ihnen trotzdem, wichtige Hinweise zu geben. Ausführlich widmen sie sich dem Thema Einwirkungen durch Wind-, Eis- und Temperaturlasten. Auch Sonderlasten wie plötzlicher Seilbruch, Flugzeuganprall und Brand werden behandelt. Ein weiteres Augenmerk legen die Autoren auf die Tragsicherheitsnachweise und die Herstellung, Montage und Zustandsüberwachung von Masten und Türmen.
Dr.-Ing. Martin Kaldenhoff, HHW Ingenieure, und Dr.-Ing. Cornelius Ruckenbrod, SMP Ingenieure, beschäftigen sich mit dem Thema Silos und Einwirkungen auf Silos nach DIN EN 1993-4-1. Einwirkungen auf die Silowände rühren zum größ ten Teil aus den Schüttgütern her. Aus den unterschiedlichen Füllständen ergeben sich zahlreiche Laststellungen, die mit verschiedenen Lastmodellen erfasst werden. Hierbei stellen die Autoren auch Vergleiche mit Berechnungen nach der Vorgängernorm DIN 1055-6 an. Weiterhin beschäftigt sich der Beitrag mit anderen Einwirkungen auf Silos, z. B. durch Erdbeben. Im Zusammenhang mit der Bemessung von Silotragwerken werden insbesondere Stabilitätsprobleme behandelt.
Durchaus kritisch betrachten Dr.-Ing. Peter Knödel, Dipl.-Ing. Andrea Heß, beide IB Knödel, und Prof. Dr.-Ing. Thomas Ummenhofer, KIT, in Stählerne Tankbauwerke nach DIN EN 1993-4-2 die Norm, da zu einer umfassenden Tankberechnung nach wie vor zahlreiche weitere Regelwerke herangezogen werden müssen, beispielsweise DIN EN 14015 oder auch das Merkblatt VdTÜV-960. Im Hinblick auf die Berechnung eines Tanks gehen die Autoren zunächst auf die spezifischen Einwirkungen ein, insbesondere Flüssigkeitslasten, Wind- und Schneelasten, Imperfektionen sowie auß ergewöhnliche Lasten, Störfälle und Katastrophen. Ein ausführliches Kapitel ist der Schnittgröß enermittlung und den Bemessungskonzepten gewidmet.Weitere Abschnitte behandeln die einzelnen Bauteile der Tankbauwerke: die zylindrische Tankwand, die Dachkonstruktion, der Tankfuß sowie die Gründung und die Ausrüstung.
Im Kommentar zu DIN EN 1993-5: Pfähle und Spundwände geben M. Sc. Christine Mohler und Dr.-Ing. Alex Schmitt, Fa. ArcelorMittal, einen sehr guten Überblick zur Anwendung des Eurocode 3 an der Schnittstelle zwischen Geotechnik und Stahlbau. Die gültigen Empfehlungen deutscher Standardwerke wie EAB und EAU nehmen Bezug auf Eurocode 3 für den Stahlbau einerseits und auf Eurocode 7 für die Geotechnik andererseits. Die Autoren folgen in ihrer Kommentierung der Gliederung des Eurocode 3 Teil 5, der vor allem zusätzliche Regeln gegenüber den übrigen Normenteilen Eurocode 3 enthält. So wird unter dem Stichwort „Werkstoffe“ auf den Einsatz von speziellen Stahlsorten bei Spundwänden eingegangen und unter dem Titel „Dauerhaftigkeit“ werden die besonderen Korrosionsschutzmaß nahmen behandelt. Im Abschnitt „Grenzzustände der Tragfähigkeit“ werden für die verschiedenen Bauformen wie Spundwände, Tragpfähle und kombinierte Wände sehr kompakt die maß gebenden Nachweise erläutert. Gerade in den Abschnitten „Anker, Gurtungen, Aussteifungen und Anschlüsse“ und auch „Ausführung“ wird deutlich, dass hier nicht nur die Stahlbauregeln, sondern auch andere Regelungen wie z. B. DIN EN 1537 zu Verpressankern oder DIN EN 1997 zu beachten sind.
Prof. Dr.-Ing. habil. Hartmut Pasternak, BTU Cottbus, und Prof. Dr.-Ing. Hans-Ullrich Hoch, Hochschule Wismar, gehen in ihrem Beitrag nach einem historischen Abriss über den Einsatz von Stahl im Industriebau auf die verschiedenen Bauformen wie Hallentragwerke, mehrgeschossige Industriebauwerke und Industriebrücken für Rohrleitungen und Transportbänder ein. Neben Hinweisen zur Systemgestaltung und konstruktiven Ausführung werden an vielen Stellen konkrete ausgeführte Beispiele gezeigt.
Ein Industriebau besonderer Art wird in dem Beitrag Kraftwerke von Prof. Dr.-Ing. Ralf Steinmann, Darmstadt, Dipl.-Ing. Norbert Kleese, Hitachi Power Europe, Dr.-Ing. Hauke Grages, Donges SteelTec, Dipl.-Ing. Michael Krumpholz, Plauen Stahl Technologie, sowie Dr.-Ing. Johann Köppl und Dipl.-Ing. Andreas Köppl, Rosenheim, und ihren Mitautoren Dipl.-Ing. Johann Bleiziffer, Dipl.-Ing. Jürgen Kiefer, Dipl.-Ing. Joachim Hartwich, Dipl.-Ing. Thorsten Nicolay behandelt. Diese Autorengruppe aus der Praxis konzentriert sich dabei auf das Dampferzeugergebäude von Kohlekraftwerken. Dem grundlegenden Überblick über die Funktionsweise eines solchen Kraftwerks folgen Erläuterungen zur Tragwerksplanung und konstruktiven Durchbildung von Kesselgerüst und Tragrost. Darüber hinaus gehen die Autoren ausführlich auf die Projektlogistik ein, die bei der Abwicklung solcher Groß projekte erforderlich ist. Ebenso werden Einblicke in die Anforderungen durch Produktionsabläufe und Qualitätssicherung gegeben, die eine enge Abstimmung zwischen Statik und Planung einerseits und Fertigung und Montage andererseits verlangen.
Die Beiträge zu den vielen verschiedenen Anwendungsgebieten des Stahlbaus verdeutlichen einmal mehr, wie vielfältig und weitgespannt das Gebiet ist, das heute durch eine einheitliche Bemessungsnorm Eurocode 3 abgedeckt wird. Auch wenn in einzelnen Bereichen die Umsetzung noch nicht vollständig vollzogen ist und gleichzeitig andere europäische oder auch noch deutsche Normen gelten, muss man die erbrachte Leistung anerkennen, so viele verschiedene Bereiche zu harmonisieren und nach einheitlichen und aufeinander abgestimmten Bemessungsregeln auszulegen. Es bleibt sicher noch einiges zu tun, um diesen ersten wichtigen Schritt zu vervollständigen. Aber je früher und je mehr Planer sich mit den europäischen Normen auseinandersetzen, umso eher kann mittelfristig eine auch für die Praxis in allen Einzelheiten befriedigende Gesamtlösung entstehen. In diesem Sinne leistet dieser Band nicht nur Information, sondern auch Anregung zur Diskussion und Weiterentwicklung des Normenwerkes.
Ich darf mich bei allen Autoren und Mitarbeitern im Institut und beim Verlag Ernst & Sohn herzlich für ihren Einsatz bedanken. Auch möchte ich alle Interessenten wieder zum Stahlbau-Kalender-Tag am Freitag, 28. Juni 2013 in Stuttgart einladen, bei dem die Autoren aus ihren Beiträgen vortragen und zur Diskussion zur Verfügung stehen.
Stuttgart, Februar 2013Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann
Verzeichnis der Autoren und Herausgeber
Autoren
Dipl.-Ing. Johann BleizifferKöppl IngenieurePlanung und Beratung im Bauwesen GmbHSteinbökstraße 183022 Rosenheim
Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Bettina BruneTechnische Universität DortmundLehrstuhl StahlbauAugust-Schmidt-Straße 644227 Dortmund
Dr.-Ing. Mathias ClobesTechnische Universität BraunschweigInstitut für StahlbauBeethovenstraße 5138106 Braunschweig
Dr.-Ing. Jörg FrickelMeyer + SchubartPartnerschaft Beratender Ingenieure VBIHauptstraße 4531515 Wunstorf
Dr.-Ing. Hauke GragesDonges SteelTec GmbHGeschäftsbereichsleiter KraftwerkeMainzer Straße 5564293 Darmstadt
Dipl.-Ing. Joachim HartwichDonges SteelTec GmbHMontageMainzer Straße 5564293 Darmstadt
Dipl.-Ing. Andrea HeßIngenieurbüro Dr. KnödelPeterhofstraße 3b86438 Bad Kissingen
Prof. Dr.-Ing. Hans-Ullrich HochHochschule WismarFakultät IngenieurwissenschaftenBereich BauingenieurwesenPhilipp-Müller-Straße 1423966 Wismar
Dr.-Ing. Martin KaldenhoffHHW Gesellschaft Beratender Ingenieure mbHWolfenbütteler Straße 31B38102 Braunschweig
Dr.-Ing. Karsten KathageDeutsches Institut für Bautechnik (DIBt)Referat Metallbau und VerbundbauKolonnenstraße 30B10829 Berlin
Dipl.-Ing. Jürgen KieferDonges SteelTec GmbHTechnisches BüroMainzer Straße 5564293 Darmstadt
Dipl.-Ing. Norbert KleeseHitachi Power Europe GmbHSchifferstraße 8047059 Duisburg
Dr.-Ing. Peter KnödelIngenieurbüro Dr. KnödelVordersteig 5276275 Ettlingen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas KöpplKöppl IngenieurePlanung und Beratung im Bauwesen GmbHSteinbökstraße 183022 Rosenheim
Dr.-Ing. Johann KöpplKöppl IngenieurePlanung und Beratung im Bauwesen GmbHSteinbökstraße 183022 Rosenheim
Dipl.-Ing. (FH) Michael KrumpholzPlauen Stahl Technologie GmbHAnlagenbauHammerstraße 8808529 Plauen
Prof. Dr.-Ing. Ulrike KuhlmannUniversität StuttgartInstitut für Konstruktion und EntwurfPfaffenwaldring 770569 Stuttgart
M. Sc. Christine MohlerArcelorMittalPiling Products DepartmentResearch & Development66, Rue de Luxembourg4009 Esch-sur-AlzetteLuxemburg
Dipl.-Ing. Thorsten NicolayDonges SteelTec GmbHMainzer Straße 5564293 Darmstadt
Dipl.-Ing. Christoph OrtmannDeutsches Institut für Bautechnik (DIBt)Referat I 3Kolonnenstraße 30B10829 Berlin
Prof. Dr.-Ing. Hartmut PasternakBTU CottbusLehrstuhl für StahlbauUniversitätsplatz 3–403044 Cottbus
Prof. Dr.-Ing. Udo PeilFörsterkamp 938302 Wolfenbüttel
Dr.-Ing. Cornelius RuckenbrodSMP-Ingenieure im Bauwesen GmbHStephanienstraße 10276133 Karlsruhe
Dr.-Ing. Wolfram SchleicherIngenieurbüro Dr. SchleicherAm Wasserturm 115732 Eichwalde
Dipl.-Ing. Sivo Schillingbauforumstahl e.V.Gutsmuthsstraße 2312163 Berlin
Dr.-Ing. Christina Schmidt-RascheIng.-büro Prof. Dr.-Ing. Ulrike KuhlmannBürogemeinschaft Kuhlmann Gerold Günther EiseleFelix-Wankel-Straße 673760 Ostfildern
Dr.-Ing. Alex SchmittArcelorMittalPiling Products DepartmentResearch & Development66, Rue de Luxembourg4009 Esch-sur-AlzetteLuxemburg
Dipl.-Ing. Stephan SchneiderTechnische Universität DortmundLehrstuhl für StahlbauAugust-Schmidt-Straße 644221 Dortmund
Dipl.-Ing. Ralf SchubartMeyer + SchubartPartnerschaft Beratender Ingenieure VBIHauptstraße 4531515 Wunstorf
Dipl.-Ing. Antje SchumannMeyer + SchubartPartnerschaft Beratender Ingenieure VBIHauptstraße 4531515 Wunstorf
Prof. Dr.-Ing. Ralf SteinmannStahlbau Planung und Beratung SteinmannHeinrich-Delp-Straße 8364297 Darmstadt
Prof. Dr.-Ing. Thomas UmmenhoferKarlsruher Institut für Technologie – KITAbt. Stahl- und LeichtbauOtto-Ammann-Platz 776131 Karlsruhe
Prof. Dr.-Ing. Dieter UngermannTechnische Universität DortmundFakultät BauwesenLehrstuhl für StahlbauAugust-Schmidt-Straße 644221 Dortmund
Dipl.-Ing. Antonio ZizzaUniversität StuttgartInstitut für Konstruktion und EntwurfPfaffenwaldring 770569 Stuttgart
Herausgeberin
Prof. Dr.-Ing. Ulrike KuhlmannUniversität StuttgartInstitut für Konstruktion und EntwurfPfaffenwaldring 770569 Stuttgart
Verlag
Ernst & Sohn Verlag für Architektur undtechnische Wissenschaften GmbH & Co. KGRotherstraße 2110245 BerlinTel. (0 30) 47 03 12 00Fax (0 30) 47 03 12 70E-Mail: [email protected]
Inhaltsübersicht früherer Jahrgänge
Ein Rechercheprogramm für alle erschienenen Ausgaben des Stahlbau-Kalenders steht seit Mai 2003 auf der Homepage des Verlages zur Verfügung.
Stahlbau-Kalender 1999
Stahlbaunormung – heute und in ZukunftHorst J. Bossenmayer
Stahlbaunormen – Kommentierte StahlbauregelwerkeHelmut Eggert
Stahlbaunormen – Erläuterungen und Beispiele zurAnwendung der StahlbaugrundnormDietmar H. Maier
Beispiele aus dem VerbundhochbauUlrike Kuhlmann, Jürgen Fries,Hans-Peter Günther
Konstruktion und Bemessung von Dach- und Wandflächen aus StahlKnut Schwarze, Friedrich A. Lohmann
Bemessungshilfen für nachgiebige Stahlknoten mit StirnplattenanschlüssenFerdinand F. Tschemmernegg, Thomas Angerer, Matthias Frischhut
Glas im konstruktiven IngenieurbauÖmer Bucak
Deutscher Stahlbau-Verband
Stahlbau-Kalender 2000
Stahlbaunormen – Kommentierte StahlbauregelwerkeHelmut Eggert
Stahlbaunormen – Erläuterungen und Beispiele zuDIN 18800, Teil 3Bettina Brune
Neue Verbundbaunorm E DIN 18800-5 mitKommentar und BeispielenGerhard Hanswille, Reinhard Bergmann
Bemessung von Flachdecken und HutprofilenUlrike Kuhlmann, Jürgen Fries,Michael Leukart
Brandsicherheit von StahlverbundtragwerkenMario Fontana
Korrosionsschutz von StahlbautenWerner Katzung
Baubetrieb im Stahl- und VerbundbauJörg Lange
Bauen mit SeilenUdo Peil
ArbeitnehmerüberlassungKarl Heinz Güntzer
Deutscher Stahlbau-Verband
Stahlbau-Kalender 2001
Stahlbaunormen – Kommentierte StahlbauregelwerkeHelmut Eggert
Stahlbaunormen – Neue VornormDIN V 18800-7 für die Ausführungvon Stahlbauten mit KommentarLothar Bär, Herbert Schmidt
Nationale brandschutztechnische BemessungPeter Schaumann
Ausgewählte Trägeranschlüsse im VerbundbauUlrike Kuhlmann, Kai Kürschner
Stähle für den Stahlbau – Auswahl und Anwendung in der PraxisRalf Hubo, Falko Schröter
Nichtrostende Stähle im BauwesenHelmut Saal, Gerhard Steidl
Guss im BauwesenFriedrich Mang, Stefan Herion
Patent- und Urheberrechte des AuftragnehmersKarl Heinz Güntzer
Stahlbau-Kalender 2002
Stahlbaunormen – Kommentierte StahlbauregelwerkeHelmut Eggert
Stahlbaunormen – Beulsicherheitsnachweisefür Schalen nach DIN 18800 Teil 4,E-DASt-Richtlinie 017 und DIN V ENV 1993-1-6Herbert Schmidt
Geschraubte VerbindungenUwe Hasselmann, Günther Valtinat
Stahl im HochhausbauJörg Lange, Jörrit Kleinschmitt
Geschossdecken mit ProfilblechenIngeborg Sauerborn, Norbert Sauerborn
Hohlprofilkonstruktionen im Geschossbau – Ausblick auf die europäische NormungRam Puthli
Vergaberecht in der BundesrepublikDeutschlandKarl Heinz Güntzer
Deutscher Stahlbau-Verband
Stahlbau-Kalender 2003
Europäische Harmonisierung für Bauprodukte – Technische BaubestimmungenHorst J. Bossenmayer, Matthias Springborn
Stahlbaunormen – Kommentierte StahlbauregelwerkeHelmut Eggert
Stahlbaunormen – Neue Norm DIN 18800-7 – Stahlbauten-Ausführung und Herstellerqualifikation – mit KurzkommentarenLothar Bär, Herbert Schmidt
Interaktion Bauwerk – BaugrundNorbert Vogt
Kranbahnen und BetriebsfestigkeitUlrike Kuhlmann, Andrè Dürr, Hans-Peter Günther
StahlhallenIngbert Mangerig, Cedrik Zapfe
FassadenÖmer Bucak, Franz Heger
Windlasten auf BauwerkeUdo Peil, Hans-Jürgen Niemann
Insolvenzen vermeiden – Nachträge durchsetzenKarl Heinz Güntzer
Stahlbau-Kalender 2004
Stahlbaunormen – Kommentierte StahlbauregelwerkeHelmut Eggert
Stahlbaunormen – DASt-Richtlinie 019 – Brandsicherheit von Stahl- und Verbundbauteilen in Büro und VerwaltungsgebäudenPeter Schaumann, Alexander Heise, Klaus Veenker
Schweißen im StahlbauChristian Ahrens, Rainer Zwätz
Schlanke StabtragwerkeJoachim Lindner, Stefan Heyde
Träger mit profilierten StegenHartmut Pasternak, Dina Hannebauer
Maste und TürmeUdo Peil
GerüstbauGerald Ast, Gerhard E. VölkelRadioteleskopeHans Jürgen Kärcher
MembrantragwerkeKnut Göppert
Sicherheitsleistungen durch Bürgschaften und ihreKostenKarl Heinz Güntzer
Stahlbau-Kalender 2005
Stahlbaunormen – Kommentierte StahlbauregelwerkeHelmut Eggert
Stahlbaunormen – Verbundtragwerke aus Stahl und Beton, Bemessung und Konstruktion – Kommentar zu DIN V 18800-5, Ausgabe November 2004Gerhard Hanswille, Markus Schäfer
Mchanische Verbundmittel für Verbundträger aus Stahl und BetonKai Kürschner, Ulrike Kuhlmann
Betondübel im VerbundbauIngbert Mangerig, Cedrik Zapfe, Sascha Burger
Momententragfähige Anschlüsse mit und ohne SteifenDieter Ungermann, Klaus Weynand, Jean-PierreJaspart, Björn Schmidt
Setzbolzen im StahlbauHermann Beck, Martin Reuter
Zugstäbe und ihre AnschlüsseKarsten Kathage, Daniel C. Ruff,Thomas Ummenhofer
Kleben von StahlHartmut Pasternak, Anja Schwarzlos
Kleben im GlasbauAnneliese Hagl
Erdbebenschutzsysteme für den Hoch- und Brückenbau
Christian Petersen, Hans Beutler, Christian Braun, Ingbert Mangerig
Steigende Materialpreise – betriebswirtschaftliche und juristische AspekteKarl Heinz Güntzer
Stahlbau-Kalender 2006
Stahlbaunormen – Kommentierte StahlbauregelwerkeHelmut Eggert, Gesche Henke
Stahlbaunormen – DIN 18800-7 Stahlbauten – Ausführung und Herstellerqualifikation – mit KurzkommentarenLothar Bär, Herbert Schmidt
Stahlbaunormen – DIN 18800-7 Stahlbauten – Ausführung und Herstellerqualifikation – EntwurfA1-ÄnderungVolker Hüller
Stahlbaunormen – DASt-Richtlinie 009 Stahlsortenauswahl für geschweißte Stahlbauten – KommentarBertram Kühn, Gerhard Sedlacek
Grundlagen und Erläuterung der neuen Ermüdungsnachweise nach Eurocode 3Alain Nussbaumer, Hans-Peter Günther
Bewertung bestehender StahlbrückenKarsten Geißler, Wolfgang Graße,Klaus Brandes
Die Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) und derenBewertung im StahlbauKarl-Heinz Fischer, Helmut Schmeink
Korrosionsschutz von StahlbautenWerner Katzung
Zylindrische Behälter aus Stahl – Bemessungskonzept und statische TragwirkungRichard Greiner, Andreas Taras
StahlwasserbauWilfried Meinhold, Ulrike Gabrys, Claus Kunz,Günter Binder, Manfred Baumann
Präqualifikation von BauunternehmenKarl Heinz Güntzer
Stahlbau-Kalender 2007
Stahlbaunormen – Kommentierte StahlbauregelwerkeHelmut Eggert, Gesche Henke
Stähle für den Stahlbau – Anwendung moderner Baustähle und Neuerungen im RegelwerkFalko Schröter
Nichtrostende Stähle nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6Helmut Saal, Detlef Ulbrich, Michael Volz
Konstruieren mit AluminiumDimitris Kosteas, Christina Radlbeck
Guss im BauwesenStefan Herion
Faserverbundwerkstoffe im BauwesenJan Knippers, Markus Gabler
Konstruktiver Glasbau – Grundlagen und BemessungGeralt Siebert, Tobias Herrmann, Andreas Haese
Tragstrukturen für WindenergieanlagenPeter Schaumann, Cord Böker, Tim Rutkowski, Fabian Wilke
CAD im Stahlbau – Bestandsaufnahme und AusblickHans-Walter Haller, Klaus Thiele,Hans-Ulrich Batzke, Alfred Asam
Gewährleistung des BauunternehmersKarl Heinz Güntzer
Stahlbau-Kalender 2008
Stahlbaunormen – Kommentierte Stahlbauregelwerke, Neufassung DIN 18800Sascha Hothan, Gesche Voith
SchweißenChristian Ahrens, Rainer Zwätz
Baudynamik für die PraxisUdo Peil
Dynamische WindwirkungenUdo Peil, Mathias Clobes
Tragverhalten, Auslegung und Nachweise von Stahlhochbauten in ErdbebengebietenIoannis Vayas
Stahlkonstruktionen unter ExplosionsbeanspruchungMarcus P. Rutner, Norbert Gebbeken,Ingbert Mangerig, Oliver Zapfe, Rüdiger Müller,Matthias Wagner, Achim Pietzsch, Martin Mensinger
Dynamik von EisenbahnbrückenLamine Bagayoko, Eckart Koch, Rüdiger Patz
Personeninduzierte Schwingungen von FußgängerbrückenChristiane Butz, Johann Distl
Schwingungsanfällige Zugglieder im BrückenbauKarl G. Schütz, Michael Schmidmeier,Ralf Schubart, Jörg Frickel, Antje Schumann
Glas im konstruktiven IngenieurbauÖmer Bucak, Christian Schuler
Rissbildung durch Flüssigmetallversprödung beimFeuerverzinken von StahlkonstruktionenMarkus Feldmann, Thomas Pinger,Dirk Tschickardt, Peter Langenberg,Peter Karduck, Alexander Freiherr von Richthofen
Haftung für Schäden an StahlkonstruktionenKarl Heinz Güntzer
Stahlbau-Kalender 2009
Stahlbaunormen – Kommentierte StahlbauregelwerkeSascha Hothan
Schlanke StabtragwerkeJoachim Lindner, Stefan Heyde
Bemessung und Konstruktion von aus Blechen zusammengesetzten Bauteilen nach DIN EN 1993-1-5Benjamin Braun, Ulrike KuhlmannKaltgeformte, dünnwandige Bauteile und Bleche ausStahl nach DIN EN 1993-1-3 – Hintergründe,Bemessung und BeispieleBettina Brune, Jens Kalameya
Stabilität stählerner SchalentragwerkeHerbert Schmidt
Einwirkungen auf Silos aus MetallwerkstoffenCornelius Ruckenbrod, Martin Kaldenhoff,
MembrantragwerkeKnut Göppert, Markus Balz
Stahlprofiltafeln für Dächer und WändeKnut Schwarze, Oliver Raabe
Gerüstbau – Stabilität und statisch-konstruktiveAspekteRobert Hertle
Dynamisches Verhalten von Lamellen-DehnfugenJoachim Braun, Johan Sebastian Leendertz,Tobias Schulze, Bernd Urich, Bernard Volk
Stahlpreise (Stand: 01.01.2009)Karl Heinz Güntzer, Peter Hammacher
Stahlbau-Kalender 2010
Stahlbaunormen – Kommentierte StahlbauregelwerkeSascha Hothan, Christoph Ortmann, Karsten Kathage
Stahlbaunormen – Verbundtragwerke aus Stahl undBeton, Bemessung und Konstruktion – Kommentar zu DIN 18800-5 Ausgabe März 2007Gerhard Hanswille, Markus Schäfer, Marco Bergmann
VerbundstützenNorbert Sauerborn, Joachim Kretz
Verbundträger und DeckensystemeWolfgang Kurz, Martin Mensinger, ChristianKohlmeyer, Ingeborg Sauerborn, Norbert Sauerborn
Verbundanschlüsse nach EurocodeUlrike Kuhlmann, Lars Rölle
Sandwichelemente im HochbauJörg Lange, Klaus Berner
Sanierung von Vorhangfassaden der 1950er- bis 1970er-JahreBernhard Weller, Sven Jakubetz, Friedrich May, Anja Meier
Feuerverzinken von tragenden Stahlbauteilen nachDASt-Richtlinie 022 und Bewertung verzinkterStahlkonstruktionenMarkus Feldmann, Dirk Schäfer, Gerhard Sedlacek
Stahlbau-Kalender 2011
Europarechtliche Regelungen und ihre Auswirkungen auf nationale Verordnungen und die BaupraxisGerhard Scheuermann
Stahlbaunormen – DIN EN 1993-1-1: AllgemeineBemessungsregeln und Regeln für den HochbauUlrike Kuhlmann, Antonio Zizza
Stahlbaunormen – DIN EN 1993-1-8: Bemessung von AnschlüssenDieter Ungermann, Stephan Schneider
Technische Baubestimmungen, Normen, Bauregellisten und Zulassungen im StahlbauKarsten Kathage, Christoph Ortmann
Ausführung geschraubter Verbindungen nach DIN EN 1090-2Herbert Schmidt, Natalie Stranghöhner
Änderungen bei der Ausführung geschweißterKonstruktionen nach DIN EN 1090Jörg Mährlein, Rainer Zwätz
Anschlüsse mit Hohlprofilen nach DIN EN 1993-1-8 – Hintergrund, Kommentare, BeispieleRam Puthli, Thomas Ummenhofer, Jaap Wardenier, Ina Pertermann
Zugstäbe und ihre AnschlüsseThomas Ummenhofer, Thomas Misiek, Karsten Kathage
Setzbolzen und MetallschraubenHermann Beck, Michael Siemers, Martin Reuter
Kleben im konstruktiven GlasbauBernhard Weller, Michael Kothe, Felix Nicklisch,Thomas Schadow, Silke Tasche, Iris Vogt, Jan Wünsch
Zur Dokumentation von Tragwerksplanung, Standsicherheit und Werkstattplanung von Stahlbauten – Die neue „Richtlinie zur statischen Berechnung von Stahlbauten“ und die „Richtlinie zur Erstellung von Ausführungsunterlagen (Herstellungsunterlagen) für Stahlbauten“Ralf Steinmann
Überarbeitung der ATV DIN 18335 „Stahlbauarbeiten“ – mit den Texten der im Beitrag zitierten Gesetze Karl Heinz Güntzer
Stahlbau-Kalender 2012
Stahlbaunormen – DIN EN 1993-1-1: AllgemeineBemessungsregeln und Regeln für den HochbauUlrike Kuhlmann, Antonio Zizza
Stahlbaunormen – DIN EN 1993-1-5: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – PlattenförmigeBauteileUlrike Kuhlmann, Antonio Zizza, Benjamin Braun
Stahlbaunormen – Kommentar zu DIN EN 1993-1- 6: Festigkeit und Stabilität von SchalenHerbert Schmidt
Stahlbaunormen – Kommentar zu DIN EN 1993-1-8:Bemessung von AnschlüssenDieter Ungermann, Stephan Schneider
Stahlbaunormen – Kommentar zu DIN EN 1993-1-9:ErmüdungAlain Nussbaumer, Hans-Peter Günther
Stahlbaunormen – Kommentar zu DIN EN 1993-1-10:Stahlsortenauswahl im Hinblick auf Bruchzähigkeit und Eigenschaften in DickenrichtungBertram Kühn, Natalie Stranghöner, Gerhard Sedlacek, Susanne Höhler
Technische Baubestimmungen, Normen, Bauregellisten und Zulassungen im StahlbauKarsten Kathage, Christoph Ortmann
Einwirkungen auf TragwerkeGerhard Scheuermann, Vera Häusler
Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen durchBeschichtungssystemeAndreas Gelhaar, Andreas Schneider
Fertigung und Montage von Stahl- und VerbundbrückenAlexander Baum, Gerald Eckersberg, Stephan Langer,Dieter Reitz, Frank Sachse, Oliver Schreiber,Klaus Thiele
Dynamik bei EisenbahnbrückenLamine Bagayoko, Karsten Geißler, Eckart Koch
BrückenseileHeinz Friedrich, Markus Hamme, Arnold Hemmert-Halswick, Reiner Saul
Brückenlager nach Europäischer NormChristiane Butz, Christian Braun
Fahrbahnübergänge nach Europäischer ZulassungJoachim Braun, Jens Tusche
Anregungen zur Gestaltung von StahlbrückenRichard J. Dietrich
1
Stahlbaunormen
DIN EN 1993-1-8: Bemessung von Anschlüssen
Prof. Dr.-Ing. Dieter Ungermann
Dipl.-Ing. Stephan Schneider
Inhaltsverzeichnis
Anmerkung zum Abdruck von DIN EN 1993-1-8
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen
Nationales Vorwort
Hintergrund des Eurocode-Programms
Status und Gültigkeitsbereich der Eurocodes
Nationale Fassungen der Eurocodes
Verbindung zwischen den Eurocodes und den harmonisierten Technischen Spezifikationen für Bauprodukte (EN und ETAZ)
Nationaler Anhang zu EN 1993-1-8
1 Allgemeines
1.1 Anwendungsbereich
1.2 Normative Verweisungen
1.2.1 Bezugsnormengruppe 1: Schweißgeeignete Baustähle
1.2.2 Bezugsnormengruppe 2: Toleranzen, Maße und technische Lieferbedingungen
1.2.3 Bezugsnormengruppe 3: Hohlprofile
1.2.4 Bezugsnormengruppe 4: Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
1.2.5 Bezugsnormengruppe 5: Schweißzusatzmittel und Schweißen
1.2.6 Bezugsnormengruppe 6: Niete
1.2.7 Bezugsnormengruppe 7: Bauausführung von Stahlbauten
1.3 Unterscheidung nach Grundsätzen und Anwendungsregeln
1.4 Begriffe
1.5 Formelzeichen
2 Grundlagen der Tragwerksplanung
2.1 Annahmen
2.2 Allgemeine Anforderungen
2.3 Schnittgrößen
2.4 Beanspruchbarkeit von Verbindungen
2.5 Annahmen für die Berechnung
2.6 Schubbeanspruchte Anschlüsse mit Stoßbelastung, Belastung mit Schwingungen oder mit Lastumkehr
2.7 Exzentrizitäten in Knotenpunkten
3 Schrauben-, Niet- und Bolzenverbindungen
3.1 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
3.1.1 Allgemeines
3.1.2 Vorgespannte Schrauben
3.2 Niete
3.3 Ankerschrauben
3.4 Kategorien von Schraubenverbindungen
3.4.1 Scherverbindungen
3.4.2 Zugverbindungen
3.5 Rand- und Lochabstände für Schrauben und Niete
3.6 Tragfähigkeiten einzelner Verbindungsmittel
3.6.1 Schrauben und Niete
3.6.2 Injektionsschrauben
3.7 Gruppen von Verbindungsmitteln
3.8 Lange Anschlüsse
3.9 Gleitfeste Verbindungen mit hochfesten 8.8 oder 10.9 Schrauben
3.9.1 Gleitwiderstand
3.9.2 Kombinierte Scher- und Zugbeanspruchung
3.9.3 Hybridverbindungen
3.10 Lochabminderungen
3.10.1 Allgemeines
3.10.2 Blockversagen von Schraubengruppen
3.10.3 Einseitig angeschlossene Winkel und andere unsymmetrisch angeschlossene Bauteile unter Zugbelastung
3.10.4 Anschlusswinkel für indirekten Anschluss
3.11 Abstützkräfte
3.12 Kräfteverteilung auf Verbindungsmittel im Grenzzustand der Tragfähigkeit
3.13 Bolzenverbindungen
3.13.1 Allgemeines
3.13.2 Bemessung der Bolzen
4 Schweißverbindungen
4.1 Allgemeines
4.2 Schweißzusätze
4.3 Geometrie und Abmessungen
4.3.1 Schweißnahtarten
4.3.2 Kehlnähte
4.3.3 Schlitznähte
4.3.4 Stumpfnähte
4.3.5 Lochschweißungen
4.3.6 Hohlkehlnähte
4.4 Schweißen mit Futterblechen
4.5 Beanspruchbarkeit von Kehlnähten
4.5.1 Schweißnahtlänge
4.5.2 Wirksame Nahtdicke
4.5.3 Tragfähigkeit von Kehlnähten
4.6 Tragfähigkeit von Schlitznähten
4.7 Tragfähigkeit von Stumpfnähten
4.7.1 Durchgeschweißte Stumpfnähte
4.7.2 Nicht durchgeschweißte Stumpfnähte
4.7.3 T-Stöße
4.8 Tragfähigkeit von Lochschweißungen
4.9 Verteilung der Kräfte
4.10 Steifenlose Anschlüsse an Flansche
4.11 Lange Anschlüsse
4.12 Exzentrisch belastete einseitige Kehlnähte oder einseitige nicht durchgeschweißte Stumpfnähte
4.13 Einschenkliger Anschluss von Winkelprofilen
4.14 Schweißen in kaltverformten Bereichen
5 Tragwerksberechnung, Klassifizierung und statische Modelle
5.1 Tragwerksberechnung
5.1.1 Allgemeines
5.1.2 Elastische Tragwerksberechnung
5.1.3 Starr-plastische Tragwerksberechnung
5.1.4 Elastisch-plastische Tragwerksberechnung
5.1.5 Berechnung von Fachwerkträgern
5.2 Klassifizierung von Anschlüssen
5.2.1 Allgemeines
5.2.2 Klassifizierung nach der Steifigkeit
5.2.3 Klassifizierung nach der Tragfähigkeit
5.3 Statisches Modell für Träger-Stützenanschlüsse
6 Anschlüsse mit H- oder I-Querschnitten
6.1 Allgemeines
6.1.1 Geltungsbereich
6.1.2 Kenngrößen
6.1.3 Grundkomponenten eines Anschlusses
6.2 Tragfähigkeit
6.2.1 Schnittgrößen
6.2.2 Querkräfte
6.2.3 Biegemomente
6.2.4 Äquivalenter T-Stummel mit Zugbeanspruchung
6.2.5 Äquivalenter T-Stummel mit Druckbeanspruchung
6.2.6 Tragfähigkeit der Grundkomponenten
6.2.7 Biegetragfähigkeit von Träger-Stützenanschlüssen und Stößen
6.2.8 Tragfähigkeit von Stützenfüßen mit Fußplatten
6.3 Rotationssteifigkeit
6.3.1 Grundmodell
6.3.2 Steifigkeitskoeffizienten für die Grundkomponenten eines Anschlusses
6.3.3 Stirnblechanschlüsse mit zwei oder mehr Schraubenreihen mit Zugbeanspruchung
6.3.4 Stützenfüße
6.4 Rotationskapazität
6.4.1 Allgemeines
6.4.2 Geschraubte Anschlüsse
6.4.3 Geschweißte Anschlüsse
7 Anschlüsse mit Hohlprofilen
7.1 Allgemeines
7.1.1 Geltungsbereich
7.1.2 Anwendungsbereich
7.2 Berechnung und Bemessung
7.2.1 Allgemeines
7.2.2 Versagensformen von Anschlüssen mit Hohlprofilen
7.3 Schweißnähte
7.3.1 Tragfähigkeit
7.4 Geschweißte Anschlüsse von KHP-Bauteilen
7.4.1 Allgemeines
7.4.2 Ebene Anschlüsse
7.4.3 Räumliche Anschlüsse
7.5 Geschweißte Anschlüsse von KHP- oder RHP-Streben an RHP-Gurtstäbe
7.5.1 Allgemeines
7.5.2 Ebene Anschlüsse
7.5.3 Räumliche Anschlüsse
7.6 Geschweißte Anschlüsse von KHP- oder RHP-Streben an I- oder H-Profil Gurtstäbe
7.7 Geschweißte Anschlüsse von KHP- oder RHP-Streben an U-Profil Gurtstäbe
Anhang NA.A (normativ)
Ergänzende Vorspannverfahren zu DIN EN 1090-2
Anhang NA.B (normativ)
Gussteile, Schmiedeteile und Bauteile aus Vergütungsstählen
Literatur zu den Kommentaren
Anmerkung zum Abdruck von DIN EN 1993-1-8
Auf den folgenden Seiten wird der Normentext von DIN EN 1993-1-8:2010-12 in zweispaltiger Darstellung wiedergegeben. Zusätzlich wird der Nationale Anhang DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12 und die „Zusätzlichen Regeln zur Erweiterung von DIN EN 1993 auf Stahlgüten bis S700“ nach DIN EN 1993-1-12:2010-12 mit dem zugehörigen Nationalen Anhang DIN EN 1993-1-12/NA:2010-10 an den jeweiligen Stellen im Normentext zitiert.
Um einen guten Lesefluss zu garantieren, wurde für die Darstellungsart Folgendes festgelegt. Der Normentext wird zweispaltig und durchgehend dargestellt. Auf eine besondere Kennzeichnung der Berichtigungen wird verzichtet. Textstellen aus dem Nationalen Anhang werden durch einen zur Blattmitte hin offenen, grauen Kasten gekennzeichnet. Links oben befindet sich dabei die Bezeichnung NDP (nationally determined parameters) für national festgelegte Parameter und NCI (non-contradictory complementary information) für ergänzende nicht widersprechende Angaben zur Anwendung von DIN EN 1993-1-8. Kommentare zum Normentext werden in einem grauen Kasten im unteren Bereich der rechten Spalte in serifenloser Schrift abgedruckt.
DIN EN 1993-1-8
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen
ICS 91.010.30; 91.080.10
Eurocode 3: Design of steel structures –
Part 1-8: Design of joints
Eurocode 3: Calcul des structures en acier –
Partie 1-8: Calcul des assemblages
Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 16. April 2004 angenommen.
Die Berichtigung tritt am 29. Juli 2009 in Kraft und wurde in EN 1993-1-8:2005 eingearbeitet.
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. Dieses Dokument ersetzt ENV 1993-1-1:1992.
Nationales Vorwort
Dieses Dokument (EN 1993-1-8:2005 +AC:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 250 „Eurocodes für den konstruktiven Ingenieurbau“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird.
Die Arbeiten auf nationaler Ebene wurden durch die Experten des NABau-Spiegelausschusses NA 005-08-16 AA „Tragwerksbemessung (Sp CEN/TC 250/SC 3)“ begleitet.
Die Norm ist Bestandteil einer Reihe von Einwirkungsund Bemessungsnormen, deren Anwendung nur im Paket sinnvoll ist. Dieser Tatsache wird durch das Leitpapier L der Kommission der Europäischen Gemeinschaft für die Anwendung der Eurocodes Rechnung getragen, indem Übergangsfristen für die verbindliche Umsetzung der Eurocodes in den Mitgliedstaaten vorgesehen sind. Die Übergangsfristen sind im Vorwort dieser Norm angegeben.
Die Anwendung dieser Norm gilt in Deutschland in Verbindung mit dem Nationalen Anhang.
Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.
Hintergrund des Eurocode-Programms
1975 beschloss die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, für das Bauwesen ein Programm auf der Grundlage des Artikels 95 der Römischen Verträge durchzuführen. Das Ziel des Programms war die Beseitigung technischer Handelshemmnisse und die Harmonisierung technischer Normen.
Im Rahmen dieses Programms leitete die Kommission die Bearbeitung von harmonisierten technischen Regelwerken für die Tragwerksplanung von Bauwerken ein, die im ersten Schritt als Alternative zu den in den Mitgliedsländern geltenden Regeln dienen und sie schließlich ersetzen sollten.
15 Jahre lang leitete die Kommission mit Hilfe eines Steuerkomitees mit Repräsentanten der Mitgliedsländer die Entwicklung des Eurocode-Programms, das zu der ersten Eurocode-Generation in den 80er Jahren führte.
Im Jahre 1989 entschieden sich die Kommission und die Mitgliedsländer der Europäischen Union und der EFTA, die Entwicklung und Veröffentlichung der Eurocodes über eine Reihe von Mandaten an CEN zu übertragen, damit diese den Status von Europäischen Normen (EN) erhielten. Grundlage war eine Vereinbarung1) zwischen der Kommission und CEN. Dieser Schritt verknüpft die Eurocodes de facto mit den Regelungen der Ratsrichtlinien und Kommissionsentscheidungen, die die Europäischen Normen behandeln (z. B. die Ratsrichtlinie 89/106/EWG zu Bauprodukten, die Bauproduktenrichtlinie, die Ratsrichtlinien 93/37/EWG, 92/50/EWG und 89/440/EWG zur Vergabe öffentlicher Aufträge und Dienstleistungen und die entsprechenden EFTA-Richtlinien, die zur Einrichtung des Binnenmarktes eingeleitet wurden).
Das Eurocode-Programm umfasst die folgenden Normen, die in der Regel aus mehreren Teilen bestehen:
EN 1990, Eurocode 0: Grundlagen der Tragwerksplanung;
EN 1991, Eurocode 1: Einwirkung auf Tragwerke;
EN 1992, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbetonbauten;
EN 1993, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten;
EN 1994, Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Stahl-Beton-Verbundbauten;
EN 1995, Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten;
EN 1996, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten;
EN 1997, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik;
EN 1998, Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben;
EN 1999, Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumkonstruktionen.
Die Europäischen Normen berücksichtigen die Verantwortlichkeit der Bauaufsichtsorgane in den Mitgliedsländern und haben deren Recht zur nationalen Festlegung sicherheitsbezogener Werte berücksichtigt, so dass diese Werte von Land zu Land unterschiedlich bleiben können.
Status und Gültigkeitsbereich der Eurocodes
Die Mitgliedsländer der EU und von EFTA betrachten die Eurocodes als Bezugsdokumente für folgende Zwecke:
Die Eurocodes haben, da sie sich auf Bauwerke beziehen, eine direkte Verbindung zu den Grundlagendokumenten2), auf die in Artikel 12 der Bauproduktenrichtlinie hingewiesen wird, wenn sie auch anderer Art sind als die harmonisierten Produktnormen3). Daher sind die technischen Gesichtspunkte, die sich aus den Eurocodes ergeben, von den Technischen Komitees von CEN und den Arbeitsgruppen von EOTA, die an Produktnormen arbeiten, zu beachten, damit diese Produktnormen mit den Eurocodes vollständig kompatibel sind.
Die Eurocodes liefern Regelungen für den Entwurf, die Berechnung und Bemessung von kompletten Tragwerken und Baukomponenten, die sich für die tägliche Anwendung eignen. Sie gehen auf traditionelle Bauweisen und Aspekte innovativer Anwendungen ein, liefern aber keine vollständigen Regelungen für ungewöhnliche Baulösungen und Entwurfsbedingungen, wofür Spezialistenbeiträge erforderlich sein können.
Nationale Fassungen der Eurocodes
Die Nationale Fassung eines Eurocodes enthält den vollständigen Text des Eurocodes (einschließlich aller Anhänge), so wie von CEN veröffentlicht, mit möglicherweise einer nationalen Titelseite und einem nationalen Vorwort sowie einem Nationalen Anhang.
Der Nationale Anhang darf nur Hinweise zu den Parametern geben, die im Eurocode für nationale Entscheidungen offen gelassen wurden. Diese national festzulegenden Parameter (NDP) gelten für die Tragwerksplanung von Hochbauten und Ingenieurbauten in dem Land, in dem sie erstellt werden. Sie umfassen:
Verbindung zwischen den Eurocodes und den harmonisierten Technischen Spezifikationen für Bauprodukte (EN und ETAZ)
Die harmonisierten Technischen Spezifikationen für Bauprodukte und die technischen Regelungen für die Tragwerksplanung4) müssen konsistent sein. Insbesondere sollten die Hinweise, die mit den CE-Zeichen an den Bauprodukten verbunden sind und die die Eurocodes in Bezug nehmen, klar erkennen lassen, welche national festzulegenden Parameter (NDP) zugrunde liegen.
Nationaler Anhang zu EN 1993-1-8
Diese Norm enthält alternative Methoden, Zahlenangaben und Empfehlungen in Verbindung mit Anmerkungen, die darauf hinweisen, wo Nationale Festlegungen getroffen werden können. EN 1993-1-8 wird bei der nationalen Einführung einen Nationalen Anhang enthalten, der alle national festzulegenden Parameter enthält, die für die Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten im jeweiligen Land erforderlich sind. Nationale Festlegungen sind bei folgenden Regelungen vorgesehen:
– 1.2.6 (Bezugsnormengruppe 6: Niete);
– 2.2(2);
– 3.1.1(3);
– 3.4.2(1);
– 5.2.1(2);
– 6.2.7.2(9).
1 Allgemeines
1.1 Anwendungsbereich
(1) EN 1993-1-8 enthält Regeln für den Entwurf, die Berechnung und die Bemessung von Anschlüssen aus Stahl mit Stahlsorten S235, S275, S355, S420, S450 und S460 unter vorwiegend ruhender Belastung.
1.2 Normative Verweisungen
(1) Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).
1.2.1 Bezugsnormengruppe 1: Schweißgeeignete Baustähle
EN 10025-1:2004, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen – Teil 1: Allgemeine Lieferbedingungen
EN 10025-2:2004, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen – Teil 2: Allgemeine Lieferbedingungen für unlegierte Baustähle
EN 10025-3:2004, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen – Teil 3: Technische Lieferbedingungen für normalgeglühte/normalisierend gewalzte schweißgeeignete Feinkornstähle
EN 10025-4:2004, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen – Teil 4: Technische Lieferbedingungen für thermomechanisch gewalzte schweißgeeignete Feinkornstähle
EN 10025-5:2004, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen – Teil 5: Technische Lieferbedingungen für wetterfeste Baustähle
EN 10025-6:2004, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen – Teil 6: Technische Lieferbedingungen für Flacherzeugnisse aus Stählen mit höherer Streckgrenze im vergüteten Zustand
1.2.2 Bezugsnormengruppe 2: Toleranzen, Maße und technische Lieferbedingungen
EN 10029:1991, Warmgewalztes Stahlblech von 3mm Dicke an – Grenzabmaße, Formtoleranzen, zulässige Gewichtsabweichungen
EN 10034:1993, I- und H-Profile aus Baustahl – Grenzabmaße und Formtoleranzen
EN 10051:1991, Kontinuierlich warmgewalztes Blech und Band ohne Überzug aus unlegierten und legierten Stählen – Grenzabmaße und Formtoleranzen (enthält Änderung A1:1997)
EN 10055:1995, Warmgewalzter gleichschenkliger T-Stahl mit gerundeten Kanten und Übergängen – Maße, Grenzabmaße und Formtoleranzen
EN 10056-1:1998, Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel aus Stahl – Teil 1: Maße
EN 10056-2:1993, Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel aus Stahl – Teil 2: Grenzabmaße und Formtoleranzen
EN 10164:1993, Stahlerzeugnisse mit verbesserten Verformungseigenschaften senkrecht zur Erzeugnisoberfläche – Technische Lieferbedingungen
1.2.3 Bezugsnormengruppe 3: Hohlprofile
EN 10219-1:1997, Kaltgefertigte geschweißte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen – Teil 1: Technische Lieferbedingungen
EN 10219-2:1997, Kaltgefertigte geschweißte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen – Teil 2: Grenzabmaße, Maße und statische Werte
EN 10210-1:1994, Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen – Teil 1: Technische Lieferbedingungen
EN 10210-2:1997, Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen – Teil 2: Grenzabmaße, Maße und statische Werte
1.2.4 Bezugsnormengruppe 4: Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
EN 14399-1:2002, Hochfeste planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau – Teil 1: Allgemeine Anforderungen.
EN 14399-2:2002, Hochfeste planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau – Teil 2: Prüfung der Eignung zum Vorspannen
EN 14399-3:2002, Hochfeste planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau – Teil 3: System HR; Garnituren aus Sechskantschrauben und -muttern
EN 14399-4:2002, Hochfeste planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau – Teil 4: System HV; Garnituren aus Sechskantschrauben und -muttern
EN 14399-5:2002, Hochfeste planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau – Teil 5: Flache Scheiben für System HR
EN 14399-6:2002, Hochfeste planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau – Teil 6: Flache Scheiben mit Fase für die Systeme HR und HV
EN ISO 898-1:1999, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl – Teil 1: Schrauben (ISO 898-1:1999)
EN 20898-2:1993, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen – Teil 2: Muttern mit festgelegten Prüfkräften – Regelgewinde (ISO 898-2:1992)
EN ISO 2320:1997, Sechskantmuttern aus Stahl mit Klemmteil – Mechanische und funktionelle Eigenschaften (ISO 2320:1997)
EN ISO 4014:2000, Sechskantschrauben mit Schaft – Produktklassen A und B (ISO 4014:1999)
EN ISO 4016:2000, Sechskantschrauben mit Schaft – Produktklasse C (ISO 4016:1999)
EN ISO 4017:2000, Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf – Produktklassen A und B (ISO 4017:1999)
EN ISO 4018:2000, Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf – Produktklasse C (ISO 4018:1999)
EN ISO 4032:2000, Sechskantmuttern, Typ 1 – Produktklassen A und B (ISO 4032:1999)
EN ISO 4033:2000, Sechskantmuttern, Typ 2 – Produktklassen A und B (ISO 4033:1999)
EN ISO 4034:2000, Sechskantmuttern – Produktklasse C (ISO 4034:1999)
EN ISO 7040:1997, Sechskantmuttern mit Klemmteil (mit nichtmetallischem Einsatz), Typ 1 – Festigkeitsklassen 5, 8 und 10 (ISO 7040:1997)
EN ISO 7042:1997, Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern), Typ 2 – Festigkeitsklassen 5, 8, 10 und 12 (ISO 7042:1997)
EN ISO 7719:1997, Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern), Typ 1 – Festigkeitsklassen 5, 8 und 10 (ISO 7719:1997)
ISO 286-2:1988, ISO-System für Grenzmaße und Passungen – Tabellen der Grundtoleranzgrade und Grenzabmaße für Bohrungen und Wellen
ISO 1891:1979, Mechanische Verbindungselemente; Schrauben, Muttern und Zubehör, Benennungen
EN ISO 7089:2000, Flache Scheiben – Normale Reihe, Produktklasse A (ISO 7089:2000)
EN ISO 7090:2000, Flache Scheiben mit Fase – Normale Reihe, Produktklasse A (ISO 7090:2000)
EN ISO 7091:2000, Flache Scheiben – Normale Reihe, Produktklasse C (ISO 7091:2000)
EN ISO 10511:1997, Sechskantmuttern mit Klemmteil – Niedrige Form (mit nichtmetallischem Einsatz) (ISO 10511:1997)
EN ISO 10512:1997, Sechskantmuttern mit Klemmteil (mit nichtmetallischem Einsatz), Typ 1, mit metrischem Feingewinde – Festigkeitsklassen 6, 8 und 10 (ISO 10512:1997)
EN ISO 10513:1997, Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern), Typ 2, mit metrischem Feingewinde – Festigkeitsklassen 8, 10 und 12 (ISO 10513:1997)
1.2.5 Bezugsnormengruppe 5: Schweißzusatzmittel und Schweißen
EN 12345:1998, Schweißen – Mehrsprachige Benennungen für Schweißverbindungen mit bildlichen Darstellungen
EN ISO 14555:1998, Schweißen – Lichtbogenbolzenschweißen von metallischen Werkstoffen (ISO 14555:1998)
EN ISO 13918:1998, Schweißen – Bolzen und Keramikringe zum Lichtbogenbolzenschweißen (ISO 13918:1998)
EN 288-3:1992, Anforderung und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe – Teil 3: Schweißverfahrensprüfungen für das Lichtbogenschweißen von Stählen (enthält Änderung A1:1997)
EN ISO 5817:2003, Schweißen – Schmelzschweißverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne Strahlschweißen) – Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten (ISO/DIS 5817:2000)
1.2.6 Bezugsnormengruppe 6: Niete
Anmerkung: Der Nationale Anhang gibt Hinweise zu Bezugsnormen.
1.2.7 Bezugsnormengruppe 7: Bauausführung von Stahlbauten
EN 1090-2, Anforderungen an die Bauausführung von Stahlbauten
1.3 Unterscheidung nach Grundsätzen und Anwendungsregeln
(1) Es gelten die Regeln der EN 1990, 1.4.
1.4 Begriffe
(1) Nachstehende Begriffe werden in dieser Norm mit folgender Bedeutung verwendet:
1.4.1 Grundkomponente (eines Anschlusses)
Teil eines Anschlusses, der zu einem oder mehreren Kennwerten des Anschlusses beiträgt
1.4.2 Verbindung
konstruktiver Punkt, an dem sich zwei oder mehrere Bauteile treffen; für die Berechnung und Bemessung besteht die Verbindung aus einer Anordnung von Grundkomponenten, die für die Bestimmung der Kennwerte der Verbindung für die Übertragung der Schnittgrößen notwendig sind
1.4.3 angeschlossenes Bauteil
Bauteil, das in einem Anschluss mit anderen Bauteilen verbunden ist
Bild 1.1. Teile einer Träger-Stützenanschlusskonfiguration
1.4.4 Anschluss
Bereich, in dem zwei oder mehrere Bauteile miteinander verbunden sind; für die Berechnung und Bemessung besteht der Anschluss aus der Anordnung aller Grundkomponenten, die für die Bestimmung der Kennwerte des Anschlusses bei der Übertragung der Schnittgrößen zwischen den angeschlossenen Bauteilen notwendig sind; ein Träger-Stützenanschluss besteht z. B. aus einem Stegfeld mit entweder einer Verbindung (einseitige Anschlusskonfiguration) oder zwei Verbindungen (zweiseitige Anschlusskonfiguration), siehe Bild 1.1
Bild 1.2. Anschlusskonfigurationen
1.4.5 Anschlusskonfiguration
Gestaltung eines Anschlusses oder mehrerer Anschlüsse an einem Knoten, an dem die Achsen von zwei oder mehreren angeschlossenen Bauteilen zusammenlaufen, siehe Bild 1.2
1.4.6 Rotationskapazität
Winkel, um den sich der Anschluss bei vorgegebenem Moment ohne Versagen verformen kann
1.4.7 Rotationssteifigkeit
1.4.8 Kennwerte (eines Anschlusses)
Tragfähigkeit, bezogen auf die Schnittgrößen der angeschlossenen Bauteile, die Rotationssteifigkeit und die Rotationskapazität des Anschlusses
1.4.9 ebener Anschluss
in einer Fachwerk-Konstruktion erfasst der ebene Anschluss die Bauteile, die in der gleichen Ebene liegen
1.5 Formelzeichen
(1) Folgende Formelzeichen werden im Sinne dieser Norm verwandt:
d
Nennwert des Schraubendurchmessers, des Bolzendurchmessers oder des Durchmessers des Verbindungsmittels;
d
0
Lochdurchmesser für eine Schraube, einen Niet oder einen Bolzen;
d
o,t
Lochgröße im Zugquerschnitt, im Allgemeinen der Lochdurchmesser, außer bei senkrecht zur Zugbeanspruchung angeordneten Langlöchern, dort sollte die Längsabmessung verwendet werden;
d
o,v
Lochgröße im schubbeanspruchten Querschnitt, im Allgemeinen der Lochdurchmesser, außer bei schubparallelen Langlöchern, dort sollte die Längsabmessung verwendet werden;
d
c
Höhe des Stützenstegs zwischen den Ausrundungen (Höhe des geraden Stegteils);
d
m
Mittelwert aus Eckmaß und Schlüsselweite des Schraubenkopfes oder der Schraubenmutter (maßgebend ist der kleinere Wert);
f
H,Rd
Bemessungswert der Hertz’schen Pressung;
f
ur
Zugfestigkeit des Nietwerkstoffs;
e
1
Randabstand in Kraftrichtung, gemessen von der Lochachse zum Blechrand, siehe
Bild 3.1
;
e
2
Randabstand quer zur Kraftrichtung, gemessen von der Lochachse zum Blechrand, siehe
Bild 3.1
;
e
3
Randabstand eines Langlochs zum parallelen Blechrand, gemessen von der Mittelachse des Langlochs, siehe
Bild 3.1
;
e
4
Randabstand eines Langlochs zum Blechrand, gemessen vom Mittelpunkt des Endradius in der Achse des Langlochs, siehe
Bild 3.1
;
l
eff
wirksame Länge einer Kehlnaht;
n
Anzahl der Reibflächen bei reibfesten Verbindungen oder Anzahl der Löcher für Verbindungsmittel im schubbeanspruchten Querschnitt;
p
1
Lochabstand von Verbindungsmitteln in Kraftrichtung, gemessen von Achse zu Achse der Verbindungsmittel, siehe
Bild 3.1
;
p
1,0
Lochabstand von Verbindungsmitteln in Kraftrichtung in einer Außenreihe am Blechrand, gemessen von Achse zu Achse der Verbindungsmittel, siehe
Bild 3.1
;
p
1,
i
Lochabstand von Verbindungsmitteln in Kraftrichtung in einer inneren Reihe, gemessen von Achse zu Achse der Verbindungsmittel, siehe
Bild 3.1
;
p
2
Lochabstand von Verbindungsmitteln quer zur Kraftrichtung, gemessen von Achse zu Achse der Verbindungsmittel, siehe
Bild 3.1
;
r
Nummer einer Schraubenreihe; Anmerkung: Bei einer biegebeanspruchten Schraubenverbindung mit mehr als einer Schraubenreihe im Zugbereich erfolgt die Nummerierung der Schraubenreihen beginnend mit der Schraubenreihe, die am weitesten von dem Druckpunkt entfernt liegt.
S
s
Länge der steifen Auflagerung;
t
a
Blechdicke des Flanschwinkels;
t
fc
Blechdicke des Stützenflansches;
t
p
Blechdicke der Unterlegscheibe (unter der Schraube oder der Mutter);
t
w
Blechdicke des Steges;
t
wc
Blechdicke des Stützensteges;
A
Brutto-Querschnittsfläche einer Schraube (Schaft);
A
0
Querschnittsfläche des Nietlochs;
A
vc
Schubfläche einer Stütze, siehe EN 1993-1-1;
A
s
Spannungsquerschnittsfläche einer Schraube oder einer Ankerschraube;
A
v,eff
wirksame Schubfläche;
B
p,Rd
Bemessungswert des Durchstanzwiderstandes des Schraubenkopfes und der Schraubenmutter;
E
Elastizitätsmodul;
F
p,Cd
Bemessungswert der Vorspannkraft;
F
t,Ed
Bemessungswert der einwirkenden Zugkraft auf eine Schraube im Grenzzustand der Tragfähigkeit;
F
t,Rd
Bemessungswert der Zugtragfähigkeit einer Schraube;
F
T,Rd
Bemessungswert der Zugtragfähigkeit des Flansches eines äquivalenten T-Stummels;
F
v,Rd
Bemessungswert der Abschertragfähigkeit einer Schraube;
F
b,Rd
Bemessungswert der Lochleibungstragfähigkeit einer Schraube;
F
s,Rd,ser
Bemessungswert des Gleitwiderstandes einer Schraube im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit;
F
s,Rd
Bemessungswert des Gleitwiderstandes einer Schraube im Grenzzustand der Tragfähigkeit;
F
v,Ed,ser
Bemessungswert der einwirkenden Abscherkraft auf eine Schraube im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit;
F
v,Ed
Bemessungswert der einwirkenden Abscherkraft auf eine Schraube im Grenzzustand der Tragfähigkeit;
M
j,Rd
Bemessungswert der Momententragfähigkeit eines Anschlusses;
S
j
Rotationssteifigkeit eines Anschlusses;
S
j,ini
Anfangs-Rotationssteifigkeit eines Anschlusses;
V
wp,Rd
Plastische Schubtragfähigkeit des Stegfeldes einer Stütze;
z
Hebelarm;
μ
Reibbeiwert;
ϕ
Rotationswinkel eines Anschlusses.
(2) In Abschnitt 7 werden die folgenden Abkürzungen für Hohlprofile verwendet:
KHP
für ein rundes Hohlprofil „Kreis-Hohlprofil“;
RHP
für ein rechteckiges Hohlprofil „Rechteck-Hohlprofil“, hier einschließlich quadratischer Hohlprofile.
(3) In Abschnitt 7 werden die folgenden Formelzeichen verwandt:
Bild 1.3. Knotenanschlüsse mit Spalt und mit Überlappung
(4) In Abschnitt 7 werden die folgenden Zahlenindizes verwandt:
(5) Im Abschnitt 7 werden die folgenden Spannungsverhältnisse verwandt:
n
Verhältnis (
σ
0,Ed
/
f
y0
)/
γ
M5
(für RHP-Gurtstäbe);
n
p
Verhältnis (
σ
p,Ed
/
f
y0
)/
γ
M5
(für KHP-Gurtstäbe);
σ
0,Ed
maximale einwirkende Druckspannung im Gurtstab am Anschluss;
σ
p,Ed
ist der Wert von σ
0,Ed
ohne die Spannungen infolge der Komponenten der Strebenkräfte am Anschluss parallel zum Gurt, siehe
Bild 1.4
.
Bild 1.4. Abmessungen und weitere Parameter eines Fachwerk-Knotenanschlusses mit Hohlprofilen
(6) Im Abschnitt 7 werden die folgenden geometrischen Verhältnisse verwandt:
(7) Weitere Formelzeichen werden im Text erklärt.
Anmerkung: Formelzeichen für Kreisprofile sind in Tabelle 7.2 angegeben.
2 Grundlagen der Tragwerksplanung
2.1 Annahmen
(1) Die Regelungen dieses Teils von EN 1993 setzen voraus, dass die Ausführung den in 1.2 angegebenen Herstell- und Liefernormen entspricht und die verwendeten Baustoffe und Bauprodukte den Anforderungen in EN 1993 oder den maßgebenden Baustoff- und Bauproduktspezifikationen entsprechen.
2.2 Allgemeine Anforderungen
(1)P Die Anschlüsse müssen so bemessen werden, dass das Tragwerk die grundlegenden Anforderungen dieser Norm und von EN 1993-1-1 erfüllt.
(2) Die Teilsicherheitsbeiwerte γM für Anschlüsse sind in Tabelle 2.1 angegeben.
Tabelle 2.1. Teilsicherheitsbeiwerte für Anschlüsse
(3)P Für ermüdungsbeanspruchte Anschlüsse müssen zusätzlich die Grundsätze in EN 1993-1-9 gelten.
2.3 Schnittgrößen
(1)P Die für den Tragsicherheitsnachweis von Verbindungen erforderlichen Schnittgrößen müssen nach den Grundsätzen in EN 1993-1-1 ermittelt werden.
2.4 Beanspruchbarkeit von Verbindungen
(1) Die Beanspruchbarkeit einer Verbindung ist in der Regel anhand der Beanspruchbarkeiten ihrer Grundkomponenten zu bestimmen.
(2) Für die Bemessung von Anschlüssen können linearelastische oder elastisch-plastische Berechnungsverfahren angewendet werden.
(3) Werden zur Aufnahme von Scherbeanspruchungen verschiedene Verbindungsmittel mit unterschiedlichen Steifigkeiten verwendet, so ist in der Regel dem Verbindungsmittel mit der höchsten Steifigkeit die gesamte Belastung zuzuordnen. Eine Ausnahme von dieser Regel ist in 3.9.3 angegeben.
2.5 Annahmen für die Berechnung
(1)P Bei der Berechnung von Anschlüssen muss eine wirklichkeitsnahe Verteilung der Schnittgrößen angenommen werden. Für die Verteilung der Kräfte und Momente müssen die folgenden Annahmen getroffen werden:
(2) Die Anwendungsregeln in dieser Norm erfüllen die Annahmen in 2.5(1).
2.6 Schubbeanspruchte Anschlüsse mit Stoßbelastung, Belastung mit Schwingungen oder mit Lastumkehr
(1) Bei schubbeanspruchten Anschlüssen, die Stoßbelastungen oder erheblichen Belastungen aus Schwingungen ausgesetzt sind, sollten nur folgende Anschlussmittel verwendet werden:
Bild 2.1. Bezugsachsen
(2) Darf in einem Anschluss kein Schlupf auftreten (z. B. wegen Lastumkehr), sind in der Regel entweder gleitfeste Schraubverbindungen der Kategorie B oder C, siehe 3.4, Passschrauben, siehe 3.6.1, Niete oder Schweißnähte zu verwenden.
(3) In Windverbänden und/oder Stabilisierungsverbänden dürfen Schrauben der Kategorie A, siehe 3.4, benutzt werden.
2.7 Exzentrizitäten in Knotenpunkten
(1) Treten in Knotenpunkten Exzentrizitäten auf, so sind in der Regel die Anschlüsse und die angeschlossenen Bauteile für die daraus resultierenden Schnittgrößen zu bemessen. Davon ausgenommen sind Konstruktionen, für die nachgewiesen wurde, dass dies nicht erforderlich ist, siehe 5.1.5.
(2) Bei Anschlüssen von Winkel- oder T-Profilen mit einer oder zwei Schraubenreihen sind in der Regel die Exzentrizitäten nach 2.7(1) zu berücksichtigen. Exzentrizitäten in der Anschlussebene und aus der Anschlussebene heraus sind unter Berücksichtigung der Schwerpunktachsen der Bauteile und der Bezugsachsen der Verbindung zu ermitteln, siehe Bild 2.1. Für den einschenkligen Schraubenanschluss zugbeanspruchter Winkel kann das vereinfachte Bemessungsverfahren nach 3.10.3 angewendet werden.
Tabelle 3.1. Nennwerte der Streckgrenze fyb und der Zugfestigkeit fub von Schrauben
Anmerkung: Der Einfluss der Exzentrizität auf druckbeanspruchte Winkelprofile in Gitterstäben ist in EN 1993-1-1, Anhang BB 1.2 geregelt.
3 Schrauben-, Niet- und Bolzenverbindungen
3.1 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
3.1.1 Allgemeines
(1) Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben müssen in der Regel die Anforderungen der Bezugsnormengruppe 4 in 1.2.4 erfüllen.
(2) Die Regelungen dieses Teils gelten für Schrauben der in Tabelle 3.1 angegebenen Festigkeitsklassen.
(3) Die Streckgrenzen fyb und die Zugfestigkeiten fub sind für Schrauben der Festigkeitsklassen 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8 und 10.9 in Tabelle 3.1 angegeben. Für die Bemessung sind in der Regel diese Werte als charakteristische Werte anzusetzen.
Anmerkung: Im Nationalen Anhang darf die Anwendung bestimmter Schraubenklassen ausgeschlossen werden.
Tabelle NA.1. Als charakteristische Werte für Werkstoffe von Kopf- und Gewindebolzen festgelegte Werte





























