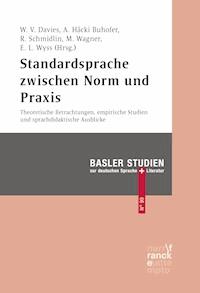
Standardsprache zwischen Norm und Praxis E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Basler Studien zur deutschen Sprache und Literatur
- Sprache: Deutsch
Die Standardsprache, auch als Hochdeutsch bezeichnet, die im deutschen Sprachraum in der öffentlichen Kommunikation, in den Schulen und in der Politik verwendet wird, ist uneinheitlich. Die Variation der Standardsprache wird in der Linguistik gegenwärtig mit plurizentrischen und pluriarealen Konzepten erfasst. In diesem Band werden neue Ergebnisse aus Forschungsprojekten zum Gebrauch und zur Bewertung der Standardsprache in Österreich, Deutschland, Luxemburg, Südtirol und der Deutschschweiz diskutiert. Einen besonderen Fokus bilden dabei die schulischen Praktiken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 684
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Standardsprache zwischen Norm und Praxis
Theoretische Betrachtungen, empirische Studien und sprachdidaktische Ausblicke
Winifred V. Davies / Annelies Häcki Buhöfer / Regula Schmidlin / Melanie Wagner / Eva Lia Wyss
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2017 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.francke.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen
ePub-ISBN 978-3-7720-0024-9
Inhalt
Plurizentrik revisited – aktuelle Perspektiven auf die Variation der deutschen Standardsprache
Im deutschen Sprachraum finden sich unterschiedliche Konstellationen von Standardvarietäten, Umgangssprachen und Dialekten. Diese bestehen aus mündlichen und schriftlichen Repertoires, welchen die Sprecherinnen und Sprecher bestimmte Einstellungen entgegenbringen. Im vorliegenden Band fokussieren wir die Standardsprache in ausgewählten Regionen Deutschlands, in der Deutschschweiz, in Österreich, Luxemburg, Südtirol und Ostbelgien. Diese weist auf allen linguistischen Ebenen Besonderheiten auf und unterliegt unterschiedlichen Verwendungsbedingungen. Die Diskussion, wie die Variation der Standardsprache in den deutschsprachigen Ländern theoretisch adäquat beschrieben werden kann, wird schon lange geführt. Sie intensivierte sich ein erstes Mal in den 1980er Jahren im Kontext der Plurizentrikdebatte1 und wird seit dem Erscheinen des Variantenwörterbuchs des Deutschen (Ammon et al. 2004, Ammon et al. 2016) auch im Hinblick auf empirisch-lexikographische Fragestellungen in verschiedenen Expertenkreisen geführt. Der monozentrische Blick auf die deutsche Sprache, der von einer geographischen Lokalisierbarkeit der Standardsprache ausging, wich der Fokussierung auf verschiedene so genannte Zentren (Ammon 1995), die aufgrund politisch und historisch autonomer Entwicklung eigene Varietäten hervorbrachten. Dies ist auch daran ersichtlich, dass zumindest teilweise zentrumseigene Kodices aus dieser Entwicklung hervorgingen und es damit zur Endonormierung der Standardsprache in den jeweiligen Zentren kam. Dem plurizentrischen Konzept mit einer plurinationalen Ausprägung (z.B. Clyne 1995) wurde sodann das pluriareale Konzept (Scheuringer 1996) mit einer regionalen Ausprägung kritisch gegenübergestellt. Die Unterschiede zwischen diesen Konzepten lassen sich folgendermassen beschreiben: Das plurizentrische Konzept geht davon aus, dass es gleichwertige, von staatlichen Grenzen beeinflusste (nationale) Standardvarietäten des Deutschen gibt und auch in so genannten Halbzentren (Südtirol, Liechtenstein, Luxemburg und Belgien) standardsprachliche Besonderheiten der deutschen Sprache zu finden sind; Ammon (1995) entwickelte ein theoretisch und terminologisch differenziertes Modell, das neben dem Variantenwörterbuch (Ammon et al. 2004, 2016) eine Reihe von empirisch fundierten Arbeiten zur Folge hatte (z.B. Markhardt 2005, Ransmayr 2006, Schmidlin 2011, Wissik 2014). Das Variantenwörterbuch dokumentiert auch länderübergreifende und regionale Phänomene, wobei für den bundesdeutschen Raum gemeinhin sechs und für Österreich vier regionale Räume angenommen wurden.2 Das pluriareale Konzept (vgl. Ammon 1998) hingegen wurde zunächst in den 1990er Jahren, bisweilen sehr emotional (vgl. Scheuringer 1996, Seifter & Seifter 2015), als eine konzeptuelle und sprachenpolitische Gegenposition vorgebracht, ohne dass eine weitergehende theoretische Ausarbeitung und ein systematisches Begriffsinventar zur Analyse entwickelt wurden (Glauninger 2015). Im Gegenzug zum plurizentrischen Zugang betont man aus pluriarealer Perspektive sprachliche Unterschiede gerade innerhalb Deutschlands zwischen Norden und Süden oder innerhalb Österreichs zwischen Osten und Westen und führt die zahlreichen grenzüberschreitenden Gemeinsamkeiten auf, z.B. Übereinstimmungen zwischen Süddeutschland, Österreich und der Schweiz oder zwischen Westösterreich und Südostdeutschland oder zwischen Vorarlberg, Liechtenstein und der Schweiz. Auf dieser Basis hat sich im Rahmen detaillierter empirischer linguistischer Analysen, auch im Zuge der Weiterentwicklung der Korpuslinguistik, eine neue Ausprägung des pluriarealen Ansatzes entwickelt, der zwar, soweit Publikationen vorliegen, theoretisch (noch) nicht so ausgebaut und terminologisch ausdifferenziert ist wie die plurizentrische Theorie, der aber gewichtige empirische Befunde für eine pluriareale Konzeptualisierung des Deutschen vorlegt (s. Elspaß & Niehaus 2014, Dürscheid, Elspaß & Ziegler 2015, Niehaus in diesem Band). Anhand konkreter empirischer Analysen zur Variation in der Grammatik des Standarddeutschen (z.B. dem Gebrauch des Adjektivs n-jährig oder diskontinuierlicher Richtungsadverbien) wird argumentiert, dass der pluriareale Zugang standardsprachliche Variation adäquater erfassen kann als der plurizentrische und auch die Dynamik der Variation besser zum Ausdruck bringt (Herrgen 2015, Niehaus in diesem Band).
In diesem theoretischen Spannungsfeld – und darüber hinaus – widmet sich der vorliegende Band der vertieften Reflexion und theoretischen Weiterentwicklung des Begriffsinventars, der Untersuchung spezifischer soziolinguistischer Praktiken und Bewertungsmuster in Bezug auf die Varietäten der deutschen Standardsprache. Die Beitragssammlung gliedert sich in vier Teile mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Während im ersten Teil stärker theoretische Aspekte wie zum Beispiel die Frage nach der Bestimmung und Abgrenzung von Standardsprachen gegeneinander sowohl aus plurizentrischer als auch pluriarealer Perspektive diskutiert werden (Durrell, Schmidlin, Niehaus, Möller), gibt der zweite Teil Einblicke in neuere empirische Studien, die an der Schnittstelle zwischen Norm und schulischer Praxis zu Forschungsergebnissen zu den Standardvarietäten in Österreich, Deutschland, Luxemburg, Südtirol und der Deutschschweiz geführt haben (de Cillia, Fink & Ransmayr; Davies; Wagner; Wyss; Glaznieks & Abel). Im dritten Teil des Bandes wird die Diskussion sowohl in Richtung Bildungswissenschaft als auch in Richtung Literaturwissenschaft geöffnet: Darin werden Fragen zum schulischen Normvermittlungserfolg und zu geographisch-territorialen Aspekten literarischer Kanonisierung behandelt (Gehrer, Oepke & Eberle; Neuhaus). Im vierten Teil werden sprachdidaktisch relevante Überlegungen zur Bewertung von Varianten vorgestellt – in Abhängigkeit von Sprachbewusstheit und Sprachwissen sowie in Abhängigkeit weiterer, aussersprachlicher Faktoren (Peter, Gatta). Abgeschlossen wird der vierte Block mit einem Beitrag zur Thematisierung von Teutonismen in Lernerwörterbüchern (Scanavino).3
Im Folgenden werden die Hauptargumentationslinien der Beiträge kurz skizziert.
I.Theoretische Betrachtungen
Im einleitenden Beitrag dieses Bandes stellt Martin Durrell zwei Ansichten über das Verhältnis zwischen Sprache und Nation im deutschsprachigen Raum des 18. und 19. Jahrhunderts zur Diskussion. Da ist zunächst die Annahme, dass die deutsche nationale Identität eine ethnolinguistische Basis hat und dann der daraus resultierende Topos, dass in Deutschland die sprachliche Einheit der politischen Einheit vorausging und die unabdingbare Voraussetzung für diese bildete. Durrell argumentiert, dass der Mythos einer grundlegenden, homogenen Sprache dazu beiträgt, dass die faktische Heterogenität der deutschen Sprache (vor allem auf mündlicher Ebene) ausser Acht gelassen wird und dass man sich auf die standardisierte schriftliche Varietät des Deutschen bezieht, wenn man die Sprache als Symbol der nationalen Identität instrumentalisiert. Dieser Mythos der einheitlichen Sprache hat auch die Perzeption des Deutschen als monozentrischer Sprache geprägt. Ferner zeigt Durrell mit Bezug auf neuere historische Untersuchungen des „Alten Reichs“, dass die sprachliche Einigung doch in einem Staatsgebilde stattfand, mit dem sich die Bildungselite identifizierte und das sich nicht so stark von einem modernen Nationalstaat unterschied, wie oft angenommen wird.
Entlang von Kleins Modell zur Erfassung sprachlicher Zweifelsfälle (Klein 2003) zeigt Regula Schmidlin, dass die Varianten des Standarddeutschen als freie, graduelle und konditionierte Zweifelsfälle betrachtet werden können. Dabei erweitert sie Kleins Modell um die Sprecherperspektive, hängt doch die Beurteilung der Korrektheit von regionalen und nationalen Varianten des Standarddeutschen von der regionalen Herkunft des zweifelnden Subjekts ab. Schmidlin plädiert dafür, nicht nur der Dynamik der Varietäten selbst, sondern auch der Dynamik der Einschätzung der Varietäten in Lehr- und Lernkontexten vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken. Das Zweifeln über die Richtigkeit und Angemessenheit sprachlicher Varianten ist ein willkommener Anlass und Anfang von Sprachreflexion. Ein kompetenter Umgang mit lexikographischen und korpuslinguistischen Hilfsmitteln kann dabei Inkongruenzen zwischen subsistenten, statuierten und intuitiv vermuteten Normen aufzeigen.
Konstantin Niehaus präsentiert Erkenntnisse aus dem österreichisch-schweizerischen Projekt „Variantengrammatik des Standarddeutschen“, das die grammatische Variabilität des Standarddeutschen untersucht. Der Autor fokussiert den Mehrwert der korpus- und systemlinguistischen Zugangsweise und zeigt anhand von exemplarischen Analysen einzelner Konstruktionen, dass verschiedene Teilbereiche der Grammatik des Standarddeutschen eine areale Variation aufweisen. Da diese Variation über Staatsgrenzen hinausgeht, wird sie – laut Niehaus – adäquater mit einem pluriarealen Modell als mit dem plurizentrischen erfasst. Der Autor geht auch auf sprachdidaktische Folgerungen für den Deutschunterricht ein und argumentiert für mehr Variationstoleranz, die man seiner Meinung nach eher durch das pluriareale Modell und die höhere theoretische Gewichtung relativer Varianten als durch das plurizentrische Modell erreichen kann.
Die Eigenständigkeit der Standardsprache in Belgien stellt Robert Möller zur Diskussion, denn Deutsch ist in Belgien die Sprache einer kleinen Minderheit. Diese hat in den vergangenen Jahrzehnten zwar an Bedeutung gewonnen und spielt für die Identität der heutigen Ostbelgier eine wichtige Rolle. Die ostbelgischen Varianten werden aber explizit von der deutschen Standardsprache abgegrenzt (im Sinne von Varianten der „Regionalsprache“). In einem Überblick stellt Möller die Heterogenität der Konstellation in den Vordergrund, indem er den dialektalen Hintergrund der Region und ihre Teilung in das südliche Moselfränkisch und das nördliche Ripuarisch sowie die nachbarschaftliche Nähe zu Deutschland hervorhebt und dabei auch historische Entwicklungen in Verwaltung und Schulwesen identifiziert. Schliesslich weist er darauf hin, dass gerade die Identifikation mit Belgien dazu führt, dass die Pflege der Mehrsprachigkeit zumeist einen höheren Stellenwert hat als die eingehende Beschäftigung mit dem Deutschen.
II.Empirische Studien
In den Beiträgen von Winifred V. Davies, Eva L. Wyss & Melanie Wagner werden die Ergebnisse der Studie „Deutsch im gymnasialen Unterricht: Deutschland, Luxemburg und die deutschsprachige Schweiz im Vergleich“ vorgelegt, die an den Universitäten Aberystwyth, Basel und Luxemburg durchgeführt wurde. Das Projekt untersucht das Normbewusstsein und -wissen von DeutschlehrerInnen an Gymnasien in Luxemburg, Deutschland (Nordrhein-Westfalen) und der deutschsprachigen Schweiz und beschäftigt sich mit ihrer Rolle als Sprachnormautoritäten. Anhand von Daten, die mit Hilfe von Fragebögen erhoben wurden, werden die Praktiken der Lehrenden in den drei verschiedenen Ländern beleuchtet, in denen die deutsche Sprache eine jeweils unterschiedliche Rolle spielt:
Winifred V.Davies beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit der Rolle von DeutschlehrerInnen in einer bestimmten deutschen Region (Nordrhein-Westfalen) und untersucht, inwiefern das Plurizentrik-Modell, das in der Soziolinguistik bisher dominant war, den Lehrenden überhaupt bekannt ist und sich auf ihre Praxis auswirkt. Davies zeigt, dass das Modell in den Lehrplänen, die die Lehrenden befolgen sollen, nicht vorkommt und keine Relevanz für sie besitzt. Sie zeigt auch, dass die Meinungen der Lehrenden darüber, was als korrekt bzw. standardsprachlich gilt, nicht immer mit den Meinungen der Kodifizierer übereinstimmt, was das Konzept einer einheitlichen variationsfreien Standardsprache weiter in Frage stellt.
Mit einem Fokus auf die Schweizer Sprachsituation zeigt Eva L.Wyss die Komplexität, die der Überlagerung von Diglossie und Plurizentrik in der Deutschschweiz erwächst. In einem ersten Teil werden die aktuellen Ergebnisse zu konstellativen, medialen, spracherwerbsbezogenen und unterrichtlichen Spezifika des deutschschweizerischen Raumes zusammengefasst, was in einer Kritik am weit verbreiteten Diglossiekonzept mündet, das gemäss Wyss durch eine differenzierte Sprachgebrauchsbeschreibung abgelöst werden sollte. Im zweiten Teil werden die Daten der erwähnten international vergleichenden Studie aus Deutschschweizer Perspektive ausgewertet. Hier finden sich bei den DeutschlehrerInnen sehr vage und variate Standardsprachkonzepte, die auch in den Curricula (vgl. Davies in diesem Band) nachgewiesen werden können. Darauf abgestützt erstaunt nicht weiter, dass auch die sprachdidaktische Situation von DeutschlehrerInnen nicht einhellig als muttersprachlich wahrgenommen wird. Schliesslich werden die divergierenden Einschätzungen der Sprachsituation und wenig loyale Bewertungen von deutschschweizerischen Standardkonstruktionen durch die Lehrenden in drei Typen unterschieden – einmal als Anpassung an die höher bewertete Sprachform, dann als Eigenständigkeit sowie als eine Lücke im Sprachwissen. Diese Sprachgebrauchsrealität wird im Anschluss mit der Metapher des „schielenden Blicks“ erläutert, durch die eine konzeptionelle Inkohärenz als eine Überlagerung der Eigen- und Fremdperspektive begriffen wird.
Melanie Wagner widmet sich in ihrem Beitrag dem Status der deutschen Sprache im luxemburgischen Gymnasium. In einem ersten Schritt beleuchtet sie die Sprachensituation Luxemburgs sowie die aktuell angewandte Lehrmethode für das Fach Deutsch im luxemburgischen Schulsystem. Sodann stellt sie die Ergebnisse einer Befragung von DeutschlehrerInnen vor und liefert eine Analyse der Curricula des Fachs Deutsch im Gymnasium sowie von Leitlinien zur Sprachplanung und Sprachpolitik in Luxemburg. Anhand der Ergebnisse der Befragung und der Analyse der Dokumente zeigt sie, dass eine klare Kategorisierung der Lehrmethode für das Fach Deutsch (Deutsch als Erst-, Zweit- oder Fremdsprache) nicht möglich ist, was die Frage aufwirft, ob Luxemburg, wo Deutsch hauptsächlich Schulsprache, jedoch weder Umgangs- noch Erstsprache ist, heutzutage tatsächlich noch ein Halbzentrum im plurizentrischen Modell darstellt (vgl. Ammon 1995).
Rudolf de Cillia, Ilona Fink & Jutta Ransmayr berichten über das FWF-Forschungsprojekt „Das österreichische Deutsch als Unterrichts- und Bildungssprache“. Anhand einer Analyse von Lehrplänen, Studienplänen an Universitäten und pädagogischen Hochschulen, Lehrmitteln und einer Fragebogenerhebung bei Lehrpersonen und SchülerInnen aus ganz Österreich wird untersucht, ob das Konzept der Plurizentrik in der Ausbildung von Lehrenden bekannt ist, wie das Korrekturverhalten zur Sprachloyalität der eigenen Varietät in Beziehung gesetzt werden kann und ob eine Sensibilisierung der SchülerInnen für die Variation der deutschen Sprache stattfindet. Auch wenn das Konzept der Plurizentrik kaum bekannt ist, ist ein Bewusstsein für unterschiedliche Ausprägungen der deutschen Standardsprache durchaus vorhanden. Allerdings fallen die Einschätzungen der Varietäten unterschiedlich aus – beispielsweise je nach dem, ob man die Korrektheit oder Gleichwertigkeit von Varianten thematisiert. Es ergibt sich ein Komplex unterschiedlicher Variablen, die die Spracheinstellungen der Lehrkräfte beeinflussen, was wichtige Ansatzpunkte für künftige Vergleiche mit Lehrpersonen aus anderen Regionen des deutschen Sprachgebiets darstellt.
Der Aufsatz von Aivars Glaznieks & Andrea Abel präsentiert Ergebnisse linguistischer Analysen zur grammatischen Kompetenz aus einem korpuslinguistischen Forschungsprojekt zum Thema „Bildungssprache im Vergleich“, in dem auf der Basis von ca. 1300 Erörterungsaufsätzen aus Südtirol, Nordtirol und Thüringen die Schreibkompetenz von Oberschülerinnen und -schülern ein Jahr vor der Matura bzw. dem Abitur beschrieben wird. Interessant ist dabei die Tatsache, dass die Alltagssprache der meisten Schülerinnen und Schüler nicht mit der schulischen Varietät, der sogenannten Bildungssprache, gleichzusetzen ist, die im schulischen Kontext erwartet und schliesslich auch bewertet wird. Je nach Region kann die Alltagssprache mehr oder weniger grosse Unterschiede zur Standardsprache aufweisen und zudem durch regionale und nationale Varianten charakterisiert sein. In der Untersuchung gehen Glaznieks & Abel auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Schreibenden bei grammatischen Normverstössen ein. Dazu gehört die Frage, ob und gegebenenfalls welche regionalen Unterschiede bei Schreibenden im deutschen Sprachraum feststellbar sind, oder die Frage, inwiefern andere aussersprachliche Variablen wie Schultyp und Geschlecht in Bezug auf die Verteilung grammatischer Normverstösse eine Rolle spielen. Dabei stehen in der Darstellung der Ergebnisse Analysen zur Rektion im Mittelpunkt. Glaznieks & Abel interpretieren die meisten vorkommenden Rektionsfehler als Normunsicherheiten, die auf die gleichzeitige Beherrschung von verschiedenen Normen zurückzuführen sind. Bei Präpositionen mit Nebenkasus wird aber davon ausgegangen, dass sie als Zweifelsfälle beschrieben werden können, die vielen Deutschsprachigen Schwierigkeiten bereiten, egal, ob diese mehr als eine Norm beherrschen oder nicht. Es wird vorgeschlagen, authentische Beispiele für Zweifelsfälle, die in den Texten der Schülerinnen und Schüler vorkommen, im Unterricht zu verwenden, um eine Diskussion über angemessenen Sprachgebrauch anzuregen sowie die Lernenden unter Umständen auch auf Sprachwandelprozesse aufmerksam zu machen.
III.Interdisziplinäre Zugänge
Karin Gehrer, Maren Oepke & Franz Eberle überprüfen, ob die für die Schweiz repräsentativen empirischen Daten der Studie EVAMARII für die sprachwissenschaftliche Plurizentrik-Debatte innerhalb des Deutschen ein gewisses Analysepotenzial bieten und ob für sprachliche Leistungsunterschiede auf universitärem Niveau empirische Hinweise für den Einfluss der Familiensprache (bzw. der Familienvarietät) gefunden werden können. Es wird gezeigt, dass bei MaturandInnen aus einem Elternhaus mit Sozialisation in Schweizerdeutsch und Schweizer Standardsprache gegenüber MaturandInnen aus einem Elternhaus mit bundesdeutscher Standardsprache weder im Gesamttest noch in den einzelnen Subskalen (Grammatik/Orthographie, Leseverstehen, Wortschatz) signifikant voneinander abweichende Ergebnisse erzielt werden. Es existieren somit auf den ersten Blick keine auffälligen Sprachstandsunterschiede. Allerdings vermuten die AutorInnen, dass dies auch an den insgesamt hohen Hürden für das Gymnasium in der Schweiz liegt, die auf die Ausprägung der sprachlichen Fähigkeiten bereits selektiv wirken. Brisant sind dabei die grossen Unterschiede in den Leistungen zwischen den Schülerinnen und Schülern und das Defizit am unteren Ende der Leistungsskala.
Die Literaturauswahl, kanonisiert in Literaturgeschichten, orientiert sich traditionell – wie Stefan Neuhaus zeigt – an den geographisch-territorialen Grenzen eines gesamtdeutschen Sprachraums. Weder die Betonung von Frauen- noch von MigrantInnen-Literatur haben diese territoriale Dominanz der Kategorisierung brechen können. Neben nationalen (die Literatur von Österreich und der Schweiz ist von deutschen Literarhistorikern allzu gern zur ‚deutschen‘ Literatur gerechnet worden) sind regionale Perspektiven auf Literatur dazugekommen. Obschon aber nach 1945 die Nationalismen zurückgedrängt wurden und Literaturgeschichten dem Nationalismus abgeschworen haben, orientieren sich diese weitgehend an dem früheren, an staatlichen oder regionalen Grenzen orientierten Einteilungssystem. Die Literatur spielt im Identitätsdiskurs eines Landes nach wie vor eine zentrale Rolle. Neuhaus beschreibt eine seit dem 18. Jahrhundert laufende Entwicklung, die von der gewachsenen Bedeutung der Grenzen einer imaginären deutschen, österreich-ungarischen oder schweizerischen Nation über eine Auflösung des Nationalitätsdispositivs hin zu einer erneuten Stärkung der nationalen oder auch regionalen, in jedem Fall geographischen Komponente im gesellschaftlichen Diskurs führt. Dies sei z.B. an der gewachsenen Bedeutung von nationalen oder regionalen Literaturgeschichten, Literaturarchiven oder Literaturpreisen ablesbar.
IV.Sprachdidaktische Ausblicke
In seiner Pilotstudie zum deklarativen Wortwissen von Lehrpersonen zeigt Klaus Peter, welche Rolle Sprachbewusstheit und Sprachwissen der bewertenden oder korrigierenden Person beim Umgang mit sprachlicher Variation spielt. Das Sprachwissen ist einerseits als Bedeutungswissen und andererseits als enzyklopädisches Wissen konzeptualisiert. In Bezug auf die Erforschung von Bewertungen regionaler Varianten folgert Peter, dass eine umfassende Interpretation einer Variantenbewertung nur dann gelingen kann, wenn sowohl Daten zu den Spracheinstellungen als auch zum individuellen Sprachwissen (oder der individuellen Sprachbewusstheit) der bewertenden Person vorliegen. Seine Ausführungen zeigen somit einen Schwachpunkt vieler bisheriger Spracheinstellungsuntersuchungen auf; dass nämlich oft zu wenig unterschieden wird, ob einer Gewährsperson eine Variante bekannt ist oder ob sie gerade im Bereich der Semantik über volle Kompetenz im Sinne von Besitz von enzyklopädischem Wissen zu einem Wort verfügt oder nicht.
Einsichten in das Normverständnis von Schweizer Lehrkräften bietet der Beitrag von Adriana Gatta. Sie untersucht, wie Lehrpersonen auf der Sekundarstufe II mit Helvetismen in Aufsätzen verfahren, ob und wie die Lehrpersonen die Helvetismen korrigieren und wie sie diese bewerten. Die Auswertung erfolgt nach den aussersprachlichen Faktoren Alter, Ausbildung, Schulstufe und Unterrichtserfahrung der Lehrpersonen. Zwar zeigen sich jüngere Lehrpersonen etwas toleranter gegenüber Helvetismen als ältere, die anderen Faktoren scheinen auf die festgestellte Helvetismenskepsis jedoch keinen Einfluss zu haben (vgl. Davies in diesem Band, Wyss in diesem Band). Ein Effekt zeigt sich jedoch in Bezug auf die sprachliche Ebene der Variation; so wurden syntaktische Helvetismen am häufigsten korrigiert.
Einen kritischen Blick auf die Lernerlexikographie wirft Chiara Scanavino. Zunächst thematisiert sie Missverständnisse, die sich aus der gängigen Terminologie zur Beschreibung der Varianten und ihrer Positionierung gegenüber den Nicht-Varianten ergeben können (vgl. dazu schon von Polenz 1988), und schlägt bspw. für letzteren Fall interdeutsch anstelle von gemeindeutsch vor. Es folgt ein Überblick über die Darstellungsweisen von Teutonismen in Lernerwörterbüchern, wobei die Auto-Kennzeichnungen sowohl der österreichischen und schweizerischen Varianten als auch der Varianten der Bundesrepublik Deutschland von Scanavino für die Angemessenheit der lexikographischen Darstellung als wichtiges Kriterium betrachtet wird. Insgesamt bezeichnet Scanavino die Darstellung von Varianten der Standardsprache in Lernerwörterbüchern als noch nicht zufriedenstellend. Sie plädiert für eine stärkere strukturelle Orientierung an enzyklopädischen Wörterbüchern und fordert eine nestalphabetische Darstellung der Lemmata, wobei auch deren Frequenz und kontextuelle Einbettung berücksichtigt werden sollen.
Fazit und Ausblick
Der Blick auf den Entwicklungszusammenhang der deutschen Standardsprache, der den Auftakt des vorliegenden Bandes bildet, weist auf die historische Verankerung der Plurizentrik des Deutschen.4 Die deutsche Standardsprache wurde zwar als Kultursprache hypostasiert. Gleichzeitig kann ihre Einheitlichkeit für keine Epoche nachgewiesen werden. Welches Gewicht soll nun aber heute der nationalen Zugehörigkeit beigemessen werden, wenn es zur Kategorisierung der Varietäten der deutschen Standardsprache kommt? Die Beantwortung dieser Frage erweist sich deshalb als schwierig, weil erstens die nationale Zugehörigkeit historisch und kulturell zwar weiterhin sozial verankert ist, was sich etwa in der literarischen Kanonbildung noch immer nachweisen lässt, weil aber zweitens gleichzeitig Nationalismen als soziale Kategorien (zu Recht) hinterfragt werden und ihre Überwindung gefordert wird. Die soziokulturelle Wirkung national-territorialer politischer Grenzen bei der Beschreibung von Sprachvariation zu negieren, wäre unseres Erachtens aber der falsche Weg. Gerade in Bezug auf die Verwendung der deutschen Standardsprache zeigt sich die Wechselwirkung der statuierten und subsistenten Normen, die die Sprecherinnen und Sprecher nachweislich prägen, wodurch bestimmte Formen des Standardsprachgebrauchs weitertradiert werden, die sowohl national als auch regional erkennbar bleiben. Wenn nun Vertreterinnen und Vertreter des plurizentrischen Ansatzes, die biographisch meist selbst aus kleineren Zentren stammen, mit dieser Modellierung auch die ökonomische, sprachliche und diskursive Dominanz des bundesdeutschen Zentrums thematisieren, wird dies zuweilen als Aufbegehren der sprachlich Dominierten ausgelegt, das mit einem nationalistisch motivierten Variantenpurismus einhergehen kann. Dabei wird ausgeblendet, dass auch eine plurizentrische Modellierung der Sprachvariation Überlappungen von Merkmalen entlang verschiedener Kontaktzonen darstellen kann und die nationale Variationsdimension als eine neben anderen Variationsdimensionen verstanden werden kann.
Ziel dieses Bandes war es nicht, sich zwischen der rege diskutierten, einer stärker der Dialektologie verpflichteten pluriarealen Modellierung einerseits und der soziolinguistisch-institutionell argumentierenden plurizentrischen Modellierung andererseits zu positionieren. Vielmehr können die hier vorliegenden Beiträge zeigen, dass mit den pluriarealen resp. plurizentrischen Modellen nicht die deutsche Standardsprache mit ihren Varietäten erschöpfend erfasst werden kann, sondern dass sie sich besser oder schlechter eignen können, um bestimmte Repräsentationsformen der deutschen Standardsprache darzustellen: mündlich, schriftlich; lexikalisch, lautlich, syntaktisch; in Bezug auf ihre (schulische) Bewertung; in Bezug auf regionale oder überregionale Pressetexte; in Bezug auf literarische Sprache oder Schulbuchtexte; in der Lernersprache; in Lernerwörterbüchern. Dazu kommt die Heterogenität der Areale selbst. So wird die deutsche Standardsprache in Luxemburg und Belgien unter ganz anderen Bedingungen verwendet als in den so genannten Vollzentren, was entsprechende theoretische Konsequenzen für die Beschreibung ihrer Variation nach sich zieht.
Einige der hier versammelten Beiträge gehen insofern über die strukturelle Beschreibung der Varianten hinaus, als sie ihre kognitive Repräsentation zusätzlich begrifflich zu fassen versuchen, so etwa als Perspektivenüberlagerung (Wyss) oder als freie, graduelle oder konditionierte Zweifelsfälle im Urteil der Sprecherinnen und Sprecher (Schmidlin). Wie schon frühere Studien (Scharloth 2005, Schmidlin 2011), so zeigen auch einige der hier vorliegenden Beiträge, dass selbst unter den Vollzentren, die von Ammon als gleichrangig betrachtet werden, eine sprachmarktbedingte Asymmetrie besteht, die gerade von Deutschlehrerinnen und -lehrern verinnerlicht zu werden scheint und ihre Korrekturpraxis dahingehend prägt, dass die (nicht-bundesdeutschen) Standard-Varianten primär als Normabweichungen gesehen werden. Es ist zu vermuten, dass, nicht zuletzt aus arbeitsökonomischen Gründen im Schulalltag, die Lehrkräfte sich für ihre Beurteilung eher auf subsistente Normen stützen denn auf Kodices, wo die standardsprachlichen Varianten durchaus thematisiert würden. Besonders hingewiesen sei an dieser Stelle auf Peters berechtigte Forderung, Spracheinstellungserhebungen mit Sprachwissenserhebungen zu koppeln. Da wir diese Forderungen im Hinblick auf zukünftige Studien, die die Einstellungen von Sprecherinnen und Sprechern gegenüber den Varianten des Standarddeutschen thematisieren, für wichtig halten, seien sie an dieser Stelle wiederholt:
Die Bewertung von sprachlichen Varianten ist nicht nur Ausdruck der Spracheinstellungen, sondern immer auch Ausdruck der Sprachbewusstheit oder des Sprachwissens der bewertenden Person.
Eine umfassende Interpretation einer Variantenbewertung kann nur dann gelingen, wenn nicht nur Daten zu den Spracheinstellungen, sondern auch zum individuellen Sprachwissen (oder der individuellen Sprachbewusstheit) der bewertenden Person vorliegen.
Bei Untersuchungen zur Bewertung von Sprachvarianten sollte jeweils auch die Kenntnis der Variantenbedeutung kontrolliert werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Tatsache, dass Sprecherinnen und Sprechern ein Wort bekannt ist, noch wenig darüber aussagt, ob sie auch alle Verwendungsweisen des Wortes im aktuellen Sprachgebrauch kennen. (Peter in diesem Band, Kap. 5.)
Welche Konsequenzen die schulische, asymmetrische Korrektur von Varianten des Standarddeutschen für den Erwerb von Schriftsprache und Textkompetenz in verschiedenen Regionen des deutschen Sprachgebiets hat, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Die Frage, wie sich die eingangs des vorliegenden Kapitels erwähnten unterschiedlichen Varietäten-Konstellationen auf das schulische Schreiben und den Umgang mit Normen auswirken, und zwar sowohl auf die Textproduktion der SchülerInnen als auch auf die Textbewertung der LehrerInnen, ist bislang noch nicht systematisch untersucht worden. Es wäre lohnenswert, hier korpusanalytisch zu untersuchen, worin sich unter einheitlichen Bedingungen erhobene Schülertexte aus den verschiedenen Regionen des deutschen Sprachraums auf verschiedenen sprachlichen Ebenen unterscheiden. Dabei könnte in variationstheoretischer Hinsicht geprüft werden, inwiefern sich die Konzepte der Plurizentrik bzw. der Pluriarealität der deutschen Standardsprache, wie sie für die Beschreibung lexikalischer und grammatischer Variation vornehmlich der geschriebenen Mediensprache im deutschen Sprachraum herangezogen werden können, für die Beschreibung der Sprachnormkonzepte eignen oder ob sich Struktur- und Diskursmuster in den Schülertexten (bspw. in argumentativen Texten) sowie die Bewertungsmuster räumlich entweder gar nicht oder dann abweichend von den Konzepten der Plurizentrik oder Pluriarealität fassen lassen. Daher wäre es wünschenswert, die Frage der Standardvarietäten im internationalen deutschsprachigen Raum in der Ausbildung von DeutschlehrerInnen stärker mitzuberücksichtigen und insbesondere auch bei der Schulbuchkonzeption (für alle Stufen und Schultypen) im Blick zu haben. Eine Erweiterung der Perspektive in kulturlinguistische Richtung könnte mit einer Verknüpfung bisheriger Ergebnisse mit diskurstheoretischen Untersuchungen zur Schulkultur erreicht werden, bei der die Art und Wirkung von auf- und abwertenden Kulturpraktiken in der schulischen Interaktion fokussiert werden. Dabei könnte untersucht werden, auf welche Weise diskursive Präferenzen zu einem Normalisierungsprozess im institutionellen Kontext der Schule führen.
Gegenwärtig wird in einem Sprachkulturraum, in dem interkulturelle Begegnungen alltäglich sind, in vielen Kontexten sprachliche Flexibilität erwartet. Im deutschsprachigen Raum verwenden zahlreiche Sprecherinnen und Sprecher in ihrem Alltag mehrere Sprachen und Varietäten und partizipieren somit an verschiedenen Varietätenkulturen. Dennoch erleben sie ihre innere Mehrsprachigkeit oft nicht als Gewinn, sondern als Defizit. Die Varianten des Standarddeutschen, auch wenn diese als standardsprachlich kodifiziert und in der Schriftsprache belegbar sind, betrachten sie letztlich doch eher als Normabweichung denn als Bereicherung ihres sprachlichen Repertoires. Wir meinen, dass diese Problematik es verdient, in der DeutschlehrerInnenausbildung und im Deutschunterricht auf allen Stufen regelmässiger thematisiert zu werden.
Dank
Im Namen aller Herausgeberinnen sei den Kolleginnen und Kollegen herzlich gedankt, die die Beiträge in einem anonymen Peer-Review-Verfahren kritisch begutachtet und somit zur Qualität des vorliegenden Bandes beigetragen haben. Nadine Mathys, Regula Gschwend und Alexandra Schiesser, Universität Freiburg (Schweiz), danken wir für ihre grosse Hilfe bei der Einrichtung und Korrektur der Beiträge. Den Beiträgerinnen und Beiträgern selbst danken wir nicht nur für ihre Texte und die gute Zusammenarbeit, sondern auch für ihre Geduld.
Literatur
Ammon, Ulrich, Hans Bickel & Alexandra N. Lenz (2016) (Hrsg.): Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol sowie in Rumänien, Namibia und Mennonitensiedlungen.2., völlig neu bearb. und erw. Aufl. Berlin: de Gruyter.
Ammon, Ulrich, Hans Bickel, Jakob Ebner, Ruth Esterhammer, Markus Gasser, Lorenz Hofer, Birte Kellermeier-Rehbein, Heinrich Löffler, Doris Mangott, Hans Moser, Robert Schläpfer, Michael Schlossmacher, Regula Schmidlin & Günter Vallaster (2004): Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol. Berlin, New York: de Gruyter.
Ammon, Ulrich (1995): Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Problem der nationalen Varietäten. Berlin, New York: de Gruyter.
Ammon, Ulrich (1998): Plurinationalität oder Pluriarealität? Begriffliche und terminologische Präzisierungsvorschläge zur Plurizentrizität des Deutschen – mit einem Ausblick auf ein Wörterbuchprojekt. In: Ernst, Peter & Franz Patocka (Hrsg.): Deutsche Sprache in Raum und Zeit. Festschrift für Peter Wiesinger zum 60. Geburtstag. Wien: Edition Praesens, 313–322.
Auer, Peter (2013): Enregistering pluricentric German. In: da Silva, Augusto Soares (Hrsg.): Pluricentricity. Language Variation and Sociocognitive Dimensions. Berlin, Boston: de Gruyter, 17–43.
Clyne, Michael G. (1995): The German Language in a Changing Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
Dürscheid, Christa, Stephan Elspaß & Arne Ziegler (2015): Variantengrammatik des Standarddeutschen. Konzeption, methodische Fragen, Fallanalysen. In: Lenz, Alexandra N. & Manfred M. Glauninger (Hrsg.): Standarddeutsch im 21. Jahrhundert – Theoretische und empirische Ansätze mit einem Fokus auf Österreich. Wien: Vienna University Press, 207–235.
Elspaß, Stephan & Konstantin Niehaus (2014): The standardization of a modern pluriareal language. Concepts and corpus designs for German and beyond. In: Orð og tunga16, 47–67.
Glauninger, Manfred M. (2015): (Standard-)Deutsch in Österreich im Kontext des gesamtdeutschen Sprachraums. Perspektiven einer funktional dimensionierten Sprachvariationstheorie. In: Lenz, Alexandra N. & Manfred M. Glauninger (Hrsg.): Standarddeutsch im 21. Jahrhundert. Göttingen: V&R unipress, 11–57.
Herrgen, Joachim (2015): Entnationalisierung des Standards. Eine perzeptionslinguistische Untersuchung zur deutschen Standardsprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In: Lenz, Alexandra N. & Manfred M. Glauninger (Hrsg.): Standarddeutsch im 21. Jahrhundert. Göttingen: V&R unipress, 139–164.
Kellermeier-Rehbein, Birte (2014): Plurizentrik. Einführung in die nationalen Varietäten des Deutschen. Berlin: Schmidt.
Klein, Wolf-Peter (2003): Sprachliche Zweifelsfälle als linguistischer Gegenstand. Zur Einführung in ein vergessenes Thema der Sprachwissenschaft. In: Linguistik online 16, 4/03.
Markhardt, Heidemarie (2005): Das Österreichische Deutsch im Rahmen der EU. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Polenz, Peter von (1988): ‚Binnendeutsch‘ oder plurizentrische Sprachkultur. Ein Plädoyer für Normalisierung in der Frage der ‚nationalen‘ Varietäten. In: Zeitschrift für Germanistische Linguistik16, 198–218.
Ransmayr, Jutta (2006): Der Status des Österreichischen Deutsch an Auslandsuniversitäten. Eine empirische Untersuchung. Frankfurt am Main etc.: Peter Lang.
Reiffenstein, Ingo (2001): Das Problem der nationalen Varietäten. Rezensionsaufsatz zu Ulrich Ammon: Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In: Zeitschrift für deutsche Philologie120, 78–89.
Scharloth, Joachim (2005): Asymmetrische Plurizentrizität und Sprachbewusstsein. Einstellungen der Deutschschweizer zum Standarddeutschen. In: Zeitschrift für germanistische Linguistik33/2, 236–267.
Scheuringer, Hermann (1996): Das Deutsche als pluriareale Sprache: Ein Beitrag gegen staatlich begrenzte Horizonte in der Diskussion um die deutsche Sprache in Österreich. In: Die Unterrichtspraxis/Teaching German29, 147–153.
Schmidlin, Regula (2011): Die Vielfalt des Deutschen: Standard und Variation. Gebrauch, Einschätzung und Kodifizierung einer plurizentrischen Sprache. Berlin: de Gruyter.
Seifter, Thorsten & Ingolf Seifter (2015): Warum die Frage, ob sich „pfiati vertschüsst“, keine linguistische ist. Zur Fundamentalkritik am „Österreichischen Deutsch“. In: Lüger, Heinz-Helmut (Hrsg.): Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung. Landau: Verlag Empirische Pädagogik, 65–90.
Sutter, Patrizia (2017): Diatopische Variation im Wörterbuch. Theorie und Praxis. Berlin: de Gruyter.
Wissik, Tanja (2014): Terminologische Variation in der Rechts- und Verwaltungssprache. Deutschland – Österreich – Schweiz. Berlin: Frank & Timme.
I. Theoretische Betrachtungen
Die Rolle der deutschen Sprache in ideologischen Konstrukten der Nation1
Sprache und Nation im deutschsprachigen Raum
Der ethnolinguistische Nationalismus im 18. und 19. Jahrhundert
Die sprachliche Situation aus der Perspektive der Soziolinguistik
Zu einer Neuevaluierung der Bedeutung des „Alten Reichs“ im Standardisierungsprozess
Literatur
1.Sprache und Nation im deutschsprachigen Raum
In diesem Beitrag werden zwei Ansichten über das Verhältnis zwischen Sprache und Nation im deutschsprachigen Raum im 18. und 19. Jahrhundert zur Diskussion gestellt, die auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen, die jedoch, wie hier gezeigt werden soll, eng miteinander verknüpft sind und auf Auffassungen über den Verlauf der deutschen Geschichte in dieser Zeit zurückzuführen sind, die die neueste historische Forschung in Frage gestellt hat.
Als erstes geht es um die ethnolinguistische Grundlage des deutschen Nationalismus, m.a.W. um die Annahme, dass die deutsche nationale Identität in Ermangelung anderer signifikanter identitätsstiftender Merkmale, wie z.B. eines klar definierbaren Territoriums, allein auf der gemeinsamen Sprache basieren könnte. Daraus entstand der besonders im 19. Jahrhundert verbreitete Topos, dass in Deutschland die sprachliche Einheit der politischen Einheit vorausging und die unabdingbare Voraussetzung für diese bildete – in den von Meinecke (1908) geprägten Termini hatte nach der nationalistischen Ideologie der Zeit eine Sprachnation (und eventuell auch eine Kulturnation) schon lange bestanden, die die Bildung einer Staatsnation in der Gestalt des „kleindeutschen“ Reichs von 1871 rechtfertigte.
Aus der Perspektive der Soziolinguistik erscheint der Begriff einer einheitlichen deutschen Sprache im frühen 19. Jahrhundert jedoch hoch problematisch, denn das Sprachgebiet bestand um diese Zeit aus einem äußerst heterogenen Dialektkontinuum, in dem Sprecher aus entfernten Gegenden sich nur mit großer Schwierigkeit verständlich machen konnten. Wie Barbour (1994: 332) sagt: „[…] probably no other European language is so diverse, and groups of dialects elsewhere which show a similar diversity are considered to be several languages“ (vgl. auch Durrell 2002). Dieser Topos trat in einer Rezension von Misha Glenny (2014) in der britischen Zeitung „The Observer“ neulich wieder auf, in der er anlässlich eines Buches über die ethnische und sprachliche Vielfalt Indonesiens schrieb: „What was it that bound Catholic Bavaria to Protestant Prussia? It clearly wasn’t religion, or language.“ Hier spielt er klar auf die alltägliche Beobachtung an, dass man in Berlin anders spricht als in München, aber in diesem Zusammenhang interessieren vor allem die Anspielungen auf die Mythen um die Bildung eines deutschen Nationalstaats.
Diese sprachliche Heterogenität steht anscheinend in krassem Widerspruch zu der Annahme, dass sich die politische Einigung auf die Einheit der Sprache gründete und darin ihre Rechtfertigung fand. Diese Auffassung war jedoch im 19. Jahrhundert – vor allem im Nachhinein, nach der Reichsgründung 1871 – allgemein akzeptiert, und sie gilt auch heute noch als Gemeinplatz der Geschichte. In einer Rezension des Bandes, in dem Durrell (2002) erschien, schrieb Bonnell (2003: 146), dass Durrells Beitrag „challenges long-conventional assumptions about German linguistic unity preceding political unity“. An dieser Stelle möchte ich jedoch die in Durrell (2002) vertretenen Ansichten sowie auch den Topos der sprachlichen Einheit als Grundlage für die politische Einigung revidieren, denn erstens ist es klar, dass man trotz der eben besprochenen Vielfalt der Erscheinungsformen schon im ausgehenden 18. Jahrhundert von einer „deutschen Sprache“ in einem in diesem Zusammenhang relevanten Sinne sprechen kann. Und zweitens hat es um diese Zeit trotz der späteren Behauptungen einer nationalistischen Ideologie auch ein politisches Gebilde gegeben, das wir mit guten Gründen als einen „deutschen“ Staat bezeichnen dürfen und in dem die deutsche Sprache die wesentlichen Stadien im Prozess der Standardisierung durchmachte. Dieses Gebilde war dann ein wichtiger Fokus für die nationale Identität. Diese Erkenntnis ist m.E. eine klare Folgerung aus der neuen historischen Forschung, insbesondere Whaley (2012) und Wilson (2016), die die Geschichte des „Alten Reichs“ völlig neu evaluiert hat und Einsichten bietet, die eine Überprüfung der herkömmlichen Ansichten über das Verhältnis von Sprache und Nation im deutschsprachigen Raum in dieser Zeit notwendig machen.
2. Der ethnolinguistische Nationalismus im 18. und 19. Jahrhundert
Bei dem ersten der zu besprechenden Themen ist es aus der Perspektive der modernen Soziolinguistik klar, dass die Tatsache der sprachlichen Heterogenität für die Annahme einer vorwiegend ethnolinguistischen Grundlage für den deutschen Nationalismus im 19. Jahrhundert problematisch erscheinen dürfte. Jedoch erscheint diese Annahme durch die Aussagen zeitgenössischer Autoren als vollständig gerechtfertigt. Im 1785 erschienenen 2. Teil seiner „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ hatte Herder die Ansicht vertreten, dass die Sprache die menschliche Natur widerspiegele und dass jede Sprache also der unverkennbare Ausdruck des Charakters eines besonderen Volkes in der menschlichen Gemeinschaft sei. Für ihn waren alle Sprachen gleichberechtigt und hatten jeweils das Wesentliche der Identität des Sprachvolks durch alle Zeiten gestiftet. So sei nach ihm der natürlichste Staat (Herder 1984: III/1, 337) „also Ein Volk, mit Einem Nationalcharakter“, denn die Sprache verbinde ein Volk mit seiner Vergangenheit und die Grenzen eines jeweiligen Staates sollten sich mit dem historischen Territorium des Sprachvolks decken.
Herders Überlegungen zum Verhältnis von Volk, Sprache und Staat wurden während der traumatischen Jahre der napoleonischen Kriege und nach dem Ende des „Alten Reichs“ weiter ausgebaut zu einem klar artikulierten nationalistischen Diskurs. Dieser neue Nationalismus sah genau wie Herder die Sprache als bestimmendes Merkmal der deutschen Nation. Das dringendste Ziel war aber jetzt die Befreiung der deutschen Lande und der deutschen Kultur von der Bedrohung durch die fremde Herrschaft und so findet man etwa bei Fichte nicht mehr Herders Annahme einer grundsätzlichen Gleichheit aller Sprachen, sondern die Vorstellung der grundlegenden Überlegenheit der deutschen Sprache insbesondere gegenüber der französischen. So liest man in den „Reden an die deutsche Nation“ (zit. nach Dieckmann 1989: 45):
Das deutsche Volk ist das ursprüngliche, das unverfälschte Volk, das gegen die militärische wie kulturelle Unterjochung durch Frankreich um seine Freiheit und Identität kämpft und dabei im Dienste eines höheren geschichtlichen Auftrags handelt. […]
Nach Jahrtausenden, und nach allen den Veränderungen, welche in ihnen die äußere Erscheinung der Sprache dieses Volks erfahren hat, bleibt es immer dieselbe Eine, ursprünglich also ausbrechenmüssende lebendige Sprachkraft der Natur, die ununterbrochen durch alle Bedingungen herab geflossen ist, und in jeder so werden mußte, wie sie ward, am Ende derselben so seyn mußte, wie sie jezt ist, und in einiger Zeit also seyn wird, wie sie sodann müssen wird. Die reinmenschliche Sprache zusammengenommen zuförderst mit dem Organe des Volks, als sein erster Laut ertönte; was hieraus sich ergiebt, ferner zusammengenommen mit allen Entwiklungen, die dieser erster Laut unter den gegebnen Umständen gewinnen mußte, giebt als letzte Folge die gegenwärtige Sprache des Volks. Darum bleibt auch die Sprache immer dieselbe Sprache.
Hier findet man alle wesentlichen Bestandteile des ethnolinguistischen Nationalismus, so etwa den Begriff eines Volks, das durch seine einzigartige, überlegene Sprache gekennzeichnet ist. Der Charakter des Volks findet in dieser Sprache seinen unvergleichlichen Ausdruck; anders als die Franzosen, die ihr ursprüngliches Fränkisch gegen das Romanische getauscht haben, hat das deutsche Volk seine Sprache immer bewahrt, und zwar in einer Form, die trotz oberflächlicher Veränderungen immer gleich geblieben ist. Dieses Volk hat das Recht auf ein unabhängiges, einheitliches politisches Gebilde in seinem ererbten Territorium ohne Fremdherrschaft.
Im 19. Jahrhundert wurde dann die Gleichsetzung von Sprache und Nation in Deutschland (wie auch oft anderswo) kaum hinterfragt. Für Hegel bildete der Volksgeist die Basis des Staats (vgl. Barnard 1965: 166–167) und für Jacob Grimm (1884: VII, 557) war bekanntlich „ein volk […] der inbegriff von menschen, welche dieselbe sprache reden“, wie er in seiner berühmten Rede auf der Germanistenversammlung in Frankfurt im Jahre 1846 behauptete. Der britische Historiker Eric Hobsbawm (1992: 103) erklärte, dass man insbesondere in Bezug auf Deutschland nicht darüber staunen sollte, dass diese Ein-Volk-eine-Sprache-Ideologie vor allem dort verbreitet war, denn:
For Germans […], their national language was not merely an administrative convenience or a means of unifying state-wide communication […]. It was more even than the vehicle of a distinguished literature and of universal intellectual expression. It was the only thing that made them Germans […], and consequently carried a far heavier charge of national identity than, say, English did for those who wrote and read that language.
Am wichtigsten ist jedoch die Perzeption von gebildeten Deutschen im 19. Jahrhundert, dass für sie in erster Linie die Sprache identitätsstiftend war, dass dieses Identitätsgefühl das Streben nach einem einheitlichen Staat legitimierte und die Basis dafür bilden sollte. Der Topos, dass es allein die gemeinsame Sprache gewesen sei, die die Nation während der Jahre der politischen Fragmentierung nach dem Wiener Kongress zusammengehalten habe, sowie auch deren ideologische Bedeutung für die Reichsgründung 1871, kommt in einer Streitschrift von Emil du Bois Raymond vom Jahre 1874 sehr klar zum Ausdruck (zit. nach Dieckmann 1989: 348): „Die Sprache war lange beinahe das einzige Band, welches die jetzt das Reich ausmachenden deutschen Stämme zusammenhielt. Ihr verdankt das Reich seine Neuerstehung.“ Und in seinem großen Standardwerk zur Geschichte der deutschen Sprache akzeptiert von Polenz (2013: 10–11) sehr klar die Annahme, dass die politische Einigung auf der Basis der eher erfolgten identitätsstiftenden sprachlichen Einigung geschah:
Im Laufe des 18. Jh.s hat die kulturpatriotische Bewegung – mehr als ein Jahrhundert vor der Gründung eines deutschen Nationalstaates – die Kodifizierung und gesellschaftliche Anerkennung der deutschen Schriftsprache als Kulturnationalsprache in den Oberschichten erreicht und auch in den deutschen Mittelschichten bis um 1800 eine mindestens passive deutsche Schriftsprachkompetenz und Sprachloyalität von der Nord- und Ostseeküste bis in die Alpenländer bewirkt. Sie stellt eine wichtige, aber noch rein kulturelle, noch nicht auf staatliche Macht hin orientierte Voraussetzung für die Entstehung des schwierigen, zwischen Kultur und Politik widersprüchlichen deutschen Nationalbewusstseins im 19. Jh. dar.
3.Die sprachliche Situation aus der Perspektive der Soziolinguistik
3.1.Zur Heterogenität des deutschen Sprachraums
Wie Durrell (2002) zeigen wollte, muss diese Vorstellung von dem Verhältnis von Sprache und Nation im 19. Jahrhundert jedoch im Lichte der sprachlichen Vielfalt des deutschsprachigen Raumes hinterfragt werden, denn die Frage stellt sich, wie es angesichts der Heterogenität der damals existierenden Sprachformen zur Annahme einer einheitlichen „deutschen Sprache“ kommen konnte. Auch ist das von Herder, Fichte und nationalistischen Ideologen aufgestellte Postulat, dass eine solche grundlegende „deutsche“ Sprache seit Jahrhunderten (etwa seit dem Karolingerreich, wenn nicht noch früher) existiert habe, eine klare Fiktion. Dieses Postulat fußt jedoch auf verbreiteten Mythen über die Sprache, so wie sie Watts (2011, 2012) beschreibt, und zwar insbesondere auf dem „Mythos der grundlegenden homogenen Sprache“, dem „Mythos der unveränderlichen Sprache“ und dem „Mythos der althergebrachten Sprache“. Watts bezieht sich dabei in erster Linie auf das Englische, aber seine Einsichten lassen sich ohne grundsätzliche Änderungen auf das Deutsche übertragen, denn diese Mythen lassen sich ohne Weiteres im deutschsprachigen Raum belegen – nicht zuletzt weil sich die Skepsis gegenüber dem Konzept der Plurizentrizität letztendlich auf die Annahme des verbreiteten Mythos der grundlegenden homogenen Sprache zurückführen lässt. Auch ist es klar, dass die oben dargestellten Vorstellungen von Herder, Fichte und anderen über Sprache in solchen Mythen verankert sind. Dass sie grundlegende Probleme dieser Vorstellungen erkannt haben könnten, lässt sich gut aus Fichtes Versuch ersehen, die Tatsachen der beobachtbaren sprachlichen Änderungen zu verniedlichen und dadurch die Annahme einer seit Jahrhunderten bestehenden einheitlichen Sprache des Volks zu retten.
Die in Durrell (2002) geäußerten Ansichten über die mit dem Versuch verbundenen Probleme, die Vorstellung einer einheitlichen „deutschen Sprache“ mit der Tatsache der Heterogenität der existierenden Sprachformen zu vereinbaren, liegt die Einsicht von Barbour (1991: 45) zugrunde, die „deutsche Sprache“ sei um 1800 „little more than a standard language spoken by a tiny minority of the population, superimposed on a group of related but highly divergent dialects with often almost no mutual comprehensibility“. Auch Mattheier (2000: 1951) schreibt, dass das Hochdeutsche um diese Zeit „eine minimale soziolinguistische Realität“ gehabt habe. Das „Hochdeutsche“ war nämlich Anfang des 19. Jahrhunderts eine fast ausschließlich in der Schrift verwendete Varietät, die im Laufe eines (zu dieser Zeit noch nicht vollständigen) schreibsprachlichen Standardisierungsvorgangs entstanden war. Sie wurde allein von einer bürgerlichen Elite verwendet und diese hatte sie nur im Bildungsprozess erwerben können, denn sie war keiner irgendwo gesprochenen Sprachform entstammt, sondern war das Ergebnis eines Selegierungsprozesses unter den regionalen Schreibsprachen der frühen Neuzeit. Haugen (1966) hat die europäischen Standardsprachen, die aus solchen Prozessen hervorgegangen sind, sehr treffend als „kulturelle Artefakte“ bezeichnet, und das gilt in sehr hohem Maße für das Hochdeutsche. Wie Barbour (1991, 1994) dargestellt hat, gibt es keinen rein linguistischen Grund, warum sich aus den regionalen Schreibsprachen der frühen Neuzeit nicht drei oder vier Standardsprachen entwickelten – und letztendlich lässt sich die heutige Plurizentrizität des Deutschen z.T. auf diese Unterschiede zurückführen.
Im Hinblick auf die Vielfalt der gesprochenen Varietäten im deutschsprachigen Raum um 1800 und die Künstlichkeit und soziale Beschränktheit des Hochdeutschen muss gefragt werden, wie eine derartige sprachliche Einheitlichkeit vorausgesetzt werden konnte, die als ethnolinguistische Rechtfertigung für das Streben nach einem Nationalstaat im 19. Jahrhundert angesehen werden konnte. Trotz der oben angeführten Behauptungen von Herder, Fichte und anderen hat es im Karolingerreich natürlich kein einheitliches „deutsches“ Volk mit einer einheitlichen Sprache gegeben, der man dann eine ungebrochene Existenz bis in die Neuzeit zusprechen könnte. Diese Vorstellung war in den gebildeten Bevölkerungsschichten weit verbreitet, das lässt sich jedoch sehr klar auf die gängige Annahme einer (mythischen) grundsätzlich unveränderlichen, homogenen, althergebrachten Sprache zurückführen. Unter anderem widerspricht das Ablösen des Niederländischen aus dem westgermanischen Sprachkontinuum in der frühen Neuzeit und seine Entwicklung als selbstständige Standardsprache der These einer seit frühester Zeit erkennbaren und von den Sprachteilhabern selbst erkannten sprachlichen Einheit eines Volkes, das stets die gleiche „deutsche“ Sprache gesprochen habe (vgl. Durrell 2002, 2009). Mit der verbreiteten Akzeptanz dieser These kamen aber dann auch wissenschaftliche Bemühungen auf, die Geschichte dieser „Nationalsprache“ zu ergründen, die auf eine historisch basierte Legitimierung für einen Nationalstaat hinzielte, dessen Ursprung sich ebenfalls bis in früheste Zeiten zurückverfolgen ließe. Ähnliche Sprachgeschichten mit einer nationalistischen Zielsetzung entstanden zu dieser Zeit in anderen europäischen Ländern, z.B. in England (vgl. Crowley 2003). Die angeblich jahrhundertealte Einheit eines Volkes, das stets das gleiche „Deutsch“ gesprochen hätte, ist letztendlich ein Mythos der nationalistischen Sprachgeschichtsschreibung im 19. Jahrhundert, die das Ziel hatte, die politische Einigung im Nachhinein zu rechtfertigen. Eine „Geschichte der deutschen Sprache“ wurde nämlich geschaffen, um zu beweisen, dass eine als „Deutsch“ erkennbare Sprache, und daher ein „deutsches“ Volk, mindestens seit der Gründung des Karolingerreichs existiert hätte. So gelang es den Sprachhistorikern, das ideologische Konstrukt von einem Volk zu etablieren, dessen Nationalbewusstsein sich bis zum Anfang seiner Geschichtsschreibung mit der Gründung seines ersten Staatsgebildes zurückverfolgen lässt. Dieses Nationalbewusstsein gründet sich seinerseits auf die Perzeption, dass die Mitglieder des Volks die gleiche Sprache redeten, die sie immer noch besitzen und nach der sie sich bezeichnet hatten (vgl. Durrell 2009), und nach der Auffassung der nationalistischen Sprachgeschichtsschreibung hätten sie dieses Bewusstsein einer grundlegenden ethnolinguistischen Einheit durch die Jahrhunderte der politischen Fragmentierung bewahrt. Dieses Konstrukt, das sich auch mit der gleichzeitig aufkommenden Vorstellung der „verspäteten Nation“ bzw. des deutschen „Sonderwegs“ (vgl. Wilson 2016: 3 u. 678) verbinden lässt, hatte einen außerordentlich kräftigen Symbolwert, vor allem weil es die Gründung eines neuen deutschen Nationalstaats durch den Bezug auf einen früheren legitimierte. Indem es auch auf andere gängige Vorstellungen über die deutsche Geschichte anspielt, hat es den Vorteil einer gewissen Plausibilität. Aber das Konstrukt ist letztendlich ein Mythos.
3.2.Zur sozialen Bedeutung von Standardsprachen
An dieser Stelle müssen wir jedoch die Grenzen der soziolinguistischen Perspektive erkennen und uns vor deren Beschränktheit hüten. In den letzten 50 Jahren hat sich die relativ neue soziolinguistische Forschung darum bemüht, das ganze Spektrum der Variation in einer Sprachgemeinschaft und die Bedingungen des Gebrauchs von Varietäten und Varianten eingehend zu untersuchen und die Funktion der Variation in der Gesellschaft zu verstehen, neuerdings auch in einem historischen Kontext (vgl. u.a. Elspaß et al. 2007). Die Prestige- bzw. Standardvarietät sollte nicht mehr den alleinigen Fokus der linguistischen Untersuchung bilden, wie es früher oft der Fall gewesen war, und Sprachwissenschaftler sind von den präskriptiven und normativen Traditionen der Vergangenheit abgekommen, die Milroy & Milroy (1999) treffend als die „Ideologie des Standards“ bezeichnet haben. Dazu gehört die Vorstellung, dass es nur eine gültige, bzw. „korrekte“ Form einer Sprache gebe und dass jede Abweichung von den Normen dieser Varietät als unrichtig oder schlecht zu betrachten sei. Auch wurde die Entstehung sowie auch der Status von Standardvarietäten in Sprachgemeinschaften eingehend untersucht, was zu der schon erwähnten Erkenntnis von Haugen (1966) führte, dass es sich bei diesen grundsätzlich um „kulturelle Artefakte“ handelt, die charakteristischerweise durch die häufig absichtlichen Bestrebungen einer Bildungselite entstehen, der es im Laufe der Zeit gelingt, die Sprachgemeinschaft zu überzeugen, dass nur die von ihr präferierten Sprachformen Gültigkeit besitzen und dass andere konkurrierende Formen nicht korrekt bzw. einfach schlecht seien (vgl. für das Deutsche Davies & Langer 2006). Dabei ist zu erkennen, dass diese Elite von dem Mythos einer grundsätzlich homogenen und unveränderlichen Sprache ausgeht und ihre Bemühungen als die Festlegung dieser Varietät für alle Zeiten versteht (vgl. Joseph 1987). Solche Standardsprachen sind dann typischerweise Sprachen der Macht, die ihr Prestige von der kulturellen Elite gewinnen, die sie geschaffen hat, und sie werden im Bildungswesen als die allein gültigen Formen aufgezwungen und des Öfteren mit dem Staat als „Nationalsprachen“ identifiziert. In diesem Fall entwickeln sie einen enormen Symbolwert als repräsentativ für die Einheit und Selbstständigkeit des Staates oder der Nation und können letztendlich als Legitimierung für die Existenz des Staates benutzt werden. Viele Staaten haben Maßnahmen ergriffen, um die Vorherrschaft einer solchen Sprache sicherzustellen und dabei eine Situation zu schaffen, die mit Herders Vorstellung übereinkommt, dass der ideale Staat ethnolinguistisch einheitlich sein sollte, mit einem einzigen Sprachvolk in dessen erblichem Territorium.
Jedoch kann eine zu enge soziolinguistische Perspektive zu einer Unterschätzung der Funktion und des Status von Standardvarietäten und zu einer Überbewertung der Bedeutung der sprachlichen Variation führen. Auch heute wird diese Perspektive außerhalb der Sprachwissenschaft selten vollständig wahrgenommen, so dass die mit der „Ideologie des Standards“ verbundenen Mythen in weiten Kreisen der Bevölkerung häufig ohne Hinterfragung akzeptiert werden, insbesondere die Vorstellung, dass es eine einzig gültige, homogene Sprachvarietät gibt, so wie sie in den gängigen Standardwerken kodifiziert ist, und dass Abweichungen davon als Sprachverfall oder dgl. zu bewerten seien und von einem Mangel an Bildung, niedrigem sozialem Status, rustikaler Rückständigkeit oder sittlicher Verderbtheit zeugen. Diese Vorstellung herrschte aber schon Ende des 18. Jahrhunderts vor, zu einer Zeit, als Kompetenzen im Hochdeutschen ausschließlich im Bildungsprozess erworben werden konnten, weil es niemandes Primärsprache war. Für die Bildungselite galt aber diese Varietät als die „deutsche Sprache“ schlechthin. Für die Grammatiker des 17. und 18. Jahrhunderts, die die endgültige Form der Standardsprache kodifizierten, waren die Mythen einer homogenen, unabänderlichen Sprache eine Selbstverständlichkeit und sie stellten es sich als Ziel vor, die – in den Termini von Schottel (vgl. McLelland 2011) – grundrichtigen und somit für alle gebildeten Sprachteilhaber verbindlichen Formen dieser Sprache festzustellen. Wie Joseph (1987: 17) zu diesem Prozess schreibt: „There existed a general belief in an original God-given language, and in original, perfect and static forms of existing languages, from which actual usage could err“. Dialekte und andere gesprochene Varietäten wurden für korrupte Abweichungen von diesen festen Normen oder einen von Ungebildeten herrührenden Sprachverfall gehalten. Man nahm an, dass diese ursprüngliche, „echte“ Sprache mit Hilfe von Vernunft und Logik aufgedeckt und ihre Grammatik und Lexik dann für alle Zeiten in der Form von Präskriptionen kodifiziert werden konnte.
Diese Schreibsprache war im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts weitgehend kodifiziert (vgl. von Polenz 2013: 144–192) und im ganzen Reich als verbindliche Form des geschriebenen Deutsch akzeptiert worden – auch im Norden trotz des großen Unterschieds zu den autochthonen niederdeutschen Mundarten und in Österreich, wo bis zur theresianischen Sprachreform etwas andere Normen gegolten hatten (vgl. Wiesinger 2000). Und dieses Hochdeutsch war es und nicht irgendwelche gesprochenen Varietäten, das den wichtigsten Fokus für die Bestrebungen nach der Gründung eines Nationalstaates im 19. Jahrhundert bildete. Typisch für allgemeine Vorstellungen über Sprache im 19. Jahrhundert – sowie oft noch heute – war die Tatsache, dass man die Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache nicht zur Kenntnis nahm und dass man allein auf die geschriebene Sprache achtete. Wie Anderson (1991: 43–46) erkannt hat, genießen allein „print-languages“ Prestige, was sich auf drei Funktionen gründet. Erstens sind sie ein einheitliches Kommunikationsmittel für alle Sprecher der vielen Varietäten, die eine auch nur lose Verwandtschaft mit dieser Schriftsprache aufweisen. Dabei handelte es sich zunächst vielleicht um eine kleine Bildungsschicht, aber für diese bedeutete sie eine gemeinsame Kultur, die schon seit langem bestanden hatte, und für gebildete Deutsche im 19. Jahrhundert war die „Nation“ genau die durch diese Sprachform gestaltete Kulturnation. Zweitens haben „print-languages“ den Anschein der Permanenz. Sie entsprechen dadurch dem Mythos der Homogenität und der Unabänderlichkeit und scheinen die Vorstellung zu bestätigen, dass sie die ursprüngliche, althergebrachte, „reine“ Sprache verkörpern. Diese ahistorische Betrachtungsweise, die Annahme, dass es diese Sprache in genau dieser Form (wie auch das dazu gehörige Sprachvolk) immer gegeben hat, ist wesentlich für die Vorstellungen des 18. Jahrhunderts über Sprache und liegt den Ansichten Herders über das Verhältnis von Sprache und Volk zugrunde, sowie auch Fichtes Ideen über die Ursprünglichkeit des deutschen Volks und seiner Sprache. Drittens sind „print-languages“ die Sprachen von Herrschaft und Macht, sie wurden vornehmlich von einer Bildungselite geschaffen und deren Verbreitung ist ein Zeichen für die anhaltende kulturelle Dominanz dieser Elite. Abweichende Varietäten werden stigmatisiert und marginalisiert. Anderson (1991) verweist in diesem Kontext ausdrücklich auf das Beispiel des Niederdeutschen, und in der Tat stellt eine der bemerkenswertesten und zugleich wichtigsten Aspekte der deutschen Sprachgeschichte der Ersatz des Niederdeutschen als Schriftsprache in Norddeutschland nach 1600 dar (vgl. Sanders 1982 und von Polenz 2013: 234–240), denn dadurch sind die Einwohner des Nordens „Deutsche“ geworden (bzw. geblieben) und ihre angestammten Dialekte gelten als Varietäten der deutschen Sprache, obwohl sie linguistisch gesehen dem Niederländischen näher stehen.
Ein besseres Verständnis der Entwicklung wird daher nur möglich, wenn wir die Sprache und insbesondere die sprachliche Variation aus der zeitgenössischen Perspektive betrachten und nicht aus dem heraus, was uns die moderne Soziolinguistik darüber gelehrt hat. Denn es ist letztendlich das standardisierte Hochdeutsch gewesen, das im 19. Jahrhundert zum zentralen Fokus der nationalistischen Ideologie wurde, obwohl es sich, wie oben ausgeführt, von allen gesprochenen Varietäten des Deutschen unterschied und fast ausschließlich in der Schrift von einer kleinen Bildungselite verwendet wurde, wie Heinrich Bauer im ersten Band seiner Vollständige[n] Grammatik der neuhochdeutschen Sprache bestätigte (1827: I, 146): „In keiner Provinz Deutschlands wurde Hochdeutsch je gesprochen“ (zit. nach Evans 2004: 21). Diese Unterschiede in den tatsächlich verwendeten gesprochenen Varietäten waren jedoch nicht relevant, denn diese wurden als ungebildete Abweichungen aufgefasst, da allein die homogene und kodifizierte schriftliche Varietät als das echte korrekte Deutsch galt. Wie Hobsbawm (1992: 113) schreibt, am wichtigsten ist „the written language, or the language spoken for public purposes“, denn „linguistic nationalism was the creation of people who wrote and read, not of people who spoke.“ Und diese Gruppe, das Bildungsbürgertum, war es, die im 19. Jahrhundert die Ideen von Herder, Fichte, Humboldt und anderen über die Einzigartigkeit von Sprachvölkern aufnahm: Die ethnolinguistische Einheit der Sprach- oder Kulturnation, so wie diese auf der Basis der in der Schrift verwendeten Varietät empfunden wurde, galt als Legitimierung für das Streben nach einer Staatsnation, einem Ziel, das dann durch die Reichsgründung 1871 erfüllt wurde – obwohl das kleindeutsche Reich keineswegs dem Herderschen Ideal eines ethnolinguistisch einheitlichen Staats entsprach, dem alle deutschen Muttersprachler, und nur diese, angehörten.
4.Zu einer Neuevaluierung der Bedeutung des „Alten Reichs“ im Standardisierungsprozess
Mit der kleindeutschen Reichsgründung unter preußischer Führung wurde jedoch dann eine narrative Teleologie assoziiert, nach der sie als Endpunkt eines natürlichen und unabänderlichen geschichtlichen Prozesses aufgefasst wurde. Diese wurde schon in den 1840er Jahren von Droysen in seinen Vorlesungen über das Zeitalter der Freiheitskriege suggeriert, wo er nach Sheehan (1989: 842–843) die Meinung vertrat, dass „it belonged to the true nature of the state to be national, and to the true nature of the Volk to have a state“, und sie kommt auch nach der Reichsgründung in Treitschkes Deutsche[r] Geschichte im neunzehnten Jahrhundert sehr klar zum Ausdruck. Diese These bezeichnet Hughes (1988: 150) als „a deliberate perversion of Germany’s history designed to present it as unbroken progress towards the Prussian-led creation of Kleindeutschland in 1871“. Allerdings lebe sie nach ihm immer noch im allgemeinen Bewusstsein weiter. Nach dieser Auffassung wurde durch die deutsche Einigung 1871 das natürliche Schicksal der Nation erfüllt, das im Mittelalter durch den Zerfall des Reichs nach der Stauferzeit und später durch die Einmischung fremder Mächte vereitelt worden war, was die ungerechte Verspätung der deutschen Nationsbildung zur Folge gehabt hatte. Dies war nun überwunden, und das deutsche Volk hatte nunmehr den Nationalstaat, der ihm immer zugestanden hatte. Diese Darstellung des Laufs der deutschen Geschichte gilt heute als vollkommen überholt, obwohl Wilson (2016: 3) schreibt, dass sie „still continues as the ‘basso continuo’ of German historical writing and perception, not least because it appears to make sense of an otherwise thoroughly confusing past“, aber ein Aspekt davon lebt immer noch weiter, und zwar die Vorstellung, dass das „Alte Reich“ ein im 18. Jahrhundert völlig überholtes Staatsgebilde gewesen sei, eine strukturlose Zusammensetzung von unbedeutenden Duodezfürstentümern und dgl., die keineswegs als nationaler Staat der Deutschen angesehen werden kann.
Damit gelangen wir jedoch zur zweiten eingangs gestellten Frage, und zwar wie bzw. warum trotz der Vielfalt der sprachlichen Variation eine einzige standardisierte Varietät der deutschen Sprache in diesem zerbröckelnden Reich ohne Hauptstadt und ohne zentrale Machtbasis entstehen konnte. Eine Antwort lässt sich nur finden, wenn wir die heute noch verbreiteten Vorstellungen über das „Alte Reich“ und den Verlauf der deutschen Geschichte in der frühen Neuzeit hinterfragen sowie auch die damit verbundene These, dass die sprachliche Einigung der politischen Einigung vorausging und erst die Basis für diese schuf. Dazu ist eine grundsätzliche Neubewertung des herkömmlichen Bilds des Heiligen Römischen Reichs nötig, indem wir erkennen müssen, dass das traditionelle in der deutschen Geschichtsschreibung kolportierte Konstrukt auch zur besprochenen „deliberate perversion of German history“ (Hughes 1988: 150) beiträgt, und zwar zur Darstellung der Reichsgründung unter preußischer Führung als Überwindung des Partikularismus, unter dem die deutsche Nation nicht nur nach dem Wiener Kongress gelitten hatte, sondern auch während des ganzen Bestehens des „Alten Reichs“.
Diese herkömmliche Darstellung des Verlaufs der deutschen Geschichte seit dem Mittelalter wurde jedoch in letzter Zeit stark revidiert. In der einleitenden Zusammenfassung des Inhalts von Evans et al. (2011) heißt es:
Over the last forty years or so, research on the history of the Holy Roman Empire of the German Nation (1495–1806) has been transformed almost beyond recognition. Once derided as a political non-entity, a chaotic assemblage of countless principalities and statelets that lacked coercive power and was stifled by encrusted structures and procedures, the Reich has been fully rehabilitated by more recent historiography. […] The multi-layered, federal structure of the old Empire and its system of collective decision-making have been held up as a model for a peace-loving, multi-ethnic Europe, a European Union avant la lettre. Other historians have described the Reich as the first German nation-state, a political configuration based not on power and expansion, but on rights and liberties, the rule of law and a structural lack of capacity for aggression.
Ausführliche Darstellungen dieser Neubewertung findet man außer bei Evans et al. (2011) vor allem bei Schmidt (1999), Whaley (2012) und Wilson (2016). In diesen Arbeiten wird z.B. die Ansicht vertreten, dass das Reich genauso gut als ein zusammenhängender, kohärent organisierter Staat zu betrachten sei wie andere, die zu dieser Zeit in Europa existierten, insbesondere nach der Reichsreform am Wormser Reichstag 1495. Es war natürlich kein Staat im modernen Sinne, aber wir müssen uns davor hüten, geschichtliche Staatsgebilde nach modernen politologischen Kriterien zu beurteilen. Insbesondere sind die Bemerkungen von Whaley (2012: 650) für unsere Diskussion relevant: „The constructed memories after 1871 came to overlay any sense of the Reich as it had actually existed“ sowie (2012: 441): „Diversity and complexity was no obstacle to a sense of belonging to a larger system or to identifying this system with the wider national community of the Germans. […] the overwhelming majority of educated Germans seems to have associated the Reich with the ‚nation‘.“ Wilson (2016: 7) beurteilt die Situation ähnlich: „Germans already saw themselves as a political nation well before unification in 1871, identifying the Empire as their natural home“. Eine ausführlichere Darstellung der sprachlichen Verhältnisse im „Alten Reich“ bietet Wilson (2016: 259–262).
Diese neuen Forschungsergebnisse führen unabdingbar zu dem Schluss, dass die These einer politischen Einigung auf der Basis einer schon vorhandenen sprachlichen Einigung auch ein ideologisches Konstrukt der nationalistischen Geschichtsschreibung um die Zeit der Reichsgründung war, mit dem Ziel, diese durch nicht-politische Argumente zu rechtfertigen. Die Neubewertung der Geschichte des „Alten Reichs“ lehrt uns aber, dass man sich als Deutscher vornehmlich durch die Identifizierung mit einem Territorium, und zwar mit dem des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, bezeichnete und letztendlich Untertan des Kaisers war, und nicht weil man Deutsch als Muttersprache hatte. Allerdings war, wie Abb. 1 zeigt, Deutsch die dominante Sprache innerhalb dieses Territoriums. Dann (1996: 45) behauptet zwar:
Aufgrund seines universalen Charakters und seiner territorialen Dimension konnte dieses Reich nicht zum Nationalstaat eines einzigen Volkes werden; seine politischen Grenzen deckten sich fast nirgendwo mit den ethnischen Siedlungsgrenzen seiner Bevölkerung.
Abb. 1: Reichsgrenze und Sprachgrenze1
Bei näherem Hinsehen ist diese Ansicht aber keineswegs stichhaltig. Erstens gibt es kaum einen heutigen europäischen Nationalstaat, dessen politische Grenzen mit sprachlichen übereinstimmen und der somit ethnisch einheitlich wäre. Aus Abb. 1 lässt sich klar erkennen, dass das „Alte Reich“ in dieser Hinsicht viel einheitlicher war als das Deutsche Reich von 1871, denn es fanden sich verhältnismäßig wenige Deutschsprachige außerhalb seiner Grenzen – wir haben es vorwiegend mit den relativ neulich vom Reich abgespalteten Gebiete des Elsass und der Schweiz, sowie Gebieten, die nie zum Reich gehörten, wie Ostpreußen und den Sprachinseln im Osten zu tun – und innerhalb des Reichs waren verhältnismäßig wenige Nicht-Deutsche – vor allem in den südlichen Niederlanden, in Böhmen und Mähren, im Tirol und im heutigen Slowenien. In Preußen und dem Habsburger Reich waren natürlich sehr viele Angehörige anderer Volksgruppen, aber diese Gebiete lagen jenseits der eigentlichen Reichsgrenzen.





























