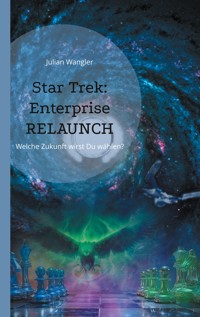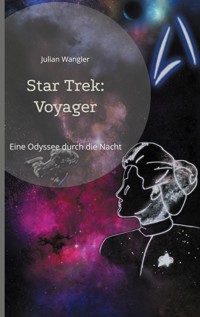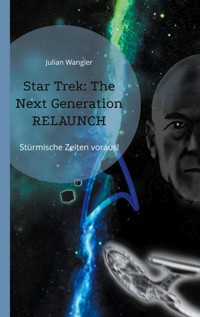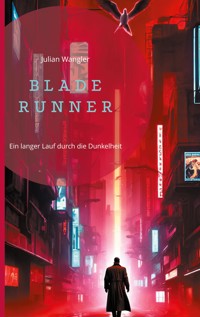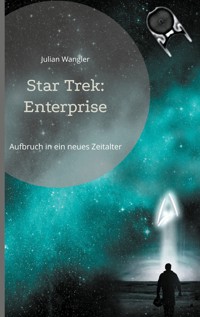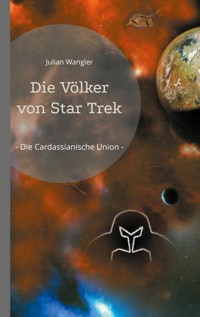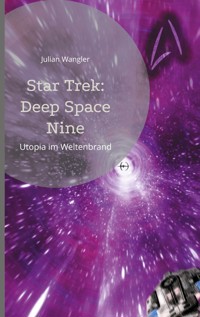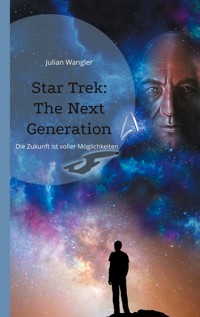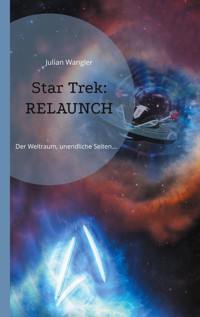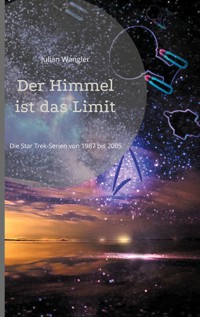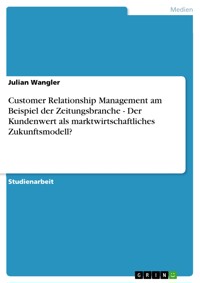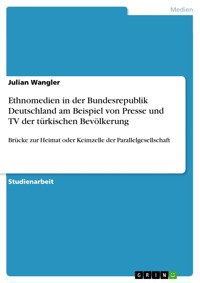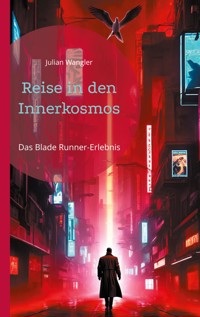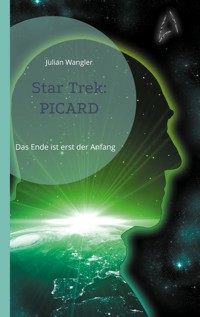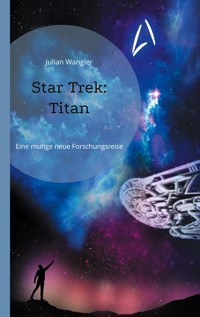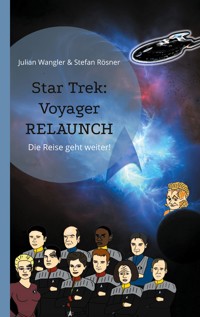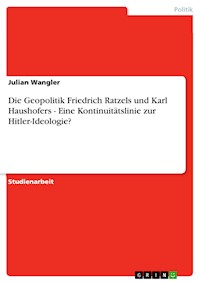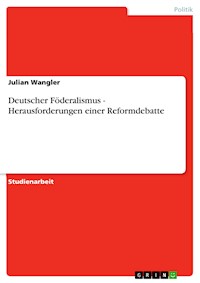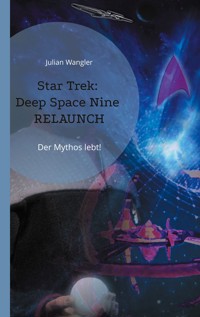
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Politische Ränke, die Macht von Religion, vielschichtige Charaktere, ein existenzieller Krieg - keine andere Star Trek-Serie ist von solch einer Dynamik wie Deep Space Nine. Am Ende der sieben Staffeln war die Serie zwar an ein natürliches Ende gelangt, doch zahlreiche Fragen blieben offen. Alles rief nach einer Fortsetzung, gab es noch eine Menge Geschichten zu erzählen. Der Wunsch vieler Fans erfüllte sich mit dem DS9-Relaunch, einer überaus epischen Serienfortsetzung in Romanform. Dieses Sachbuch trägt alles Wichtige über dieses einzigartige Sequelprojekt zusammen und bespricht sämtliche Werke. Lassen wir den Mythos wiederaufleben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Nun fühlte sie sich, als sei ein Kreis geschlossen, das Bild komplett – von ihrem morgendlichen Traum eines sterbenden Frachters in den Badlands und Benjamin bis zum Hier und Jetzt. Sie stand im Lift zur Ops und fühlte sich, als sei sie gewachsen, gereift. Zum ersten Mal seit langem lauerte keine tiefe Dunkelheit mehr in ihrem Leben, keine böse Überraschung. Sie fühlte sich gefestigt, bereit, wahrhaft in die Fußstapfen des Mannes zu treten, der sie bereits vor Monaten verlassen hatte.
Sie trat auf die Ops und nickte den Offizieren zu, während sie zu ihrem Büro ging. Natürlich war nicht alles perfekt – aber Glück hatte nichts mit Perfektion zu tun. Es ging vielmehr um das Vorhandensein von Hoffnung, ein Gefühl von Liebe und Gewissheit und darum, mit sich selbst im Reinen zu sein.
Genau hier begann die neue Reise von Kira Nerys, ihrer Crew und Deep Space Nine. Alles war nun anders, und doch war es genau so, wie es sein sollte.
- Roman Offenbarung, Teil 2
Inhaltsverzeichnis
Einführung
| Das, was noch vor Dir liegt…
01
| Phase 1: Vor‐Relaunch (2375/76)
02
| Phase 2: Season 8 (2376)
03
| Alte, neue Crew: Die Hauptfiguren der 8. Staffel und darüber hinaus
04
| Forschen auf Umwegen: Die wechselvolle Erfahrung mit dem Gamma‐Quadranten
05
| Sterbendes Volk: Das dunkle Schicksal der Andorianer
06
| Phase 3: Die Welten von
Deep Space Nine
(2376/77)
07
| Phase 4: Season 9 (2377)
08
| Crossover: Das Ende der Galaxis, wie wir sie kannten (2381)
09
| Neue Zeiten, neues Schiff: Die Erfindung der
U.S.S. Aventine
10
| Crossover:
Deep Space Nine
in der
Typhon Pact
‐Reihe (2383/84)
11
| Ein neuer Widersacher entsteht: Der Typhon‐Pakt
12
| Crossover:
Deep Space Nine
in der
The Fall
‐Reihe (2385)
13
| Phase 5: Post‐Season 9/Post‐
Destiny
(2385/86)
14
| Plötzlich wieder gewöhnlicher Sterblicher: Benjamin Siskos harter Weg zurück ins lineare Leben
15
| Crossover: Vom Ende eines Universums inmitten des Multiversums (2387)
16
| Exkurs: Die anderen
Deep Space Nine
‐Zukünfte
Schlussbetrachtung
| Die unglaubliche Reise, die zuletzt versandete
~
2376
Sie war wach. Die verfluchte KOM hatte sie aus dem Tiefschlaf gerissen.
Augenblicklich war ihr klar, was das bedeutete: So begann also ihre erste Woche als offiziell ernannte Kommandantin.
[Bedaure, Sie wecken zu müssen, Colonel…] Es war Devros Stimme, einer der Männer vom Sicherheitspersonal. Die Pause, die er machte, kündigte nichts Gutes an. […aber es gab einen Anschlag an Bord der Station.]
Kira setzte sich auf und blinzelte. „Was ist passiert?“
„Die Details kennen wir noch nicht, aber es scheint, als sei mindestens eine Person getötet worden. Lieutenant Pantal wird Sie zusammen mit dem Doktor in der medizinischen Station D treffen.“
Im Autopsieraum.
„Bin unterwegs.“, sagte Kira, und Devro trennte die Verbindung.
Wie der Computer ihr mitteilte, war es 0530, und somit blieb nur mehr eine halbe Stunde, bis sie ohnehin hätte aufstehen müssen.
Sie schwang ihre Füße aus dem Bett und verharrte einen Augenblick mit geschlossenen Augen. Schlechte Nachrichten nach einem schlechten Traum, nach einer ganzen Reihe von schlechten Tagen – oder zumindest frustrierenden, angesichts der im Zeitplan zurückliegenden Generalüberholung der Station.
Verdammt, hatte sie denn nicht schon genug zu tun? Sie musste in die Rolle der dauerhaften Befehlshaberin schlüpfen – enorm große Schuhe ausfüllen –, DS9 eine neue Rolle in einer sich jäh ändernden stellarpolitischen Ausgangslage verschaffen…und dafür sorgen, dass diese Station so bald wie möglich diese Rolle ausfüllen konnte.
Schnell zog sie sich an, und ihr Gehirn nahm seine Arbeit auf.
Dank der Wiederaufbaumaßnahmen nach dem Krieg waren die Ressourcen der Sternenflotte äußerst dünn gesät und mancherorts nahezu wertlos. Hinzu kamen die humanitären Dienste: die Hilfe, die die Föderation unabhängigen, vom Krieg gezeichneten Welten und Zivilisationen gewährte. Jeder Freund und Verbündete, den sie nun gewannen, war ein potenzielles Neumitglied der Föderation, und wenn das bedeutete, dass Einrichtungen wie DS9 ein Weilchen länger auf dem Zahnfleisch gehen und unbesetzt bleiben würden – nun, dann mussten sich diese Einrichtungen eben mit dem begnügen, was sie hatten.
Als wäre nicht schon genug los, hatte man DS9 zum offiziellen Koordinationspunkt der multikulturellen Hilfsmaßnahmen für Cardassia ernannt, was für den gesamten Stab eine Menge zusätzlicher Aufgaben bedeutete. Versorgungs- und Hilfsschiffe von über einem Dutzend Planeten gingen zurzeit täglich ein und aus, ergänzt von einer ständig schwankenden Anzahl an ‚Mietschiffen‘. Sie sorgten für einen konstanten Zufluss kleiner und großer Probleme.
Zudem herrschte ein emotionales Klima an Bord, wie es Kira noch nie gespürt hatte. Zwar vertraute sie auf die guten Absichten ihres Volkes, war doch die Mehrheit der knapp 7.500 Bewohner der Station bajoranisch, zweifelte aber bis heute daran, ob DS9 wirklich die beste Wahl für die Wiederaufbaumaßnahmen darstellte, Lage und Größe hin oder her.
Shakaar sah das anders. Der Erste Minister fand, Bajors Bereitschaft zur Mithilfe sei ein entscheidender Schritt hin zur Annäherung an die Cardassianer…und schade Bajors erneutem Antrag auf Mitgliedschaft in der Föderation sicher ebenfalls nicht. Er hatte bei Kira insistiert, sie habe doch leibhaftig auf Cardassia Prime mit angesehen, was geschehen war. Nun, da sich die Dinge umgekehrt hatten und es die Cardassianer waren, die vollends am Boden lagen, wollte Shakaar das mit einem politischen Neuaufbruch für Bajor verbinden. Er war überzeugt, die Welt war soweit.
Es hatte eine Zeit gegeben, in der sie Cardassias Schicksal als ausgleichende Gerechtigkeit empfunden hätte. Aber als sie nun an die rußgeschwärzten, qualmenden Ruinen dachte, die mit Leichen überfüllten Straßen, den Schrecken auf den leeren Gesichtern der Überlebenden… Ab diesem Punkt wurde Kira klar, dass inzwischen zu viel geschehen war und sie nicht mehr alle Cardassianer über einen Kamm scheren konnte. Die Leute, die jetzt litten, waren einfach durch die galaktischen Ereignisse mitgerissen und buchstäblich von ihnen überrollt worden. Sie konnten nichts für die Entscheidungen, die an der Spitze zwischen dem Dominion und der cardassianischen Militärregierung getroffen worden waren.
Am Ende hatte sich Kira sowohl von Shakaar als auch vom Sternenflotten-Oberkommando überzeugen lassen, dass die Station eine vitale Rolle beim Heilungsund Versöhnungsprozess zwischen Bajor und Cardassia spielen sollte, auch wenn es immer noch ein langer Weg dorthin war. Was das bajoranische Volk davon hielt, stand indes auf einem anderen Blatt. Sie konnte sich gut vorstellen, dass es viele ihrer Landsleute gab, die kein Interesse daran hatten, den Cardassianern zu helfen und ihnen die Hand zu reichen.
Ein langer Weg, oh ja, das würde es sein…
Es wäre schön, Benjamin zu fragen, wie er jetzt vorgehen würde., dachte sie. Doch er war nicht hier, unklar, ob er je zurückkehren würde. Dies hier war nun ihr Büro, ihre Station, ihre Verantwortung.
„Beweg Dich, Colonel.“, sagte sie leise, straffte ihre Schultern, und ihr Blick wurde härter. Sie war der leitende Offizier der Raumstation Deep Space Nine, einem der inzwischen wichtigsten Stützpunkte im ganzen Quadranten, und die Arbeit ging wieder los.
Also tat Kira Nerys, was sie gelernt hatte, was ihr entsprach: die Dinge zu nehmen, wie sie waren, das Beste daraus zu machen…und weiterzukämpfen.
~
Hinweis: Diese Szene entstammt nicht dem in diesem Buch zu behandelnden DS9‐Relaunch, sondern wurde vom Autor im Sinne eines kleinen ‚Aperitifs‘ ergänzt.
01
>> Phase 1: Vor‐Relaunch (2375/76)
Ein Stich zur rechten Zeit (A Stitch in Time)
Autor: Andrew J. Robinson
Erscheinungsjahr: 2000; deutsche Übersetzung: 2011
Zeitraum: 1/2376
Inhalt
Garak, seines Zeichens Schneider, Gärtner, Spion, Verhörexperte, Attentäter, Philosoph und Überlebenskünstler, ist eine der vielschichtigsten Figuren in Star Trek. In sieben Jahren Deep Space Nine folgte seine Charakterentwicklung stets einem bestimmten Prinzip: Wir erhielten immer mal wieder eine (halbe) Antwort auf unsere Fragen über seine Vergangenheit, doch je mehr wir über den Schneider erfuhren, desto mehr neue Fragen tauchten auf. Das war auch ein Geheimrezept des Charakters, das ihn dauerhaft spannend machte. Immerhin: Versatzstücke dieser Vergangenheit, die Garak etwas latent Unberechenbares verlieh, durften wir im Laufe der sieben Staffeln kennenlernen, und uns offenbarte sich ein Mann voller frappierender Widersprüche, ein wildes, schillerndes Fragmentarium von Identitätsmerkmalen. Die Geschichte seiner komplexen Persönlichkeit wurde jedoch nie erzählt.
Mit Ein Stich zur rechten Zeit, einer unmittelbar an die Geschehnisse des DS9‐Finales anknüpfenden Erzählung, schließt sich der Kreis. In diesem, von Garak‐Schauspieler Andrew J. Robinson höchst selbst entwickelten Roman aus dem Jahr 2000 werden die entscheidenden Stationen in der Biografie des Cardassianers offengelegt. Alles beginnt damit, dass Garaks so viele Jahre gehegter Traum Wirklichkeit wird: Er darf nachhause zurückkehren, zurück nach Cardassia.
Doch was ist davon jetzt noch übrig? In den letzten Tagen des Dominion‐Kriegs legten die Jem’Hadar große Teile des Planeten in Schutt und Asche; Hunderte Millionen Cardassianer fanden den Tod. Nach seiner Ankunft läuft Garak durch Staub, Feuer und Ruinen. Vor ihm liegt eine gebrochene, von den Fehlern der Vergangenheit ruinierte Welt. Garak möchte helfen, sie wiederaufzubauen, auch wenn er weiß, dass dies vermutlich eine Generationenaufgabe werden wird. Er sieht sich mit einem kollabierten, von einer Identitätskrise befallenen Volk konfrontiert, dessen Glaubensgrundsätze zerborsten sind und das auch mental am Abgrund steht.
Um die Cardassianer zu vereinen, muss sich Garak mehr denn je mit seiner eigenen Vergangenheit auseinandersetzen. Dabei hilft ihm seine intensive Korrespondenz mit dem auf DS9 verbliebenen Julian Bashir. Nach und nach breitet Garak seinem alten Freund sein Leben aus. Im Zuge dessen beginnt er sich der Welt zu erinnern, die ihn großzog; der Welt, die er stets verachtete und doch über alles liebte. Es ist ein introspektiver Rückblick, der mit Schmerzen einhergeht. Doch nur so ist es möglich, Frieden mit sich zu machen.
Kritik
Der Roman besteht aus drei großen Handlungsbögen, die in unterschiedlichen Zeitperioden spielen und einander ständig abwechseln. Klug ineinander verschachtelt, werden sie alle aus Garaks Perspektive in der Ich‐Form als Teil seiner urpersönlichen ‚Memoiren‘ erzählt, die er Bashir anvertraut. Der erste Plot spielt in der Gegenwart. Er schildert die unmittelbaren Eindrücke und Gedanken des Schneiders im Angesicht des untergegangenen Cardassia, auf dem er sich in Rettungsteams engagiert, in den Ruinen nach Überlebenden Ausschau hält und sich von Zeit zu Zeit in einen kleinen Schuppen am Rande des zerstörten Anwesens von Enabran Tain zurückzieht, um sein kompliziertes Leben Revue passieren zu lassen.
Dort zeichnet er einen Großteil der Einträge des zweiten Plots – Kern der Geschichte – auf, die sich mit dem Rückblick auf sein Leben beschäftigen. Hier geht es im Wesentlichen um die Schilderung der gesellschaftlichen Verhältnisse zur Zeit seiner Kindheit und Jugend, seine frühzeitige Rekrutierung für den cardassianischen Geheimdienst und die darauf folgende Ausbildung an der Spionage‐Akademie Bamarren, seinen allmählichen Aufstieg im Obsidianischen Orden und eine ziemlich traurige, da unerfüllte Liebe zu einer Frau namens Palandine. Später folgt eine Spionagemission auf Romulus und die Situation, in der er bei seinem Mentor in Ungnade fällt, bis hin zu seiner letztendlichen Verbannung nach Terok Nor.
Das in der Schwebe verharrende Verhältnis zu Enabran Tain, der von Anfang eine Rolle in Garaks Leben spielt, die Wahrheit seiner Vaterschaft jedoch hinter einer Lüge verbirgt, ist hierbei ein Schlüsselelement. Bereits früh beschleicht den Jungen das Gefühl, Tain würde die Fäden in seinem Leben ziehen und nicht seine (vermeintlichen) Eltern. Dabei ist gerade das unausgesprochene, verleugnete Vater‐Sohn‐Verhältnis zwischen Tain und Garak die große Hypothek im Leben des jungen Mannes. Obwohl Garak so einige Male im Leben die Rollen wechseln wird, bis ihm schließlich jene des Schneiders auf DS9 zufällt, wird er das unausgesprochene Leiden niemals los, und nur so lässt sich erklären, wieso er immer wieder derart stark um Tains Zuneigung und Lob gebuhlt hat. Dieses geistige Abhängigkeitsverhältnis machte ihn ausbeut‐ und instrumentalisierbar.
Der dritte Handlungsbogen beinhaltet Tagebuchaufzeichnungen im Zeitraum der Invasion des cardassianischen Territoriums durch Sternenflotten‐ und alliierte Verbände im letzten Kriegsjahr. Sie schildern Begebenheiten auf der Station, Gespräche mit seinen Kameraden von DS9, das Verhältnis zu einer jungen Bajoranerin namens Remara (einer alten Freundin von Tora Ziyal), in die er sich verliebt, und immer wieder Garaks große Sehnsucht nach der Rückkehr in die Heimat. Und doch spricht gerade aus diesem Plot immer wieder der große Zweifel, den er mit seinen Gedanken an die Heimkehr verbindet. Sie leisten gleichsam einer schonungslosen Auseinandersetzung mit seinem frühen Leben Vorschub.
Der Roman kreist in seiner Essenz um die Frage, als welche Person sich Garak letztendlich sehen möchte, wo er den Kern seiner Identität nach einem derart zerrütteten, verwirrenden und oft fremdbestimmten Leben verortet. Und das Faszinierende ist, dass er nichts von dem, was er war, zurückweisen möchte. Vielmehr fügt er die Splitter seines Ichs zusammen und erkennt sie als ein Ganzes, was sich in berührenden Passagen niederschlägt.
„Wir alle tragen – bis zu einem gewissen Grad – Erinnerungen, Charakterzüge und Fragmente jener Persönlichkeiten in uns, die vor uns lebten. Vielleicht sind wir sogar auf einer tieferen, spirituelleren Ebene ‚verbunden‘. Die ersten Hebitianer glaubten das. Auf jede Generation folgt nicht nur die nächste, sie wird von ihr subsumiert, so dass die Vergangenheit immer gegenwärtig ist und aktiv an der Gestaltung der Zukunft beteiligt ist. In gewissem Sinne gibt es also keine Vergangenheit und Zukunft; es gibt nur die Gegenwart. So gesehen sind wir alle Teil einer ewigen Gegenwart.“ (Auszug aus Ein Stich zur rechten Zeit)
Wenn man sich philosophische Anwandlungen wie diese ansieht, so kann eigentlich kein Zweifel bestehen: Ein Stich zur rechten Zeit ist eine Perle, prall gefüllt mit Weisheiten, die häufig zwischen den Zeilen liegen, und einer wunderbaren Sprache.
Am Beispiel des nach sieben Jahren bekannten und doch ominösen Schneiders kündet der Roman vom Leben in einer autoritär geführten und zutiefst misstrauischen Gesellschaft. In einer solchen Gesellschaft gibt es kein Mitgefühl, sondern nur den Zwang zum Funktionieren im Sinne der allgemeinen Losungen und Prämissen. Jeder Einzelne in ihr ist erstaunlich einsam, und deshalb gibt es bloß ein Rezept: Man muss sich innerlich von den Gräueln abschotten, die man im Namen der eigenen Nation zu tun genötigt wird – und um jemand zu sein. Dieses elitäre Gefühl, dieser krankhafte Ehrgeiz, seinem Vaterland einen besonderen Dienst zu tun, erfasst auch Garak früh und trägt seinen Teil zum Entstehen einer Person bei, die sowohl schmeicheln als auch entsetzen kann. Der Verlust einer einstmals einflussreichen Religion in der cardassianischen Gesellschaft ist dabei stellvertretend für das eigentliche Problem zu sehen: Irgendwann verlernte es diese Nation, im Gleichgewicht zu leben, Demut zu üben, sich Idealen zu verschreiben und danach zu streben, besser zu werden als sie ist. Sie wurde zu ihrem eigenen Dämon.
Im Laufe des Romans wird nichtsdestotrotz fühlbar, dass Garak längst nicht mehr ohnmächtiger Betrachter seines Lebens ist, sondern eine beträchtliche Stärke und Eigenständigkeit entwickelt – die durchaus auch schon bei seinem Exil beginnt. Seine Liebe Palandine gegenüber steht hierfür ebenso wie die zeitweilige Beschäftigung mit dem Oralianischen Weg, jener verschütteten Spiritualität der cardassianischen Ahnen, die einen Ausweg aus dem nimmersatten Macht‐ und Mordgelüst eines vergifteten Gemeinwesens in der Union weisen könnte. Garak ist somit bereits in jüngeren Jahren an manchen Stellen (beinahe) bereit, das herrschende System zu hinterfragen, hinter die Fassade zu blicken und eigenen Wertvorstellungen einen Platz einzuräumen. Am langen Ende ist er jedoch machtlos, denn gegen eine ganze imperiale wie soziale Maschinerie kommt er nicht an.
Wenn man dieses Buch gelesen hat, wird man auch eine neue Lesart auf cardassianische Figuren insgesamt entwickeln. Endlich wird es möglich, sie in einem umfassenden Sinn zu verstehen, in ihr Innerstes hineinzufühlen – und im Sinne der Allegorie, die Star Trek sein möchte, überhaupt in eine Vielzahl von Personen, die in undemokratischen, von Misstrauen und Drill vereinnahmten Staaten groß wurden. Mehr noch als das: Garaks Geschichte ist deshalb so mitreißend, weil sie uns eindrucksvoll und erschreckend zugleich vor Augen führt, dass selbst eine herausragende und in sich ruhende Gestalt wie der weise Schneider sich letztlich nur unter großen Mühen lossagen kann von den eigenen Wurzeln.
Wir sind alle Kinder unserer Zeit und der Verhältnisse, in denen wir aufwachsen, sozialisiert werden. Doch indem Garak seinen Stich zur rechten Zeit macht, beginnt er sich das einzugestehen – und erfährt Vergebung. Diese Vergebung liegt in den Erinnerungen an seinen falschen Vater Tolan begründet, einem Anhänger der alten hebitianischen Hochkultur, deren Losungen von Frieden und Harmonie die Hoffnung auf ein neues, besseres Cardassia bereithalten. Ausdrucksstarkes Symbol hierfür wird die edosianische Orchidee: Sie verkörpert nicht nur eine wichtige Reminiszenz in Bezug auf Garaks Leben, sondern steht auch für jenen Teil in ihm, der bereit ist, Abschied zu nehmen von der kalten Gesellschaft, in der er groß wurde.
Gerade, weil er um seine Vergangenheit weiß, kann Garak am Ende der Geschichte Frieden mit sich machen und zu einem Hoffnungsträger für ein neues, demokratisches Cardassia werden, während andere Cardassianer diesen Neubeginn nicht schaffen. Zum ersten Mal scheinen seine Horizonte offen zu sein, denn sein Leben ist nicht länger an die Entscheidungen Anderer oder höhere Zwänge gebunden. Garak erhebt sich aus der Asche seiner Heimatwelt, und so fällt doch ein besonderes Licht auf diese ruinierte Welt, auf der – gewissermaßen aus der Asche des Gestern – jemand Neues geboren wird. Bei all dem darf sein Freund Bashir (und mit ihm der Leser) Zeuge sein – bestes Rezept für einen bittersüßen Ausklang.
Fazit
Das Buch verbindet gekonnt die vielen losen Fäden von Garaks umwälzungsreichem Leben zu einem organischen Ganzen, aber die Art, wie es das tut, ist noch beeindruckender. Wird die Vergangenheit einer schwer durchschaubaren Figur transparent gemacht, besteht zwar die Gefahr der Entmystifizierung, doch Robinson ist es gelungen, Garak auf eine neue Stufe zu hieven. Dass er sich mit dem Ende seines Exils Bashir ultimativ anvertraut und öffnet, hält etwas Episches und Poetisches bereit. Robinson beweist hier, dass er Garak nicht nur gespielt hat, sondern in den sieben Jahren geradewegs lebte.
Erst indem Garak die Fetzen eines wechselvollen Lebens voller Bürden und Brüche aufgreift und zum alles entscheidenden Stich ansetzt, ist es möglich, einen wirklichen Neuanfang zu machen. Es ist ausgerechnet der Schneider in ihm, der Garak heilt, weil nur er in der Lage ist, besagte Fetzen zu etwas Neuem, Ganzen zu vernähen. Das neue Kleid ist fertig – und es ist überaus prächtig.
The Left Hand of Destiny #1
Autoren: J.G. Hertzler & Jeffrey Lang
Erscheinungsjahr: 2003
Zeitraum: 1/2376
Inhalt
Martok, Sohn von Urthog, war sein Leben lang ein Soldat aus der Ketha‐Provinz, zusammengehalten von ehernen Prinzipien und wohlwissend, dass zu viel Macht eine Gefährdung eben dieser Prinzipien bedeuten kann, und dann wurde ihm von seinem Freund Worf eines Tages die Kanzlerschaft des Klingonischen Reichs zugetragen. Nun ist der Dominion‐Krieg beendet. Martok hat viel dafür gegeben, damit ein Sieg möglich wurde, und nun spürt er Erschöpfung. Er spürt sie auch deshalb, weil es sich in den letzten Kriegstagen so anfühlte, als hätten klingonische Streitkräfte Schlacht um Schlacht alleine bestritten. Die Verlustliste ist lang, und als Martok mit seinen Sternenflotten‐Alliierten inmitten toter Cardassianer auf den lang ersehnten Triumph anstoßen wollte, zeigten sich, kaum war das lange, blutige Ringen vorbei, bereits erste Befremdungserscheinungen und Risse.
Alte Schulterschlüsse scheinen morgen vielleicht nicht mehr zu gelten. Der Krieg ist tatsächlich vorüber und ein neues Zeitalter im Anbruch. Martok weiß nicht, wohin es ihn führen wird; er weiß jedoch, dass er bislang ein Kriegskanzler war und nun auf Qo’noS seine gerade gewonnene politische Macht konsolidieren muss – ein Feld, auf dem er zweifellos Nachholbedarf hat. Vorerst geht es zurück in den Schoß seines Volkes, wo nun ein Leben beginnt, das er sich im Grunde seines Herzens nie gewünscht hat und eine Schlacht erwartet, dessen Arena vornehmlich Konferenzräume sein werden. Doch es besteht auch Anlass, der Heimkehr mit Freude und Sehnsucht entgegenzublicken: Martok will zurück in die Nähe seiner zutiefst verehrten Sirella.
An der Seite von Worf, des neuen Föderationsbotschafters auf Qo’noS, fliegt Martok erwartungsvoll nachhause. Zunächst verläuft die Ankunft der Negh’Var, seines Flaggschiffs, planmäßig. Kaum ist sie allerdings in den Orbit eingetreten und Martok bereit, von Bord zu gehen, ereignet sich ein Inferno von unfassbaren Ausmaßen: Eine urgewaltige Detonation reißt das Herz der Ersten Stadt in Stücke. In Bruchteilen von Sekunden finden große Teile des Hohen Rats und der politischen Nomenklatura den Tod.
Ehe überhaupt abzusehen ist, was gerade passierte, werden alle Frequenzen auf der Oberfläche der klingonischen Heimatwelt von einer Transmission überflutet. Ein Mann namens Morjod bekennt sich zu dem Anschlag und verbindet diese grässliche Offenbarung mit einem feurigen Plädoyer, das klingonische Volk zu seinen Wurzeln zurückführen zu wollen. Morjod vertritt die Auffassung, die Klingonen würden unlängst durch Werte vereinnahmt, die ihnen fremd seien. Martok sei mit seiner Verbrüderung an der Seite der Föderation das beste Beispiel hierfür, den er zusammen mit Worf zu töten gedenkt. Tatsächlich gelingt es Morjod, eine bürgerkriegsähnliche Unruhe heraufzubeschwören und die konservativen Teile der klingonischen Bevölkerung gegen Martok aufzuhetzen.
Danach beginnen sich die Ereignisse zu überschlagen: Die Negh’Var wird angegriffen und zerstört. Martok, Worf und ein großer Teil der Mannschaft gelingt es, sich in eine alte Verteidigungsstellung zu evakuieren und dort einen ersten Überfall durch feindliche Horden abzuwehren. Als der Kanzler jedoch erfährt, dass seine Frau in Morjods Hände gelangt ist und bald exekutiert werden soll, zieht er auf eigene Faust los. Da Worf vorher verwundet wurde, kann er seinen Freund weder aufhalten noch begleiten.
Tatsächlich gelingt es Martok, sich bis ins Verließ in der Hauptstadt vorzukämpfen, wo er Sirella findet. Kurz darauf tappt er allerdings in eine Falle und wird selbst gefangen genommen. Das Auftauchen einer Frau namens Gothmara führt zur Klärung einiger längst überfälliger Fragen rund um Morjods Identität: Martok ist offenbar dessen Vater und hat ihn vor der Ehe mit Sirella mit Gothmara gezeugt. Defacto ist Gothmara – eine von Größenwahn zerfressene Wissenschaftlerin – diejenige, welche die Strippen hinter diesem Staatsstreich spielt. Sie verwendet Morjod, um sich nicht nur persönlich, sondern auch ideell an Martok zu rächen. Dies tut sie, indem sie ihren eigenen Sohn mit Hur’q‐DNA manipuliert und sich eine gentechnische Armee geschaffen hat, welche die nächste Stufe in der Evolution der klingonischen Spezies einläuten soll…
Kritik
Mittlerweile wissen wir ja, dass es bei den Klingonen politisch heiß zur Sache gehen kann – übrigens eine große Gemeinsamkeit mit ihren romulanischen Erzfeinden, die sie sich wohl nur ungern eingestehen. Die eigentliche Geschichte um eine weitere innere Zerreißprobe frei nach der bekannten TNG‐Doppelfolge Der Kampf um das klingonische Reich wirft einen also nicht unbedingt vom Hocker. Nehmen wir kein Blatt vor den Mund: Teilweise ist sie sogar ziemlich hanebüchen konstruiert.
Nicht nur wird mit der Pulverisierung gleich der halben Ersten Stadt ein wenig dick aufgetragen und einem wieder einmal quasi aus dem Nichts auftauchenden politischen Rivalen zu viel Sand aufgewirbelt, wobei ich – by the way – nicht verstehen kann, wieso es Morjod so leicht gelingt, mit einer bestialischen Tat ein Volk gegen einen an und für sich doch sehr populären Kanzler aufzuwiegeln. Auch den Griff in die Gentechnikkiste, der sich am Ende des ersten Teils von The Left Hand of Destiny zeigt, ist mehr als unglücklich und zeugt von nur geringer plottechnischer Kreativität. Just another Klingon Civil War, und zwar auf Biegen und Brechen. Von der nur schweren Nachvollziehbarkeit von Gothmaras Motiven will ich gar nicht anfangen zu reden.
Das alles kann man der Geschichte jedoch verzeihen, denn eigentlich von Anfang an ist klar, dass hier blutige innenpolitische Auseinandersetzungen nur Kulisse, eher ein klingonisches Nebenbei‐Feeling, sind. Dieser Roman vollzieht sich – vergleichbar mit Ein Stich zur rechten Zeit rund um die Figur Garaks – dicht am mentalen Kosmos von Martok und einigen ihm assoziierten Figuren. Dafür sprechen die vielen Träume und Reflexionen, die das wahre Potenzial des Tandems Lang und Hertzler offenlegen. Ganz ohne Zweifel wäre der Martok‐Schauspieler höchstpersönlich nicht in dieses Projekt involviert worden, würde es sich nicht um eine verkappte Biografie des neuen klingonischen Führers handeln; eines Mannes, der antrat, um den Klingonen ihre verlorene Ehre zurückzubringen.
So rekurriert The Left Hand of Destiny auch im Zusammenhang mit der Person Martok auf eine weltanschauliche Auseinandersetzung um die wahre Ehre, um das Ende der Verleugnung des klingonischen Wesens, welche am Ende der dritten Star Trek‐Serie verstärkt thematisiert wurde. Dabei werden die losen Enden des Canon gekonnt aufgegriffen: Der Roman knüpft an die DS9‐Episode Das Schwert des Kahless an, was nicht nur die Hur’q – die einzige Spezies, der je eine Invasion des klingonischen Reichs gelang – zurück auf die Tagesordnung ruft, sondern auch das heilige Schwert und seine Bedeutung für den Fortbestand des Klingonenimperiums.
Das Gute ist, dass The Left Hand of Destiny nicht den Fehler begeht, sich in ellenlangen Abhandlungen über die klingonische Ehre zu ergießen. Vielmehr sublimiert das Autorentandem dieses an und für sich Kopfzerbrechen bereitende Thema auf eine persönliche Ebene, indem in der Haut Martoks fühlbar wird, wie der richtige Weg für die klingonische Zukunft aussehen könnte. Hierbei sind es gerade die Selbstzweifel und Leidensfähigkeit des Kanzlers, die ihn und die Zeichnung seines Charakters authentisch und faszinierend zugleich machen.
Fazit
Lässt man sich also auf eine vortreffliche Charakterstudie des neuen klingonischen Führers ein, bekommt man ein wirklich empfehlenswertes Werk geboten. Ganz ohne Frage wäre ein besserer und weniger vorhersehbarer Politthriller rund um diese Gelegenheit wünschenswert gewesen, aber da zum Ende des ersten Teils noch nicht alle Fragen geklärt wurden, bleibt darauf zu hoffen, dass sich The Left Hand of Destiny #2 im Hinblick auf seine Rahmenhandlung noch etwas wird steigern können.
The Left Hand of Destiny #2
Autoren: J.G. Hertzler & Jeffrey Lang
Erscheinungsjahr: 2003
Zeitraum: 1/2376
Inhalt
Auf Qo’noS ist die denkbar größte Katastrophe eingetreten: Kurz vor seiner offiziellen Machtübernahme wurde Martok übel mitgespielt. Ein Klingone namens Morjod hat einen gewalttätigen Umsturz initiiert und sich selbst zum Imperator ausgerufen. Wo im ersten Teil der Geschichte noch das verzweifelte Bemühen im Vordergrund stand, dem drohenden Tod und ständig neu auftauchenden Gefahren zu entgehen, konsolidieren Martok und seine treuen Mitstreiter ihre Situation zu Beginn des zweiten Buches.
An Bord der Rotarran kommt er mit Kahless, Worf, Alexander und Ezri Dax zusammen, wo sie ihre Geschichten austauschen. Wir tauchen ab in Flashbacks eines jungen Martok sowie in die Vergangenheit von Morjods Mutter. Diese Erzählungen bilden die fehlenden Puzzleteile zu den Ereignissen aus dem ersten Roman. Es entpuppt sich, dass Morjods Mutter – eine Frau namens Gothmara – eine Wissenschaftlerin war und schon seit geraumer Zeit versuchte, die Macht im Klingonischen Reich an sich zu reißen (wieder einmal hängt dies mit Rachemotiven zusammen). So stellt sich heraus, dass Gothmara bereits Jahre zuvor als treibende Kraft hinter den Kulissen an der Erschaffung von Kahless‘ Klon tätig war in der Hoffnung, dass Kahless‘ Wiederauferstehung einen Bürgerkrieg auslösen könnte (ein großartiger Link zur entsprechenden TNG‐Episode!).
Nachdem Martok nun klar sieht, kann er mit seiner Kerntruppe zurückverfolgen, dass der Planet Boreth das Zentrum allen Unheils zu sein scheint. Sowohl Kahless als auch Gothmaras Hur’q‐Klone entstammen diesem Ort, und die Klingonin scheint auf irgendeine Weise Einfluss auf die dortigen Kleriker zu haben, um ungestört ihre Experimente durchführen zu können. Auf verschiedenen Schiffen und unterschiedlichen Kursen machen sich Martok und seine Getreuen auf den Weg. Dax und Worf helfen dem Kanzler bei der Zurückerlangung seiner Macht, indem sie das legendäre Schwert des Kahless für ihn (erneut) suchen.
Doch der dramatische Höhepunkt des Existenzkampfes um die Seele des Klingonischen Reichs erwartet Martok auf Boreth. Dort nimmt eine letzte große Schlacht ihren Lauf, die in die Geschichtsbücher eingehen wird...
Kritik
Ich muss sagen, nach dem ersten, eher leicht überdurchschnittlichen Teil war ich überrascht, wie stark sich die Geschichte gesteigert hat und wie enorm die Atmosphäre im zweiten Buch verdichtet wird. Tatsächlich hat die Auflösung von The Left Hand of Destiny einen ausgesprochen ominösen Anstrich erhalten, in der nicht nur politische Machenschaften und Intrigen eine wichtige Rolle spielen (wie wir sie aus so manchen TNG‐ und DS9‐Folgen bereits kennen), sondern auch der Mystizismus der klingonischen Kultur, die dadurch einmal mehr an Reichhaltigkeit und Tiefe gewinnt. So zeigt sich, dass an Martoks Visionen aus dem ersten Teil mehr dran ist als anfangs vielleicht vermutet, und auch seine neuen Mitstreiter verfügen über geradewegs übernatürliche Eigenschaften. Insofern ist der Roman um ein gewisses Star Wars‐Feeling angereichert, das aber wunderbar mit dem bestehenden ST‐Universum in Einklang gebracht wird.
Die ‚Rebellion‘, angeführt von Martok, teilt sich auf und geht verschiedenen Missionen nach, um sich schließlich am Ziel der Reise zu treffen und die entscheidende Schlacht gegen das Böse in einer Hoth‐artigen Eiswüste zu schlagen. Die Geschichte von Buch zwei erscheint insoweit prädestiniert für die große Leinwand, wobei der Brutalitätsfaktor erneut nicht zu unterschätzen ist. Es passt aber zu einer entfesselten klingonischen Story, bei der es buchstäblich um Alles oder Nichts, Schatten und Licht geht. Ein Kritikpunkt ist in diesem Zusammenhang aber anzuführen: Das letzte Drittel bietet einen Kampf auf Boreth, der ein wenig zu erwartungsgemäß abläuft und sich rasch abnutzt. Immerhin gibt es jedoch einen wichtigen Wendepunkt, der das Finale dieser Heldensaga einläutet.
Während im ersten Roman die Charaktere häufig lange Zeit allein mit ihren Reflexionen waren und sich diese Gedanken zumeist um den Kampf und die unmittelbare Bedrohung gedreht haben, ist es im zweiten Teil der Duologie wohltuend, die Charaktere zusammen und zusammenwirkend zu erleben. Vor allem die Dialoge von Martok, Darok und Lady Sirella sind spitz, pointiert und unterhaltsam, doch auch das Trio Worf‐Alexander‐Ezri funktioniert wunderbar. Die Charaktere sind alles in allem exzellent getroffen. Das könnte vielen, die mit den Klingonen vielleicht nicht so viel anfangen können, beim Einstieg in die Geschichte helfen. Wo ich soeben von Sirella sprach: Ihr heroisches Opfer beweist, wie glühend sie ihren Mann Martok verteidigt und liebt. Ihre kratzbürstige, widerspenstige Oberfläche, wie wir sie in DS9 (Episode Klingonische Tradition) kennenlernten, sagt nur wenig darüber aus, wer sie wirklich im Kern ihres Herzens ist.
Etwas eigenartig erscheint mir, dass das Schwert des Kahless am Ende der gleichnamigen DS9‐Episode laut diesem Roman nicht im Gamma‐Quadranten, sondern in einem abgelegenen Sektor des Klingonischen Reichs im All treibend zurückgelassen wurde. Aus dem Ablauf der Folge hätte ich geschlussfolgert, dass es irgendwann auf dem Rückweg zur Raumstation ins All gebeamt wurde. Jedoch genau darüber nachgedacht, könnten Jadzia und Worf den Dahar‐Meister Kor damals auch mit dem Runabout direkt nach Kronos zurückgebracht haben. Dass das Schwert im klingonischen Raum treibt, ist also nicht unvorstellbar, erscheint einem beim Lesen des Romans aber im ersten Moment etwas seltsam.
Fazit
Glorreiche Kämpfe, große Heldentaten und mitreißende Visionen. Nicht nur für Fans der klingonischen Kultur ein absolutes Muss. Selten habe ich erlebt, dass sich ein Fortsetzungsbuch so erheblich gegenüber dem ersten Teil steigert wie hier. Martoks Schlacht um Qo’noS ist in jeder Hinsicht episch und atmet die Atmosphäre eines echten Kinofilms.
The Never‐ending Sacrifice
Autorin: Una McCormack
Erscheinungsjahr: 2009
Zeitraum: 2370‐2378
Inhalt
Wenn man an Cardassia in der Star Trek‐Literatur denkt, fällt einem als erstes der Name Una McCormack ein. In einer ganzen Reihe von Romanen im Zuge des eigenständigen Romanuniversums hat sie die Vergangenheit dieses Volkes ausgearbeitet, seine weitere Entwicklung nach dem Ende des Dominion‐Kriegs erschaffen oder auch Figuren wie Garak weiter vertieft. Besonders hervorstechend ist allerdings ihr Roman The Never‐ending Sacrifice, ein Standalone‐Roman, der seinen Ausgangspunkt in einer einzelnen Folge zu Beginn der zweiten DS9‐Season findet (Die Konspiration) und eine vollständig eigenständige Geschichte erzählt. Das Buch wurde im Herbst 2009 von Pocket Books veröffentlicht, ist aber bislang nicht ins Deutsche übertragen worden.
Es handelt von der Figur Rugal, einem jungen Cardassianer, der im Alter von vier Jahren von seinen Eltern getrennt und in ein Waisenhaus gebracht wurde. Später wurde Rugal von dem Bajoraner Proka Migdal und dessen Frau aufgenommen, einfachen, aber hingebungsvollen Leuten. Dabei wächst der adoptierte Junge mit der bajoranischen Kultur und dem Glauben auf, allerdings auch mit all den Geschichten über die Grausamkeit der Cardassianer während der Besatzung. Seine Zieheltern hassen die einstigen Unterdrücker und übertrugen ihre Weltsicht auch auf Rugal, der alles, was mit seiner Spezies zu tun hat, zu verabscheuen lernte.
Als Rugal mit seinem Ziehvater 2370 nach DS9 kommt, entspinnt sich eine verworrene Geschichte, bei der die Wahrheit über Rugals vermeintlichen Waisenkindstatus ans Tageslicht kommt. Denn eigentlich ist er gar keine Waise. Er hat einen einflussreichen Vater namens Kotan Pa’Dar, eine wichtige Figur im Detapa‐Rat, der acht Jahre zuvor auf Bajor stationiert war. Pa’Dar wurde jedoch weisgemacht, der Junge sei durch bajoranische Widerstandskämpfer getötet worden. Kein Geringerer als Gul Dukat hat die Intrige eingefädelt: Er ließ Rugal in einem Waisenheim verschwinden – aus Rache an Pa’Dar, den er mitverantwortlich für den Rückzug von Bajor macht. Dukat machte ganz bewusst öffentlich, dass der Junge noch lebt. Pa’Dars Karriere platzen zu lassen (die cardassianische Sozialmoral ist sehr hart in Bezug auf die Vernachlässigung und Schädigung eigener Kinder), kommt da nicht nur seinem Wunsch nach Vergeltung gelegen, sondern ermöglicht ihm auch, von eigenen Problemen abzulenken, die ihn derzeit auf Cardassia plagen. Letztlich gelingt es im Zuge einer von Commander Sisko durchgeführten Anhörung, Dukats mutmaßliche Verwicklung in die Entführung Rugals aufzudecken.
Da Pa’Dar seinen leiblichen Sohn nach Cardassia zurückholen möchte, steht Rugal ein schwerer Abschied von seinen Zieheltern bevor. Zumal seine Adoption niemals rechtskräftig war und der Junge noch minderjährig ist, hat Sisko keine andere Wahl, als sich auf Pa’Dars Seite zu stellen und ihm zu ermöglichen, Rugal in seine Geburtswelt mitzunehmen (wenn auch gegen den vehementen Protest des Jungen und seiner Zieheltern).
Soweit die Geschichte, wie sie Die Konspiration erzählte und vom vorliegenden Roman noch einmal aufgegriffen wird. Was aus Rugal wurde, haben wir indes nie erfahren. Obwohl die Idee für eine Fortsetzung von jemand anderem kam, begeisterte McCormack sich schnell für das Projekt. „Ursprünglich kam mein damaliger Editor Marco Palmieri damit auf mich zu.“, erinnert sich McCormack, mit der ich im Jahr 2010 über das Buch sprechen konnte. „Er rief mich an und sagte, er halte es für spannenden Stoff, dieses junge Leben weiterzuverfolgen, zumal er nun nach Cardassia ging – eine Welt, über die wir natürlich sehr viel mehr erfahren könnten. Ich war sofort Feuer und Flamme. Die Gliederung war im Handumdrehen geschrieben; es war, als hätte die Geschichte auf mich gewartet.“
The Never‐ending Sacrifice erzählt jedoch nicht nur Rugals weitere Lebensgeschichte, nachdem er nach Cardassia aufgebrochen ist. Es tut viel mehr: Es bettet sie auch ins große Panoptikum der cardassianischen Gesellschaft ein, in die Rugal nicht recht hineinpasst. „Das Buch ist im Grunde so etwas wie eine Coming‐of‐Age‐Geschichte.“, erklärt McCormack. „Rugal wird erwachsen und muss seinen Weg finden. Aber er muss auf Cardassia praktisch wieder von vorne anfangen. Es geht um seine inneren und äußeren Kämpfe, mit dieser großen und ungewollten Veränderung in seinem Leben klarzukommen, während Cardassia um ihn herum in kurzer Zeit dramatische Veränderungen durchläuft.“
The Never‐ending Sacrifice umfasst den Zeitraum von acht Jahren (2370 bis 2378) und reicht damit sogar über die DS9‐Serienhandlung hinaus. „Ich habe eine Zeitleiste der Ereignisse in Rugals Leben erstellt und die wichtigsten Ereignisse der cardassianischen Geschichte daneben gestellt. Das ist oft eine gute Möglichkeit, Handlungspunkte zu generieren. Bei der eigentlichen Auswahl des Materials habe ich den dramatischen Fokus relativ eng auf Rugal gelegt, und wenn ich große Teile der cardassianischen Geschichte vermitteln musste, bin ich zur Erzählung übergegangen, anstatt zu versuchen, alle Ereignisse zu dramatisieren.“
Mit dem ungewollten Eintreffen auf Cardassia ändert sich Rugals Leben grundlegend. Zwar wird er jetzt nicht mehr ob seines Äußeren mit Irritation bis blanker Abscheu betrachtet, aber nun ist es Rugal selbst, der hier fremdelt und seiner neue Lebenswelt mit Irritation und Misstrauen begegnet. Cardassia Prime ist so ziemlich das glatte Gegenteil seiner früheren Heimat. Hier hat er es zu tun mit einer durch und durch urbanen, hoch entwickelten Gesellschaft, der jedoch Werte der Liebenswürdigkeit und des Vertrauens in weiten Teilen abhandengekommen sind. Stattdessen regieren Technokratie und Intrigen, Propaganda und Furcht, die das Volk innerlich entzweien. Der Obsidianische Orden ist eine allgegenwärtige abstrakte Gefahr, lässt Leute verschwinden und observiert jeden Winkel bei Tag und Nacht. Rugal lebt zwar im angesehensten Viertel der cardassianischen Hauptstadt, fühlt sich jedoch schnell wie ein Vogel im Goldkäfig. Als mit dem Vergehen von Wochen und Monaten zusehends ersichtlich wird, dass er nicht nach Bajor wird zurückkehren können, beginnt er sich dieser Welt nolens volens langsam zu öffnen…
Kritik
Rugal erweist sich als starker Charakter, der große Anpassungen schon aus jungen Jahren gewohnt ist. Zudem zeigt sich, wie sehr er sich in Wahrheit als Kind zweier Welten fühlt. Damit besetzt er eine nahezu einzigartige Zwischenweltlernische im äußerst problematischen Verhältnis zwischen Bajor und Cardassia. Neben Rugal wird der Roman hauptsächlich von drei weiteren Cardassianern getragen. Die wichtigsten Nebenfiguren sind Rugals biologischer Vater Kotan Pa’Dar, seine Freundin Penelya und seine Großmutter Geleth. Verschiedene andere Personen – bekannte und neue – tauchen hier und da im Laufe des Buches auf, aber diese vier bilden den Kern. Alle Charaktere sind filigran und liebenswürdig ausgearbeitet. Jeder von ihnen vertritt eigenständige, atmende Standpunkte, und doch bleiben sie am Ende Cardassianer.
Durch ihre gekonnten Beschreibungen taucht McCormack tief ab in die cardassianische Seele, einer im Grunde genommen sehr traurigen Seele. Dieses Seelenleben wird fühlbar in privaten Gesprächen Rugals mit Kotan, einem Mann des Detapa‐Rats, der stets bedacht ist, nicht anzuecken und insgeheim von einem anderen Cardassia träumt. Auch zeigt es sich im Verhalten von Kotans Mutter, die als Frau der alten Schule zwar zunächst antipathisch wirkt, jedoch auch viel Bitterkeit und Einsamkeit in sich trägt. Man kann nur ahnen, was sie in ihrem jüngeren Leben alles durchgemacht haben muss. Sie ist nicht von allein die Person geworden, die sie heute ist.
Endlich erfährt man, wie es Ende 2371 zum Staatsstreich auf Cardassia kommen konnte, in dem der Detapa‐Rat alle legislativen und exekutiven Befugnisse für sich sicherte, wo er bis dato immer nur eine Debattiereinrichtung gewesen war. Gerade diese Stelle des Buches führt dem Leser anschaulich das Kräftedreieck vor Augen: Zivilinstitutionen auf der einen, Zentralkommando auf der anderen Seite, dazwischen der Obsidianische Orden, der schier überall seine Finger im Spiel hat. Erst, als der Geheimdienst im Rahmen seiner verhängnisvollen Verschwörung mit dem Tal Shiar im Gamma‐Quadranten in den Ruin fällt, kippen die Machtverhältnisse. Es gelingt Kotan – einem der maßgeblichen zivilen Putschisten –, die Reste des Ordens auf die Seite des Detapa‐Rats zu ziehen, und das Militär muss nachgeben. Die Schilderung des Coups ist sicher einer der Höhepunkte des Romans.
Viel kündet in dem Werk von der Überkommenheit der cardassianischen Kultur. In der TV‐Serie gingen Vorurteile über die ‚faschistischen Cardassianer‘ trotz mancher Erläuterungen recht leicht von der Hand. Hat man diesen Roman gelesen, wird es alles etwas komplizierter, weil im Laufe der Story fühlbar wird, welchen Zwängen und welcher Selbstverleugnung auch und gerade eine Gesellschaft unterliegen kann, die das Atom gespalten und die Sterne erreicht hat. Rugal wird es einmal so ausdrücken: „On Cardassia [...] everybody just keeps on playing the game.“ Aus diesem Spiel scheint es kaum ein Entrinnen zu geben. McCormack geht hier äußerst einfühlsam der Frage nach, was es ist, das eine Gesellschaft, die um ihre Abgründe weiß, an Ort und Stelle hält.
‚Das Ewige Opfer