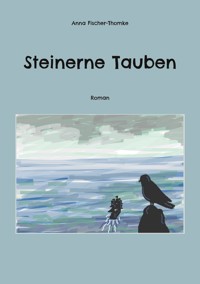
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein Fischerjunge und seine Freunde begeben sich auf eine Reise ins Land der Riesen, um dort seine Schwester aus der Hand eines Riesen zu befreien.
Das E-Book Steinerne Tauben wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Märchen, Abenteuer, Fantasy, Freundschaft, Meer
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Teil 1
Es war einmal …
1. Ein Schiff legt an
2. Eine Taube aus Stein
3. Hilfe aus der Adlerburg
4. Die Regenfee
5. Reisevorbereitungen
6. Ein blinder Passagier
7. Auf See gelten eigene Regeln
8. Das Meer des Nordens
9. Kopflos
10. Ankunft im Land der Riesen
11. Das Riesenmädchen
12. Der Handel
13. Wieder eine Falle
14. Bäumlinge
15. Mit Riesenschritten unterwegs
16. Im Geisterwald
Teil 2
17. Eine Strasse durch Berge und Winter
18. Gute Aussichten, schrecklicher Traum
19. Ein Land aus Stein
20. Das Heer der Tausend Ritter
21. Heimlicher Aufbruch
22. Getroffen!
23. Und doch ein Verräter
24. Geständnisse einer Prinzessin
25. Ein Wagen voller Jungfrauen
26. Die letzten Tränen
27. Bruderliebe
28. Vereint! Gewonnen! … und doch nicht
29. Abschied
30. Die steinerne Braut und ihre Tauben
31. Das Geschenk einer Fee
32. Blaue Federn
Zu den Personen
Zur Autorin
Für alle entschlossenen Feen und grossartigen Zwerge Für Riesen, die sich niederbeugen und für alle die, die niemals aufgeben …
Und für meine Familie: Erst zusammen sind wir ein Ganzes!
Teil 1
Es war einmal …
… im Land der Riesen, da lebte ein Jüngling von eitlem Wesen. Er hörte von einer reichen Königstochter, die ausserdem schön sei wie eine aufgehende Frühlingssonne. Ohne viel Nachdenkens beschloss er, sich aufzumachen, um ihr Herz zu erobern – und ihr Reich.
«Gib Acht», mahnte ihn sein Vater, «nach Grossem strebt dein Sinn! Doch geh und übe dich zuerst in rechter Bescheidenheit, Gehorsam und Geduld, so wird das Leben dir bald Höheres anvertrauen.»
Der Jüngling wollte wenig wissen vom Rat des Vaters, nahm Abschied und zog fröhlich davon. Bald erreichte er das Schloss, wo er die schöne Königstochter zu finden hoffte. Er hatte sich wahrlich nicht zu wenig versprochen: Sie war sogar noch schöner, als er es sich in seinen kühnsten Träumen ausgemalt hatte. Ihre Wangen glühten wie die wilden Rosen an der Palastmauer, ihr Haar leuchtete, als wäre es aus purem Gold, und ihre Anmut und Vollkommenheit verzauberten ihn und bestärkten ihn in dem Entschluss, sie zur Frau zu nehmen.
Ihr Vater war ein grosser König. Seine Schlösser und Ländereien zählten zu den prächtigsten im ganzen Land, seine Besitztümer zeugten von unermesslichem Reichtum. Gold und Purpur kleideten ihn, Seide und Samt den ganzen Hofstaat. Selbst noch die niedrigste Dienerschaft trug feinstes Leinen.
Doch wie sollte ein dahergekommener Jüngling es anstellen, die Königstochter für sich zu gewinnen?
Übe dich in Bescheidenheit, Gehorsam und Geduld, kamen ihm die Worte des Vaters in den Sinn. Und obwohl ihn solche Dinge langweilten, nahm er es sich zu Herzen und liess sich am Hof zum Ritter ausbilden, um auf diese Weise Ehre und die Gunst der Königstochter zu erlangen.
Jahre vergingen und der Jüngling wurde tatsächlich zum ruhmreichen Ritter und stattlichen Krieger, dem König stets treu.
Als eines Tages im Schloss ein Feuer ausbrach, sah er seine Stunde endlich gekommen. Das Unglück nahm seinen Anfang, gerade als sich die Königstochter im höchsten Turmzimmer des Schlosses aufhielt, um dort die Tauben zu füttern, die unter den Zinnen hausten.
Der Ritter eilte ihr zu Hilfe und rettete sie vor den tödlichen Flammen, worauf sich ihr Herz ihm endlich zuwandte. Noch während er sie aus den Gemäuern trug, gab sie ihm ihr Wort, seine Frau zu werden.
«Unter einer Bedingung», sagte sie. «Geh noch einmal zurück und befreie auch die jungen Tauben aus ihren Nestern unter dem Dach. Sie können noch nicht fliegen und müssten sonst allesamt sterben.»
Aber davon wollte der eitle Ritter nichts wissen. Was kümmerten ihn junge Tauben? Endlich hielt er seine Auserwählte im Arm, alles, was er sich je gewünscht hatte!
Darüber wurde die Königstochter traurig und sprach: «So wird also wahr, was den Königen einst geweissagt wurde: Das Reich muss zu Stein werden, denn gehörte es einem König, der sich nicht kümmert um das Wohl der Geringsten, es nähme ein böses Ende. Ich versprach dir meine Hand und mein Leben dazu, aber du verachtest das Leben derer, die nicht weniger wert sind. Was für ein König wärst du? Dem Land ergeht es besser, wenn es zu Stein wird.»
Und wie sie das sagte, nahm das Schicksal seinen Lauf. Die Königstochter erstarrte vor seinen Augen, und mit ihr alles rundumher. Blumen und Blätter zerfielen und das Land verschwand unter einer grauen, undurchdringlichen Decke aus Stein.
Natürlich erschrak der Ritter – aber zu spät.
In seiner Verzweiflung fiel er auf die Knie, klagte jämmerlich und zerriss sein Rittergewand.
Da erschien ein kleines Weiblein und fragte ihn, was ihn bekümmerte. Er wollte es wegschicken, doch es liess sich nicht beirren und sagte: «Ei, ei, junger Mann, du solltest guten Rat nicht verwerfen! Sieh an, ich weiss um die Not, die dich trifft. Du tätest gut daran, mich zu fragen, wie ich dir helfen könne.»
«Dann sag es mir!», befahl der Ritter.
Das Weiblein hielt in der Hand eine Taube, die wie alles zu Stein geworden war, und liess darauf eine Träne niederfallen. Wie die Träne die Taube berührte, erwachte diese zu neuem Leben, schwang sich auf und flog davon.
Der Ritter staunte und eilte freudig zu der versteinerten Königstochter hin, damit ihm das Augenwasser käme und seine Tränen auf sie niederfallen würden.
Doch das Weiblein mahnte ihn: «Nicht deine Tränen werden es bewirken. Und auch nicht die meinen. Um sie aus dem Schlaf aufzuwecken, braucht es mehr als das. Die Tränen einer Jungfrau werden es sein, gute, junge Tränen. Erst dann wird dir zurückgegeben, was du verloren meinst.»
Und wie das Weiblein dies sagte, verschwand es. Der Ritter, voller Fragen, die ihm jetzt niemand mehr beantworten würde, begann bitterlich zu weinen und beklagte sein Elend, bis seine Tränen versiegten.
Dann erhob er sich und fasste einen folgenschweren Entschluss. «So schwer kann es nicht sein, die Tränen einer Jungfrau herzubringen, um meine Liebste zurückzugewinnen», sagte er sich.
Aber er sollte sich irren…
Kapitel 1
Ein Schiff legt an
Man wird geboren mit dem Willen zu wachsen, Grenzen zu erweitern und zu neuen Ufern aufzubrechen. Erst mögen es nur kleine Schritte sein: die eigene Hütte, der Platz davor und jener dahinter, der Garten, dann die nächste Hütte, die übernächste. Und steht man erst sicher auf eigenen Beinen und das Laufen geht von allein, ist auch der Weg zum Strand nicht mehr weit, zu den Felsen, zum Hafen, zum Fischmarkt oder in die Stadt hinauf. Die Hügel rücken näher und warten darauf erklommen zu werden, bald will man wissen, was sich dahinter verbirgt. Ebenso, wenn man ins Boot klettert und aufs Wasser rudert. Woher kommen die Wellen? Wohin fliessen sie weg? Wie weit würden sie mich tragen? An ferne Strände? Bis ans Ende der Welt?
Zuweilen meint man, es sei nun gut und könnte bleiben, wie es ist, mit allem, was man je entdeckt hat. Und doch hebt sich der Blick bald wieder zum Horizont und man fragt sich: War’s das schon? Gibt’s nicht noch mehr?
Als Junge bestaunte ich die grossen Schiffe im Hafen Scalonas, meiner Heimatstadt. Ich war fasziniert von der Wucht ihrer Erscheinung, von den hohen Masten, dem eindrucksvoll angefertigten Gerippe aus hunderten von Tauen und Balken, die bis in schwindelerregende Höhen führten, und einem Schiffbauch, in dem unser ganzes Fischerdorf Platz gefunden hätte. Ich malte mir aus, woher die Schiffe kamen, bildete mir ein, den Hauch der Fremde zu spüren, der von fernen Ufern zeugt und allerlei Geschichten mit sich trägt.
Die grosse Fremde lockte und umwarb mich mit säuselnden Versprechen. Irgendwann würde ich das Land meiner Heimat verlassen, um Wind, Wellen und Seeungeheuern zu trotzen und zu neuen Ufern aufzubrechen. Kanonensalven und lobende Abschiedsrufe würden mich auf See hinausbegleiten – die Segel gesetzt, Kurs auf ein fernes Ziel genommen – und das Abenteuer meines Lebens könnte beginnen.
Na ja, wenn man ein Junge ist, malt man sich so einiges aus.
Doch nichts davon lässt sich vergleichen mit dem, was mich schliesslich dazu bewegte, meinen Fuss tatsächlich auf die Planke einer grossen Karacke zu setzen. An diesem folgenschweren Tag, mit einem Schritt, liess ich meine Kindheit hinter mir. Und es hatte ganz und gar nichts mit aufregenden Träumereien zu tun.
Ich erinnere mich gut. Ein kräftiger Wind zog über das schaumgekrönte Meer und liess die beim Steg Zurückbleibenden noch mehr erzittern als sie es ohnehin taten. Die Schatten des Abends legten sich über Strand und Stadt, während sich schwere, grünlich graue Wolken gegenseitig voranschoben. Es roch nach Sturm. Und trotzdem würden wir aufbrechen – so schnell es nur ging. Erfahrene Seemänner, unter dem Kommando ihres Kapitäns, im Auftrag des Königs, zu allem bereit.
Vom Deck her ertönte ein Pfiff. Der Moment war gekommen. Ich musste Mutters Hand loslassen, ob ich wollte oder nicht. Abschied tut weh, ein solcher erst recht. Ich las in ihren Augen, wie weit ihr Flehen reichte. Unter keinen anderen Umständen hätte sie mich auf diese Weise ziehen lassen, das wusste ich. Jetzt aber drängte sie mich geradezu. Ihre ganze Hoffnung legte sie in das Gelingen dieser Reise. Zusätzlich befahl sie mir Ernesto, meinen Bruder, an, der nicht davon abzubringen war, mit an Bord zu gehen. Sie verstand ihn, auch wenn es ihr das Herz brach. Vater, an ihrer Seite, legte ihr still den Arm um die Schulter. Seine Haltung war gefasst, wie immer. Er hatte sich bloss den Hut vom Kopf genommen und drückte ihn fest an seine Brust; ich wusste, er tat es nicht bloss des Windes wegen. Ein letzter Blick in seine Augen verlieh mir endlich die Kraft, die ich brauchte, um mich wegzudrehen und den Weg über die Planke zu nehmen.
An Bord wartete Fenaj. Sie stand einfach da und musterte mich mit demselben leeren Ausdruck, wie ich ihn seit unserer ersten Begegnung kannte. Sie sagte kein Wort, nahm mich stattdessen bei der Hand, sobald ich sie erreichte, und führte mich Richtung Heck davon. Ernesto folgte uns schweigend. Ein letzter Blick über die Reling liess meine Augen brennen.
Wie lange, bis ich euch wiedersehe? Und werden wir finden und wiederbringen, was uns genommen wurde?
Ich hätte längst spüren müssen, dass etwas nicht stimmte. Der Winter, es war mein dreizehnter, gestaltete sich von Anfang an ungewöhnlich. Regen folgte auf Sturm, Sturm auf Kälte. Mehrmals legte sich sogar eine dünne, nasskalte Schicht Schnee über Scalona. Häufiger als sonst zwang das Wetter die Fischer zu mehrtägiger Rast, während die Glocke am Hafen einzig läutete, wenn der Sturm daran rüttelte.
Dennoch waren es letztlich nicht die Wetterlaunen, die diesen Winter für uns alle unvergesslich machten. Der wahre Sturm lauerte anderswo. Und dies ausgerechnet jetzt, nachdem unsere Insel und ganz Scalonien vor über einem Jahr endlich von einem langjährigen Hexenfluch erlöst worden war. Zum ersten Mal seit langer Zeit lag ein ertragreicher Sommer hinter uns, die Keller und Vorratskammern waren gefüllt mit Korn und Wein, und niemand brauchte mehr Hunger zu leiden, nicht einmal die Bauern. Ausserdem schien es, als hätte der wiedergekehrte Zauber der Glasvogellieder das Land regelrecht zum Erblühen gebracht. Man sagt von diesem Vogelsang, er berühre die Seele allen Lebens in einer Weise, dass Kummer weichen und Hoffnung aufkeimen müsse. Natürlich trug aber ebenso die Tatsache, dass dem Königreich wie durch ein Wunder seine lange totgeglaubte Prinzessin und Erbin zurückgegeben worden war, massgeblich dazu bei, dass alle glaubten, es wären endlich gute Zeiten angebrochen.
Umso härter traf es uns deshalb, als eines Tages die Hörner geblasen und das Volk im ganzen Land auf die Plätze gerufen wurde, wo eine schreckliche Nachricht es erreichte. Man wollte es weder hören noch glauben, und doch musste jeder davon erfahren: Es ging um die Prinzessin!
Für mich allerdings hatte das Elend bereits früher begonnen. Eigentlich schon an jenem Tag im späten Herbst, als ein anderes Schiff im Hafen anlegte.
Und hier nun beginnt meine Geschichte: Nach Tagen des ununterbrochenen Regens, als die Fischer endlich wieder einmal ausgefahren waren, zog ich mir gerade ein Woll-Hemd über, verliess die Hütte und rannte zum Hafen, während die Glocke bereits die ersten Rückkehrer ankündigte. Ein heller werdender Himmel zauberte gleissende Silberstreifen auf die schäumenden Wogen und liess die Luft klar und gleichzeitig kalt erscheinen. Fast eine Woche lang hatte der Sturm uns in die Hütten gezwungen. Dafür versprach ein aufgewühltes Meer nun umso üppigere Fänge. Die halbe Stadt würde sich heute auf dem Fischmarkt versammeln.
Am Hafen winkten die heimkehrenden Fischer mich herbei, ihnen zur Hand zu gehen, Kisten aus den übervollen Booten zu hieven und Fässer über den Steg zu rollen. Vater und Mauro waren noch nicht zurück, also packte ich mit an, wo ich gerade gebraucht wurde.
«Was für ein Tag!», riefen die Fischer. «Ein Festtag für unsereins! Gleich fahren wir nochmals.»
Wie gern wollte ich mit! Aber Vater und Mauro waren gemeinsam, bloss mit einem Boot, draussen. Es brauche bei solchem Seegang zwei erwachsene Männer an Bord, meinten sie, was mich ärgerte. Immerhin war ich schon fast dreizehn und für mein Alter, wie alle sagten, reif und kräftig gebaut. Und ausserdem, davon war ich überzeugt, war mir bereits durchaus Gefährlicheres begegnet als ein paar belebte Wellen. Im vorletzten Sommer zum Beispiel, als ich gemeinsam mit der Prinzessin einer Hexe hatte entfliehen müssen, die Nebelsümpfe durchwandert und gegen einen Sumpftiger gekämpft hatte, einer Horde Piraten entkommen war und eigenhändig den Drachen des Gunklos von seinen Ketten befreit hatte – das waren echte Gefahren gewesen! Ausserdem war ich auf einem Drachenvogel über die halbe Insel geflogen. Alles in allem hatte ich massgeblich dazu beigetragen, dass Scaloniens Glasvögel endlich ihr Lied zurückerhalten hatten und dass die Prinzessin überhaupt erst zur Prinzessin geworden war. Aber all das schien hier niemanden zu interessieren, wenn es darum ging, an einem windigen Tag in ein belebtes Meer zu stechen.
Na ja, nicht mehr lange, sagte ich mir, und ich werde erwachsen sein und endlich beweisen können, was alles in mir steckt.
Mehr, als für immer ein gewöhnlicher Fischer zu bleiben, wie Vater und Mauro es waren, wollte ich irgendwann zur See fahren, nicht bloss mit einem kleinen Boot, sondern mit einem jener schöngefertigten Handelsschiffe, die in letzter Zeit immer öfter im Hafen anlegten. Genau wie mein Bruder Antonio. Mit fünfzehn hatte er bei einer Schiffsmannschaft angeheuert und besegelte seither die Meere. Selbst wenn wir lange nichts von ihm gehört hatten, war ich überzeugt, er führte ein aufregendes, wunderbares Leben.
Mutter glaubte genau das allerdings nicht. Eines Tages wird er wiederkehren, sagte sie manchmal, auf Knien angekrochen kommen. Er wird sich wünschen, die Schrecken der See nie kennengelernt zu haben. Der Mensch braucht Erde unter den Füssen, kein bodenloses Meer, das nur darauf wartet, ihn zu verschlingen.
Meine Mutter war als Bauerntochter aufgewachsen und erst durch die Heirat an die Küste gezogen. Mochte sie dadurch zwar die Frau eines Fischers geworden sein und kannte bestens jeden Handgriff unseres Handwerks, vom Ausnehmen der Ware, übers Entschuppen, bis hin zum Räuchern, Einsalzen oder Braten, sie hatte in ihrem ganzen Leben trotzdem niemals auch nur den Fuss in ein Boot gesetzt. Das übernahmen wir für sie, meine Geschwister und ich. Mauro, mein ältester Bruder, an erster Stelle. Er war bereits verheiratet und lebte mit seiner Frau in der Stadt. Gemeinsam mit Vater fuhr er täglich mindestens zweimal aufs Meer, meistens mit zwei Booten.
Ernesto und ich waren ihre Gehilfen, manchmal auch Marlena, unsere älteste Schwester, oder Emilia, Ernestos Zwillingsschwester. Seltener begleitete uns Federico, der trotz seiner gerade erst neun Jahren meiner Meinung nach bereits beachtlich mitanzupacken wusste. Die Einzige, die ganz nach Mutter kam und nicht freiwillig in ein Boot stieg, war Fiora, die Jüngste. Nicht dass sie wie Mutter das Meer gefürchtet hätte, sie konnte es bloss nicht ertragen, auch nur einen Fisch oder eine Krabbe leiden zu sehen.
Mutter und Grossmutter Gina nahmen täglich die Fänge entgegen und alle gemeinsam bereiteten wir diese für den Verkauf vor. Auf dem Fischmarkt, alle paar Tage auch oben in der Stadt, boten wir unsere Ware an und verdienten damit unseren Lebensunterhalt.
An diesem Morgen nun kehrte ich gewiss zum zehnten Mal über den Steg, um eine weitere Kiste mit Frischfisch entgegenzunehmen.
«Danke, Giu!» sagte der Fischer, dem ich gerade die schwere Fracht abnahm, um sie zur Hafenmauer zu tragen.
«Immer gern!» gab ich zu Antwort.
«Du wirst von Tag zu Tag kräftiger, mein Junge. Eigentlich schade, dass dein Vater dich so oft selbst beansprucht; ich könnte einen wie dich gut gebrauchen.»
Meine Wangen erglühten. «Ja, bloss heute wollte er mich nicht dabeihaben. Zu gefährlich, meint er.»
Der Fischer nickte. «Dein Vater tut nicht unrecht, vorsichtig zu sein. Aber bei aller Ware, die heut reinkommt, können wir dich hier umso besser gebrauchen. Keine Angst, das kommt schon noch. Irgendwann wirst du’s mit jedem Wetter aufnehmen können.»
Er lächelte wohlwollend und ich lächelte zurück, ehe ich mich über den Steg entfernte.
Gerade in diesem Moment ertönte die Glocke aufs Neue. Ich sah mich um, aber entdeckte weit und breit kein zurückkehrendes Fischerboot. Stattdessen rief der Glöckner laut und gutgelaunt vom Ende des Stegs her: «Grosses Schiff! Grosses Schiff in Sicht!»
Es hatte sich unter den Fischern am Hafen eingespielt, jedes Schiff anzukündigen und wenngleich es auch in den letzten Monaten nichts Aussergewöhnliches mehr war, dass grosse Handelsschiffe in Scalonas Hafen einliefen, versprach es dennoch jedes Mal spannende Kunde.
Ich beeilte mich, die Kiste bei der Hafenmauer abzusetzen und hastete, den Horizont mit den Augen absuchend, zurück zum Steg. Tatsächlich! Weit draussen, mit aufgeblähten Segeln und flatternden Bannern tanzte es über die schäumenden Wellen, stolz wie ein Kriegsross nach erfolgreicher Schlacht.
Mein Herz klopfte vor freudiger Erwartung. Es mochte der Wind sein, das grüne Meer, der helle Glanz des Morgens oder die strahlend, vom Sonnenlicht beschienenen Segel, was bewirkte, dass der Anblick sich mir auf eine Weise einprägte, die ich niemals vergessen würde. Und dennoch, im Nachhinein frage ich mich, ob nicht bereits der Hauch einer Ahnung das Schiff umhüllte, als wollte das Schicksal mich warnen: Gib Acht, Junge, da kommt etwas auf dich zu!
Als die Glocke das nächste Mal erklang, kündigte sie Vaters Boot an. Marlena, Ernesto und Emilia hatten sich wie ich bereits am Hafen eingefunden, Grossmutter Gina, Mutter, Mauros Ehefrau Elena und meine jüngsten Geschwister folgten in diesem Moment. Sie führten Kleopatra, unseren Esel, samt Wagen und Körben bei sich.
«Wunderbar da draussen!», lachte Mauro, als sie den Steg erreichten. «Wie frisch aufgerührt, alles in Hülle und Fülle vorhanden. Kommt, helft abzuladen, gleich fahren wir nochmals!»
Eben noch hätte mich sein Schwärmen geärgert, weil ich an Land bleiben musste, aber inzwischen hatte ich ohnehin andere Pläne. Ich wollte das Spektakel am Hafen nicht verpassen, wenn das grosse Schiff anlegte. Es war kein scalonisches Schiff, so viel stand schon mal fest; die leichten Karavellen des Königreichs kannte ich bestens, auch aus der Ferne. Dieses erschien mir viel breiter, protziger und seine Flaggen leuchteten rot, nicht blau und golden wie die hiesigen.
Eilig leerten wir das Boot und machten uns an die Arbeit, den Marktverkauf vorzubereiten. Wiederum bestand meine Aufgabe zuallererst darin, Kisten zu schleppen und Fässer zu rollen. Ein Teil der Fänge wurde direkt zurück zur Hütte gebracht, um ihn dort fürs Räuchern vorzubereiten. Mutter schnappte sich Ernesto und Federico, um mit ihnen diesen Part zu übernehmen. Wir anderen machten uns an die Arbeit, den grossen Rest der Fänge an Ort und Stelle zu verarbeiten, in Kisten auf den Eselwagen zu verfrachten und sodann auf den Fischmarkt zu bringen, der nur Schritte vom Hafen entfernt, nahe dem Stadttor, lag.
Während nun also das vielversprechende Schiff aus der Fremde den königlichen Steg ansteuerte, welcher etwas weiter drüben im Schatten der Felsen lag, hatten wir längst unseren Platz auf dem Markt eingenommen und es blieb keine Zeit mehr, von grossen Schiffen und ihren Geschichten zu träumen – eigentlich. Zugegeben, ich war nicht recht bei der Sache und überlegte gerade, wie ich mich ungesehen davonschleichen könnte, als ich hinter mir meinen Namen hörte. «Giuseppe!»
Auf der Stelle war mir klar, dass die Stimme weder einem Fischer noch einem gewöhnlichen Händler gehörte, weil keiner von ihnen mich je mit meinem vollen Namen Giuseppe angesprochen hätte. Sie nannten mich Giu, oder Heda, Junge, oder einfach Du, Fischer. Giuseppe wurde ich hingegen ausschliesslich von hohen Stadtbürgern oder Abgeordneten des Königs angeredet, die mich überhaupt bloss deswegen kannten, weil ich im vorletzten Sommer durch die Sache mit den Glasvogelliedern einen Namen in der Stadt erlangt hatte und ausserdem ein Freund der Prinzessin war.
Sobald ich mich umdrehte, fand ich mich denn auch einem scalonischen Soldaten gegenüber, auf dessen Brust unübersehbar das Wappen des weissen Adlers prangte.
«Guten Tag! Ihr wünscht?», fragte ich mit einem gewissen Erstaunen.
«Frischen Fisch!», antwortete er knapp.
Weil ich nicht auf Anhieb verstand, wie er das meinte, weil scalonische Soldaten für gewöhnlich nicht auf dem Fischmarkt einkauften, fragte ich vorsichtshalber nach: «Ihr wollt frischen Fisch kaufen? Gerne, davon gibt’s heute jede Menge.»
Die Antwort kam prompt, von einem hervorgepressten Hüsteln begleitet: «Hm, nicht ich. Die Prinzessin wünscht frischen Fisch auszuwählen.»
«Oh», sagte ich einigermassen verblüfft und entdeckte in diesem Moment den golden bestickten Baldachin aus schwerem Brokatstoff hinter dem Stadttor auftauchen. Soldaten gingen ihm voran, bahnten mit ihren Lanzen einen Weg durch die Menge, während die Leute anstandslos zur Seite hin auswichen, stehen blieben, voller Ehrerbietung die Köpfe neigten oder knicksend eine Verbeugung andeuteten.
Nun, die Prinzessin von Scalonien kannte zwar den Fischmarkt, gut sogar, doch anders als früher zählte sie heute zu den seltenen, dafür umso bedeutenderen Gästen. So war es nicht immer gewesen. Einst hatte sie keine Samtkleider getragen, stattdessen einen einfachen Mägderock, und niemand hatte gewusst, schon gar nicht sie selbst, dass sie bloss aufgrund einer unglücklichen Verwechslung und der wagemutigen List eines königlichen Beraters als vermeintliche Tochter einer Küchenmagd aufgewachsen war – anstatt als Königskind. Man hatte während Jahren geglaubt, die Prinzessin wäre kurz nach ihrer Geburt gestorben, aber das Zurückkehren der Glasvogellieder hatte die Wahrheit schliesslich ans Licht gebracht.
Der Zug der Soldaten und Träger steuerte auf uns zu und kam schliesslich vor unserem Verkaufsstand zum Stehen. Zwei Leibwächter traten zum tragbaren Zelt, worauf der eine etwas hinein flüsterte, während der andere den Soldaten befahl sich in Stellung zu bringen, um einen abgesicherten Raum zu schaffen für den vorgesehenen Einkauf. Indessen liessen die Träger das schwere Prunkstück zu Boden sinken, der Vorhang wurde zur Seite geschoben und seinem Innern entstieg ein junges Mädchen, mit langem, glänzendem Kleid und aufwendig hochgesteckter Frisur, aus welcher sich einzig ein paar unbändige Locken gelöst hatten. Nicht, dass ich sie nicht erkannt hätte, sie sah auch ganz bezaubernd aus, aber einmal mehr, wenn ich sie so sah, erschien sie mir fremd – noch fremder als sonst, wenn ich jeweils ihren Einladungen ins Schloss folgte und wir gemeinsam bei Rosinenbrötchen und Marzipan in eher gezwungener Weise über dies und das plauderten, als hätte es die nahe Vertrautheit unserer Kindertage nie gegeben. Mochten ihre schönen Mandelaugen die gleichen geblieben sein, manchmal war ich mir nicht sicher, ob es die Toni von früher überhaupt noch gab. Sie war es immer gewesen, die behauptet hatte, Dinge wie Rang und Stand würden nichts über den eigentlichen Menschen aussagen, aber ich war überzeugt, dass solches eben doch grössere Gräben schlägt, als uns lieb ist.
Grossmutter Gina stand neben mir, ebenso Marlena und Emilia, aber die Prinzessin würdigte sie keines Blickes. Sie kam stattdessen direkt auf mich zu.
«Ihr … wünscht?», fragte ich mit stockender Stimme und senkte gerade noch rechtzeitig den Blick, um nicht unhöflich zu wirken.
Sie blieb zwei Schritte vor mir stehen. Als sie schliesslich ihren Wunsch äusserte, klang ihre Stimme fremd, beinahe kalt: «Hm … ich dachte an etwas Besonderes.»
Seltsam befangen versuchte ich ihren Wunsch zu erraten: «Na ja, es gibt eine Menge Besonderes. Das Meer ist aufgewühlt vom Sturm, die Erträge von besonderer Fülle. Ich kann vieles empfehlen: Thunfisch, ein üppiger Fang. Oder Seehecht, Meerbarbe, Sardellen. Da, Garnelen. Oder hier, Tintenfisch. Eine Languste? Austern? Oder anderes, seht nur! Was immer Ihr wünscht, alles frisch, alles von bester Qualität.»
Ganz kurz sah ich sie doch an. Die Prinzessin besah sich die Fänge nicht einmal, ihre Augen waren stier auf mich gerichtet. Schnell senkte ich den Blick wieder.
«Schöne Ware, zweifellos», sagte sie schliesslich, «aber nichts davon meinte ich. Ich dachte, ich fände hier etwas, was ich seit langem vermisse und was mir niemand je an die königliche Tafel bringt. Aber offenbar habe ich mich geirrt.»
Angestrengt durchforstete ich meine Gedanken, als liesse sich irgendwo in einem verborgenen Winkel meines Kopfes finden, was es denn sein könnte, was die Prinzessin vermisste. Suchte sie nach Haifisch? Dorsch? Seeigel? Konnte ich mich denn gar nicht erinnern, was ihre Vorlieben waren? Aber doch, Muscheln, fiel es mir ein! Sie hatte sie einst wie Schätze gesammelt, war im seichten Gewässer nach ihnen getaucht, hatte Strand und felsiges Gestein durchforstet, immer auf der Suche nach etwas Besonderem.
Meine Augen streiften unsere Fänge, aber ich musste bald einsehen, es war nichts Passendes dabei.
Gerade als ich etwas sagen und mich in irgendeiner Weise entschuldigen wollte, kam sie mir zuvor: «Lass gut sein, Giu. Ich nehme diesen!» Sie zeigte auf einen gewöhnlichen Rochen. «Der ist in Ordnung. Wieviel schulde ich dir?»
Ich zögerte, da fuhr Grossmutter Gina dazwischen: «Oh, gar nichts, Majestät, der ist umsonst.»
Die Prinzessin erwiderte nichts, während ich den Rochen in ein Stück Tuch wickelte und ihn ihr entgegenstreckte. Statt dem Päckchen fasste sie meinen Arm und liess nicht mehr los, bis ich mich gezwungen sah, zu ihr aufzusehen.
«Was ist los mit dir, Giu?», zischte sie mir leise zu. «Ich dachte, wir sind Freunde.»
«Sind wir auch», entgegnete ich hilflos und wich ihrem Blick bereits wieder aus. «Tut mir leid, wenn ich nichts anderes zu bieten habe. Keine schönen Muscheln oder … Meeresschnecken.»
Sie schüttelte den Kopf: «Ich wollte keine Muscheln. Ich wollte dich sehen. Hier, auf dem Fischmarkt, und spüren, wie das Leben pulsiert. Aber alles, was ich vorfinde sind versteinerte Gestalten, sobald ich irgendwo auftauche. Man weicht zur Seite, verneigt sich oder versteckt sich sogar. Und du, du bist von allen der Schlimmste. Was ist nur los mit dir? Ich verstehe es nicht, Giu. Und es ist mir zuwider. Du bist mir zuwider.»
Sie liess mich los, entriss mir den Rochen und machte Anstalten zu gehen, als sie sich noch einmal zurückdrehte und mir eine Goldmünze zuwarf. «Da! Ich weiss, dass ein solcher nicht umsonst ist, für gewöhnlich. Und ein Dieb will ich nicht sein. Leb wohl!»
Damit verschwand sie in ihr tragbares Zelt und verliess mitsamt dem königlichen Trupp den Fischmarkt wieder.
Als hätte sie mir eine Ohrfeige verpasst, blieb ich stehen, bis der Zug der Träger und Soldaten durchs Tor verschwunden war.
Erst dann stupste Grossmutter Gina mich an. «Kopf hoch, mein Junge. So ist es nun mal, die sind von anderem Schlag dort oben. Da ist nichts zu machen.»
Ich nickte mit zusammengepresstem Mund. Wie sehr ich die alte Toni vermisste, Gina hatte recht: letztlich war es zwecklos, sich deswegen verrückt zu machen.
Die Masse des gewöhnlichen Volkes rückte bald wieder zusammen, füllte den Platz und strömte herbei, um zu kaufen und zu tauschen, als hätte man den hohen Auftritt von eben bereits vergessen. Und vergessen wollte auch ich. Entschieden sah ich mich nach neuer Kundschaft um, aber Emilia durchkreuzte meine Pläne und berührte mich am Arm.
«Giu, es tut mir leid», wisperte sie.
«Was denn?» Ich sah sie fragend an.
Ihre leicht staubigen Wangen wiesen glänzende Spuren auf, woran ich erkannte, dass sie geweint hatte. Bloss warum? Obwohl sie meine Schwester war, erschien mir niemand so rätselhaft wie sie – vielleicht nicht einmal die stummen Fische im Meer. Es verging kein Tag, an dem nicht irgendetwas sie zum Weinen brachte. Ihr Leben musste traurig, wenn nicht geradezu grausam sein, selbst wenn mir oft verborgen blieb, woran es lag. Niemand war besonders streng oder gemein zu ihr. Aber bereits das kleinste Missgeschick, der harmloseste Streich oder auch nur ein falsches Wort brachten sie oft völlig aus der Fassung. Sie ertrug weder Streit noch Schmerz, selbst dann nicht, wenn sie selbst überhaupt nicht davon betroffen war. Manchmal weinte sie auch einfach so.
«Was tut dir leid?», fragte ich nochmals.
«Dass wegen Toni … ähm, ich meine, wegen der Prinzessin. Was sie dir gesagt hat.»
«Ach, das war doch nichts», winkte ich ab. «Das … das sagt man so, es hat nichts zu bedeuten. Emilia, wirklich, das braucht dich nicht zu kümmern. Überhaupt, was geht es dich an?»
«Nichts», antwortete sie betrübt und drehte sich schnell weg, als hätten meine Worte sie noch mehr gekränkt.
Ich schüttelte verständnislos den Kopf. Toni ärgerte mich, aber Emilia erst recht.
Für eine Weile hatte ich das grosse Schiff am Hafen vergessen, und als es mir endlich wieder einfiel, blieb keine Zeit mehr, sich darum zu kümmern. Die ganze Stadt schien sich nach dem Sturm auf dem Fischmarkt einzufinden. Die Münzen klimperten wie selten. Gerade durfte ich selbst eine unerwartet grosse Handvoll davon entgegennehmen, weil der Wirt der nahen Herberge seine Einkäufe heute einzig bei uns tätigte, da tauchte aus der Masse ein Mann auf. Er zog meine Aufmerksamkeit sofort auf sich, selbst wenn ich ihn nicht auf Anhieb erkannte. Sein Gesicht war braungebrannt, seine ganze Gestalt wirkte wild und schmutzig, als hätte er sich seit Wochen nicht gewaschen, mit zerzaustem Haar und lumpigen Kleidern. Auch etwas abgemagert sah er aus, trotzdem ausserordentlich kräftig, mit breitgebauten Schultern und starken Händen, die ohne Zweifel keine Arbeit scheuten. Aber nicht allein deswegen blieb mein Blick an ihm haften; es war sein Lächeln und die hellen, braunen Augen, was mich schliesslich in freudiges Zittern versetzte.
«Antonio?», kam es mir tonlos, als würde ich träumen, über die Lippen, während ich spürte, wie mir die Münzen, die ich eben erst erhalten hatte, eine nach der anderen, aus den Händen glitten.
In diesem Moment blieb er stehen. «Giu, bist du das?» Er musterte mich mit erstauntem Blick, während sein Mund sich zu einem breiten Lächeln formte. «So gross und kräftig? Fast schon ein Mann?»
Und dann gab es kein Halten mehr: Wer immer mich gerade zurechtweisen wollte wegen der Münzen, die allesamt klimpernd zu Boden gefallen waren, das musste warten. Ich flitzte an Gina und Marlena vorbei und warf mich in Antonios offene Arme. Mehr als zwei Jahre war er fortgewesen. Zwei lange Jahre – aber jetzt war er wieder da und hielt mich fest. Antonio, mein grosser Bruder!
Nur aus dem Augenwinkel nahm ich wahr, wie die anderen zu uns aufschlossen, sobald auch sie den Ankömmling erkannt hatten. Und zum zweiten Mal an diesem Tag entdeckte ich dabei, wie Emilia in Tränen ausbrach, doch diesmal, das erkannte und verstand ich, waren es Freudentränen!
Dass genau dies kein gutes Zeichen war, davon ahnte ich noch nichts.
Kapitel 2
Eine Taube aus Stein
Antonio war zurück!
Er war wieder da und es fühlte sich so gut an; mein Inneres konnte nicht aufhören, immer aufs Neue in Jubel auszubrechen.
Alle waren glücklich. Später am Hafen, nachdem Vater und Mauro vom Meer zurückgekehrt waren, hielten die beiden erst verblüfft inne, sobald sie uns entdeckten. Vater streifte sich den Hut vom Kopf und fuhr sich mehrmals aufgeregt durchs Haar, ehe er endlich losstürmte, um seinen heimgekehrten Sohn in die Arme zu schliessen und eine ganze Weile nicht mehr loszulassen.
Mauro trat sichtlich erfreut hinzu. «He Kleiner!», scherzte er, sobald Vater Antonio wieder freigab, und legte ihm freundschaftlich den Arm um die Schulter. «Wer hätte das gedacht? Wenn du uns nur etwas erhalten bleibst! Du wirst bald Onkel, musst du wissen. Im Frühling, Kleiner. Wir können es kaum erwarten. Ehrlich!»
Mauro strahlte wie immer, wenn er davon sprach. Seine Frau Elena erwartete ihr erstes Kind und alle freuten sich mit den beiden.
Antonio zeigte sich ebenfalls erfreut darüber und sicherte uns zu, vorläufig bei uns zu bleiben. Was weiter komme, würde sich zeigen.
Zuerst aber wollte er nach Hause. Am liebsten hätte ich ihn begleitet, nur schon, um dabei zu sein, sollte Mutter vor Freude oder Schreck in Ohnmacht fallen, sobald sie ihn sähe, wie er da kam, aufrecht und gutgelaunt – und keineswegs auf Knien ankriechend, wie sie es befürchtet hatte. Aber man liess mich nicht, die zweite Fracht Frischfang rief mich zurück an die Arbeit.
Am Abend erwartete uns dafür ein regelrechtes Festessen. Mutter war zwar nicht in Ohnmacht gefallen, stattdessen aber hatte sie kurzerhand alles stehen- und liegengelassen, um Antonios Heimkehr gebührend zu feiern. Über dem Feuer brutzelte ein verheissungsvoll duftender Ferkelbraten, was nicht alle Tage vorkam, ein Fass Wein wurde angerollt, während sich hinter dem Haus schier das halbe Dorf versammelte, um Antonio zu begrüssen. Er selbst schien diesen ganzen Aufmarsch zu geniessen, wenn er auch einigermassen müde aussah. Kein Wunder auch, nach all dem Reisen und erst recht nach dem vergangenen Sturm. Das Leben an Bord mochte ihn gezeichnet haben, er wirkte ausgelaugt und ewig hungrig. Trotz allem feierte er mit uns bis tief in die Nacht hinein.
Antonio bezog sein Lager in der halbfertigen Hütte neben unserem Haus. Mauro hatte diese einst zu bauen begonnen, um dort mit seiner Frau zu leben, ehe ich im vorletzten Sommer durch die Sache mit der Prinzessin und den Glasvogelliedern zum Ehrenbürger Scalonas ernannt worden war und deswegen ein Haus geschenkt bekommen hatte. Da ich selbst kein Haus brauchte, hatte ich es kurzerhand an Mauro weiterverschenkt. In dieser halbfertigen Hütte nun hausten seither unsere Tiere. Aber Antonio störte es nicht, sich den Schlafplatz mit Esel, Hühnern und Ziegen zu teilen.
Nach einigen Tagen und viel frischem Fisch, Milch und Käse fühlte er sich bereits wieder kräftig genug bei unserem täglichen Tun mitanzupacken und fuhr bald mit den Fischern hinaus. Ich selbst war mit von der Partie bei seinem ersten Fischfang und staunte über seine muskulösen Arme, überhaupt über seinen kräftigen Oberkörper, der in keiner Weise mehr jenem eines Jungen glich. Antonio war ein Mann geworden und ich bewunderte ihn dafür. Voller Stolz arbeitete ich an seiner Seite, und das Beste dabei war, er selbst behandelte mich stets so, als wäre auch ich kein Junge mehr.
«Giu», sagte er eines Abends, als wir gemeinsam vor der Hütte sassen, «ich staune. Weisst du eigentlich, wie du dich verändert hast? Damals, als ich mich von dir verabschiedet habe, hast du bloss den Kopf hängen lassen, erinnerst du dich? Wie ein winselnder, kleiner Köter, der den Schwanz einzieht. Aber jetzt? Ich erkenn dich kaum wieder. So gross und … hm.» Er spannte seinen Oberarmmuskel an und deutete gleichzeitig mit anerkennendem Lächeln auf die meinen, als wäre er tatsächlich beeindruckt. «Und man erzählt sich Dinge über dich. Ehrenbürger, unglaublich! Das wird nicht jeder, aller Achtung. Ja, eine Menge erzählt man sich über dich.»
«Na ja», entgegnete ich und spürte, wie meine Wangen erglühten, «wegen der Sache mit den Glasvögeln. Wir haben ihre Stimmen zurückgeholt.»
«Ja, tatsächlich. Das ist unglaublich, Giu. Wer hätte das gedacht. Ich bin echt stolz auf dich.»
«Eigentlich ist es am meisten Toni zu verdanken. Durch sie haben die Vögel ihr Lied zurückerhalten», fügte ich schnell hinzu, als wäre ich verpflichtet, diese Einzelheit zu ergänzen.
Antonio musterte mich, ein zufriedenes Grinsen umspielte seine Lippen. «Genau, ich weiss. Toni, die Prinzessin! Du bist ohnehin ein Teufelskerl, Giu, aber ganz nebenbei rührst du auch mit grosser Kelle an, weisst du das? Ein einfaches Bürschchen, aber angelst dir eine Prinzessin. Tja, darum beneid ich dich fast, das geb ich zu.»
Jetzt schoss mir endgültig das Blut in die Wangen. Wenn er damit meinte, zwischen Toni und mir gäbe es etwas mehr als blosse Freundschaft, dann irrte er sich – und das nicht nur, weil sie eine Prinzessin war und sich einfache Leute nicht einmal im Traum ausmalen dürften, sich je eine Prinzessin zu angeln.
«Widersprich mir ruhig!», lachte er. «Ich weiss doch, wie das ist, mit den schönen Mädchen. Sag, hast du je eines geküsst?»
«Na ja … ich weiss nicht», antwortete ich ausweichend. Ich wollte über Derartiges nicht mit meinem fünf Jahre älteren Bruder reden, der mir auf diesem Gebiet ohne Zweifel viele Meilen voraus war.
«Oh, du Schlingel, du weisst es also nicht?» Er langte mir ins Haar, um es ordentlich zu zerzausen, wie er es oft tat, wenn er mich scherzend aufziehen wollte. «Nun, du wirst es schon noch lernen – das Küssen, meine ich. Aber lass dir gesagt sein: in Scalona mögen die Mädchen hübsch und nett sein, aber andernorts …» Er stiess einen bewundernden Pfiff aus. «Glaub mir, es gibt Orte auf dieser Welt, da gleichen die Mädchen Göttinnen. Sie sind noch schöner als der Abendstern am Sommerhimmel, Giu, und ihre Küsse schmecken süsser als Honig. Dorthin müsste ich dich mitnehmen – aber nicht nur der Mädchen wegen. Da gibt es Paläste aus Gold, marmorne Strassen, und Tiere, wie du sie nie zuvor gesehen hast. Grösser als unser Haus, sie können ganze Bäume tragen. Es gibt Weiten, die du dir nicht vorstellen kannst: Wüsten, ganz gelb und unendlich wie das Meer, Wälder, die niemals enden, und Berge, die bis zum Himmel reichen und das Grün des Sommers nicht einmal kennen.»
Ich vergass die Mädchen und tauchte stattdessen in Antonios Berichte ein. Er erzählte von den Schiffen, mit welchen er durch die Welt gesegelt war und den Ländern, die er bereist hatte. Gebannt liess ich alles, was er mir schilderte, vor meinen Augen Gestalt annehmen. Solche Grössen und Weiten, Schönheit und Vielfalt! All das lockte mich und der Wunsch, diese Dinge eines Tages mit eigenen Augen zu sehen, wuchs mit jedem seiner Wort.
«Antonio, du verdrehst dem Jungen den Kopf!», schimpfte Mutter, während sie sich an uns vorbeidrängte, um Rüstabfälle in den Hof zu werfen. «Er ist nicht wie du, also lass ihn!»
«Ach, Mutter», entgegnete Antonio. «Warum? Was willst du damit sagen?»
«Ich will sagen, dass du damit aufhören sollst, ihm die Welt auf einem goldenen Teller aufzutragen. Er wäre enttäuscht, sähe er, wie es wirklich ist.» Sie sprach mit Antonio, aber ihr ernster Blick hielt mich fest. «Er ist noch ein Kind und glaubt dir alles. Aber du weisst es besser, also hör auf damit!»
Was sie sagte und wie sie mich ansah, liess mich erschaudern. Sobald sie zurück in der Hütte verschwand, legte mein Bruder beschwichtigend den Arm um meine Schulter und flüsterte mir zu: «Keine Angst, sie sorgt sich nur. Es ist der Gedanke, dich zu verlieren, der ihr nicht gefällt. Aber so sind Mütter nun mal. Am Ende verzeihen sie dir alles, wenn sie nur sehen, dass du glücklich bist. Also vergiss, was sie gesagt hat und mach dir dein eigenes Bild von der Welt!»
Ich wollte nicht, dass Mutter sich meinetwegen sorgte. Doch andererseits war ich kein kleiner Junge mehr und hatte, zumindest in Scalonia, bereits eine ganze Menge erlebt und am eigenen Leib erfahren, wie dunkel die Welt zuweilen sein konnte. Antonio hatte recht, ich sollte mir selbst meine Bilder machen und einem plötzlichen Einfall folgend sprudelte es aus mir heraus: «Wirst du mich mitnehmen, wenn du wieder gehst?»
Erst lachte mein Bruder, ehe er mich einen Augenblick lang ernst musterte, als müsste er prüfen, ob ich nicht scherzte. Aber das tat ich nicht.
«Du meinst es ernst. Tatsächlich! Na ja… das wär schon was.» Sein Lächeln kehrte nur zaghaft zurück, aber er schüttelte den Kopf. «Doch nein, ich werde dich nicht mitnehmen.»
«Warum nicht? Wegen Mutter?», fragte ich.
«Nein, nicht wegen Mutter», antwortete er.
«Warum dann?»
Er suchte nach den richtigen Worten. «Nun, Giu, du bist… Hör zu, sie brauchen dich hier. Du bist ein guter Fischer. Ich kann dich nicht einfach von hier wegreissen.»
Seine halbherzige Antwort traf mich. «Gerade eben hast du noch gesagt, ich soll mir mein eigenes Bild von der Welt machen.»
«Ja, sollst du auch, aber … du bist erst zwölf, Giu. Das hat noch Zeit, glaub mir.»
Entrüstet stiess ich seinen Arm weg und sprang auf. «Ich werde dreizehn. Aber klar, ich hab schon verstanden.» Eilig drehte ich mich weg und sputete davon.
«Giu, warte!», rief Antonio mir hinterher. «So warte doch!»
Aber das wollte ich nicht. Ich rannte zum Strand. Von aufkommenden Tränen übermannt, warf ich mich in den Sand. Wie konnte er sowas sagen? Er, der sonst ganz anders war als Mauro, der mich zwar von Herzen liebte, aber in mir immer den kleinen Bruder sehen würde. Antonio, so hatte ich geglaubt, würde mich verstehen. Seit seiner Ankunft hatte er mir das Gefühl gegeben, ich sei mehr als die Summe meiner Jahre – fast schon ein Mann. Aber ich hatte mich getäuscht.
«Mensch, Giu», hörte ich seine Stimme sich nähern. «Da bist du ja!»
Er setzte sich zu mir in den kühlgewordenen Sand. «Hör zu, es tut mir leid», sagte er ernst. «Ich hab das nicht so gemeint. Du bist zwölf – entschuldige, fast schon dreizehn, das stimmt, aber eigentlich ist das kein Grund, wenn ich dich ansehe. Wir hatten auch mal `nen Schiffsjungen, der war erst zwölf. Der machte seine Sache gut, ehrlich. Aber weisst du, das ist nicht der Punkt.»
«Was dann?», fragte ich schniefend und wischte mir die Tränen weg, für die ich mich hätte ohrfeigen können – als zeugten sie davon, dass ich eben doch noch ein Kind war.
«Es ist wegen Vater und Mutter», fuhr Antonio fort. «Ich glaube, bis Ernesto und Federico alt genug sind, brauchen sie dich einfach hier. Sieh, Mauro wird bald selbst Vater werden, da wird auch er mehr Unterstützung nötig haben. Verstehst du das? Hör zu, ich war fünfzehn, als ich an Bord ging. Aus eben solchen Gründen, glaub mir. Und ich war kein guter Fischer, so wie du. Mein Kopf war einfach nicht recht bei der Sache, verstehst du? Aber trotzdem hielt ich durch. Lass ihnen noch etwas Zeit, Giu. Du wirst sehen, es geht schnell – schneller, als du jetzt denkst.»
Der Wind strich unangenehm kühl über uns hinweg und jagte finstere Wolken über den Nachthimmel, während sich die Brandung mit schäumendem Zischen in den Sand frass. Meine Augen verloren sich in der Ferne, wo in der Dunkelheit kein Horizont auszumachen war. So finster musste die Nacht draussen auf See sein, überlegte ich und spürte, wie der Gedanke mich plötzlich zittern liess. Antonios Worte hallten in mir nach und stimmten mich versöhnlicher, je länger sie auf mich einwirkten.
«Du hast Recht, sie brauchen mich», sagte ich leise. «Auch Erno und Federico. Ich bin ihr grosser Bruder und möchte für sie da sein.»
«Siehst du?», Antonio nickte. «So spricht mein Bruder – auch wenn du jünger bist als ich, du bist ein guter grosser Bruder, das weiss ich ganz bestimmt. Du hast das Herz am richtigen Fleck – genau am richtigen.»
Es war nicht nötig, dass er mir erneut den Arm umgelegt hätte, ich spürte seine Nähe auch so und es tat unheimlich gut, hier, neben ihm zu sitzen und aufs Meer zu starren, selbst wenn da draussen nichts als schwarze Nacht zu sehen war.
Bald brach der Winter an. Kälte zog auf, vor der selbst eine gute Wolljacke nicht mehr ausreichend schützte. Wir schnürten uns einfach gefertigte Lederbundschuhe um, die wir, weil Leder sehr teuer ist, nur in der kalten Jahreszeit trugen, und liessen das Feuer in der Hütte Tag und Nacht nie ausgehen.
Das Fischerhandwerk mag einem das ganze Jahr über einiges abverlangen, der Winter aber verschärft die täglichen Strapazen. Sturm und Wetter peitschen die Küsten, das Meer braust und tost ohne Rast, während kalte Strömungen es mehr und mehr abkühlen. Selbst im knietiefen Wasser der Buchten, wo zu Fuss gefischt und gesammelt wird, lässt die schäumende Brandung die Arbeit mühsam und gefährlich werden. Sommer und Winter lebt man vom Ertrag der Fänge, doch während der kalten Tage sitzt man auch mal länger als sonst in den Hütten beisammen und lässt den Wind an den Hauswänden rütteln. Unterdessen geht einem die Arbeit trotzdem nicht aus. Oft sind es gerade die unwirtlichen Winterwochen, die endlich Raum bieten, sich Liegengebliebenem zu widmen: zerrissenen Netzen, zerschlagenen Töpfen, beschädigten Fässern und stumpfen Messern, undichten Dächern oder löchrigen Kleidern. Die Luft in den Hütten ist schlecht, das immerwährend schummrige Licht erdrückend und trotzdem verbringt man ganze Nachmittage und Abende auf diese Weise nahe beisammen und versucht, sich dabei einigermassen bei Laune zu halten.
Wie gesagt, in diesem Jahr brach der Winter mit besonderer Härte über uns herein und zwang uns immer aufs Neue, im Schutz der Hütten auszuharren. Zu Beginn hatte ich kaum je etwas dagegen. Grossvater erzählte uns seine Geschichten, und endlich blieb dabei genug Zeit, sie auch bis zum Ende zu hören. Er selbst mochte alt und zittrig geworden sein, verhüllte sich unter Decken und fröstelte dennoch immerzu, aber die Abenteuer, die er mit seiner Stimme zum Leben erweckte, vertrieben die Enge im Raum, zumindest für eine Weile. Doch je länger die Stürme andauerten, desto häufiger wurde es trotzdem zu eng. Alle unter einem Dach, alle nah beieinander – oft genügte eine einzige, unwichtige Kleinigkeit und wie bei einem überspringenden Funken entbrannte daraus ein feuriger Zank. Marlena und Gina stritten sich besonders gerne, zwei Dickköpfe, die es weder scheuten, lauthals ihre Meinung zu sagen, noch auf ihrem Standpunkt zu beharren. Ernesto neigte in solchen Momenten dazu, mit witzigen Bemerkungen und Sticheleien der sich aufheizenden Stimmung entgegenzuwirken, womit er das Ziel allerdings meistens verfehlte – vor allem bei Emilia. Manchmal fragte ich mich, wie die beiden sich einst den Mutterleib hatten teilen können. Wie Tag und Nacht schienen sie dafür bestimmt zu sein, einander das Leben schwer zu machen. Sie ertrug seine Witze nicht, zeigte sich beleidigt und wurde damit erst recht zur Zielscheibe. Und er merkte nicht, wann es genug war, und plagte sie weiter, bis sie in Tränen ausbrach. Mutter wies die beiden zurecht, indem sie sagte: «Ernesto, lass das! Und du, Emilia, hör auf und reiss dich zusammen!» Einmal fügte sie dabei etwas Seltsames hinzu: «Die Tränen werden dir noch ausgehen, mein Kind, und wenn du sie mal brauchst, werden keine mehr da sein.»
Gut möglich, dass sie das nur so daher sagte. Woher hätte sie wissen können, dass sowas tatsächlich passieren kann?
Wenn es mir im Haus zu hitzig oder zu stickig wurde, verzog ich mich in den Stall, zu den Tieren. Manchmal traf ich dort auf Antonio, der seinen kühlen Lagerplatz offensichtlich dem engen Miteinander ums wärmende Feuer vorzog. Er verweilte nie lange bei uns. Immer öfter war er überhaupt nicht da. Mir war aufgefallen, dass er und Mauro einige Male aneinandergeraten waren und bald begann ich zu fürchten, Antonio könnte sich bereits wieder durch die Stadt streifend umhören, ob nicht bald ein Schiff auslaufen würde. Scalona schien ihn zu erdrücken, jetzt im Winter erst recht. Ich konnte ihn verstehen – irgendwie. Wenn man tagelang nur rumsitzt und nichts Rechtes zu tun hat, kann man ganz schön ins Grübeln kommen.
Obwohl ich zum Beispiel versucht hatte, den Vorfall neulich auf dem Fischmarkt zu vergessen, kam es mir jetzt ständig wieder in den Sinn, wie die Prinzessin an jenem Morgen unerwartet dort aufgetaucht und meinetwegen auch schnell wieder von da verschwunden war. Ich hatte seither nichts mehr von ihr gehört. Normalerweise erhielt ich fast jede Woche eine Einladung in die Adlerburg. Es musste nichts zu bedeuten haben, Prinzessinnen sind nun mal sehr beschäftigte Leute. Und dennoch … Ich wurde den Verdacht nicht los, ich wäre der Grund für ihr Schweigen, und das betrübte mich.
Aber hatte ich nicht längst gewusst, dass es irgendwann so kommen musste? Nicht, dass ich je an unserer Freundschaft gezweifelt hätte. Toni und ich hatten unsere Kindheit zusammen verbracht, und die Zeit, als wir gemeinsam dem Ruf der Glasvögel folgend durch Scalonia gezogen waren, hatte uns zu engen Verbündeten gemacht. Und trotzdem: Sie war jetzt eine Prinzessin, und ob wir uns treffen oder nicht, war nicht länger meine Entscheidung. So ist das nun mal.
Glücklicherweise dauern Stürme nicht ewig an, und sobald sich unsere Arbeit wieder nach draussen verschob, wo wir uns der Kälte trotzend mit doppeltem Eifer einsetzten, rückten selbstmitleidige Gedanken schnell wieder in den Hintergrund – und so war es auch gut.
Doch dann, eines Tages, änderte sich alles. Etwas geschah, etwas Schreckliches, was niemand je für möglich gehalten hätte.
Ich will nicht sagen, dass nie schlimme Dinge geschahen im Dorf der Fischer. Immerhin ist die Fischerei allein schon ein durchaus gefährliches Handwerk, schon als kleiner Junge musste ich das eine oder andere Unglück in der Nachbarschaft miterleben. Aber diesmal war es anders. Was uns widerfuhr, hatte es nie zuvor gegeben: Meine Schwester verschwand. Emilia! Einfach so.
Sie war plötzlich weg und niemand wusste, wo sie hingegangen war. Überhaupt hatte sie niemand weggehen gesehen. Ernesto und ich kamen gerade vom Fischmarkt und Mutter fragte uns nach ihr.
«Gewiss ist sie bei Nachbarn», vermuteten wir. «Sie wird bestimmt bald zurück sein.»
Aber sie war nicht bei Nachbarn und auch nicht im Garten, nicht am Hafen und nicht auf dem Fischmarkt. Auch nicht am Strand – sie war überhaupt nirgends.
«Giu, komm! Das musst du dir ansehen?» Ernesto stupste mich an und zog mich mit sich in die Hütte, wo er mich in den hinteren Teil zu Emilias Lager führte. «Da, schau, was kann das sein?», fragte er und zeigte zum Gebälk empor.
Ich folgte seinem Blick, während meine Augen sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse anpassen mussten. Allmählich wurden die Umrisse eines ziemlich grossen Vogels erkennbar. Er bewegte sich nicht und je länger ich hinsah, desto klarer wurde, dass es sich auch gar nicht um ein lebendiges Tier handelte, sondern um einen Vogel aus Stein – eine Taube, wie es schien, bloss grösser als eine solche.
«Ernesto», fragte ich und spürte, wie mein Mund sonderbar trocken wurde, «was ist das? Wo kommt es her und seit wann ist es da?»
Er sah mich mit grossen Augen an. «Ich weiss nicht. Gerade erst hab ich es entdeckt.» Seine Stimme klang belegt.
«Hier, über Emilias Lager, bist du sicher?» Ich wusste, dass er sich gelegentlich Scherze ausdachte, manchmal auch in ungünstigen Momenten. Aber etwas in seinem Blick verriet mir, dass es diesmal nicht so war.
«Ja», nickte er. «Genau da.»
«Ich hab ihn reinfliegen sehen», liess in diesem Moment Fios feine Stimme uns zusammenzucken. Sie stellte sich zu uns. «Er hatte eben noch blauglänzende Federn.»
«Das ist nicht witzig, Fio», wies ich unsere kleine Schwester zurecht. «Der Vogel ist aus Stein. Er kann überhaupt nicht fliegen und blaue Federn hat er schon gar nicht.» Auch wenn ich sie tadelte und ihr kein Wort glaubte, ihrer ernsten Miene abzulesen, schien sie sich ihrer Sache sicher zu sein, was in mir immerhin ein eigentümliches Frösteln bewirkte.
Trotzdem zog ich einen Hocker heran, kletterte hoch und versuchte den Vogel etwas ungelenkig von seinem Sitz im Gebälk zu holen. Er war unheimlich schwer, gänzlich aus Stein, und seine Krallen verfingen sich tatsächlich schier im Holz, als versuche er sich dort festzuhalten.
Hatte Emilia ihn hier oben platziert? Wohl kaum. Sie hätte ihn unmöglich selbst emporheben können. Und überhaupt, weshalb hätte sie sowas tun sollen? Woher kam er?
Wieder am Boden legte ich das schwere Ding möglichst vorsichtig ab. Zu dritt betrachteten wir es eine ganze Weile lang stumm. Aus fernen Erinnerungen tauchte ein verzerrtes Bild in meinem Kopf auf, fast als hätte ich einen ähnlichen Vogel schon einmal gesehen. Leere, traurige Augen aus Stein, in einer dunklen Nacht. Ich verband sie mit Angst, ohne zu wissen, warum, während eine düstere Ahnung mich beschlich, Emilia sei nicht einfach so verschwunden.
Wie sich herausstellte, wusste auch sonst niemand etwas über die steinerne Taube, weder, woher sie gekommen war, noch wer eine solche angefertigt oder hergebracht haben könnte. Und auch über Emilias Verbleib liess sich nichts herausfinden. Das Einzige, was feststand, war, dass sie nicht zurückkam, nicht, als es Abend wurde, nicht nachts und auch nicht am nächsten Tag. Niemand hatte sie gesehen und die Furcht, etwas Schreckliches müsse passiert sein, wuchs von Stunde zu Stunde.
Angst krallt sich einem um den Hals, mit kalten, festen Fingern, bis man zu ersticken droht. Mich machte sie ausserdem wütend, denn je länger ich darüber nachdachte, desto sicherer war ich: jemand war schuld an Emilias Verschwinden! Jemand hatte sie uns weggenommen! Denn wäre ihr etwas zugestossen, hätten wir es längst erfahren. Sie ging nie weit vom Haus weg, schon gar nicht allein. Und da war diese Taube – wie das Erkennungszeichen eines Entführers.
Ich wartete, bis ich Antonio allein im Stall antraf und zog ihn sodann ins Vertrauen. Erst musterte er mich skeptisch, während ich ihm meine Gedanken darlegte, am Ende aber nickte er zustimmend.
«Verdammt, Giu, da könnte was dran sein.» Eine Weile schien er angestrengt zu überlegen, dann fügte er hinzu: «Ehrlich, jetzt, wo du’s sagst, fällt mir etwas dazu ein. Ich hab sowas ähnliches schon mal gehört. Auf Seereise. In einer Stadt. Auch da verschwand ein Mädchen, nein, ich glaube, es waren sogar zwei oder drei. Wie auch immer … auf jeden Fall erzählte man sich dann auch sowas mit solchen Vögeln. Genau sowas, wie dies hier. Giu, das ist erstaunlich – wie bist du bloss darauf gekommen?»
«Ich weiss nicht», erwiderte ich – verwirrt, weil das, was Antonio erzählte, mir einerseits recht gab, andererseits die Angst umso mehr schürte. Ausserdem glaubte ich ja ebenfalls, einen solchen Vogel bereits einmal gesehen zu haben.
«Es ist einfach die einzige Erklärung, die passt», schlussfolgerte ich.
Was tut man, wenn jemand verschwindet?
Erst sucht man überall und fragt sich herum. Man schwärmt aus und durchkämmt das ganze Umland, hofft, endlich zu erfahren, was geschehen ist und fürchtet dasselbe gleichzeitig. Man verzweifelt schier, aber dann – zumindest ist es im Dorf der Fischer so – kehrt man irgendwann trotz allem zum Tagesgeschäft zurück, nicht weil man vergessen könnte, sondern weil es einfach sein muss. Mag die Last, die man trägt, einen fast erdrücken, man lernt damit zu leben, jeder auf seine eigene Weise.
So kam es, dass kurz nach Emilias Verschwinden Antonio uns eines Nachmittages völlig unerwartet verriet, dass er uns wieder verliesse. Er habe bereits vor über einer Woche bei einem Handelsschiff im königlichen Hafen Scalonas als Leichtmatrose angeheuert und würde nun an Bord gerufen. Der Zeitpunkt konnte kaum schlechter sein und einmal mehr glaubte ich, Mutter würde gleich in Ohnmacht fallen; mit aschfahlem Gesicht und zitternden Lippen suchte sie tastend nach einer Sitzgelegenheit und liess sich gerade noch rechtzeitig auf einen Hocker nieder. Wir waren alle zutiefst geschockt. Gina schimpfte in einem fort, während Mauro so finster dreinblickte, wie ich es noch nie zuvor erlebt hatte. Ernesto, Federico und ich bestürmten Antonio verzweifelt, er solle doch bei uns bleiben und Fio verdrückte eine Träne, ehe sie losstürmte und ihren grossen Bruder fest umarmte. Elenas Gesicht wirkte von Sorge ganz zerfurcht, während Marlena bloss eine saure Miene zog und Vater, der lange gar nichts sagte und nur hin und wieder tief und lange seufzte, meinte schliesslich: «Na dann, alles Gute, mein Sohn. Pass auf dich auf und komm bald zurück!»
Noch zur selben Stunde packte Antonio seine Sachen zusammen und brach auf. Ich riss mich zu Hause frei und begleitete ihn zum Hafen.
«Mach nicht ein solches Gesicht, Giu, ich komm doch wieder!», meinte er aufmunternd und legte mir den Arm um die Schulter.
«Schon klar», antwortete ich nur.
«Du bist wütend und traurig wegen Emilia, stimmt’s?» Er blieb stehen. «Mir macht das auch zu schaffen, glaub mir. Gerade deshalb kann ich nicht bleiben.»
Offenbar war dies seine Art, mit dem Schmerz fertigzuwerden: aufbrechen und verschwinden. Ein wenig konnte ich ihn sogar verstehen.
Trotzdem fragte ich: «Was willst du damit sagen? Du hast bereits vor über einer Woche dein Wort gegeben, wieder aufzubrechen – hast du gesagt.»
«Hab ich auch, aber … na ja, inzwischen hab ich … ausserdem so was gehört.»
Ich horchte auf. «Etwas gehört? Was denn?»
Antonio sah mich an. «Nun, tja, was soll ich sagen …»
«Sag’s einfach!», drängte ich ihn.
Er legte den Kopf schief, als zweifelte er noch, ob er mir antworten sollte. «Es könnten Piraten sein», sagte er schliesslich. «Erinnerst du dich, als ich dir von diesen Mädchen in den anderen Städten erzählt habe? Die ebenfalls verschwunden sind? Sie wurden … von Piraten … mitgenommen.»
«Piraten?», wiederholte ich entsetzt. «Was wollen die denn von ihr?»
«Na ja … Piraten sind nun mal grausam, nehmen sich unschuldige, junge Mädchen, um sie irgendwo für teures Geld wieder zu verkaufen.» Er sagte das so dahin, während mir fast schlecht wurde.
«Aber … das … sowas dürfen sie nicht», stiess ich hervor.
Antonio blieb stehen. Er sah mich mit festem Blick an, doch seine Gesichtsmuskeln zuckten, was nur bedeuten konnte, dass diese Vorstellung ihn ebenso entsetzte wie mich.
«Ja», sagte er schliesslich mit ernster Stimme, «und deshalb muss ich gehen.»
«Weil du sie suchen willst?», fragte ich, mich an eine kleine Hoffnung klammernd. Trotzdem klang meine Stimme kleinmütig.
Er antwortete nicht auf Anhieb.
«Das wirst du doch», fragte ich noch einmal.
Endlich nickte er. «Ja.»
«Versprichst du’s? Bis du sie findest und zurückbringst?»
«Giu, hör zu …»
«Bitte versprich es!», unterbrach ich ihn. Ich wollte keine Erklärung hören, sondern sein Wort darauf, dass er alles daransetzen, alle Meere durchsegeln und jeden Piraten zur Strecke bringen würde, bis er Emilia wiedergefunden und befreit hätte.
«Natürlich …», sagte er endlich. Weil es aber wenig überzeugt klang und ich ihn weiterhin mit beunruhigtem Blick festhielt, versuchte er es schliesslich nochmals: «In Ordnung, ich verspreche es. Ich verspreche dir, dass … hm, falls ich sie finde … ihr ganz sicher nichts geschehen wird.» Er nahm meine Hand und drückte fest zu. «Du kannst dich auf mich verlassen, Giu.»
Eine Weile blieben wir so stehen und sahen uns an. Mutter hatte wahrscheinlich nicht ganz unrecht, wenn sie meinte, die Welt da draussen sei eine gefährliche und obwohl ich meinen Bruder am liebsten begleitet hätte, um Emilia zu suchen, liess der Gedanke an Piraten und Entführer mich doch mächtig zittern. Aber Antonio hatte keine Angst; mein grosser, mutiger Bruder scheute sich nicht, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Davon war ich überzeugt.
Bei der Mauer, am Steg, wo bereits mehrere Schaluppen bereitstanden, Mann und Ware an Bord eines mächtigen Handelsschiffes zu bringen, trennten wir uns schliesslich.
«Leb wohl, mein Grosser», sagte Antonio zum Abschied. «Und denk dran, eines Tages nehm ich dich mit. Aber jetzt geh!»
Er drückte mich ein letztes Mal an sich, ehe er mich viel zu plötzlich losliess und in der Masse der Geschäftigkeit, die sich rund um die Boote tummelte, verschwand.
Da stand ich nun, inmitten vieler Leute, und doch ganz allein. Ich hatte keine Lust umzukehren, zu Hause wartete nichts als Arbeit und Leere auf mich.
Im Gewimmel entdeckte ich ein Mädchen, mit schwarzem, zerzaustem Haar und schmutziger Schürze. Sie erinnerte mich auf eigentümliche Weise an längst vergangene Tage, an die Zeit, bevor es in Scalona eine Prinzessin gegeben hatte, stattdessen ein fröhliches Mägdemädchen. Mein Blick erhob sich, wanderte über die Köpfe der Menschen und über die Dächer der Stadt hinweg zur Adlerburg hoch, und zum ersten Mal seit Emilias Verschwinden dachte ich wieder an Toni. Früher hatten sie und ich uns immer alles erzählt. Wenn einer von uns in Not geraten war, so wartete er nicht lange, dem anderen davon zu berichten und dann waren wir füreinander da gewesen, zu jeder Zeit. Vieles mochte seither geschehen sein und unsere Leben hatten sich voneinander entfernt, aber waren es nicht im Grunde genommen einzig die äusseren Umstände, die uns trennten? Mehr als alles wollte ich plötzlich zu ihr, wollte Toni erzählen, was geschehen war – alles über Emilia und die Piraten – und hören, wie sie darüber dachte. Vielleicht hatte sie von Piraten in der Gegend gehört. Oder sogar von Entführungen. Ausserdem kannte sie sich mit Piraten aus, immerhin war sie selbst einmal für kurze Zeit in die Hände von Seeräubern geraten – wenn auch aus einem ganz anderen Grund. Aber das ist eine andere Geschichte.
Plötzlich wusste ich, was ich wollte! Was immer mich hätte abhalten können, ich brauchte den Rat der Prinzessin! Und zwar jetzt.
Wenn noch irgendetwas von der alten Toni in ihr steckt, so wird sie sich anhören wollen, was ich zu berichten habe.
Kapitel 3
Hilfe aus der Adlerburg
«Du bittest also um eine Audienz. Bei der Prinzessin. Etwa jetzt sofort?» Zwei breitbeinige Soldaten in glänzender Rüstung, die am äusseren Schlosstor der Adlerburg ihre Lanzen kreuzend Wache standen, musterten mich misstrauisch.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















