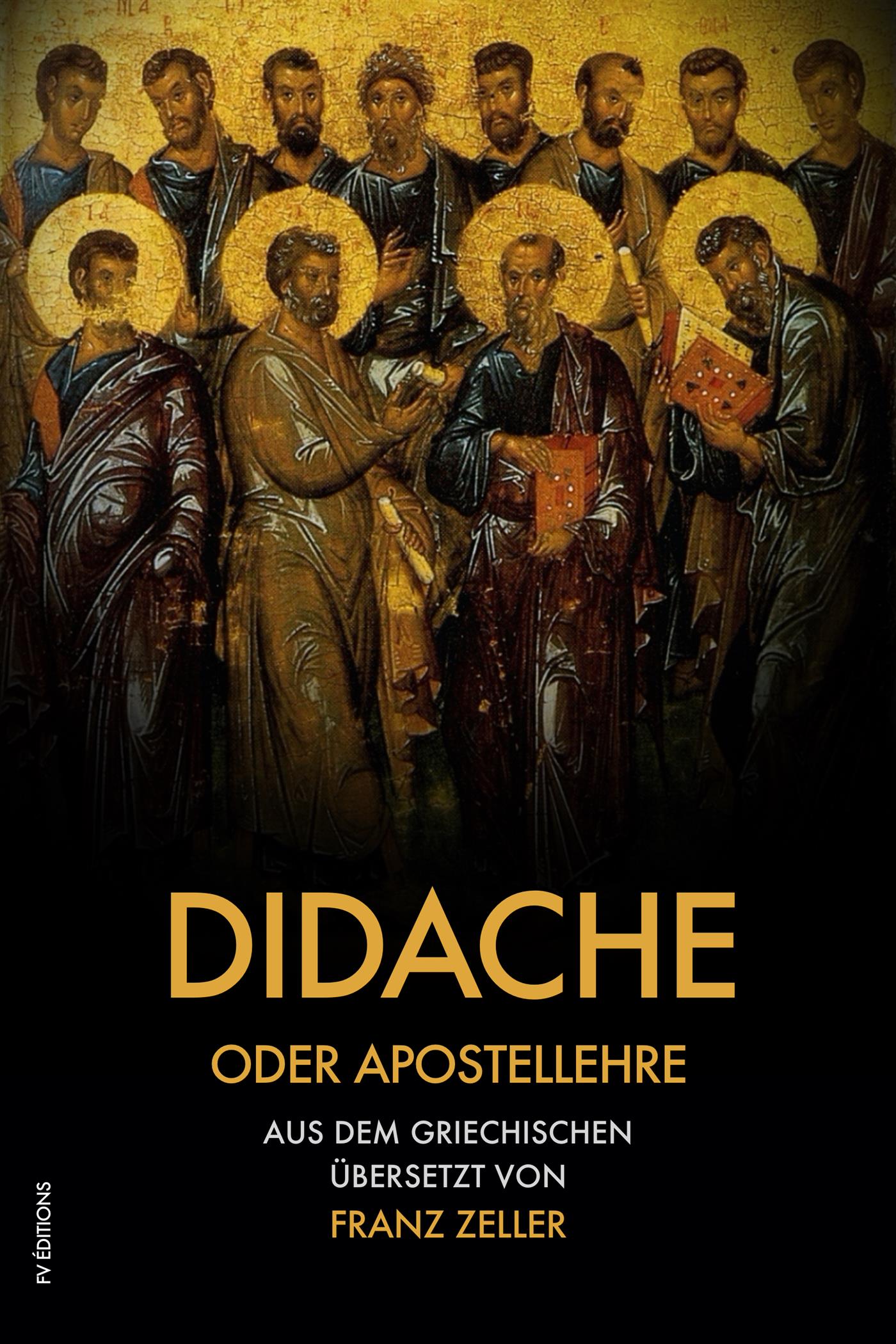6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein neuer Fall für Chefinspektor Franco Moll und seinen Kollegen Oberhollenzer Sanft fällt der erste Schnee auf den Salzburger Universitätsplatz, setzt den Türmen der barocken Kollegienkirche weiße Hauben auf – und bedeckt den Müllcontainer mit Uwe Marthalers Leiche. Marthaler war ein skrupelloser, eiskalter Geschäftemacher, der nicht nur seine Angestellten demütigte, sondern sich auch einer Reihe Mülldivern, die noch brauchbare Lebensmittel aus den Müllcontainern der Supermärkte holen, in den Weg stellte. Chefinspektor Franco Moll und Kollege Oberhollenzer haben bald mehr Verdächtige, als ihnen lieb ist. Selbst Molls Nachbarin Melinda gerät unter Verdacht, und das, als Moll gerade zarte Bande der Liebe zu ihr knüpft. Eine neue Spur taucht erst auf, als es plötzlich zu tauen beginnt und der Schnee eine weitere Leiche freigibt. "Franz Zellers Figuren ... könnten Kultstatus erreichen, ähnlich dem Lemming von Stefan Slupetzky oder dem Brenner von Wolf Haas." (Wolfgang Weninger, www.krimicouch.de)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Franz Zeller
Sterben ist das Letzte
Ein Salzburg-Krimi
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Sanft fällt der erste Schnee auf den Salzburger Universitätsplatz, setzt den Türmen der barocken Kollegienkirche weiße Hauben auf – und bedeckt den Müllcontainer mit Uwe Marthalers Leiche. Marthaler war ein skrupelloser, eiskalter Geschäftemacher, der nicht nur seine Angestellten demütigte, sondern sich auch einer Reihe Mülldivern, die noch brauchbare Lebensmittel aus den Müllcontainern der Supermärkte holen, in den Weg stellte. Chefinspektor Franco Moll und Kollege Oberhollenzer haben bald mehr Verdächtige, als ihnen lieb ist. Selbst Molls Nachbarin Melinda gerät unter Verdacht, und das, als Moll gerade zarte Bande der Liebe zu ihr knüpft. Eine neue Spur taucht erst auf, als es plötzlich zu tauen beginnt und der Schnee eine weitere Leiche freigibt.
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
Danksagung
1
Hätte Maximilian Marthaler schon von weitem erkannt, was da auf dem Sushiband auf ihn zuglitt – er wäre wohl aufgesprungen und hätte, ohne zu zahlen, das Lokal verlassen. Seit Tagen hielt er sich lieber in Innenräumen auf, weil er sich dort sicherer fühlte. Er ging auch kaum mehr mit Hannibal aus dem Haus und stieg, ganz gegen seine früheren Gewohnheiten, erst in der Garage aus dem Auto, nachdem sich das Tor geschlossen hatte.
Aber hier drinnen fühlte er sich sicher, obwohl er der einzige Gast war. Lustlos tauchte er ein Avocado-Maki in billige Sojasauce und steckte es in den Mund. Nach ein paar wenigen Kaubewegungen schob er den Rest der Reisrollen weit von sich. Qualität mangelhaft.
Der rote Teller mit seiner ungewöhnlichen Fracht hatte fast die erste Biegung des Sushibandes erreicht. Das kleine hautfarbene Etwas darauf schaukelte leicht unter den Vibrationen der Förderanlage. Der junge Mann fand es plötzlich zu ruhig im Lokal. Vor ein paar Momenten noch hatte synthetische Musik leise im Hintergrund geklimpert. Nun hörte man nur mehr das feine Surren der Lüftung. Es war halb drei. Er war wohl der letzte Gast vor der Nachmittagspause.
Seine rechte Hand klopfte, ohne dass er es merkte, ungeduldig auf den Tisch. Der Koch rauchte offenbar im Freien eine Zigarette. Auch sonst war kein Personal mehr im Raum zu sehen. Das Angebot auf dem Band war einfach abgerissen. Die letzte Schale mit Rindfleisch Bulgogi hatte ihn vor einer gefühlten Ewigkeit passiert. Er seufzte.
Endlich kam Nachschub.
Aber es war nichts, was er angreifen, geschweige denn hätte essen wollen. Als Marthaler den Inhalt des Tellers erkannte, blieb seine Hand plötzlich ruhig auf dem Tisch liegen, in einer Art Schockstarre, die jegliche Energie aus seinen Muskeln zog. Er wollte wegsehen, wagte es aber nicht, seinen Blick vom Band zu lösen.
Auf dem Teller glitt ein abgetrennter Finger auf ihn zu. Er näherte sich langsam, wie von Geisterhand, und schien für die letzten drei Meter Ewigkeiten zu brauchen, obwohl nur die plötzliche Angst den Lauf der Zeit bremste. Dann glaubte Marthaler ein leises Brummen zu hören, und der Motor des Bandes erstarb. Der Untersatz mit dem abgeschnittenen Finger blieb genau vor ihm stehen.
Marthaler starrte ihn an. Der Finger deutete geradewegs auf ihn. Er war nur leicht im Gelenk geknickt. Ohne darüber nachzudenken, wusste Marthaler, dass es ein Zeigefinger war.
Aus den Augenwinkeln versuchte er zu erfassen, wer sich sonst noch im Raum aufhielt, den er bisher nicht bemerkt hatte.
Niemand. Zumindest war niemand zu sehen.
Kaum merkbar drehte er den Kopf nach links, blickte aber trotzdem nicht vom Teller auf. Auch dort konnte er niemanden entdecken. Der Koch hatte sich wohl doch nicht zum Rauchen aus dem Staub gemacht. Sondern aus schwerwiegenderen Gründen.
Vorsichtig, als dürfte er sich nur langsam bewegen, weil eine Waffe auf ihn gerichtet war, zog der Dreißigjährige eine Klammer mit Geld aus seiner Hosentasche. Währenddessen ließ er den Finger nicht aus den Augen. An den Wundrändern erkannte er eine schmale Linie eingetrockneten Blutes. Der Nagel schien sauber manikürt, so wie seine eigenen Nägel. Ein paar wenige feine blonde Härchen ragten aus dem Fingerrücken. Wem auch immer man den Finger abgetrennt hatte, es war mit einem glatten Schnitt passiert.
Sie beobachteten ihn nicht nur. Sie rückten ihm auf den Pelz. Er musste sich schleunigst eine Pistole besorgen. Hannibal war als Schutz nicht mehr genug, obwohl der Schäferhundrüde durchaus wie eine Waffe wirkte. Jetzt nutzte ihm auch der Hund nichts. Er hatte ihn daheim gelassen. Besorgt sah Marthaler aus dem Fenster auf den Parkplatz. Nur ein einziges Auto stand dort quer über zwei weiße Bodenmarkierungen: sein eigener BMW. Ganz sanft fielen einzelne Schneeflocken auf das Auto. Sie schienen sich auf das glänzende schwarze Blech zu legen, um es einzuhüllen und zum Verschwinden zu bringen. Rundherum blieb der Boden stumpfgrau, als berührte ihn der Schnee gar nicht.
Wie in Trance legte Maximilian Marthaler einen Zwanzigeuroschein auf den Tisch und verließ, immer zwischen Küche und Ausgang hin- und herblickend, das Sushilokal.
Marthaler schaltete in den dritten Gang und zog rechts auf der Busspur an einem Ford vorbei. Einer dieser Loser, die nichts zu tun und deshalb auch keine Zeit zu verlieren hatten. Er schaltete kurz in den vierten Gang und schnitt vier Wagen weiter vorne, nach einer abrupten Bremsung, wieder in die Autospur hinein. Ein paar Sekunden später stand die Autoschlange erneut. Der Schneefall war stärker geworden. Unruhig fegte der Scheibenwischer die Flocken von der Windschutzscheibe. Das Flockengewimmel schnappte nach ihm wie ein Maul mit unzähligen Gummizähnen, das mit vielen kleinen Bissen alles verzehren wollte.
Mehrmals strich Marthaler sich durch sein kurz geschnittenes, hellblond gefärbtes Haar. Er blickte in den Rückspiegel. Nein, selbst wenn sie ihn verfolgten, hatte er sie spätestens durch das Überholmanöver auf der Busspur abgehängt. Aber im Grunde konnte er sie nicht loswerden. Sie wussten bestimmt, wo er wohnte.
Im Schritttempo ging es weiter. Das Sigmundstor näherte sich zögerlich. Die Drähte der Busoberleitungen verflochten sich vor dem Portal gleich den Fäden eines Spinnennetzes. Blödsinn, dachte Marthaler, als er sich bei dieser Vorstellung ertappte. Aber das Geflecht der Stahlseile im fahlen Licht des Schneegestöbers hatte etwas Beklemmendes. Nein, es war etwas anderes. Was es war, merkte er, als die dunkle Einfahrt in den alten Mönchsbergtunnel immer näher kam.
Er hatte Angst vor diesem schwarzen Loch. Oder noch viel schlimmer: Er hatte einfach Angst. Pure, primitive Angst, eine Angst, die dunkel und tief war und nun in ihm saß wie ein tonloses schwarzes Tier, von dem man nicht wusste, ob es schlummerte oder lauerte.
Wieder strich er sich durch das helle Haar und wählte dann eine Nummer. Die Freisprechanlage funktionierte nicht. Das verdammte Telefon hatte sich wieder nicht mit ihr gekoppelt. Unwirsch drückte er sein Handy ans Ohr. Eine freundliche Frauenstimme begrüßte ihn mit: Marthaler Cleaning Services. Marthaler ließ sie nicht ausreden.
»Hat sich Sascha gemeldet?«
Er unterbrach die Frau, als sie zu einer Antwort ansetzte.
»Nein, ich will nicht wissen, wie oft du es bei ihm probiert hast. Ich will wissen, ob er sich gemeldet hat.« Sein Ton wurde lauter. »Interessiert mich auch nicht. Du kannst so oft auf die Mailbox sprechen, wie du willst. Und es heißt auch nicht: Lassen Sie mich bitte ausreden. Sondern: Lassen Sie mich bitte ausreden, Herr Marthaler. Und noch was: Sag Stöger, er soll die Videoüberwachung an meinem Haus reparieren. Und zwar rasch.« Grußlos legte er auf.
Sandra näherte sich ihrem Ablaufdatum. Und das rasant. Wenn er Lust hatte, würde er sie morgen schon rauswerfen. Wenn nicht, vielleicht erst nächste Woche oder in einem Monat. Er ballte seine Faust. So konnte er Sandra in seinem Universum zermalmen. Eine brave Dienerin. Mehr war sie nicht.
Kurz vor der Einfahrt zum Tunnel, den jeder in Salzburg nur Neutor nannte, stockte der Verkehr wieder. Jetzt nach Hause zu fahren hatte keinen Sinn. Er würde nur über den heutigen Fingerzeig nachdenken. Besser, er regelte ein paar andere unangenehme Dinge. Wegen der Sache mit Sascha hatte er den Betrieb vernachlässigt, der ihn ernährte. Das war seine Grundsicherung für den Höhenflug. Er musste sich wieder mehr um seine Arbeitsbienen kümmern.
Ohne zu blinken, schlug er am Hildmannplatz nach links ein und bog auf die Reichenhaller Straße ab.
Fünfzehn Minuten später überquerte er den Parkplatz eines Supermarktes und stoppte an der Rückseite direkt vor den großen Müllcontainern. Neben ihm parkte ein Transporter mit der Aufschrift: Marthaler Cleaning Services.
Marthaler stieg aus und ließ die Autotür zuknallen. Nach ein paar Schritten blickte er sich auf dem fast leeren Lieferantenparkplatz um und zog seinen Schlüssel noch einmal aus der Tasche. Fest drückte er auf das Symbol mit dem Schloss. Das schnappende Geräusch vom Einrasten der Türverriegelungen beruhigte ihn und gab ihm zumindest ein bisschen das Gefühl von Sicherheit zurück.
Er stieg eine kleine Rampe hoch, die es den Verkäuferinnen leichter machte, den Abfall zu entsorgen. Statt den Müll hochzustemmen, konnten sie ihn in Bauchhöhe einwerfen. Als Marthaler den Deckel des ersten grünen Containers öffnete, schnüffelte er kurz in den Behälter und verlor das bisschen Gefühl an Sicherheit sofort wieder. Er kontrollierte auch noch den zweiten Abfallbehälter und merkte, wie ihm das Blut in den Kopf schoss.
»Danica«, schrie er, obwohl er sich allein auf dem Parkplatz befand.
Wütend riss er eine graue Stahltür auf, die neben einer Anlieferungsrampe ins Lager führte. Noch einmal brüllte er nach Danica und schlug die Tür wütend ins Schloss.
Er stand zwischen zwei Gängen mit Bierkisten. »Danica, wo bist du? Schon wieder eine rauchen, du faules Ding?«
Nur ein paar Sekunden später erschien eine kleine pummelige Frau in blauem Kittel und gelbem Kopftuch hinter den Bierkisten. In der Hand hielt sie einen tropfenden Schrubber.
»Cvetanka«, sagte sie leise. »Nix faul, fleißig, aber viel, viel Arbeit allein hier.«
»Pfeif auf Cvetanka. Ihr seid alle Danicas. Komm, du Trampel.« Damit packte er die verschüchterte Frau am Arm und zerrte sie aus dem Lager. Sie konnte kaum Schritt halten mit dem wütenden Mann an ihrer Seite.
Neben dem Lieferanteneingang stieß Marthaler sie unsanft über die drei blechernen Rampenstufen hoch und dann gegen einen Container.
»Mach auf!« Er deutete auf den Deckel.
Nur kurz ließ Cvetanka den Blick von ihrem Chef, als sie den Deckel des Müllbehälters hob.
»Und was siehst du da?«
Die schwitzende Frau zuckte ganz leicht mit den Schultern.
»Danica!«, brüllte Marthaler. »Was du da siehst, frage ich dich.«
»Cvetanka«, flüsterte die Frau in ihrem fleckigen Kittel.
Außer sich drückte Maximilian Marthaler den Kopf der kleinen Frau in Richtung des Containers. Sie stützte sich am Rand des Behälters ab, um nicht hineinzufallen.
»Merkst du was?« Marthaler wartete nur eine halbe Sekunde auf die Antwort. »Da gehört ein halber Liter Putzmittel drüber. Und weißt du, warum? Weil die Geschäftsleitung hier das so will. Damit Hungerleider wie du nicht am Abend nach Geschäftsschluss kommen und das Zeug stehlen. So machen wir das Gemüse da drinnen unbrauchbar, auch wenn es arme Schlucker gerne kochen würden. Immer. Jeden Tag, verstehst du? Und das sollte sogar in einen dummen Kopf wie den deinen hineingehen.«
Mit einem festen Rempler stieß Marthaler Cvetanka zum zweiten Container mit Gemüseabfall. »Und hier ist es dasselbe. Verstehst du mich?« Er musste sich bücken, um der kleinen Frau aus kurzer Distanz mit zornigen Augen ins Gesicht zu sehen. In einer letzten Aufwallung riss er seiner Mitarbeiterin das gelbe Tuch vom Kopf und warf es auf den Boden. Sie quittierte den Angriff mit einem kurzen schrillen Aufschrei. Mit einer Hand versuchte sie, ihr Haar zu bedecken, die andere drückte sie auf ihren Mund, um den Schrei zu ersticken.
»Ach, sei ruhig, dummes Ding.« Damit gab Marthaler ihr noch einen zornigen Stoß gegen die Schulter. Cvetanka stolperte zurück. Als sie sich an der Kante der offenen Mülltonne abstützen wollte, rutschte sie ab. Mit einem dumpfen Schrei stürzte sie in den Container und blieb inmitten von Gemüseresten und verpacktem Brot kurz schockstarr liegen. Klein und gedemütigt krümmte sich die Frau dann im Abfall zusammen.
Auch Marthaler hatte die Folge seines Stoßes etwas überrascht. Für einen Moment wollte er die Hand nach der Frau im Müll ausstrecken, dann ließ er den Arm gleichgültig sinken. Nein, dieses Leben ging ihn nichts an, er hatte mit seinem eigenen genug zu tun. Mit zornigen Schritten ging er zurück zu seinem Auto.
Cvetanka schloss die Augen und drückte ihre Lider fest nieder. Nur so konnte sie die Tränen zurückhalten. Erst als sie hörte, dass sich das Auto entfernte, bog sie sich zu einem winzigen Packen Mensch zusammen, legte die Arme wie ein Embryo um ihre eigenen Schultern und begann zu weinen. Sie durfte ihrem Mann auf gar keinen Fall von dieser Szene erzählen. Sonst war Schlimmeres zu befürchten.
2
Weißt du, wo die Einmalhandschuhe sind?« Julian Kremer ließ zwei Batterien mehrmals gedankenverloren in seiner Hand kreisen und drückte sie dann in das Fach der LED-Stirnlampe. Er war nicht ganz auf der Höhe, fühlte sich ziemlich erschöpft. Hätte er der Truppe nicht versprochen, wieder mitzukommen, wäre er jetzt mit einer Ausrede zu Bett gegangen. Etwas ungeschickt versuchte er, die Stirnlampe aufzusetzen, und drückte dann probehalber den ON-Knopf. Der weiße Schein fiel auf Maja, die eben in der Tür zum Flur erschien.
Die Dreieinhalbjährige lachte. »Du schaust aus wie ein Zug«, sagte das schmale Mädchen und blickte gespannt zu ihm hoch. »Kann ich so was auch haben?«
»Klar!« Kremer nahm die Lampe wieder ab. »Wenn dein Kopf so groß ist, dass die Lampe fest darauf sitzt.« Langsam verstaute er die Leuchte in der Außentasche seines Rucksacks.
Maja gab nicht auf. »Gibt’s das nicht für Kinder?«
»Mal sehen. Vielleicht finde ich eine für dich.«
Das Mädchen legte den Kopf leicht schief. Wie immer, wenn ihre Gedanken auf Hochtouren liefen. »Mit der Lampe würde ich mich in der Nacht nicht so fürchten, glaube ich. Und nicht so oft zu euch ins Bett kommen.«
Kremer lächelte, ohne dass sich sein Mund auch nur ein wenig bewegte. Maja verwandelte sich seit ein paar Wochen in eine kleine Menschin, die sehr schnell lernte, wie man andere manipulierte. Immer wieder ertappte er sie bei kleinen Lügen, die ihr nicht wegen ihrer ausufernden Fantasie passierten, sondern weil sie sich davon einen Vorteil versprach. Tarnen, täuschen, betrügen: der Beginn des Homo sapiens. Zum Schmunzeln brachte ihn ihre Schlauheit dennoch, obwohl er jegliche Art Bauernschläue verachtete.
Pia kam mit einer Box Einweghandschuhe aus der Wohnküche. Sie wirke zwar abgekämpft, sah aber nach wie vor entzückend aus, wie sie so lächelnd dastand mit ihren langen brünetten Haaren. Sie zog einen Packen der gelblichen Plastikfinger aus dem Schlitz im Karton. »Du siehst nicht gut aus, Julian.« Langsam strich sie ihm über die kurzen schwarzen Haare. »Ist etwas? Du wirkst so ernst. Um nicht zu sagen, trübsinnig.«
Julian Kremer schüttelte den Kopf. »Bin nur etwas müde. Einmal ausschlafen, und alles ist wieder okay.« Das war gelogen, aber er wollte Pia nicht beunruhigen. Sie stand selbst unter Druck. Eine freiberufliche Grafikerin, die um ihre Jobs raufen musste. So wie alle. Jeden Monat schafften sie es gerade irgendwie, über die Runden zu kommen. Auch sein Einkommen als freier Journalist fürs Radio entsprach nicht annähernd dem Aufwand und der Energie, die er dafür investieren musste. Überall steckte das Wörtchen »frei« drin, um darüber hinwegzutäuschen, dass die ganze Horde von freien Arbeitnehmern, freien Mitarbeitern, freien Grafikern, freien Musikern und freien Irgendwas völlig abhängig und deshalb miserabel bezahlt war. Lauter Idioten, die auf den Schmäh der Ich-AG hereingefallen waren. Ohne Ausnahme. Vogelfrei einfach.
Pia ließ nicht locker. »Ist wirklich alles in Ordnung? Du könntest auch mal absagen. Die gehen auch ohne dich auf Tour.«
Kremer nickte. »Aber ich habe den Nachschlüssel. Die Leute verlassen sich auf mich. Einige von ihnen haben die Lebensmittel viel nötiger als wir. Vor allem die paar Studenten, die immer wieder mitgehen. Und uns schadet es auch nicht, wenn wir die Vorräte aufstocken.« Er deutete mit dem Kinn in Richtung Küche.
»Wie du meinst.« Pias Zeigefinger fuhr neckisch über seinen dünnen Kinnbart. »Wenn du zurückkommst, schlafe ich vielleicht schon. Obwohl …« Sie drehte sich in Richtung ihres aufgeklappten Notebooks um, dessen Schirm eine kalte weiße Lichtwolke ins Wohnzimmer zeichnete. »Ich muss noch Ideen und Entwürfe für eine Ausschreibung abgeben. Die Agentin hat mir vor zwei Stunden etwas geschickt. Ein Großauftrag, die gesamte Corporate Identity. Wenn das etwas wird, könnten wir mal durchschnaufen.« Pia seufzte und nestelte an ihren Haaren herum. »Aber das haben wir uns schon öfter gedacht. Dusch dich auf jeden Fall, bevor du ins Schlafzimmer kommst, falls ich schon im Bett liege. Du riechst dann immer so, als wärst du in eine Mülltonne gefallen.«
»Ja, wie eine alte Banane«, sagte Maja anklagend, die eben auf einem roten Bobby-Moped um die Ecke bog.
»Du weißt ja gar nicht, wie ich rieche, wenn ich heimkomme. Du schläfst da schon.«
»Aber ich stelle es mir so vor.« Mit einem kräftigen Stoß ihrer Beine rollte Maja wieder in den großen Raum zurück.
Julian Kremer lehnte sich gegen die Wand und atmete lange aus. Das Leben hätte so lustig sein können mit seinen zwei Frauen, der kleinen und der großen. Wenn er sich nicht gefühlt hätte wie Atlas mit der Erdkugel auf seinen Schultern. Morgens schaffte er es kaum aufzustehen. Und selbst wenn er in der Redaktion nur kurze Texte schrieb, musste er sich quälen. Vor dem Mikrofon klang er zunehmend wie ein Langstreckenläufer nach dem Schlusssprint. Einfach kaputt. Wenn er nicht aufpasste, würden sie ihm die Sprechfreigabe entziehen. Und dann begann ein neuer Hürdenlauf. Aber vielleicht erledigte sich das Problem mit der Erschöpfung ganz anders. Vielleicht würde er irgendwann liegen bleiben im Bett. So wie einer, der vergessen hat, dass es auch noch eine Welt jenseits der zwei Quadratmeter weißer Laken gibt. Oder wie einer, dem einfach Arme und Beine und der Wille, sie zu bewegen, abhandengekommen sind.
»Das brauchst du sicher auch.« Pia drückte ihm eine Rolle dünner Plastiktaschen in die Hand, wie sie in den Supermärkten neben dem Gemüse hingen. Kremer hielt ihr den Rucksack auf, und sie ließ Einmalhandschuhe samt Tüten hineinfallen. So energisch wie möglich warf er sich einen Riemen über die Schulter und drehte sich zur Tür um.
»Hast du nicht etwas vergessen, Julian?« Verspielt winkte Pia mit seinem Pass. »Nur falls sie dich erwischen sollten. Ich will dich nicht eine Nacht in einer Zelle wissen.«
Statt einer Antwort nahm er ihr das rote Dokument aus der Hand und küsste Pia auf die Nase und dann auf den Mund. »Man tut, was man kann.« Im Umdrehen fügte er hinzu: »Und manchmal auch mehr.« Vorsichtig drehte er den Schlüssel nach links, um die Tür zu öffnen. Es kostete ihn sehr viel Überwindung.
3
Ich hab kein gutes Gefühl dabei.« Eduard sah seinen älteren Bruder mit schief gelegtem Kopf an wie ein verwundertes Kleinkind. Seine Hände strichen immer wieder über die Nieten seiner Jeans.
Gerfried Wegscheider wusste, dass der Kleine letztendlich tun würde, was er von ihm wollte. Das war immer so gewesen. Er schwächelte schon jetzt. Die nervösen Hände, der ausweichende Blick. Es brauchte nicht mehr viel, um ihn endgültig auf Linie zu haben. Wenn er Edis marode Seele noch ein bisschen pinselte, spielte er mit.
Eduard zuckte zusammen, als Gerfrieds Ledersohlen über den Parkettboden klapperten. Es klang wie der Flügelschlag eines Messingvogels. Ein Messingvogel. Vielleicht sein nächstes Projekt. Immerhin brachte ihn sein Bruder auch mal auf eine Idee und nicht nur auf hässliche Gedanken.
Gerfried Wegscheider zog einen Pass aus seiner schwarzen Aktentasche. »Komm her, Edi. Schau dir das an.«
Zögerlich und völlig lautlos ging Edi in seinen Socken auf Gerfried zu. Noch immer fürchtete er den Großen ein bisschen. Er war so übermächtig. Durchtrainiert und kompakt, irgendwie unbezwingbar, als könnte er jedes noch so große Hindernis beseitigen.
Gerfried drückte die Seiten des Reisepasses auseinander und hielt sie Eduard entgegen. »Sieht doch perfekt aus, oder? Du kannst die optische Qualität sicher besser beurteilen als ich. Aber da war ein super Visagist am Werk.« Mit einem manikürten Finger strich er über das Bild. »Die Ähnlichkeit zwischen euch beiden ist fast unglaublich.«
Eduard starrte auf das Bild eines Mannes, der sein Zwillingsbruder hätte sein können. Verlegen strich er sich durch die blonden Haare.
»Du machst das schon, Edi. Bist ja ein cooler Typ.«
»Aber es ist nicht okay.«
»Nein, okay ist es nicht.« Gerfried drückte der blonden Memme den Pass in die Hand. »Tu es für mich. Ich schulde Max etwas. Ich sehe dafür zu, dass ich dir eine Ausstellung in der Galerie Horvath verschaffe.«
Edi nickte kaum merklich.
Gerfried wusste, dass der Kleine jetzt mürbe war. Man musste nur auf die Emotionen der Menschen hören, dann kannte man sofort ihre Schwachstellen. Die Emotionen, das waren die Löcher in der Burgmauer, durch die man die ganzen Städte namens »Ich« einnehmen konnte. Die Einfallstore hatten Namen: Gier, Ehrgeiz, Selbstüberschätzung, Neid, Geilheit, Eitelkeit. Edis Problem war die übersteigerte Bescheidenheit. Welcher Mensch mit Verstand kam schon auf die Idee, Zeichnen zu unterrichten, obwohl man eigentlich Künstler sein wollte? Nur Memmen ohne Eier arbeiteten immer mit Netz. Und das hatte Edi jetzt davon. Gefangen im Netz der trostlosen Schulwelt. Da nebenbei noch eine künstlerische Identität aufzubauen, das konnte ja nicht funktionieren. So etwas ging nur mit vollem Einsatz. Netzwerken. Reden. Und wieder netzwerken. Dabei sein bei allen wichtigen gesellschaftlichen Anlässen. Und vor allem ein bisschen mehr Selbstsicherheit im Auftreten. Das fehlte seinem linkischen Bruder völlig.
Irgendwie tat ihm der Kleine leid. Gerfried Wegscheider legte seine Hand auf Edis Schulter. »Du gehst morgen in die Gerichtsmedizin in der Ignaz-Harrer-Straße und erledigst das wie ein Mann, okay?« Mit einem leichten Rüttler an Edis Schulter stellte Gerfried klar, dass die Frage rein rhetorischer Natur war. »Ich denke, die haben irgendwelche Pornos dort, damit es dir leichter fällt, deine Proteinspende abzugeben. Sonst gebe ich dir Geld, und du kaufst dir was auf dem Weg dorthin.«
Gerfried Wegscheider knöpfte das Sakko seines schmalen grauen Anzugs zu. »Den Pass brauche ich bis übermorgen wieder.«
Edi nickte erneut.
4
Marthalers Wut riss nicht ab. Sascha Markow war jetzt seit fast zwei Wochen verschwunden. Es hatte gereicht, in der Früh die Kühlschranktür zu öffnen. Auf dem Hirschschinken hatte er feinen Schimmel gefunden. Dabei hatte Ewa doch dafür zu sorgen, dass alle verdorbenen Lebensmittel in der Tonne landeten, bevor er sie zu Gesicht bekam. Und wenn sie sie daheim auffraß, war es ihm egal. Hauptsache, sein silbern glänzender Kühlschrank blieb sauber. Nicht einmal Hannibal wollte er das verschimmelte Zeug geben. Außerdem, wo steckte der Köter überhaupt? Wütend schlug er die Tür zu. Die Lust auf ein Frühstück war ihm vergangen.
Als Gespielin war die Polin weitaus besser denn als Putzhilfe. Zweimal pro Woche räumte sie bei ihm auf, sonst schrubbte sie sich mit den anderen durch Salzburg und machte die Böden in Einkaufszentren, Museen oder Arztpraxen sauber. Ein- bis zweimal pro Woche legte er sie über die Lehne der Couch, hob ihren Kittel hoch und regelte die Geschichte mit den Hormonen. Irgendwie hatte er den Eindruck, dass ihr das gar nicht so unrecht war. Andererseits hätte er sich an ihrer Stelle auch lieber vögeln lassen als zu putzen. Aber das musste trotzdem jemand erledigen. Sie nämlich. Und mit der Regelmäßigkeit, mit der sie es auf der Couch trieben, näherten sie sich ohnehin einer Beziehung. Das wollte er auf keinen Fall. Allerdings: Obwohl er sich umgesehen hatte, fand er unter seinen Angestellten niemanden, auf den er so scharf gewesen wäre. Ewas kleiner Spitzbusen und die schrägen, kalten Augen machten ihn an. Trotzdem musste sie auch mit ihrem Putzlappen tun, was er wollte. Sollte er draufkommen, dass sie ihre Möse bei ihm zum vorherrschenden Businessmodell machen wollte, würde er sie umstandslos entsorgen.
Er trat gegen den Edelstahlfuß des Glastisches. Verdammt. Alles lief schief momentan. Er hätte platzen können vor Zorn. In Wahrheit stand er mit dem Rücken zur Wand. Sascha war offensichtlich untergetaucht. Und würde vielleicht nicht mehr auftauchen. Und mit ihm das Geld, das nicht ihnen gehörte.
Er legte den Kopf zurück, schloss die Augen und dachte nach. Die Wand in seinem Rücken war kalt. Er versuchte, die eisige Mauer zu ignorieren. Es ging nicht. Die Kälte. Das war der Nachteil dieses Baus auf dem schicken Mönchsberg, ein paar hundert Meter oberhalb des Festspielhauses. Sein Vater hatte ihm das Haus vor zwei Jahren überlassen. Er war nach dem Tod der Mutter ausgezogen und hatte es zwanzig Jahre lang an einen Freund vermietet. Ein Haus zum Herzeigen, für Einladungen und Gesellschaften. Allein die Adresse Mönchsberg führte bei den meisten zu einem ehrfürchtigen Gemurmel. Ein paar Meter zu Fuß über einen schmalen asphaltierten Weg, und man blickte auf die Stadt hinunter und ihre Menschen. Das tat gut. Wer wollte schon Teil dieses Gewusels da unten sein. Diese Menge von Ameisen, die alle ihren niedrigen Obliegenheiten nachgingen, ihren Kinkerlitzchen, mit minderen Ambitionen, ohne große Pläne. Trotzdem hatte er das Haus nach seinem Einzug radikal umbauen lassen, die ganzen Tramdecken geschliffen, Wände entfernt, Stofftapeten heruntergerissen. Das Dunkel vertrieben, das manche als edles Understatement empfanden. Vor allem hatte er den Geruch des Vaters vertreiben wollen, den er auch nach zwanzig Jahren noch in diesem Gemäuer zu spüren vermeinte. Außen war die Umgestaltung aufgrund von Auflagen nur sehr dezent gegangen, nicht mal mit viel Druck durch Geldbündel und Netzwerke. In Salzburg musste alles Alte konserviert werden, ohne Rücksicht auf die Zukunft. Die Häuser hier am Mönchsberg waren durchwegs ein paar hundert Jahre alt. Fast alle trugen Namen wie Ohr-Gottes-Haus, Baumgartenhaus oder Schlafhauserhaus; Letzteres war fast siebenhundert Jahre alt. Und allerorten erinnerten Tafeln an prominente Bewohner, egal ob Skipioniere oder bildende Künstlerinnen. Die Vergangenheit war die Gegenwart.
Und wieder spürte er die Kälte im Rücken. Langsam öffnete er die Augen. Über Nacht hatte es erneut geschneit. Trotzig drückte er die Türklinke zur Terrasse hinunter und ging barfuß im Morgenmantel hinaus in den Novemberschnee.
Nach zwei Schritten stockte er vor einem Schuhabdruck. Die Spur war leicht angezuckert vom Schnee, aber noch immer sehr gut zu erkennen, konnte also nicht alt sein. Und es war nicht das einzige Relikt von Eindringlingen. Quer über die Terrasse liefen die Fußspuren von zwei Menschen in schmalen Schuhen. Wo war Hannibal, verdammt noch mal? Nicht einmal der Hund tat, was er sollte.
Ach ja, er hatte den Schäferhund um halb sieben rausgelassen. Dann war das Vieh immer eine bis eineinhalb Stunden unterwegs. Da beschwerte sich niemand, weil es noch kaum Spaziergänger gab.
Weiter hinten entdeckte er Spuren, die in die Gegenrichtung liefen. Wieder hinaus aus seinem Garten.
Vorsichtig ging er den Fußabdrücken nach. Sie endeten genau vor seinem Schlafzimmer. Glücklicherweise war das Rollo heruntergelassen. Die Spuren vor dem Fenster wirkten nicht so, als hätten sich die zwei gelangweilt die Füße vertreten. Ebenso geradlinig wie sie zu seinem Zimmer marschiert waren, fast mit derselben Schrittlänge, hatten sie sich auch wieder entfernt.
Dass seine Füße barfuß im Schnee standen, spürte er nicht mehr.
Sie wussten nicht nur, wo er wohnte. Sie kannten auch seine Gewohnheiten. Wann Hannibal aus dem Weg war. Er schlief immer im großen Salon und hatte nicht gebellt. Die beiden unsichtbaren Besucher waren also erst nach halb sieben gekommen. Mutig. Aber sie wussten wohl, wie sie das Risiko senken konnten, von Hannibal erwischt zu werden. Einfach abwarten, bis der Hund aus dem Haus war.
Er würde in den ersten Stock ziehen. Erst als er sich umdrehte, um ins Haus zurückzugehen, sah er, dass sich das Aussehen der Mauer neben dem Schlafzimmerfenster verändert hatte. Marthaler starrte auf eine riesengroße ungelenke Sieben an der Wand. Sie wirkte, als hätte man sie mit einem Stück Holzkohle gezogen. Der Oberstrich war schlampig gebogen. Auch unten beim Schrägstrich war der Strich noch einmal ausgerissen.
Hilflos bückte er sich. Er schaufelte den Schnee mit seinen hohlen Händen auf und formte zitternd einen Schneeball. Mit der Kugel wischte er über die schwarzen Linien. Mit wenig Erfolg. Die Zeichnung widersetzte sich und sah ihn weiterhin dunkel an.
Wo, verdammt noch mal, war Hannibal? Hatte er wieder irgendein kleines Tier gerissen bei seinem Morgenausflug?
Und warum eine Sieben an der Wand?
Selbst wenn er sie mit einer Reihe von Nullen ergänzte. Das war nicht die Summe, die er den Leuten schuldete.
Warum hatten sie eine vermurkste Sieben an die Wand geschrieben?
Plötzlich fiel ihm etwas ein. Mit ein paar Laufschritten erreichte er die Treppe und nahm immer zwei Stufen auf einmal. In einer Nische im ersten Stock aktivierte er den Bildschirm seiner Videoüberwachungsanlage. Das Bild der beiden Außenkameras bröselte noch immer stark. Sandra hatte offenbar vergessen, die Reparatur bei Stöger, dem Chauffeur seines Vaters, in Auftrag zu geben. Trotzdem spulte er die letzten Minuten schnell zurück. Links unten lief die Zeit in weißen Lettern rückwärts. Um sechs Uhr fünfzig betraten zwei Männer mit Kapuzenjacken den Garten. Sie waren einfach über den Zaun geklettert und dann seelenruhig und zielstrebig in Richtung seines Schlafzimmers gegangen. Nur vage konnte Marthaler sie im schwarz-weißen Gestöber der defekten Überwachungsbilder ausmachen. Aber auch bei einer guten Aufnahme wären sie nicht zu erkennen gewesen. Die Kapuzen waren so weit ins Gesicht gezogen, dass man gerade mal die Münder erahnen konnte. Mit einem gepressten Schrei hämmerte Marthaler auf das Gerät ein.
5
Die kleine Kröte hätte das nicht sagen dürfen. Er hatte einfach zugeschlagen. Obwohl er noch nie jemanden geschlagen hatte. Eine Ohrfeige, ein Klatscher mitten ins Gesicht. Niklas sah verwundert seine Hand an. Sie hatte sich einfach selbständig gemacht, zwischen der Englisch- und der Deutschstunde. Selbst jetzt plagte ihn kein schlechtes Gewissen deswegen. Erleichtert hatte ihn der Schlag aber auch nicht. Es war mehr so gewesen, als hätte er mit der Wucht seiner flachen Hand eine unsichtbare Wand aus Pergamentpapier durchstoßen. Und nun war er durch diese Wand gestiegen. Und hinein in einen Zug. Hallein ab 14:35, Salzburg an 14:51 Uhr. Das ging fast zu schnell. Niklas setzte sich einer älteren Schülerin gegenüber, die sicher nicht mit ihm reden wollte und in ein Vampirbuch vertieft war. Mit einem Seufzer schob er seinen Schulrucksack unter seine Knie.
Es war sein erstes »sehr gut« in Englisch gewesen. Die rotgesichtige Kröte hatte es ihm nicht vergönnt und ihn vor ein paar anderen auf dem Gang gehänselt. »Er weiß zwar nicht, wer sein Vater ist, aber dafür kann er jetzt Englisch mit ihm reden.« An und für sich eine der dummen Bemerkungen, wie sie in seiner Klasse üblich waren. Nur dass sie diesmal nicht gut ausgegangen war. Niemand hatte erwartet, dass er zuschlagen würde, er, der Immersanfte. Die Kröte hatte sich zwei Sekunden später verwundert die Wange gehalten.
»Lieber habe ich gar keinen Vater als so einen wie du«, hatte Niklas noch laut und deutlich gesagt und sich umgedreht. Das Kichern hinter ihm hatte dem Rotgesichtigen gegolten, nicht ihm.
Aber in einem hatte sich die Mistkröte geirrt. Er wusste, wer sein Vater war. Noch nicht lange. Aber er wusste es.
Er blickte rechts aus dem Fenster, hinauf zum Schlenken. Das markante Dreieck war weiß. Beim Anblick der großen Schneefläche wurde ihm unvermittelt eiskalt.
Es war so einfach gewesen, den Namen herauszufinden. Zuerst hatte er es mit der Dokumentenmappe versucht. Aber seine Mutter war clever genug gewesen, dort nur Dinge wie Staatsbürgerschaftsnachweis oder Meldezettel aufzubewahren, keine Geburtsurkunde. Dann hatte er die Post der letzten Wochen durchwühlt, die immer auf einem kleinen Tisch hinter dem Eingang zur Küche lag. Oft monatelang, bis seine Mutter die Papiere in einem Anfall von Ordnungswillen abtrug. Der Stapel kam ins Rutschen und stürzte um. Er suchte am Boden weiter. Seine Mutter würde an diesem Tag nicht vor sieben heimkommen. Sie arbeitete viermal die Woche als Ordinationsgehilfin bei einem Zahnarzt.
In einer Schublade entdeckte er schließlich die Kontoauszüge. Die meisten Buchungen waren rot. Mindestens zweimal pro Monat gingen aber auch Geldbeträge ein. Die Überweisungen von Dr. Huber variierten. Die zweite schwarze Zahl blieb auch ein halbes Jahr zurück Monat für Monat stabil. Die vierhundertsechzig Euro kamen vom Konto eines M. Marthaler. Verwendungszeck: keiner. Nicht Bub, nicht Kind, nicht Alimente.